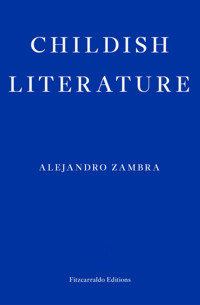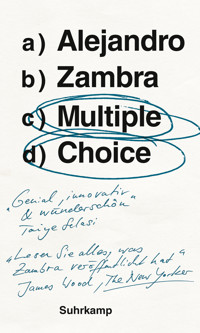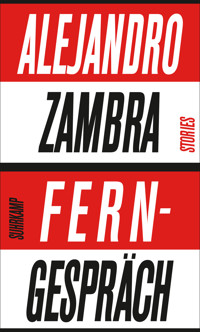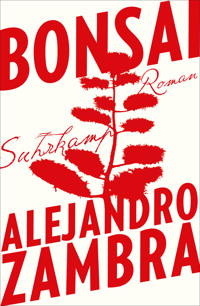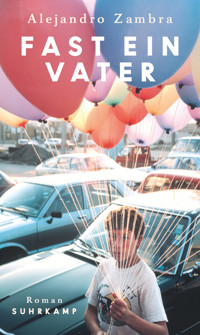
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als er nach neun Jahren seine erste Liebe wiedersieht, erhält Gonzalo eine zweite Chance. Und mit ihr eine Aufgabe: Vater sein. Denn während er sich in all der Zeit mit Haut und Haaren der Poesie verschrieb, bekam Carla einen Sohn. Der ist jetzt sechs, liebt Katzenfutter und wirkt mindestens genauso überrumpelt. Nicht nur deshalb will Gonzalo es besser machen als all die nichtsnutzigen Männer aus seiner Familie, sondern auch um seinem eigenen Scheitern endlich etwas entgegenzusetzen. Doch trotz allem bleibt er immer nur fast ein Vater. Und als er mit seiner Poesie eine zweite Chance erhält, scheint nichts naheliegender als der Verrat an sich und seinen Idealen.
Ein Roman über das Gewicht der Liebe, über Vaterschaft und die tragischen, die komischen Befreiungskämpfe eines Mannes, der etwas anderes erwartet hat. Alejandro Zambra ist der große Virtuose der lateinamerikanischen Literatur, Fast ein Vater sein unbestrittenes Meisterwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Alejandro Zambra
Fast ein Vater
Roman
Aus dem Spanischen von Susanne Lange
Suhrkamp Verlag
Widmung
Für Jazmina und Silvestre
Motto
Es gibt kein Zuhause, keine Eltern, keine Liebe: Es gibt nur Spielgefährten.
Alain-Fournier/Jorge Teillier
Eine Technik, die für das Schreiben taugt, sollte auch für das Leben taugen.
Fabián Casas
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
I Frühwerk
Es war die Zeit
Während Gonzalo
Gonzalo schob Bauchschmerzen
Zu Anfang
Schließlich zerrte man Gonzalo
II Stieffamilie
Es war fast vier Uhr
Carla hatte ihm
Ein langer
Ein Jahr später
Manchmal war ihm
»Die kenne ich«
Sie halten sich
Das strafende Schweigen
»Die Erwachsenen
Im April 2005
»Du warst
»Eine Klasse
Eines Nachts
Nachdem Carla
Gonzalo ging
Vier Tage
III Poetry in motion
»I’m gonna eat
Er wacht mittags auf
Pru und Jessye
Da León am Nachmittag
Hacienda San Pedro
Pato ist Vicentes
Das Kämmerchen
Vicente wurde
Dank dieser ersten Interviews
Montagvormittag
Während dieser Tage
Gerade als sich
Rocotto interessiert
An ihrem letzten Morgen
»Ich habe dich
Keine der Optionen
IV Parque del Recuerdo
Gonzalo nutzt
In New York
Er träumt
In den folgenden Tagen
In Wirklichkeit
»Du hast das Buch
»Deine Buchhandlung
Sie gehen
Informationen zum Buch
Abbildungsnachweis
Impressum
Hinweise zum eBook
I
Frühwerk
Es war die Zeit
Es war die Zeit der überängstlichen Mütter, der schweigsamen Väter und der stämmigen großen Brüder, aber es war auch die Zeit der Decken, Plaids und Ponchos, sodass sich niemand wunderte, wenn Carla und Gonzalo jeden Nachmittag zwei, drei Stunden auf dem Sofa verbrachten, unter einem herrlichen Poncho aus Chiloé, der im eisigen Winter 1991 ein Grundbedarfsartikel zu sein schien.
Die Poncho-Taktik machte es möglich, dass Carla und Gonzalo den Hindernissen zum Trotz praktisch alles miteinander ausprobierten, abgesehen von der berühmten, sakrosankten, gefürchteten und ersehnten Penetration. Carlas Mutter hingegen verfolgte die Taktik, so zu tun, als hätte sie keine. Damit die beiden nicht übermütig wurden, fragte sie höchstens mit kaum merklicher Tücke, ob ihnen nicht warm sei, und im Chor antworteten sie, stotternd wie erbärmliche Schauspielschüler, aber nein, es sei hundekalt.
Carlas Mutter verschwand dann im Flur und konzentrierte sich auf die Fernsehserie, die sie in ihrem Zimmer ohne Ton sah – ihr reichte der Ton vom Fernseher im Wohnzimmer, denn Carla und Gonzalo sahen die Serie ebenfalls, zwar ohne großes Interesse, doch die ungeschriebenen Regeln verlangten, ein Auge darauf zu haben, wenn auch nur, um prompt auf die Bemerkungen der Mutter reagieren zu können, die in unregelmäßigen, nicht unbedingt kurzen Abständen im Wohnzimmer auftauchte, die Blumen in der Vase richtete, die Servietten zusammenlegte oder sonst einer Tätigkeit von zweifelhafter Dringlichkeit nachging und manchmal Seitenblicke Richtung Sofa warf, weniger zur Beobachtung, sondern damit sie spürten, dass sie beobachtet werden konnten, und dabei Sätze fallen ließ wie hat sie sich ganz allein zuzuschreiben oder der hat wohl einen Sprung in der Schüssel, und dann antworteten Carla und Gonzalo, unter dem Poncho fast völlig nackt, immer im Chor und mit mächtigem Schiss, ja oder klar oder ist halt verliebt.
Carlas furchteinflößender großer Bruder – der kein Rugbyspieler war, aber nach Größe und Auftreten ohne Weiteres in die Nationalmannschaft gepasst hätte – kam gewöhnlich nicht vor Mitternacht zurück, und wenn er doch einmal früher dran war, schloss er sich in sein Zimmer ein und spielte Double Dragon, konnte aber jeden Augenblick herunterkommen und sich ein Mortadellabrot oder ein Glas Cola holen. Zum Glück konnten Carla und Gonzalo in dem Fall auf die wundersame Hilfe der Treppe zählen, vor allem der zweiten – oder vorletzten – Stufe: Wenn sie das gequälte Knarren hörten, verblieben bis zu dem Augenblick, in dem der große Bruder im Wohnzimmer landete, genau sechs Sekunden, Zeit genug, sich unter dem Poncho zurechtzusetzen und zwei harmlose Unbekannte zu mimen, die aus reiner Solidarität der Kälte gemeinsam trotzen.
Die futuristische Fanfare der Abendnachrichten beschloss den Tag. Das Pärchen legte im Vorgarten eine leidenschaftliche Abschiedsszene hin, die manchmal mit der Ankunft von Carlas Vater zusammenfiel, der dann das Fernlicht einschaltete und den Motor seines Toyota aufheulen ließ, als Gruß oder als Drohung.
»Dieses Techtelmechtel dauert schon zu lange«, sagte der Mann mit hochgezogenen Brauen, wenn er in Stimmung war.
Vom Viertel La Reina bis zur Plaza de Maipú war es über eine Stunde Fahrt, die Gonzalo mit Lesen verbrachte, obwohl ihn meist die schwächelnde Beleuchtung daran hinderte und er ein Gedicht nur rasch überfliegen konnte, wenn sie an einer hellen Ecke hielten. Jeden Abend bekam er Ärger, weil es so spät geworden war, und jeden Abend schwor Gonzalo, ohne die geringste Absicht, Wort zu halten, dass er von nun an früher nach Hause kommen werde. Er schlief in Gedanken an Carla ein, und wenn er nicht schlafen konnte, was oft geschah, holte er sich in Gedanken an Carla einen runter.
Sich in Gedanken an den geliebten Menschen einen runterzuholen ist bekanntermaßen der feurigste Beweis der Treue, besonders wenn er, wie es im Film so schön heißt, ausschließlich auf wahren Begebenheiten beruht: Gonzalo verlor sich keineswegs in kühnen Phantasien, sondern stellte sie sich beide auf dem altbewährten Sofa, unter dem altbewährten Chiloé-Poncho vor, mit dem einzigen Unterschied, der einzigen fiktiven Zutat, dass sie allein waren, und dann drang er in sie ein, und sie umarmte ihn und schloss empfindsam die Augen.
Das Überwachungssystem schien unüberwindbar, doch Carla und Gonzalo vertrauten auf eine baldige Gelegenheit. Die ergab sich zu Frühlingsende, als die blödsinnige Wärme schon alles zu verderben drohte. Ein fulminantes Bremsen und ein kollektiver Aufschrei durchbrachen die Ruhe von acht Uhr abends – an der Ecke war ein Mormone angefahren worden, die Hausherrin schoss hinaus zum Klatsch, und Carla und Gonzalo begriffen, dass der ersehnte Moment gekommen war. In Anbetracht der dreißig Sekunden, die die Penetration dauerte, und der dreieinhalb Minuten, in denen sie das bisschen Blut wegwischten und die ernüchternde Erfahrung verarbeiteten, hatte der ganze Vorgang gerade einmal vier Minuten gedauert, wonach Carla und Gonzalo sich kurzerhand der Schar der Schaulustigen anschlossen, die den blonden jungen Mann auf dem Gehweg umringte, daneben das verbogene Fahrrad.
Wenn der junge Blonde gestorben und Carla schwanger geworden wäre, hätte es auf der Welt einen leichten Ausschlag zugunsten der Dunkelhaarigen gegeben, denn ein Kind von Carla, die ziemlich dunkel war, und dem noch dunkleren Gonzalo hätte kaum blond werden können, doch nichts davon traf ein: Der Mormone wurde lahm und Carla so nachdenklich, schwermütig und traurig, dass sie sich mit lächerlichen Ausreden zwei Wochen lang weigerte, Gonzalo zu sehen. Dann traf sie ihn nur, um mit ihm Schluss zu machen, »Auge in Auge«.
Zu Gonzalos Verteidigung muss man sagen, dass in jener unglücklichen Zeit kaum Informationen im Umlauf waren, es keine Hinweise von Eltern, keine Ratschläge von Lehrern oder Erziehungsberatern gab, keine hilfreichen Regierungskampagnen oder dergleichen, denn das Land hatte genug damit zu tun, die gerade erst wiedererlangte, noch schwankende Demokratie über Wasser zu halten, als dass man an etwas so Fortschrittliches und Erstweltliches hätte denken können wie eine umfassende Sexualkundepolitik. Mit einem Schlag befreit von der Diktatur ihrer Kindheit, erlebten die chilenischen Fünfzehnjährigen ihren eigenen Übergang, den zum Erwachsenenalter, indem sie Gras rauchten und Silvio Rodríguez, Los Tres oder Nirvana hörten und dabei allen möglichen Ängsten, Traumata und Betroffenheiten nachspürten, fast immer mittels der gefährlichen Methode von Versuch und Irrtum.
Damals gab es natürlich keine Abermillionen Online-Videos, die den Sex als Marathon propagieren. Zwar kannte Gonzalo Zeitschriften wie Bravo oder Quirquincho und hatte schon einmal ein paar Playboy- und Penthouse-Nummern, sagen wir, gelesen, jedoch noch nie einen Pornofilm gesehen, sodass er auch nicht auf audiovisuelle Hilfsmittel zurückgreifen konnte, um zu verstehen, dass seine Leistung in jeder Hinsicht katastrophal gewesen war. Seine Vorstellung von dem, was sich im Bett abspielte, beruhte allein auf den Poncho-Übungen und auf den Erzählungen einiger Klassenkameraden, vollmundig, wolkig und erfunden.
Überrascht und untröstlich versuchte Gonzalo alles, was in seiner Macht stand, um die Sache mit Carla einzurenken, obwohl in seiner Macht nur stand, im Halbstundentakt bei ihr anzurufen und seine Zeit mit vergeblicher Lobbyarbeit bei zwei tückischen Vermittlerinnen zu verschwenden, die ihm gar nicht helfen wollten, da sie ihn zwar für intelligent, attraktiv und unterhaltsam hielten, jedoch im Vergleich zu Carlas unzähligen Bewerbern für nichts Besonderes, für einen seltsamen Vogel aus Maipú, einen Störenfried.
Gonzalo blieb nichts anderes übrig, als alles auf die Karte der Lyrik zu setzen. Er sperrte sich in sein Zimmer ein und fabrizierte in nur fünf Tagen zweiundvierzig Sonette, von der nerudianischen Hoffnung getragen, etwas so restlos Überzeugendes zu schreiben, dass Carla ihn nicht mehr zurückweisen konnte. Bisweilen vergaß er die Traurigkeit; wenigstens ein paar Minuten lang wurde sie überdeckt von der geistigen Anstrengung, einen hinkenden Vers zu retten oder einen Reim zu finden. Doch auf die Freude über ein, wie er fand, gelungenes Bild folgte sofort die Bitterkeit der Gegenwart.
In keiner dieser zweiundvierzig Kompositionen steckte jedoch leider Gottes echte Poesie. Als Beispiel sei nur dieses kaum denkwürdige Sonett angeführt, das vermutlich noch unter den fünf besten – unter den fünf weniger schlechten – der Serie rangierte:
Das Telefon ist blau so wie das Weltall
das Telefon ist gelb und es ist grün
ich frag mich Tag und Nacht, wo bist du hin
ich gehe wie ein Zombi durch die Mall.
Bin wie Piscola ohne Alkohol
bin eine wunderliche Zigarette
zerknautscht in ihrer Taschen-Ruhestätte
bin eine Glühbirne laternenlos.
Das Telefon, es schrillt den ganzen Tag
kaum anzunehmen, dass ich lächeln mag
mir schmerzt das Herz und auch das Ohr
mir schmerzt die Braue, ja der Zahn da vorn
nun ist es Sommer, Frühling oder Herbst
und sehr wahrscheinlich, dass ich sterb.
Der einzige vermeintliche Vorzug des Gedichts bestand im bemühten Einhalten der klassischen Form, was für einen Sechzehnjährigen schon beachtlich sein mag. Das Schlussterzett war bei weitem der schlimmste Teil und zugleich der authentischste, denn auf seine halbherzige, zögerliche Art wollte Gonzalo sehr wohl sterben. Es wäre nicht komisch, wenn wir uns über seine Gefühle lustig machten, machen wir uns also über das Gedicht lustig, über seine offensichtlichen oder mittelmäßigen Reime, über seine Schmalzigkeit, seine unfreiwillige Komik, aber unterschätzen wir nicht seinen Schmerz, der war echt.
Während Gonzalo
Während Gonzalo mit den Tränen und den Fünfhebern kämpfte, hörte Carla wieder und wieder »Losing my Religion« von R.E.M., damals ein Erfolgshit, der laut Carla perfekt ihren Gemütszustand spiegelte, auch wenn sie nur einige Wörter davon verstand (»life«, »you«, »me«, »much«, »this«) und den Titel, den sie mit der Sünde in Verbindung brachte, als hieße der Song in Wirklichkeit »Losing my Virginity«. Obwohl sie bei den Nonnen zur Schule ging, war ihr Schmerz kein religiöser oder metaphysischer, sondern ein strikt physischer, denn, Scham und Symbolik beiseite, die Penetration hatte höllisch wehgetan: Dasselbe Glied, das sie sich sonst so ungeniert heimlich in den Mund gesteckt und Tag für Tag mit gehöriger Kreativität massiert hatte, kam ihr nun wie ein erbarmungsloser, heimtückischer Drillbohrer vor.
»Niemand steckt ihn mir je wieder rein, niemals. Weder Gonzalo noch sonst jemand«, sagte sie ihren Freundinnen, die sie jeden Nachmittag besuchen kamen, fast gegen Carlas Willen, die in alle Winde verkündete, sie wolle allein sein. Doch sie kamen trotzdem.
Carlas Freundinnen teilten sich von selbst in die engelhafte, langweilige und umfangreiche Gruppe der Noch-Jungfrauen und in die zusammengewürfelte, schmale Gruppe der Nicht-mehr-Jungfrauen. Die Menge der Jungfrauen bestand wiederum aus der kleineren Teilmenge derer, die als Jungfrau in die Ehe eingehen wollten, und der größeren, schwankenden Teilmenge der Nur-jetzt-noch-nicht, zu der Carla kurzzeitig gehört hatte. In der Gruppe der Nicht-Jungfrauen stachen zwei Freundinnen heraus, die Carla spöttisch und bewundernd »die Linken« nannte, eigentlich nur, weil sie in fast jeder Hinsicht radikaler oder vielleicht bloß weniger gehemmt waren als alle anderen, die Carla kannte. (Eine von ihnen wollte, dass Carla ihren Lieblingssong wechselte, denn sie hielt »I Touch Myself« von Divinyls, auch ein Erfolgshit damals, in der gegenwärtigen Situation für passender als »Losing my Religion«. »Lieblingssongs wählt man nicht aus«, gab Carla zurück, völlig zu Recht.)
Nachdem sie sich den Schwall von Ratschlägen aus beiden Lagern angehört und vor allem die Meinungen der Linken zu Herzen genommen hatte, hielt Carla es für das Vernünftigste, ihre erste sexuelle Erfahrung so schnell wie möglich zu vergessen, wozu sie logischerweise dringend eine zweite sexuelle Erfahrung benötigte. An einem Freitag rief sie nach der Schule Gonzalo an und zitierte ihn ins Zentrum. Der konnte sein Glück nicht fassen. Er rannte los zur Bushaltestelle, seltsam für ihn, da ihm rennende Leute auf der Straße lächerlich vorkamen, vor allem in langen Hosen. Er erwischte einen Bus ohne freien Sitzplatz, schaffte es aber dennoch, einen Großteil der zweiundvierzig Gedichte, die er im Rucksack bei sich trug, im Stehen noch einmal zu lesen.
Zur Begrüßung saugte sich Carla an seinem Mund fest und stellte gleich klar, dass sie wieder zusammen sein und in ein Stundenhotel gehen sollten, obwohl sie ebendas fast ein ganzes Jahr lang verweigert und als Grund Anstand, Geldmangel, Ungesetzlichkeit, Bakteriophobie oder alles zusammen angeführt hatte, doch jetzt versicherte sie in einem schon übertrieben lüsternen Ton, ja, das wolle sie, komme um vor Verlangen.
»Beim Kunsthandwerkmarkt gibt’s eins, hab ich gehört, ich hab Kondome besorgt und Geld dabei«, sagte Carla in einem einzigen überstürzten Satz. »Los!«
Das Hotel war ein elendes Loch, das nach Räucherstäbchen und ranzigem Öl roch, denn man konnte sich gebratene Käse- und Hackfleisch-Empanadas aufs Zimmer bestellen, außerdem Bier, Pichuncho und Piscola, was sie alles verwarfen. Eine Frau, das Haar rot gefärbt, die Lippen blau, nahm das Geld entgegen und verlangte natürlich keinen Ausweis. Sobald sie die Tür des winzigen Zimmers hinter sich geschlossen hatten, zogen Carla und Gonzalo sich aus und betrachteten einander erstaunt, als hätten sie gerade erst die Nacktheit entdeckt, was im Grunde auch stimmte. Fünf Minuten lang beschränkten sie sich aufs Küssen, Lecken und Beißen, dann zog Carla Gonzalo eigenhändig das Kondom über – sie hatte am selben Vormittag mit einem nackten Maiskolben geübt –, und er drang langsam in sie ein, mit der Beherrschung und dem tiefen Empfinden dessen, der sich den Augenblick einprägen will, und alles lief wunderbar. Doch die Verbesserung war minimal, weil der Schmerz anhielt (Carla tat es sogar noch mehr weh als beim ersten Mal), und die Penetration dauerte letztlich so lange, wie ein Hundertmeterläufer für die ersten fünfzig gebraucht hätte.
Gonzalo zog die Jalousien ein wenig hoch und sah den Leuten zu, die von der Arbeit nach Hause gingen, mit einer Langsamkeit, die ihm aus der Entfernung phantastisch vorkam. Dann kniete er sich vor das Bett und betrachtete eingehend Carlas Füße. Noch nie hatte er auf ihre Fußlinien geachtet. Eine ganze Minute lang folgte er, als suchte er den Weg aus einem Labyrinth, diesen chaotischen Fährten, die sich bis ins Unsichtbare verästelten, und dachte daran, ein langes Gedicht über jemanden zu schreiben, der barfuß auf einem endlosen Pfad wandert, bis seine Fußlinien verwischt sind. Dann streckte er sich neben Carla aus und fragte, ob er ihr seine Sonette vorlesen könne.
»Ja«, antwortete Carla gedankenverloren.
»Aber es sind zweiundvierzig.«
»Lies mir das vor, das dir am besten gefällt.«
»Schwer zu entscheiden. Ich lese dir zwanzig vor.«
»Drei«, handelte ihn Carla hastig herunter.
»Fünf.«
»Gut.«
Gonzalo begann, ihr mit feierlicher Intonation seine Sonette vorzutragen, und obwohl Carla sie gern gut gefunden hätte, konnte sie in Wirklichkeit nichts damit anfangen. Beim Zuhören dachte sie an Gonzalos Hals, an seine Brust, glatt wie Eis und doch so warm, an sein fast sichtbares, so komisches Skelett, an seine Augen, mal braun, mal grün und immer eine Spur seltsam. Sie hielt ihn für schön, und es wäre fabelhaft gewesen, wenn ihr auch seine Gedichte gefallen hätten, die sie dennoch respektvoll und mit einem Lächeln anhörte, das heiter und entspannt sein sollte, aber eher von Melancholie zeugte.
Als Gonzalo mit dem fünften Sonett anfing, schwoll ein Stöhnen aus dem Nebenzimmer an, von dem sie nur eine dünne Wand trennte. Die unfreiwillige Intimität mit diesen Unbekannten löste Unterschiedliches aus: Gonzalo empfand es als Privileg, einen echten Porno mitzuerleben, live und in Direktübertragung – wirklicher Sex, unverfälscht, mit quietschendem Bett und leicht versetzten Schreien, die auf einen bestimmt denkwürdigen Ansturm folgten. Für Carla dagegen war so viel Nähe zunächst verstörend, sie dachte sogar daran, an die Wand zu klopfen und um mehr Diskretion zu bitten, aber dann konzentrierte sie sich lieber auf dieses Stöhnen und überlegte, ob die genießende Unbekannte unten lag oder obenauf oder in einer dieser seltsamen Stellungen, die ihre Klassenkameradinnen in der Pause tollkühn an die Tafel malten. Die Vorstellung, ebenfalls so zu stöhnen, wie eine unschlagbare Siegerin von Roland-Garros, hielt sie für grandios, wenn auch momentan für unmöglich, denn dort wurde aus Lust gestöhnt, und mochten sich auch manchmal Schmerz und Lust vermischen, bei Carla war das nicht der Fall, bei ihr war es reiner, ausschließlicher Schmerz.
Mit dem plötzlichen Verlangen, lauter zu schreien als ihre Nachbarin, schwang sich Carla auf Gonzalo und begann, ihm den Hals zu lecken. Er packte mit beiden Händen ihren Hintern und spürte, dass die volle Erektion sofort zurückkehrte und einem zweiten Vögeln an diesem Nachmittag, ihrem dritten Mal, das die Erinnerung an die vorhergehenden auslöschen oder zumindest relativieren sollte, nichts im Wege zu stehen schien. Gonzalo versuchte, sich eigenhändig ein neues Kondom überzustreifen, und obwohl er mit fast würdevollem Ungeschick vorging, reichten diese zusätzlichen Sekunden, Carla davon abzubringen, penetriert zu werden, und das Scharmützel endete mit gegenseitigem Masturbieren, bewährt und effektiv.
Gonzalo lehnte sich gegen Carlas Brüste und wäre sogar eingeschlafen, wenn nicht der Radau nebenan gewesen wäre, denn die Nachbarn rammelten immer noch wie die Kaninchen oder wie verrückt oder wie verrückte Kaninchen. Er griff zur Fernbedienung, es war ohnehin nicht mehr lang bis zur Fernsehserie, von der sie inzwischen nicht mehr lassen konnten, kaum verwunderlich, denn schlecht war die Serie nicht und stand zudem vor ihrem großen Finale, doch Carla, die seit zehn Minuten an die Decke starrte, schaltete nicht nur den Fernseher aus und riss ihm die Fernbedienung aus der Hand, sondern nahm auch die Batterien heraus und warf sie gegen die Wand. Darauf folgte eine Stille, die wenig von Stille an sich hatte, denn die Nachbarn machten weiter, sie waren, wie ein Professor für Literaturtheorie sagen würde, in medias res.
»Das kann nicht sein«, sagte Gonzalo schließlich in aufrichtigem Unglauben. »Das ist zu viel.«
»Zu viel was?«
»Hörst du die nicht? Die treiben es zu lange. Das ist doch nicht normal.«
»Soweit ich weiß, ist das sehr wohl normal«, sagte Carla und versuchte dann, den Akzent anders zu setzen. »Das Normale ist, soweit ich weiß, genau das.«
»Anscheinend weißt du viel über Sex«, murmelte Gonzalo und versuchte, seine Scham zu verbergen. Sie antwortete nicht.
Als das Keuchen im Nachbarzimmer endlich verstummte, blieben Carla und Gonzalo noch eine gute Stunde im Hotel, aber sie hatten zu gar nichts mehr Lust, nicht einmal zum Fortgehen. Gonzalo betrachtete Carlas herrlichen Rücken und streichelte ein paar weniger dunkle Streifen, die Spuren wechselnder Badeanzüge, die wie eine Negativtätowierung von den Schultern abfielen.
»Verzeih mir«, sagte er.
»Schon gut«, sagte Carla.
»Verzeih mir«, wiederholte Gonzalo.
Sie sammelten die Batterien der Fernbedienung auf und erwischten noch die letzten Minuten der Serie. Zu Fuß gingen sie zur Alameda und besprachen tatsächlich die Folge. Es war eine der traurigsten Szenen des Nachmittags, der Woche, vielleicht ihrer ganzen Beziehung: Carla und Gonzalo Hand in Hand auf dem Weg zur Alameda, im Gespräch über die Serie. Sie waren wie zwei Unbekannte, die verzweifelt ein gemeinsames Thema suchen; es schien, als sprächen sie über etwas und wären zusammen, aber sie wussten, in Wirklichkeit sprachen sie über nichts und waren allein.
Gonzalo schob Bauchschmerzen
Gonzalo schob Bauchschmerzen vor und ging in die Praxis von Doktor Valdemar Puppo, der weder Psychiater noch Psychologe war, auch kein Urologe oder dergleichen, sondern der Kinderarzt, zu dem er schon immer gegangen war. Der Patient neigte zwar zu Umschweifen und Beschönigungen, versuchte aber, deutlich zu sein: Das Problem war die Penetration an sich, beim Vorspiel konnte er sich beherrschen, aber sobald er in Carla eindrang – er verschwieg, dass es erst zweimal geschehen war –, gelang es ihm nicht mehr. Der Doktor demonstrierte seine männliche Verschworenheit durch ein ärgerliches, peinlich langes Lachen.
»So geht’s allen, mein Lieber, mir allerdings nie, muss ich gestehen«, sagte der Mann, während er sich mit beiden Händen den Wanst streichelte, als hätte er gerade ein ganzes Wildschwein verschlungen. »Die Penetration wird überschätzt. Bekommst halt die Flatter, Meister.«
In diesem abscheulichen, bemüht jugendlichen Jargon empfahl Doktor Valdemar Puppo, Gonzalo solle sich entspannen und zur Taktik der Ablenkung greifen, die er vage und vulgär zusammenfasste:
»Wenn dein Schwanz schön steif ist, denk an deine Oma.«
Gonzalo verstand, was mit dem Ratschlag gemeint war, musste ihn aber gleich wörtlich nehmen und traurig werden, denn die alte Frau war gerade gestorben.
Alles in allem war es ein guter Rat gewesen. Das Pärchen vögelte noch einmal im selben Hotel, ein paarmal auf Partys und sogar bei Gonzalo auf dem Dachboden, flankiert von schimmernden Spinnweben, vielleicht auch von Wühl- und Hausmäusen, und die Ablenkungstaktik, die Gonzalo die Puppo-Taktik nannte, funktionierte meistens. Natürlich dachte er nicht an seine Oma, sondern an Frauen, die er hässlich fand, wobei seine Vorstellung von Hässlichkeit eine Art moralischen Hintergrund hatte. Der Abscheu, den etwa die frühere Bildungsministerin Mónica Madariaga, die Sängerin Patricia Maldonado oder sogar Lucía Hiriart de Pinochet höchstselbst in ihm auslösten, war bei weitem mehr ideologischer als physischer Natur, da es sich – sah man von Señora Maldonado ab – nicht unbedingt um objektiv hässliche Frauen handelte.
Doch so schrecklich ihm diese Señoras auch erscheinen mochten, irgendwann wichen ihre Haut, die er sich rau, runzlig und schlaff vorstellte, Carlas samtiger Schulter oder ihren perfekten Schenkeln – die Wirklichkeit siegte über die Vorstellung, weshalb Gonzalo meist doch eher Früh- als Spätzünder war. Der Trick bestand darin, wie er schließlich begriff, sich auf etwas Abstrakteres zu konzentrieren, auf etwas Neutrales, Ruhiges, das für anhaltende Ablenkung sorgte, etwa auf die Bilder von Kandinsky, Rothko oder Matta, auf Schachübungen für Anfänger oder die Eroberung des Weltraums, auf tiefernste, dramatische Gedichte von Miguel Arteche, die ihm überhaupt nicht gefielen, die er jedoch in der Schule hatte analysieren müssen (»Golf«, »Das schwachsinnige Kind«), und er erzielte sogar beachtliche Ergebnisse mit der grausamen Methode, sich einen Parkinsonkranken vorzustellen, der eine Artischocke verzehrte.
Auch wenn es immer öfter zum Sex kam und es Carla immer etwas weniger wehtat, war sie sich nicht sicher, ob sie mit Gonzalo zusammenbleiben wollte. Sie versuchte, sich einzureden, dass sie verliebt war wie nie zuvor, aber eigentlich hatte sie die Schwärmerei der Anfangszeit hinter sich. Die Vorstellung, viele Jahre oder das ganze Leben mit Gonzalo zu verbringen, erschien ihr immer bedrückender.
Im Sommer lud eine der beiden Linken sie nach Maitencillo ein, und obwohl es einfach gewesen wäre, unter einem beliebigen Vorwand mit Gonzalo wegzufahren, wollte Carla die Zeit nutzen, ihre Beziehung zu überdenken. Ebendas tat sie im Grunde während all der neun Tage in Maitencillo: Sie frühstückte, aß zu Mittag und zu Abend und überdachte ihre Beziehung, sie spielte Volleyball, Beachball oder Johnny-on-the-Pony und überdachte ihre Beziehung, sie trank Fanschop und tanzte wild zu Technotronic-Hits und überdachte ihre Beziehung, und sogar an dem Abend, als sie zuließ, dass ein muskulöser Argentinier sie ein paarmal küsste, ihr an Hintern und Titten fasste, überdachte sie ihre Beziehung, und so erstaunlich es klingen mag, auch während sie besagtem Argentinier einen blies, überdachte Carla gewissermaßen ihre Beziehung.
Das Abenteuer mit dem Argentinier wurde von zahlreichen Beinah-Augenzeugen geschildert, kommentiert und analysiert und wäre bald Gonzalo zu Ohren gekommen. Von Gewissensbissen geplagt, beschloss Carla, die Untreue zu gestehen und auch das Flötenblasen nicht auszulassen, ein mildernder Umstand und ein Beweis, dass sie sich der Penetration verweigert hatte, wenn auch nicht aus Treue, ehrlich gesagt, sondern, weil sie die Vorstellung entsetzt hatte, von einem Glied penetriert zu werden, das zwar ein paar Zentimeter kürzer als Gonzalos war, aber beträchtlich dicker.
Während der folgenden sechs Monate war die Schuld der einzige Brennstoff ihrer Beziehung. An manchen Tagen fürchtete Carla, Gonzalo könne Rache nehmen, an manchen jedoch wünschte sie es sich geradezu, denn durch einen Ausgleichstreffer hätte sie zumindest ihre Würde wiedererlangt, die sie selbstverständlich gar nicht verloren hatte, auch wenn Gonzalo sie hin und wieder mit feindseligen oder selbstmitleidigen Kommentaren quälte.
Gonzalo, von Natur aus eigentlich treu, beschloss, den versteckten Avancen von Bernardita Rojas nachzugeben, einem Mädchen aus dem Viertel, dem er sich irgendwie verbunden fühlte, da auch sein Nachname Rojas war. Verwandt waren sie natürlich nicht, es war ein Allerweltsname, aber sie grüßte ihn immer, als wären sie es doch, darin bestand eigentlich der Flirt (»wie steht’s, Cousin Rojas?«, sagte sie und blähte die Nasenflügel, wie es schlechte Schauspielerinnen tun, die Erregung darstellen wollen). Bernardita Rojas hatte etwas Originelles an sich, denn bei ihr drapierte kein Haargel den Pony als drohend erstarrte Welle über der Stirn wie bei fast allen jungen Mädchen damals in Chile – eingeschlossen Carla –, als hätten sie sich zu einer gemeinsamen Hommage an Hokusais Große Welle verabredet. Doch an Bernardita Rojas zog ihn ebenfalls an, dass sie immer ein Buch von Edgar Allan Poe bei sich trug, das sie mit der gleichen Hingabe las, mit der andere sich durch Fragmente einer Sprache der Liebe, Die offenen Adern Lateinamerikas oder Der wunde Punkt arbeiteten.
Die falschen Cousins Rojas sahen sich gemeinsam Night on Earth an, und wenn der Hintergedanke bei dem Kinobesuch auch gewesen war, im Dunkeln den Händen freien Lauf zu lassen, fanden sie Jim Jarmuschs Film so unterhaltsam, dass sie nur wie hypnotisiert auf die Leinwand starrten.
»Es war schön, mit dir auszugehen«, sagte Bernardita, während sie auf den Bus warteten.
»Finde ich auch«, antwortete er zerstreut.
Die Fahrt nach Hause verbrachte Gonzalo in Gedanken an Winona Ryder – er stellte sie sich am Steuer eines Lada-Taxis vor, wie sie an einer Ecke in Santiago auf grünes Licht wartete, dabei Kaugummi kaute, rauchte und Tom Waits hörte. Bernardita wurde es leid, dass ihr Sitznachbar so einsilbig war, gab jeden Versuch eines Dialogs auf und machte sich daran, »Ligeia« zu lesen, ihre Lieblingserzählung von Poe. Gonzalo sah ihr ein paar Minuten beim Lesen zu, im Hintergrund die Abenddämmerung über der Stadt, und auf einmal wollte er ihr tatsächlich einen Kuss geben. Er versuchte es, doch sie wies ihn mit ihrem üblichen Lächeln fest geschlossener Lippen zurück.
»Ich lese«, sagte sie.
»Lies mir ein bisschen vor«, entgegnete Gonzalo.
»Ich will nicht«, sagte Bernardita, schob das Buch aber in seine Richtung, damit Gonzalo mitlesen konnte, und den Rest der Fahrt lasen sie Kopf an Kopf, fast Arm in Arm die Poe-Erzählung.
Sie gelangten zu der Ecke, an der sie sich verabschieden mussten, und da willigte Bernardita doch in einen kurzen Kuss ein, wenn auch ohne viel Zunge. Gonzalo ging nach Hause und erwog die Möglichkeit, die Rache voranzutreiben, bis sie ungefähr symmetrisch war. Er zögerte und beschloss, sich mit Marquitos zu besprechen, einem etwas älteren Rotschopf, der im Laden im Viertel arbeitete und in Verkleinerungsform gerufen wurde, weil er so winzig, fast schon zwergenwüchsig war. Es wurde dunkel, Gonzalo half Marquitos, den Laden zu schließen, und sie stellten sich an die Theke, jeder mit einer 1,5-Liter-Flasche Escudo-Bier, schön kalt.
»Deine Freundin ist doch viel schärfer als die Bernardita«, sagte Marquitos, nachdem er ein paar Sekunden lang über das Dilemma nachgedacht hatte. »Hand aufs Herz, deine Freundin ist viel, viel besser.«
Das war Marquitos’ Floskel: »Hand aufs Herz, Señora, das hier sind die besten Wassermelonen der Saison«, sagte er zum Beispiel oder: »Ich bin eingeschlafen, Chef, Hand aufs Herz«, manchmal benutzte er die Floskel auch in ganz banalen Sätzen wie: »Hand aufs Herz, es ist heiß.«
»Ja, ich weiß, aber sie ist fremdgegangen«, antwortete Gonzalo.
»Du bist halt hässlich, Gonza, kreuzhässlich.«
»Ja und? Was spielt das für eine Rolle, dass ich hässlich bin?«, gab Gonzalo zurück, der sich keineswegs für hässlich hielt (und es auch nicht war).
»Sieh mal, die Sache ist die, deine Freundin ist einfach irre scharf. Die ist die schärfste Braut von allen.« Es klang so, als hätte Marquitos diese Bemerkung seit einer Ewigkeit auf der Zunge gehabt.
»Sag mal, was ist los mit dir, Mann«, antwortete Gonzalo überrascht und verärgert.
»Entschuldige, aber das ist die Wahrheit. Und Freunde müssen immer die Wahrheit sagen, etwa nicht?« Gonzalo zögerte zwei Sekunden, bevor er nickte, scheinbar sanftmütig. »Hand aufs Herz, deine Freundin ist versnobt, aber scharf. Und sie ist nichts für dich. Die ist eine Nummer zu groß, Kleiner. Ich weiß nicht, wie du sie dir geangelt hast. Wenn ihr Schluss macht, wirst du im Leben nicht mehr eine Braut bekommen, die nur halb so scharf ist.«
»Ich will nicht mit ihr Schluss machen«, sagte Gonzalo, als dächte er laut nach.
»Aber sie wird dahinterkommen, die Bräute kommen hinter alles«, sagte Marquitos mit Expertenmiene.
Er holte Biernachschub und ein Kastenbrot und bot Gonzalo ein paar Scheiben an.
»Und was gefällt dir an meiner Freundin besonders?«, fragte Gonzalo in bemüht gelassenem Ton.
»Das willst du echt wissen?«
»Ja.«
»Und wirst nicht böse?«
»Nein, Marquitos, keine Angst. Wie soll ich wegen so was böse werden?«
»Du wirst böse, Kleiner.«
»Nein, Kumpel, keine Sorge. Reine Neugier.«
»Ich weiß nicht, Mann, alles. Diese feinen Spitzentitten. Und dieser Hintern, ich bitte dich. Das Maß aller Dinge. Deine Freundin hat ein Wahnsinnsteil von Hintern, wirst du wohl bemerkt haben. Und das Gesicht.«
»Was ist mit ihrem Gesicht? Sag schon, ich werd nicht böse. Wie ist ihr Gesicht?«
»Also, und das sage ich mit allem Respekt, sie hat ein Gesicht … Hand aufs Herz, Kumpel, deine Freundin hat ein höllisch heißes Gesicht.«
Gonzalo hatte keine Wahl: Eine Faust aufs Auge, zwei in den Magen und einen Tritt in die Eier erledigten für immer seine Freundschaft mit Marquitos. Traurig und verstört verließ er den Laden, zum ersten Mal in seinem Leben auch besorgt über seine angebliche Hässlichkeit, die er den hartnäckigen Pickeln zuschrieb, obwohl er die schon hatte, seit er elf war, und sie als Teil seines Gesichts betrachtete.
»Was ist los, Cousin Rojas?«, fragte Bernardita am Freitag derselben Woche.
»Wieso?«
»Du ziehst so ein langes Gesicht.«
»Ich ziehe ein hässliches Gesicht.« Gonzalo versuchte, witzig zu sein.
Sie gingen zur Plaza, unterhielten sich ausgiebig, und Gonzalo erzählte ihr alles oder fast alles. Beim Abschied sah Bernardita ihn an, als wäre Gonzalo tatsächlich ihr Cousin oder ihr Bruder, war aber dennoch verärgert. Sie wusste von seiner Freundin, hatte die beiden schon öfter zusammen gesehen, war aber davon ausgegangen, dass sie Schluss gemacht hatten oder gerade dabei waren, und natürlich gefiel es ihr gar nicht, bloß Mittel zur Rache zu sein. Am nächsten Morgen jedoch klingelte sie bei Gonzalo, gab ein Päckchen ab und rannte fort. Es war eine Schuhschachtel mit einem frisch geschnittenen Aloeblatt, einem Messer und einer handschriftlichen Gebrauchsanweisung sowie einem Plan, auf dem Bernardita zehn verschiedene Stellen in Maipú markiert hatte, an denen Aloe wuchs.
Gonzalo wurde es zur Gewohnheit, sich jeden Nachmittag ein Blatt zu schneiden und den Saft vor dem Schlafen auf die zahlreichen Problemzonen seiner Haut zu verteilen. Wenn ihn jemand gefragt hätte, warum er ein Messer im Rucksack habe, hätte er geantwortet, zur Verteidigung, was im Grunde stimmte, denn er verteidigte sich gegen die Hässlichkeit.
Zu Anfang
Zu Anfang war alles so natürlich, so angenehm und vergnüglich gewesen, dachte Gonzalo, als er sich an seine erste Begegnung mit Carla fast drei Jahre zuvor erinnerte, nach einem Konzert von Electrodomésticos: ein kurzer Flirt, der zum Belanglosen tendierte, da sie nicht einmal fünf Minuten miteinander sprachen, doch Gonzalo nahm seinen Mut zusammen und fragte sie nach ihrer Telefonnummer – so kühn war er zum ersten Mal in seinem Leben –, und da Carla sie ihm verweigerte, bat er, sie solle ihm wenigstens die ersten sechs Ziffern nennen. Das fand sie so lustig, dass sie ihm schießlich die ersten fünf gab.
Am nächsten Tag bezog Gonzalo Stellung vor dem gelben Telefon an der Ecke, die Hosentasche voller Hundert-Peso-Münzen, und ging in aufsteigender Reihenfolge vor (von 00 bis 04), wechselte aber zur absteigenden (von 99 bis 97), ließ sich dann von Eingebungen leiten (09, 67, 75) und kam so durcheinander, dass er die Ziffern schließlich auf denselben Block notieren musste, auf dem er seine Gedichte entwarf. Es schien eine endlose Aufgabe zu sein, dazu noch Verschwendung – das Telefon an der Ecke war zu einem Spielautomaten geworden und Gonzalo zu einem entfesselten Spielsüchtigen und zu einem Dieb, denn weder sein Taschengeld noch das Wechselgeld vom Bäcker reichten aus, sodass er täglich in die Geldbeutel seiner Eltern vordringen musste. Wenn Resignation aufkam, dachte Gonzalo daran, wie Carla sich das Haar band, ein Bild, das sich ihm eingeprägt hatte: die Arme, zum rabenschwarzen Haar erhoben, die knochigen Ellbogen, die Brüste, die sich unter dem grünen T-Shirt abzeichneten, und ein Lächeln, das den Blick auf leicht auseinanderstehende Zähne freigab, sehr gewöhnliche Zähne, die für ihn jedoch einzigartig und schön waren.
Als ihn schon die Gewissheit beschlich, dass sein Unternehmen zum Scheitern verurteilt war, traf Gonzalo mit der Ziffer 59 ins Schwarze. Beim ersten Anruf war Carla eher spröde, sie konnte so viel Hartnäckigkeit kaum fassen, doch von da an sprachen sie jeden Nachmittag ein paar Minuten lang, fast immer so lange, wie es zwei-, dreihundert Pesos zuließen, doch als die Telefonleitungen ein paar Monate später endlich auch Gonzalos Haus erreicht hatten, mindestens eine Stunde täglich. Der Plan, sich zu treffen, nahm immer mehr Gestalt an, obwohl Carla noch zögerte, da sie fürchtete, der leibhaftige Gonzalo könne ihr weniger gut gefallen. Doch nach ihrem Treffen an einem Samstagvormittag, als sie sich wild umschlungen küssten, waren alle Zweifel wie weggewischt.
Immer hatten sie mit strahlender Freude an all die kleinen Episoden aus der Anfangszeit zurückgedacht, an die er sich nun voll Kummer erinnerte – er führte sich seine Beziehung zu Carla vor Augen, idealisierte sie immer noch unerschütterlich, doch zugleich begriff und akzeptierte er widerwillig, dass sie nicht mehr so viel Spaß zusammen hatten, nicht mehr so viel lachten und sich ihre Körper, vielleicht wegen der vielzitierten Penetration, nicht mehr so reibungslos reimten (»hätte ich ihn ihr doch niemals reingesteckt«, sagte sich Gonzalo eines Vormittags, leider laut – seine Klassenkameraden kamen um vor Lachen und nannten ihn von da an den »Reumütigen«).
Es überraschte ihn nicht, dass Carla Objekt der einhelligen Begierde war, er hatte sich bereits daran gewöhnt, dass fast alle Männer (bedauerlicherweise auch Gonzalos Vater) sie dreist taxierten und sogar manche Frauen Carla gegenüber Neid, vielleicht auch heimliches Verlangen, schlecht verbergen konnten. Gonzalo war nicht eifersüchtig, obwohl er nach dem Abenteuer mit dem Argentinier und dem Vorfall mit Marquitos dachte, dass er es vielleicht sein sollte, gewissermaßen die Pflicht dazu hatte. Aber er wollte nicht eifersüchtig sein, nicht besitzergreifend oder gewalttätig. Wollte nicht wie alle Welt sein.
Im Gegensatz zu den Horden oberflächlicher junger Leute, die sich der Endogamie und dem physischen Schönheitskult hingaben, hatte Gonzalo an Carlas Seite eine Oase reiner Kameradschaft gefunden. Wer wie Marquitos behauptete oder andeutete, Gonzalo habe sich Carla »geschnappt«, müsse sich anstrengen, sie zu behalten, und nicht mehr loslassen, verstand nichts von der Natur der Liebe, aber beleidigend war tatsächlich gewesen, dass Marquitos Carla als versnobt bezeichnet hatte, denn sie redete weder versnobt noch kleidete sie sich so – das heißt, im Vergleich zu Gonzalo, Marquitos und Bernardita Rojas vielleicht schon, aber verglichen mit den Snobs aus Vitacura oder Las Condes keineswegs.
Zwischen Carla und Gonzalo gab es offensichtliche Unterschiede, vor denen keiner der beiden die Augen verschloss: private Nonnenschule in Ñuñoa kontra staatliche Jungenschule in Santiago Centro, großes Haus mit drei Badezimmern kontra kleines Haus mit einem einzigen, Tochter eines Anwalts und einer Zahntechnikerin kontra Sohn eines Taxifahrers und einer Englischlehrerin, alteingesessene Mittelklasse in La Reina kontra Mittelklasse in Maipú (untere Mittelklasse, würde Gonzalos Vater sagen, aufstrebende Mittelklasse, seine Mutter). Weder Gonzalo noch Carla empfanden jedoch die soziale Kluft als besonders trennend, die Unterschiede beförderten eher das gegenseitige Interesse: die Vorstellung der Liebe als ein zufälliges glückliches Zusammentreffen, untermauert von der unverwüstlichen Theorie der besseren Hälfte.
Marquitos’ giftige Worte kehrten mit der Beharrlichkeit einer mitternächtlichen Mücke zurück und drangen ein in die heikelste Zone der Beziehung, Carlas offenkundiges Desinteresse an Lyrik. Sie liebte die Musik, hatte sich von klein auf für die Fotografie begeistert und las immer irgendeinen Roman, hielt die Lyrik aber für infantil und hochtrabend. Gonzalo verband die Lyrik jedoch, wie fast jeder, mit der Liebe. Er hatte Carla zwar nicht mit Gedichten erobert, sich jedoch fast gleichzeitig in sie und in die Lyrik verliebt und konnte beides nur mühsam trennen.
Alles wurde noch schlimmer, als Gonzalo beschloss, Literatur zu studieren. Seit einiger Zeit schon war er sich sicher, dass er Dichter werden wollte, und obwohl man dafür eigentlich nicht studieren musste, dachte er, ein Abschluss in Geisteswissenschaften würde ihn weniger von seinem Ziel ablenken. Es war eine mutige Entscheidung, radikal, ja sogar ein Skandal, gegen den Gonzalos Eltern hartnäckig opponierten, sie hielten es für Verschwendung: Mit Fleiß und offen gestanden unerklärlicher Begabung war aus ihrem Sohn der Musterschüler einer der angeblich besten Schulen Chiles geworden, sodass er nach einer weniger abenteuerlichen Zukunft streben konnte und vielleicht sollte. Als Gonzalo in der Hoffnung auf blinde, solidarische Unterstützung Carla von seinen Plänen erzählte, reagierte sie gleichgültig.
Damals war die chilenische Lyrik für Gonzalo die Geschichte genialer, exzentrischer Männer, dem Wein zugetan und Experten im Auf und Ab der Liebe. Infiziert von diesem Mythos, kam ihm manchmal der Gedanke, dass Carla künftig nur als ferne Jugendliebe fungieren würde, die den angehenden Dichter nicht zu schätzen gewusst hatte (die Frau, die allen Anzeichen zum Trotz die Größe des Mannes an ihrer Seite nicht hatte ermessen können, ja sogar fremdgegangen war). Carla schien eindeutig nicht die passende Gefährtin für die schwierige Reise zu sein, auf die er sich begeben wollte; früher oder später, vermutete Gonzalo, würde ihre Beziehung enden, sie würde sich einen Betriebswirt angeln, einen Zahnarzt oder einen Romancier. Gonzalo rechnete mit einem Bruch in mittelfristiger Zukunft, überraschte sich jedoch schon jetzt bei dem Gedanken, welche Worte er ihr dann sagen würde. Er malte sich eine elaborierte Rede aus, die ganz allmählich auf die Notwendigkeit zusteuerte – ihm gefiel diese Redewendung –, getrennte Wege zu gehen; erst würde er die Schuld auf das Schicksal oder das Verhängnis schieben, doch falls sie wütend wurde, alle Schuld auf sich nehmen und Schluss.
Eines Vormittags schwänzten sie und gingen schweigend durch Santiagos lärmendes Zentrum, bis sie den Paseo Bulnes erreichten. Dort setzten sie sich gewöhnlich auf eine Bank vor der Buchhandlung des Fondo de Cultura Económica, rauchten und küssten sich und bogen dann in die Tarapacá, wo sie Hot Dogs aßen und einige Partien Poolbillard spielten – sie gewann immer – oder ins Kino Arte Normandie gingen. Diesmal jedoch war das Drehbuch offensichtlich ein anderes: Carla wollte nur gehen, nicht einmal Hand in Hand, und sie fixierte die dicken Wolken, als könnten ihre Augen sie per Superkraft zerstreuen. Sie hatte eine lange Einführung geplant, platzte dann aber lieber mit diesem lapidaren Satz heraus:
»Die Gefühle haben sich geändert, Gonza.«
Dieser Satz, ebenso schroff wie elegant, traf Gonzalo mit ungeahnter Gewalt. Wir wissen, er war halbwegs auf den Bruch vorbereitet, aber in seiner Vorstellung war er es, der Schluss machte.
Während der folgenden Wochen hielten sich Leugnen und Groll die Waage, was seinen Ausdruck in Masturbationsphantasien fand – er bestrafte seine Ex, indem er sich vorstellte, mit Winona Ryder zu schlafen, mit Claudia di Girolamo, mit Katty Kowaleczko, ja sogar mit einer Tante von Carla, die Gonzalo ein wenig gefiel.
Eines Nachmittags begegnete er Bernardita Rojas, ausgerechnet vor einer gewaltigen Aloepflanze neben dem Tor zur Villa Las Terrazas. Als Erstes streichelte ihm Bernardita das Gesicht, das dank der Behandlung mit der wundersamen Pflanze teils zur Glätte zurückgefunden hatte. Er ließ es auf einen Versuch ankommen und war in seinen Avancen nicht zimperlich – sie wich aus.
»Wir sind Freunde, Cousin Rojas«, sagte Bernardita kategorisch.
»Nein, Berni, so enge Freunde sind wir nicht.«
»Wir sind Freunde. Sehr enge Freunde«, wiederholte sie.
»Aber so enge Freunde sind wir nicht«, wiederholte Gonzalo.
Der Dialog war noch ein ganzes Stück länger und redundanter. Sie gelangten zu keinem Schluss.
»Ich will nur deine Freundin sein«, beharrte Bernardita beim Abschied.
»Freunde habe ich schon«, sagte Gonzalo. »Ich habe zu viele Freunde. Mehr brauche ich nicht.«
Gonzalo gab seinen onanistischen Rachefeldzug bald auf und versank in der Willenlosigkeit und in der Platte Corazones von Los Prisioneros, die er nun für den Soundtrack seines ganzen Lebens hielt. Er verzichtete auf jede Form von Dialog, sogar auf den mit sich selbst, das heißt auf das Schreiben. Er verließ sein Zimmer kaum, doch besorgniserregend, zumindest für seine unmittelbare Umgebung, war vor allem seine radikale Weigerung, sich zu waschen.
Schließlich zerrte man Gonzalo
Schließlich zerrte man Gonzalo eines Morgens, die Neuauflage einer häufigen Strafe seiner Kindheit, mit Gewalt unter den eisigen Wasserstrahl, und er reagierte wie auf die heftigste aller Erniedrigungen, fand aber dennoch ein gewisses Vergnügen oder etwas Neues daran, sich den Körper sorgfältig einzuseifen, und blieb eine ganze Stunde unter dem Wasser – das damals als unerschöpfliche Ressource angesehen wurde –, eine Art Versöhnung mit der Sauberkeit. Dann zog er sich schnell an, nutzte den sonnigen Tag und legte sich mit seinem Block auf den Rasen der Plaza, stürzte sich aber nicht in Gedichtentwürfe, sondern blieb bei einem Vorstadium hängen, einer immer wieder aufgeschobenen Frage: der Wahl eines Pseudonyms.
Die Vorstellung, ein Pseudonym anzunehmen, hatte für ihn etwas Geschmackloses, Unbehagliches, doch er sah keinen anderen Weg, weil er von Gonzalo Rojas zwar nur eine Handvoll Gedichte gelesen hatte – die er im Übrigen großartig fand –, doch sehr wohl wusste, dass er einer der weltweit anerkanntesten chilenischen Dichter war, ja gerade den Premio Nacional de Literatura und einen weiteren, anscheinend ziemlich wichtigen Preis gewonnen hatte, in Spanien. Der Name war also besetzt, aber auch die Alternative Muñoz, der Nachname seiner Mutter, taugte nicht, denn es gab ebenfalls einen Dichter, weitaus weniger bekannt als Gonzalo Rojas, doch geadelt von der geheimnisvollen Aura der Avantgarde, der Gonzalo Muñoz hieß. Die Option, als Gonzalo Rojas Muñoz zu firmieren, roch zu sehr nach: »Ich bin nicht der Gonzalo Rojas.« Als räumte er von vornherein die Niederlage ein.
Er versuchte, Pablo de Rokhas Vorbild zu folgen, als Carlos Díaz Loyola geboren, der sich nach dem Wort für »Fels« einen sprechenden Nachnamen erfunden hatte, aber ihm fielen nur Albernheiten ein wie Gonzalo de Bakhel oder Gonzalo de Gout oder Gonzalo de Bussy. Dann suchte er in anderen literarischen Ökosystemen nach einem Pseudonym, wie es damals Gabriela Mistral und Pablo Neruda getan hatten, letztlich beide Nobelpreisträger. Nachdem er die dümmsten Optionen verworfen hatte (Gonzalo Rimbaud, Gonzalo Ginsberg, Gonzalo Pasolini, Gonzalo Pizarnik), verfestigte sich eine kurze Liste mit den Pseudonymen Gonzalo García Lorca, Gonzalo Corso, Gonzalo Grass, Gonzalo Li Po und Gonzalo Lee Masters, doch er konnte sich für keines davon entscheiden. Es wurde schon dunkel, als ihm das Pseudonym Gonzalo Pezoa in den Sinn kam, mit dem er zugleich dem portugiesischen Dichter Fernando Pessoa (den er nicht gelesen hatte, von dem er jedoch wusste, dass er toll war) und dem chilenischen Dichter Carlos Pezoa Véliz (den er phantastisch fand) eine Hommage erwies.
Sieben Monate nach dem Bruch erhielt Carla per Einschreiben Briefe von Gonzalo, die lang und unterhaltsam waren und von der Fiktion ausgingen, dass ihre Beziehung nicht zu Ende war und er von fernen Orten schrieb wie Marokko, Istanbul oder Sumatra, sogar aus Phantasiegegenden. Er besaß ein besonderes Talent, fleischfressende Pflanzen und wilde Tiere zu erfinden, und widmete sich in seinen Berichten ausführlich den Naturkatastrophen. Diese herrlichen Briefe unterschrieb Gonzalo mit dem eigenen Namen, die beigelegten Gedichte jedoch mit dem brandneuen Pseudonym.
Gonzalos neue Gedichte folgten nicht mehr den westlichen Formen, denn nach den Sonetten und Romanzen hatte er sich nun auf die Haikus gestürzt oder vielmehr auf Kurzgedichte, denen er diesen Namen gab. (Gonzalo schlug nie den Bogen von seiner plötzlichen Leidenschaft für Haikus zu seinen Problemen mit dem vorzeitigen Samenerguss.)
Im ersten Brief fand sich dieses einfache, vielleicht schöne Gedicht:
Der Wind in den Bäumen
du beim Zeichnen, die Augen
geschlossen.
Weniger denkwürdig war dieser Text in Brief Nummer drei:
Verrat des Morgens
diffuser Mittag
inmitten der Nacht.
Manchen Gedichten ging die kontemplative Ruhe, die das Haiku auszeichnet, gänzlich ab, wie in diesem aus Brief Nummer neun:
Gefallen sind schon alle Blätter
des Herbstes. Und noch immer ist es Herbst,
Scheiße auch.
Brief Nummer zwölf zeigte den missglückten Versuch, experimentell zu sein:
Ei, cara Carla mein
karge Klagen, rares
Eiklar: Gelb.
Zu Brief Nummer elf gehörte diese erotische Momentaufnahme:
Die Leberflecken deines
linken Schenkels
habe ich verzehrt.
In den letzten Briefen verschwand zunehmend der Humor, ein Beweis dafür ist dieses düstere, anmaßende und vielleicht verzweifelte Gedicht:
Wo dein Blut war
da war ich
drinnen.
Es waren insgesamt siebzehn Briefe, die die Empfängerin wieder und wieder las und die sie entzückten, aber sie war so nett oder so weise, keine falschen Hoffnungen zu nähren. Sie empfand weder Groll noch Ärger oder dergleichen, aber ihre Beziehung zu Gonzalo sah sie nun als eine gewaltige Zeitverschwendung. Damals hatten sich auch einige ihrer Freundinnen gerade von ihren jeweiligen Freunden getrennt, und eine war auf die Idee gekommen, eine Art exorzistische Versammlung abzuhalten, bei der sie gemeinschaftlich Fotos und jegliches Andenken verbrannten. Aus dem Vorschlag wurde ein Grillfest: Zwischen der großzügig mit Paraffin besprengten Kohle brannten unter den verzückten Blicken der Mädchen Dutzende von Kärtchen, Fotos, Briefen, Postkarten, Tickets für Kino, Schwimmbad oder Konzerte, dazu ein paar gequälte Teddybären. Carla wollte anfangs nicht mitmachen, doch schließlich gab sie dem kollektiven Druck nach und fütterte den Scheiterhaufen mit allen Briefen und Andenken an ihre Beziehung zu Gonzalo, darunter auch eine Taschenbuchausgabe von Siddhartha, die er ihr geschenkt hatte.
Die Stadt Santiago ist so groß und ihre Viertel sind so unabhängig, dass Carla und Gonzalo sich eigentlich nie mehr wiedersehen müssten, doch eines Nachts, neun Jahre später, sehen sie sich wieder, und dank dieser Wiederbegegnung bringt es die Geschichte auf die notwendige Seitenzahl für einen Roman.
II
Stieffamilie
Es war fast vier Uhr
Es war fast vier Uhr morgens, »Stop« von Erasure wurde gespielt, und von den über zweihundert Begeisterten, die auf der Tanzfläche ausflippten, tanzte jeder mit jedem oder niemand mit niemandem. Carla sah ihn zuerst, er stand einsam am Tresen, und da es ein Gay-Club war, nahm sie an, dass Gonzalo Farbe bekannt hatte, was sie zunächst wunderte und für einen Augenblick sogar ärgerte, aber nach kurzer Überlegung kam sie zu dem Schluss, dass sie es hätte merken müssen, es im Grunde schon immer gewusst hatte und sich vieles dadurch erklären ließ, auch wenn sie nicht hätte sagen können, was genau. Mit leichtem, elegantem Tanzschritt ging sie auf ihn zu, in Erwartung erstaunlicher, entschiedener Bekenntnisse – Gonzalo stürzte sich auf sie und versuchte, sie in eine Ecke zu bugsieren, wo sie reden konnten, doch es war schwierig, die entfesselte Menge zu durchqueren, sodass sie auf der Tanzfläche blieben, verstrickt in dieses fröhliche Theater der Anarchie.
»Ich bin nicht schwul!«, schrie Gonzalo, als ihm die mögliche Verwechslung bewusst wurde, und sah sich blitzenden Blicken voll Skepsis und Enttäuschung ausgesetzt, und vielleicht war auch Carla ein wenig enttäuscht, denn sie hatte sich bereits vorgestellt, wie sie ihren Freundinnen erzählte, ihr erster Freund, der erste Mann, mit dem sie geschlafen hatte und den sie mit zärtlichem Sarkasmus »den Dichter« nannte, sei schwul, und sie war sogar auf den Gedanken gekommen, dass der eine oder andere ihrer Freunde gern mit ihm ausgehen würde.
»Ich auch nicht!«, gab Carla zurück, für alle Fälle, obwohl sich in jenen karikaturesken Jahren der kollektiven Ahnungslosigkeit der Gedanke erst zaghaft durchsetzte, dass die Homosexualität kein Vorrecht der Männer war.
Es wäre eine Beleidigung für Tänzer, Choreographen und Akademielehrer, zu behaupten, dass Carla und Gonzalo tanzten, sie standen nur nicht still, und diese Abwesenheit von Stillstand drückte sich in einer Reihe wirrer Bewegungen aus. Dennoch schüttelte Carla die Schultern relativ graziös und synchron, was den trügerischen Eindruck von Sicherheit und somit Nüchternheit erweckte, während Gonzalo einen Schritt versuchte, der in seiner Reinform als Simulation von Trunkenheit beschrieben werden könnte, doch in diesem Fall war kein Simulieren nötig, sodass Gonzalo streng genommen nicht tanzte, sondern so reglos war, wie jemand so Betrunkenes nur sein konnte – er taumelte und packte Carla bei der Taille, als hielte er sich an einem Laternenpfahl fest, dann umarmte er sie vollends, verwegen. Sie hatte das Gefühl, dass sie ihn zurückweisen musste, wollte die Umarmung jedoch erwidern, brauchte es vielleicht, weil sie seit langem schon niemand mehr mit dieser Heftigkeit, dieser Dringlichkeit umarmt hatte oder Gonzalos Körper ihr einen warmen Schauer der Vertrautheit vermittelte oder diese Umarmung sie neun Jahre zurückversetzte oder wer weiß, warum, auszuschließen waren nur Albernheiten wie, dass sie ihn nie vergessen hatte – das war ihr fast sofort gelungen –, und verwerfen wir auch den Einfluss des Alkohols, der natürlich Einfluss hatte, aber an der Schwelle zum 21. Jahrhundert war der Zynismus, alles auf die Trunkenheit zu schieben, bereits aus der Mode gekommen.
Carla streichelte Gonzalos langes Haar, eine ganz neue Erfahrung, denn während ihrer gemeinsamen Jahre hatte er das Haar immer kurz getragen, »in vorschriftsmäßiger Länge«, wie von seiner Schule gefordert, das heißt zwei Fingerbreit über dem Hemdkragen. Die Umarmung brachte ihre Bewegungen in Einklang, und jetzt wurde »Can’t Get You Out of My Head« von Kylie Minogue gespielt, doch man hätte meinen können, dass sie zu einer Bachata von Juan Luis Guerra tanzten oder zu einem dieser anheizenden Hits von Chichi Peralta, obwohl es auch wie eine Art Walzer aussah, als wären sie ein Brautpaar, nicht gewohnt an Ernst, Feierlichkeit und Glamour, das mit Würde einen Walzer zu tanzen versucht.
Nach wenigen Minuten schlingernden, lasziven Tanzes fanden sie sich auf dem Männerklo wieder, legten verschwenderisch Hand aneinander und begeiferten sich gegenseitig. Als sie in die einzige Kabine dort gingen, die zum Glück frei war, kam es zu einem Moment des Zögerns, zu einer kurzen Pause der Vernunft, die Carla den Gedanken fassen ließ, verdammt, was tu ich da, während Gonzalo ihr schon vorschlagen wollte, lieber zu ihm zu gehen, anstatt sich auf dieser stinkenden Toilette einzuschließen, doch beide wussten, dass jedes weitere Wort den Zauber zerstören würde. Zwischen dem Standardgestammel einer Wiederbegegnung und der Möglichkeit eines unverantwortlichen, frenetischen und schwer zu rechtfertigenden Ficks wählten beide Letzteres.
Carla schlug die Zähne in Gonzalos Hals, den er ihr zahm darbot wie ein Sterbender, doch wie ein Sterbender, der lebendig genug war, Carlas Hintern abzufingern, ein Hintern, an den er sich erinnerte oder zu erinnern glaubte, obwohl er ihm nun modellierter, fester und üppiger vorkam. Er ging in die Knie, und während er sie zwischen den Beinen küsste, zog er ihr den Slip aus und steckte ihn als Trophäe in die Hosentasche. Jetzt ging sie in die Knie, Gonzalo stand wieder auf und war sogar so nett, Carla mit dem komplizierten Mechanismus des Gürtels zu helfen. Sie fing an, ihm stürmisch einen zu blasen. Mit der rechten hielt sie sein Glied, mit der Linken öffnete sie Gonzalos rechten Treter, dann wechselte sie die Hand, um auch den linken aufzuknüpfen. Während sie ihm beide Schuhe, Hose und Unterhose auszog, machte sie ihn mit wirkungsvollen Zungenschlägen bewegungslos, und obwohl sie sich das gar nicht vorgenommen hatte, warf sie die Unterhose in die Kloschüssel und zog an der Kette.
Es war eine himmelblaue Unterhose mit dunkelblauem Rand gewesen, ein Geschenk zu seinem Geburtstag Nummer sechsundzwanzig, ausgerechnet von den Freunden, die ihn in dieser Nacht in den Club mitgeschleppt hatten, Freunde, die von dem Wunsch besessen waren, Gonzalo zu beweisen, dass die Heterosexualität eine Art Leiden ist, chronisch, jedoch heilbar. Als er sah, dass seine Lieblingsunterhose – abgesehen vom Design sehr bequem – im Klo einfach nicht untergehen wollte, bekam Gonzalo einen Lachanfall, und auch sie, die vor ihm kniete, seinen pulsierenden Penis im Mund, lachte auf. Da warf er Carlas Slip ebenfalls in die Schüssel und zog an der Kette, beide zogen immer wieder, kamen um vor Lachen, als wären sie nicht betrunken, sondern high, obwohl sie im Grunde eher wie zwei kleine Kinder waren, die ein Spiel ein ums andere Mal wiederholen.
»Lass uns das gut machen«, sagte sie da auf einmal, strich sich den Rock glatt und ordnete ihr Haar.
Gonzalo wollte es gut machen oder soso oder schlecht, aber auf der Stelle, und er hatte sie fast rum, denn sie nahmen das Küssen und Befingern wieder auf und hätten auch weitergemacht, wäre nicht ein Besoffener dazwischengekommen, der gegen die Kabinentür hämmerte und brüllte:
»Hey, die Toilette ist für alle da, ihr seid nicht die Einzigen, die ficken wollen!«
Ohne Slip und Unterhose traten Carla und Gonzalo in die Nacht von Bellavista hinaus. Sie bewahrten sich noch Reste von Lachen in den Mundwinkeln, ebenso eine beachtliche Reserve an Erregung, und natürlich hätten sie einander abertausend Dinge fragen müssen, doch stattdessen atmeten sie lieber die relative Stille der Nacht. Als sie eine Gruppe Punks sahen, die mitten auf der Brücke Pío Nono eine Pisco-Flasche leerten, nahm Gonzalo Carla bei der Hand, und es kam ihr wie eine altmodische Geste vor, auf komische Weise galant, doch sie ging gern Hand in Hand mit Gonzalo oder erinnerte sich gern daran, wie es gewesen war, Hand in Hand mit ihm zu gehen. Die Punks würdigten sie keines Blickes, und Gonzalo wollte ihre Hand loslassen, doch sie hielt seine fest.
»Ich mag den Club, das ist der einzige Ort, an dem ich in Ruhe tanzen kann und vor den Typen sicher bin«, sagte Carla, als sie bereits die Plaza Italia erreicht hatten und keiner von beiden wusste, was tun.
»Ich mag ihn, weil es der einzige Ort ist, an dem ich mich wirklich begehrt fühle«, scherzte Gonzalo, auch wenn nicht deutlich wurde, ob es tatsächlich ein Scherz war.
Sie hätten sich verabschieden müssen, ohne Weiteres hätte das alles gewesen sein können, eine Episode, die man in seinem Vorstrafenregister als verrückte Nacht archivierte, doch Gonzalo sagte, er wohne drei Blocks weiter, und sie willigte ein, ihn zu begleiten. Während sie schweigend die drei Blocks zurücklegten, die in Wirklichkeit sieben waren, wurde es hell.
Wenn der Sonnenaufgang Gonzalo unterwegs überraschte, war ihm immer, als gäbe es eine Verbindung zwischen der Geburt der Helle und dem Akt des Bewegens, als wäre der Gehende gewissermaßen verantwortlich für den Sonnenaufgang oder umgekehrt: als erzeugte der Sonnenaufgang die Bewegung der Füße auf dem Gehweg. Er wollte es schon Carla sagen – er war sich aber nicht sicher, ob er es würde erklären können, fürchtete, sich zu verhaspeln, hatte das Gefühl, jedes weitere Wort könnte diese schöne, verrückte Morgendämmerung verderben.
In der Wohnung verlief alles mit schneller Ungezwungenheit. Kaum hatte er die Tür geschlossen, drang er in sie ein, ohne Kondom, sie hängte sich an seinen Hals, und sie gingen zum Bett – während Gonzalo an ihren Nippeln saugte, dachte er, dass Carlas Brüste womöglich größer geworden waren, und das gefiel ihm und wunderte ihn auch, obwohl nichts Wunderliches daran war, antwortete er sich selbst, denn der Körper verändert sich, natürlich verändert sich der Körper: Die Hüften waren tatsächlich breiter, die Beine eine Spur weniger samten, und vielleicht war sie weniger schlank als vor neun Jahren.
Gonzalo ist ein anderer, philosophierte ihrerseits Carla, während er langsam und kräftig in sie eindrang: zumindest einer, der gut vögelt – sie spürte den nahenden Orgasmus und zugleich die anachronistische Furcht, Gonzalo könne zu schnell kommen, und die Lust ließ etwas nach, doch zwei Minuten später kündigte sich der Orgasmus wieder an und kam auch, sie wusste nicht, ob ein doppelter oder ein einziger langer.
Ihm fiel Carlas Nabel auf, er war sich nicht sicher, ob er ihn richtig in Erinnerung hatte, er schien ihm leicht vorzustehen – er glitt von den Brüsten hinab zum Nabel, küsste und leckte ihn eingehend oder küsste und leckte ihn vielmehr, um ihn sich eingehend anzusehen, und dachte, ins Unreine, ins Blaue hinein, dass es ein neuer Nabel war. Etwas weiter unten, zwei Zentimeter über dem Schambein, stieß Gonzalo auf die blasse Narbe einer Operation.
Sie ging auf alle viere, und er drang wieder kräftig vor, im Einklang mit ihrer beider Stöhnen, vor ihm ihr Rücken und ihre Taille, auf der sich Archipele von Streifen abzeichneten, und da erinnerte er sich – er hatte sie gerade erst gesehen, verbuchte es jedoch bereits als Erinnerung – an Nabel, Narbe und vergrößerte Brustwarzen, an beträchtlich schlaffere Brüste und andere Streifen um sie herum, die er ebenfalls flüchtig gesehen hatte, und nun fasste er für sich in Worte, was er bereits wusste, aber immer noch nicht akzeptieren wollte, weil es ein unwiderruflicher, entsetzlich mächtiger Satz war, der alles ruinieren konnte: Carla hatte ein Kind.
Er lenkte sich ab wie in den fernen Zeiten, als er die Valdemar-Puppo-Taktik angewandt hatte, diesmal allerdings unabsichtlich. Er musste inzwischen nicht mehr an den Weltfrieden oder die Sphärenmusik denken, an Magnetfelder oder die Romane von Mariano Latorre, seit Jahren schon konnte er sich die Zeit sorglos einteilen, und doch spürte er ungewollte Vorboten, die die Gegenwart nicht wirklich rückgängig machten, denn Ansturm und Stöhnen gingen weiter, und sein Penis fühlte sich noch genauso hart an; aber zugleich erschien vor ihm das Bild eines Strandes, auf dem er mit Sonnenschirm voranging und Sandburgen baute, sogar Kuchenbrötchen und Eis für Carlas Sohn kaufte, ihm Schwimmen beibrachte, ein gesichtsloses Kind, das gleich darauf in einem bunten Zimmer auftauchte, wo es tief und fest schlief, während Gonzalo zahllos verstreutes Spielzeug vom Boden aufsammelte.
Sie vögelten weiter, während er sich vorstellte, dass Carlas Sohn furchtbar ungezogen war, auf niemanden hörte, schlechte Noten bekam, mürrisch und frech war, häufig ausflippte und zu ihm sagte: Du bist nicht mein Papa. Er sah sich in einem allzu hellen Wohnzimmer, wo Carla darauf wartete, dass der gesichtslose Junge endlich aufhörte, mit den Cornflakes zu spielen, und zu Ende frühstückte, und dann hasteten sie alle drei zur U-Bahn, der Junge ließ die Hand seiner Mutter los, blieb mal zurück, lief mal voraus, in seinem eigenen Rhythmus, bis die drei in die Menge im Waggon eintauchten, und als Carla und der Junge ausstiegen, fuhr er noch ein paar Stationen weiter und legte allein im Laufschritt noch eine Strecke von mehreren Blocks zurück, damit er rechtzeitig bei einer erbärmlichen Arbeit erschien, der schlimmstmöglichen, einer ungeliebten Arbeit, an die er sich klammern musste, weil er einen Sohn hatte, weil er einen Sohn hatte, weil er einen Sohn hatte, der nicht einmal sein Sohn war.
Carla bekam einen weiteren Orgasmus und sank erschöpft und befriedigt zurück. Er dagegen hatte noch nicht ejakuliert und spürte, dass seine Erektion gleich nachlassen würde, doch Carla sollte es nicht merken, weshalb er nach einer kurzen Pause zwischen ihre Beine zurückkehrte und sich nur darauf zu konzentrieren versuchte, ihr Lust zu bereiten, und unwillkürlich suchte ihn dabei eine andere Szene heim, nun auf einem Platz, auf dem er mit Carlas gesichtslosem Sohn Fußball spielte. Eine typisch männliche Vorstellung: Vater und Sohn oder jemand, der sein Sohn zu sein scheint, auf einem Platz beim Fußballspielen. Der Sohn bemüht sich, doch der Ball springt in jede beliebige Richtung, der Vater jubelt über die angeblichen Fortschritte, sendet positive Signale aus; das Kind hat kein einziges Tor geschossen, könnte gar kein Tor schießen, das Kind hat noch keinen Begriff von einem Tor, und dennoch sagt, schreit oder verkündet der Vater, das Kind habe soeben ein Tor geschossen, und jubelt hemmungslos. Der Vater zeigt ihm mit sanfter Autorität, wie man den Ball richtig tritt, denn der Vater kennt sich aus. Der Vater lässt es gewinnen, denn ein guter Vater muss sein Kind gewinnen lassen. Vatersein besteht darin, sein Kind gewinnen zu lassen, bis der Tag der echten Niederlage kommt.