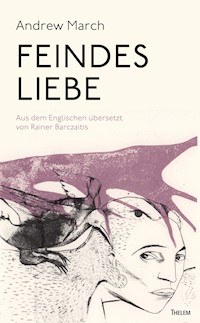
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Thelem / w.e.b Universitätsverlag und Buchhandel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dresden, September 1936. Fred Clayton, brillanter junger Student der Universität Cambridge, steht vor einer Klasse der Kreuzschule, sein Jahr als Englischlehrer beginnt. Was bringt ihn nach Deutschland? Was wird er in Dresden erleben? Fred hat den Aufstieg des Nationalsozialismus mit wachsendem Schrecken verfolgt und will erfahren, wie es in Deutschland zugeht. Das Jahr in Dresden wird seinem Leben einen Stempel aufdrücken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Alicia, Isabelle und Ben
Seid Brückenbauer und wagt zu lieben.
Inhalt
Vorwort
Prolog: Albträume in Indien
TEIL I: Fred 1931-1939 Brüchiger Friede
Erstes Kapitel: 1931-1936 Von Liverpool nach Cambridge und Wien
Zweites Kapitel: Herbst 1936 Ankunft in Dresden
Drittes Kapitel: 1936-1937 Politische Diskussionen
Viertes Kapitel: 1937-1939 Wieder zu Hause
TEIL II: Fred 1939-1946 Vom Widersinn des Krieges
Fünftes Kapitel: 1939-1941 Kriegsausbruch
Sechstes Kapitel: 1941-1942 Indienfahrt
Siebtes Kapitel: 1942 -1944 Wüstes Land Indien
Achtes Kapitel: 1945 Zerrüttet in Indien
Neuntes Kapitel: 1946 Zusammenbruch
TEIL III: Rike 1939-1946 Vom Leben und vom Sterben
Zehntes Kapitel Kindheit und frühe Jugend
Elftes Kapitel Neue Schicksalsschläge
TEIL IV: Fred und Rike 1946-1948 Die Glut in der Asche
Zwölftes Kapitel: 1946 Ein Briefwechsel beginnt
Dreizehntes Kapitel: 1947 Pläne reifen
Vierzehntes Kapitel: 1947 Nicht so einfach
Fünfzehntes Kapitel: 1947-1948 Zu neuen Ufern
Sechzehntes Kapitel: 1948 Papierkrieg in Berlin
Siebzehntes Kapitel: 1948 Und neues Leben blüht
Epilog Juli 2000
ANHANG
Nachwort des Autors
Anmerkungen des Übersetzers
Danksagung des Übersetzers
Ausgewählte Quellen
Bildnachweise
Vorwort
Seit den finsteren Zeiten des Zweiten Weltkriegs liegt Dresden den Menschen in Coventry am Herzen. Nicht allein, dass uns schreckliche Erfahrungen in der Vergangenheit gemeinsam sind, wir haben diese Erfahrungen auch in Zukunftshoffnung verwandelt, rufen zur Versöhnung auf und leben im Geist des Friedens und des gegenseitigen Vertrauens.
Der junge Fred Clayton, klassischer Philologe und frischgebackener Absolvent der Universität Cambridge, tat das schon weit vor uns. Mitte der 1930er Jahre war er bemüht, Brücken zwischen England und Deutschland zu errichten – gerade noch rechtzeitig, wie wir heute wissen. Als später der Gedanke Brücken zu bauen wieder aktuell wurde, war unermesslicher Schaden eingetreten, unzählige Menschen hatten ihr Leben verloren, die Frauenkirche in Dresden und die Kathedrale von Coventry lagen in Schutt und Asche.
Andy March lässt uns in seiner Erzählung von Freundschaft, von Begegnung von Kulturen und von Liebe die prophetische, ja visionäre Stimme Fred Claytons vernehmen, mitten in einem Europa, das wie ein Schlafwandler auf dem Weg in den Krieg war – wir wissen das heute, aber Fred Clayton war es schon damals klar. 1936 macht er sich nach Dresden auf ›mit der vagen Vorstellung, er könnte vielleicht Brücken bauen‹. Bei Kriegsausbruch 1939 geht ihm durch den Kopf, dass ›die Brücken, die er gebaut hatte, nun der Zerstörung anheimfallen mussten‹.
Am Ende sollten Freds Brücken dem Trauma und dem Hass des Krieges auf eine Weise standhalten, die er, und wir als Leserinnen und Leser mit ihm, wohl nie erwartet hätten. Sein Kampf gegen die Ungeheuerlichkeit von Krieg und Zerstörung bringt ihn zu der Erkenntnis, dass Liebe und Hass ganz verschiedenen, kategoriell unterschiedlichen Ebenen angehören. Sie stehen nicht auf herkömmliche Weise miteinander im Wettbewerb, so, wie etwa zwei Gegner ihre Kräfte messen und einer den anderen aus dem Feld zu schlagen sucht. Und damit wird eines deutlich: Wo unter Menschen Liebe und Freundschaft herrscht, wo man, in Freds Worten, »emotional verbunden« ist mit den Menschen, die man hassen soll, dort wird der Irrsinn von Krieg und Hass als etwas Bösem sichtbar, etwas, das sinnlos ist und verderbt. Es bietet für das, was die Menschheit bedarf, keine Lösung. Am Ende siegt bei Fred die Liebe. Entscheidend ist dabei aber: Die Liebe war nie ein Mittel im Kampf. Die Liebe siegt gerade deshalb, weil sie sich stets dem Einfluss des Hasses entzieht. Darin liegt die Botschaft des »liebet eure Feinde«.
Ich durfte Dresden viele Male besuchen. Immer wieder am jährlichen Gedenken an die Zerstörung Dresdens teilzunehmen, und dies in Gegenwart von Überlebenden der entsetzlichen Nacht des 13. Februar 1945, gehört zu den bewegendsten Erfahrungen in meinem Leben. 2015 begleitete mich Andy March als Gemeindepfarrer von Coventry am siebzigsten Jahrestag der Bombardierung. Ich war tief berührt, als ich miterlebte, wie Andy in Dresden von den Spuren seines Großvaters erzählte und nahm tiefen Anteil, als er sich mit dessen außergewöhnlicher Lebensgeschichte beschäftigte, die auch eine Geschichte der Liebe ist, der Liebe zwischen Fred und Andys Großmutter Rike, deren Heimatstadt Dresden war.
Zu meiner großen Freude hat Andy jetzt die Ergebnisse seiner sehr persönlichen Auseinandersetzung mit seiner Familiengeschichte als Buch veröffentlicht. Es ist ihm gelungen, Freds Geisteshaltung, seine Aufrichtigkeit und seine reiche Gedankenwelt einzufangen, seine Reaktion auf die furchtbare Welle der Gewalt, in der Europa in den 1930er und 1940er Jahren unterzugehen drohte. Im Mittelpunkt der Erzählung stehen jedoch nicht Ideologie oder Politik, den Mittelpunkt bilden Menschen, Orte, bedeutungsvolle Begegnungen und die sorgsame Pflege von Freundschaften. Es ist eine Entwicklung, die Fred enormen Mut abverlangt, wenn er im Deutschland der 1930er Jahre offen eine gefährliche Ideologie attackiert, wenn er Kindern aus dem nationalsozialistischen Herrschaftsgebiet Zuflucht zu geben bemüht ist, und wenn er nach der Bombardierung Dresdens erkennen muss, dass »auf unserer Seite Barbarei ebenso wie auf ihrer über Toleranz gesiegt hat«. Mit den Worten des Gebets, das im Zentrum des Friedens- und Versöhnungsdienstes der Kathedrale von Coventry steht: Wir alle müssen sagen, »Vater, vergib«. Und um Bonhoeffer zu zitieren, ein Friede wie der Freds »muss gewagt werden«.
Bedeutungsvolle Verbindungen zu pflegen, uns der Wunden bewusst zu bleiben und sie, wenn die Zeit da ist, mit Gottes Gnade zu heilen, ist der Mittelpunkt der Mission von Coventry. Natürlich leben wir heute in einer anderen Welt; aus dem Buch wird deutlich, wie sehr sich unsere Art zu reisen und miteinander zu kommunizieren seither verändert hat. Aber ebenso wie Freds Brücken die schweren Stürme seiner Zeit überstanden, so wird seine Geschichte den Test der Zeit bestehen. Mein Wunsch ist, dass diese Erzählung von Andy March alle, die sie lesen, so inspiriert, wie sie mich inspiriert hat, als Wegweiser und Wahrzeichen auf dem Pfad der Versöhnung, des Vertrauens und der Liebe, der Coventry mit Dresden und Großbritannien mit Deutschland verbindet.
Rt Reverend Dr. Christopher Cocksworth, Bischof von Coventry
Prolog: Albträume in Indien
Der Nachthimmel war blutrot vom Widerschein hunderter Feuer. Die Stadt brannte, ein entsetzlicher Feuersturm. Unaufhörlich detonierten die Bomben. Durch das Brausen der Flammen konnte er die verzweifelten Schreie der flüchtenden Menschen hören, wie sie in den engen Straßen, die zu Todesfallen geworden waren, nach ihren Kindern riefen. Die Gluthitze sengte seine Haut, Geruch von verbranntem Fleisch erfüllte die Luft.
»Ist was mit dir, Clayton?« Die Stimme kam von dem Bett an der Wand gegenüber, sie klang besorgt.
Fred fuhr hoch, schweißgebadet. Er brauchte einen Moment, bis er sich zurechtfand. Ja, es war Krieg, er war in Indien, einquartiert in einer beschlagnahmten Villa zusammen mit anderen Offizieren seiner Einheit. Tausende Meilen fort von zu Hause, von Dresden und von den Menschen, die er dort liebgewonnen hatte.
»Clayton« – die Stimme war jetzt dringender – »Clayton, was ist mit dir los?«
»Ach, nichts, entschuldige«, stotterte Fred. »Es war ein Albtraum, nichts weiter«.
»Dann nimm dich zusammen, ja? Du hast einen derartigen Rabatz gemacht, bestimmt ist die halbe Belegschaft davon aufgewacht!«
»Ja, tut mir wirklich leid. Soll nicht wieder vorkommen.«
Aber es war immer derselbe Albtraum, Nacht für Nacht. Dresden ging in Flammen auf und all die Jungen der Kreuzschule kamen um.
TEIL I: Fred 1931-1939 Brüchiger Friede
Erstes Kapitel: 1931-1936 Von Liverpool nach Cambridge und Wien
Fred erhält ein Stipendium, studiert am King’s College der Universität Cambridge, fährt nach Wien und entschließt sich, ein Jahr in Dresden Englisch zu unterrichten.
Wir schreiben das Jahr 1934. Im altehrwürdigen King’s College der Universität Cambridge schreibt Frederick William Clayton seine Abschlussarbeit im Bereich klassische Philologie. Mit seinen zwanzig Jahren ist er ein Jahr jünger als die anderen seines Jahrgangs, eine knabenhaft zierliche Gestalt, klare blaue Augen unter einer pechschwarzen Haartolle. Im Mai ist er fertig und gibt ab, die Arbeit wird ihm ein Forschungsstipendium verschaffen, aber das weiß er jetzt noch nicht. Dagegen weiß er genau, was er als nächstes tun will, bevor im Herbst dann das Master-Studium anfängt. Wir sehen ihn wie er die Rasenflächen im College umrundet, er blättert in einem Lehrbuch der deutschen Sprache, das auf einem Deutsch-Wörterbuch in der Armbeuge balanciert. Fred wird die Gelegenheit ergreifen, sich mit einer anderen Sprache und Kultur zu beschäftigen, neue Welten zu entdecken, die Werke Goethes, Hegels, Schleiermachers und anderer im Original zu lesen. Das wird ihm auch eine Gelegenheit geben, diese neue Bewegung kennenzulernen, die politischen Umwälzungen besser zu verstehen, die sich wie ein Flächenbrand in Deutschland verbreiten. Er ahnt nicht, dass dieser Entschluss sein Leben entscheidend prägen wird.
Fred hatte sein Studium am King’s College im Jahr 1931 aufgenommen, einem Jahr wachsender politischer Spannungen in einer Welt, die noch unter den Folgen des Ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise von 1929 litt. In Deutschland war die Niederlage im Weltkrieg immer noch eine offene Wunde und es gab jede Menge Schuldzuweisungen. Das war eine der Ursachen für den Aufstieg von Adolf Hitler, der versprach, der deutschen Nation ihre Würde zurückzugeben. Gleichzeitig erhob sich im Osten ein scharlachrotes Tier und das sowjetische Russland erklärte, es habe als einziges Land der Welt die Kriegstreiber verjagt, die den ersten Weltkrieg zu verantworten hätten. Man konnte diesen Themen nicht ausweichen, nicht in den Debattierclubs von Oxford und Cambridge, nicht bei den gemeinsamen Mahlzeiten im College, nicht bei der traditionellen Tasse Tee in den Aufenthaltsräumen der Dozenten. Überall gab es heiße Diskussionen über Nationalsozialismus und Kommunismus und darüber, was ihr Aufstieg bedeutete. Bei einer ihrer berühmten öffentlichen Debatten sorgte im Februar 1933 die »Oxford Union« mit dem Antrag für Aufsehen, »nie mehr für König und Vaterland ins Feld zu ziehen« – er bekam eine Mehrheit, was in der konservativen Presse mit wütenden Schlagzeilen wie »TREULOSES OXFORD: KNIEFALL VOR DEN ROTEN« quittiert wurde. Auch in Cambridge wandte sich eine erhebliche Anzahl von Angehörigen der Universität dem Kommunismus zu und sah in ihm den einzigen Garanten für den Frieden.
Fred beteiligte sich mit Verve an diesen Debatten. Dabei spürte er immer wieder einen Unterschied: Er kam aus einfachen Verhältnissen und war nicht wie seine Mitstudenten im King’s oder in den anderen Colleges auf eine der teuren Privatschulen wie Eton gegangen. Seine Kindheit hatte er in einem Reihenhaus in einem Vorort von Liverpool verbracht, zur Schule gegangen war er in einem staatlichen Gymnasium. Während seine Kommilitonen meist aus wohlhabenden Familien stammten, war sein Vater William Rektor an einer kleinen Dorfschule bei Liverpool, seine Mutter Gertrud war Hausfrau und in der Verwandtschaft gab es Briefträger und kleine Ladenbesitzer – von Reichtum war keine Rede. Freds älterer Bruder Don hatte seine eigenen Träume von einem Studium begraben müssen, die Eltern waren einfach nicht der Lage, das Geld für zwei Jungen an der Universität gleichzeitig aufzubringen; Don arbeitete nun bei einer Versicherungsgesellschaft. All das konnte Fred überspielen und so tun, als sei er gar nicht so anders, aber sobald er den Mund aufmachte, war es damit vorbei: Sein breiter Liverpooler Akzent verriet ihn sofort als jemanden, der alles andere als aus der Oberschicht kam. Am King’s College war er damit sofort aufgefallen, so etwas wie ihn hatten sie dort noch nicht gehabt und er war, so hatte er das Gefühl, Zielscheibe des Spotts, den der Dialekt von Liverpool oft auf sich zog. Am Anfang hatte er sich unwohl gefühlt, immer wieder sprach jemand ihn auf seinen nordenglischen Tonfall an und ließ ihn merken, dass er »anders« war, selbst wenn es gut gemeint war. Einmal schlug ihm sogar jemand vor, er solle doch seinen Namen ändern, mit Fred sei man im King’s College fehl am Platze, Francis sei viel besser, oder Hilary (aber das waren doch Mädchennamen, oder?).
Er erlebte die Zeit seines Studiums wie einen Rausch, in gesellschaftlicher Hinsicht ebenso wie in akademischer. Das anfängliche Gefühl, nicht »dazu zu gehören«, verschwand rasch angesichts einer allseitigen Bewunderung ob seiner Brillanz als Student, zumal angesichts seins Alters. Bald standen ihm die Türen zu den inneren Zirkeln der akademischen Welt offen und er fand Freunde, denen er sich anschloss. Einladungen bei der geistigen Elite folgten, Fred speiste bei dem weltberühmten Maynard Keynes und in Gesellschaft literarischer Größen wie E.M. Forster und T.S. Eliot. Keynes, der wie Fred dem King’s College angehörte, lud ihn mehrmals zu Lunch und Dinner ein, er hatte seine Wohnung am Webb’s Court, die Wände waren halbhoch eichengetäfelt, darüber stellten acht großartige Wandbilder von Duncan Grant und Vanessa Bell die Musen der Künste und der Wissenschaften dar. Fred war selbst kein großer Kunstkenner, wusste aber, dass Keynes einer war und war klug genug, ihn nach den Bildern zu fragen, die Keynes selbst in Auftrag gegeben hatte. Bei der zweiten Einladung zum Lunch saß Fred am Tisch zusammen mit Basil Willey, der am Pembroke College englische Literatur lehrte, und T.S. Eliot. Fred war sehr gespannt auf die Gesellschaft eines so berühmten Dichters gewesen, wurde aber enttäuscht: Eliot sagte keine zwei Sätze. Das kam ihm etwas seltsam vor, später erfuhr er, dass dies bei Eliot nicht selten vorkam. Die Atmosphäre beim Essen wurde zunehmend unangenehm und Willey machte sich bald aus dem Staub. Auf der verzweifelten Suche nach einem Gesprächsgegenstand erkundigte Keynes sich nach dem Thema von Freds Abschlussarbeit, und zur allgemeinen Erleichterung sorgte nun Fred für Unterhaltung, indem er begeistert von seinem Untersuchungsgegenstand erzählte.
Später würde er sich fragen: ›Warum bin ich im King’s so gut angekommen? Weil ich so ungewohnt war – so naiv und dabei so vielversprechend?‹ Er versuchte nie, seine Herkunft zu verleugnen, entwickelte eine heiter-kritische Sicht auf die snobistische englische Klassengesellschaft und konnte über die naiven Ansichten der Elite ebenso lachen wie über seine eigene Unerfahrenheit. Gern erzählte er später, wie er bei einem großen Dinner, das Keynes gab, zum ersten Mal vor einem Teller Austern saß. Er war sichtlich verlegen und wusste nicht, was er mit dieser wenig einladend aussehenden Delikatesse anfangen sollte, und es wurde nicht besser davon, dass Keynes ihn fragte, »also, Clayton, wie halten Sie’s: Erst bisschen kauen oder gleich schlürfen?« Das schallende Gelächter der Tischgesellschaft ließ ihn vermuten, dass hinter dieser Frage irgendeine mehr als eindeutige Anspielung steckte. Er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und konzentrierte sich auf die anstehende Aufgabe, schließlich entschied er sich für Schlürfen, so würde es jedenfalls schneller vorbei sein. Die vielen ihm zugewandten Gesichter versuchte er zu ignorieren. Später sollte er auch die spaßige Seite der Geschichte sehen – damals hatte er es nicht so lustig gefunden.
Links: Fred als Jugendlicher vor dem Eintritt ins King’s College. Rechts: Ausschnitt aus dem Photo zur Immatrikulation, Fred ist der zweite von links in der ersten Reihe. Alan Turing, mit dem Fred sich anfreunden sollte, steht oben rechts
Auf die Dauer gewöhnte er sich an die Neckereien und ließ sich nicht weiter davon stören. Etwas anderes konnte ihn dagegen richtig ärgern: Wenn Leute ihn seiner Herkunft wegen für ihre politischen Ziele vereinnahmen wollten. So war es zum Beispiel an einem Abend gewesen, als er mit seinem Freund und Kommilitonen am King’s College, Alan Turing, im Studentenclub des Trinity College bei einem Bier saß.
Der gesamte Immatrikulations-Jahrgang am King’s College, Herbst 1931
Turing hatte er beim Rudern kennengelernt. Rudern deshalb, weil Fred, obzwar keine Sportskanone, mit seiner zierlichen Gestalt einen guten Steuermann abgab, und Turing war in seinem Achter. Sie befreundeten sich rasch, sie hatten den gleichen scharfen Intellekt und waren zudem beide Außenseiter – Fred, weil er so klein war und wegen seiner Herkunft, Alan wegen seiner sexuellen Vorlieben. Fred sprach immer gerne mit anderen über ihre Ansichten und Empfindungen, er fühlte sich von Alan Turing angezogen, der stets ganz offen mit ihm über seine Homosexualität sprach und davon, was er im Internat erlebt hatte. Fred bewunderte Alan dafür, wie selbstverständlich er damit umging, denn was seine eigene Sexualität anging, war er mehr als verwirrt. Ein Dozent hatte ihn einmal einen ›ziemlich normalen heterosexuellen Mann‹ genannt, aber das entsprach so gar nicht seiner Erfahrung. Er wusste nicht, was er war, und auch wenn er sich zu Männern hingezogen fühlte, so wusste er doch, dass dieser Weg ihm versperrt war – für jemanden mit seinem gesellschaftlichen Hintergrund war es ein Tabu, zudem war es auch gegen das Gesetz. Und was es noch schlimmer machte, außer seiner Mutter hatte in seinem Leben noch nie eine Frau eine Rolle gespielt. Es schien ihm als habe er nie eine Gelegenheit gehabt, sich zu einer Frau hingezogen zu fühlen – alle Frauen, denen er begegnete, empfand er als furchteinflößende Respektspersonen, oder sie nahmen kaum Notiz von ihm, wohl weil er so klein war, in ihren Augen nur ein Junge.
Als begeisterter Leser verschlang Fred die »Sexual-psychologischen Studien« von Havelock Ellis ebenso wie die Schriften von Sigmund Freud, und auch in seinem eigenen Fach, der Literatur der Antike, machte er einschlägige Entdeckungen, von denen er Turing berichtete, der als Mathematiker selbst kaum Zugang zu Latein oder Griechisch hatte. An diesem Abend, Fred erzählte Turing gerade von seinem neuesten Fund, trat plötzlich ein Mann zu ihnen an den Tisch. Er sah blendend aus, wie ein Filmstar, trug ein gestreiftes Jackett, eine gepunktete Krawatte und ein cremegelbes Beinkleid – selbst für Cambridge war das auffällig. Der Mann nickte Turing zu und richtete seine Aufmerksamkeit auf Fred. »Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Was wollen Sie trinken? Ich nehme einen Gin Fizz, für Sie auch einen?«
»Ehm, danke – für mich ein kleines Bier bitte.«
»Soll so sein.« Der Mann schlenderte zur Bar.
»Da hat jemand ein Auge auf dich geworfen«,» murmelte Alan. «Glaub mir, ich kenn mich da aus.“
»Was redest du da?« Fred war gar nicht erbaut. »Ach hör schon auf, Alan.«
Turing zog die Augenbrauen hoch, aber bevor er etwas sagen konnte, war der Mann schon wieder zurück. »Kann ich mich zu euch setzen?« Er wartete die Antwort gar nicht erst ab, und zu Fred: »Sie sind also nicht von hier aus der Gegend.«
»Nein, ich bin aus Liverpool«.
»Liverpool? Das ist ja interessant. Ich hab mir sagen lassen, dass es dort oben schlimm zugeht. Arbeitslose zu Tausenden. Zeigt mal wieder, wie völlig bankrott das kapitalistische System ist. Ich hab davon die Schnauze längst voll, ich und eine Menge anderer Leute hier, deshalb bin ich dann auch in die Partei gegangen. Großartig bei denen. Dieses Wochenende zum Gedenken an den Waffenstillstand gibt’s eine Demonstration am Kriegerdenkmal. Kommen Sie doch einfach mit! Du bist auch dabei, Turing, oder?«
Turing nickte.
»Also, hm, ich weiß noch nicht so recht, ob ich am Wochenende Zeit habe«,“ meinte Fred.
»Ach so«, stutzte der Mann, offenbar etwas gekränkt. »Also, ich muss jetzt weg.« Er streckte Fred seine Hand hin: „Freut mich Sie kennengelernt zu haben, Herr…
»Fred Clayton.«
»Ich bin Burgess. Guy Burgess. Wir sehen uns bestimmt wieder einmal.«
Die Begegnung verwirrte Fred: Er fühlte sich erst geschmeichelt von der Aufmerksamkeit, die er erweckte, aber weshalb Burgess sich so an ihm interessiert gezeigt hatte, war ihm nicht recht klar. Mit der Zeit merkte er, dass man wegen seiner bescheidenen Herkunft einfach annahm, er würde sich natürlich auf die Seite der wachsenden kommunistischen Bewegung schlagen. Aber für Fred war das nicht so einfach – für Fred war es nie so einfach. Es ärgerte ihn maßlos, wenn Leute aus der Oberschicht, Eton-Absolventen wie Burgess, mit ihrem ganzen vornehmen Charme plötzlich anfingen, sich über die Arbeiterklasse zu verbreiten, von der sie kaum eine Ahnung hatten. Fred sah sich einer regelrechten Kampagne ausgesetzt, um ihn zu ihrer Sache zu bekehren. Aber er misstraute dem Dogmatismus, mit dem sie den Marxismus für alles und jedes als Erklärung heranzogen, und manchmal kamen ihre Ansichten ihm einfach nur albern vor. Er wurde den Verdacht nicht los, dass er für die kommunistische Partei nur als Vorzeige-Arbeiterkind interessant war, und er mochte auch ihr Vorgehen nicht. Er mochte es nicht, eingekreist zu werden.
Ein andermal saß Fred mit Alan Turing auf dem Rasen hinter dem Bodley Court, wo Turing in dem Jahr wohnte. Gerne zogen sie sich nach dem Dinner dorthin zurück, sie liebten den perfekt geschnittenen Rasen und den Blick auf die Bäume am Fluss im Schein der Abendsonne. Plötzlich ertönte hinter ihnen die wohlbekannte schneidende Stimme: »Turing, Clayton. Immer zusammen. Dachte mir, dass ihr hier seid.« Ohne eine Aufforderung abzuwarten, ließ Burgess sich nieder und fuhr fort: »Also Clayton, wenn jemand unserer kommunistischen Partei beitreten sollte, dann du – schließlich wissen wir doch Bescheid über die unterdrückte Arbeiterklasse, und wirklich, ich muss mich wundern über dich, bei deiner Herkunft…«
Bodley Court, der Lieblingsaufenthalt von Fred und Alan
Fred und Alan sahen sich entnervt an, Fred wusste gar nicht mehr, wie oft Leute wie Burgess oder Anthony Blunt, die beide später für die Sowjetunion spionieren sollten, schon versucht hatten, ihn zu rekrutieren. Bis zu diesem Tag hatte er sich auf Diskussionen mit ihnen eingelassen und ihre Avancen mit einem Lächeln zurückgewiesen, aber als Burgess seine höflichen Absagen einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollte, da riss ihm der Geduldsfaden.
Er stand vom Gras auf. »Jetzt ist aber gut, Burgess. Ich weiß ja, ihr hättet mich gern als Aushängeschild, der Junge aus der Unterschicht, und ihr redet als wüsstet ihr alles über uns arme Zurückgebliebene dort im abgehängten Norden. Ihr schwingt Reden über die Arbeiterklasse und erklärt mir, was sie erdulden muss, aber ihr habt keinen blassen Schimmer. Ich glaube, ihr seid noch nie einem richtigen Arbeiter begegnet – und ich bin ja eigentlich auch keiner. Für euch ist der Kommunismus der einzige Garant des Weltfriedens, aber ihr wollt nicht sehen, wie grausam in Russland die Gegner von Stalin und seiner Korona behandelt werden – wer nicht linientreu ist, für den bleibt nur das Grab. Offen gesagt, mir steht es bis hier. Ich trete eurem Verein nicht bei, jetzt nicht und in Zukunft nicht.«
Fred warf einen Blick auf Turing, der ein Grinsen kaum unterdrücken konnte. »Bis später, Alan, ich geh auf mein Zimmer.« Er rauschte ab und ließ einen konsternierten Burgess zurück, dem es dieses eine Mal tatsächlich die Sprache verschlagen hatte.
Auch wenn Fred hier kein Interesse gezeigt hatte, so war er doch ein durch und durch politischer Mensch. Er war überzeugter Pazifist, wollte sich jedoch nicht auf eine politische Linie festlegen – er wollte sich nicht einengen lassen. So misstraute er auch dem Nationalstereotyp, das alle Deutschen als Bösewichte darstellte; er war überhaupt streitbar und es fehlte ihm nie an dem Mut, in politischen Debatten seine eigenen Ansichten in die Waagschale zu werfen, auch wenn das zu Kontroversen führte. So war es auch, als er zum Herausgeber der Wochenschrift »Cambridge Review« ernannt wurde – dem jüngsten in der Geschichte der bedeutenden Zeitschrift und dem ersten, der auf einem staatlichen Gymnasium gewesen war, nicht auf einer Privatschule. Fred fand die Zeitschrift ziemlich grau und langweilig und nahm sich vor, sie aufzumischen. Das gelang ihm ausgezeichnet, aber er litt Höllenqualen dabei. Er las nie noch einmal durch, was er gerade geschrieben hatte, hoffte einfach, dass es gut sein würde, und machte sich direkt an die nächste Ausgabe. Zugleich gab er sich alle Mühe mit der Abschlussarbeit, um sich seines Stipendiums würdig zu zeigen.
Als Herausgeber kümmerte er sich um die üblichen Besprechungen von Theateraufführungen und Neuerscheinungen, ließ aber auch die Gelegenheit nicht aus, Aufmerksamkeit auf die politischen Debatten zu lenken, in die er selbst verwickelt war, und schrieb Artikel, die den Marxismus erst kritisierten, dann wieder verteidigten. Seine eigenen Erfahrungen hielt er im Februar 1935 in einem satirischen Beitrag fest, »Gespräche mit Kommunisten«. Darin spielte er darauf an, wie jede Unterhaltung mit Kommunisten, ganz gleich, worum es ging, stets beim Klassenkampf endete. Der Artikel schlägt ein neues Gesellschaftsspiel vor:
Stellen Sie sich als Ziel des Spiels vor, dass ein Gespräch nicht irgendwie in Gang gehalten wird, wie in herkömmlichen Unterhaltungen, dass es vielmehr so bald wie möglich den Gang in Richtung Klassenkampf einschlägt. Ein Spieler kann, was das Spiel anbetrifft, einen Punkt machen, sobald er den Klassenkampf ganz unverhohlen aufs Tapet bringt. Ich sage »was das Spiel anbetrifft«, denn es ist fraglich, ob der Klassenkampf sonst etwas anbetrifft.
Der Artikel gibt dann Ratschläge, wie man in dem Spiel erfolgreich sein kann, zum Schluss heißt es:
Wie zynisch man werden darf, ist eine schwierige Frage. Ich würde es als Regelverstoß ansehen, wenn jemand ruft, »Die Massen können mich mal!«. Mancher Beteiligte meint aber auch, in diesem Spiel sei einfach alles erlaubt. Meiner persönlichen Ansicht nach sollte ein derartiger Schlag unter die Gürtellinie nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn der Gegner mit »Tatsachen« droht. Aber selbst dann, sei mir erlaubt zu sagen, und ich meine es, wie ich es sage, selbst dann halte ich das für absolut geschmacklos.
Fred wusste, dass er in ein Wespennest stach, und er legte zwei Wochen später noch eins drauf, als er Leserbriefe zu dem Thema veröffentlichte sowie einen Artikel, in dem der Kommunismus verteidigt und er selbst kritisiert wurde:
Allein, ein nachdenklicher und intelligenter Autor wie F.C. muss merken, was er da alles ablehnt. Er sagt doch praktisch: Es ist mir egal, dass der größere Teil der Menschheit leidet und unterdrückt wird, ich lehne es ab, mich dafür zu interessieren und ich lache nur darüber, dass es irgendjemanden interessieren könnte, es hat nicht den geringsten Einfluss darauf, was ich denke oder tue.
Dieselbe Nummer des Cambridge Review veröffentlichte einen Artikel zu einem bevorstehenden Besuch des Führers der englischen Faschisten, Sir Oswald Mosley, in Cambridge, der bei einem Dinner der British Union of Fascists an der Universität zugegen sein würde. Der Artikel warnte vor den Gefahren des Faschismus für Großbritannien mit diesen Worten:
Wir müssen wohl kaum darauf hinweisen, welche Katastrophe es für die englische Kultur bedeuten würde, sollte der Faschismus hier die Oberhand gewinnen. In einem faschistischen Staat hat die kulturelle Avantgarde keinen Platz. Er kann wissenschaftliche Neuerungen nicht nutzen. Er will keine hochqualifizierten, kritischen Köpfe, er will Muskelprotze, die stumpfsinnig seinen Befehlen folgen und in seinen Kriegen kämpfen, ohne kritische Fragen zu stellen.
Bisher ist der Faschismus nur eine kleine Wolke am Horizont, kaum handtellergroß. Aber in Zeiten von Unruhe und Krisen kann eine solche Wolke unversehens anschwellen und alles verdunkeln. Alle, denen die Kultur am Herzen liegt, alle, die sich um die Zukunft von Cambridge sorgen und allem, wofür Cambridge steht, sollten diese Warnung ernst nehmen.
Diese Artikel im Cambridge Review waren eine Provokation für alle in den Colleges, für die kommunistischen ebenso wie die faschistischen Studenten und auch für diejenigen unter den Dozenten, die von dem Sturm ungewöhnlich radikaler Ansichten, der sich in der Universität zusammenbraute, noch nichts bemerkt hatten. Anfänglich machte es ihm Spaß, sich das Stirnrunzeln der Dozenten vorzustellen, wie sie beim Nachmittagstee über die Artikel sprachen, aber das änderte sich rasch, als ihm klar wurde: Er war zu weit gegangen – am Ende seiner Herausgeberschaft hatte er es mit beiden Seiten verdorben und sah sich auch noch mit einer Klage wegen übler Nachrede konfrontiert.
Zu Hause in Liverpool sorgte er auch für Aufregung, als er, auch wenn ihm die Knie dabei zitterten, seinem Vater eröffnete, er sei Pazifist. Der Vater hatte wie so viele im Ersten Weltkrieg gekämpft, als nun sein Sohn erklärte, »Du hast keine Ahnung von den Deutschen. Euer Krieg war sinnlos«, schoss er umgehend zurück: »Du wirst noch an mich denken, mein Sohn, wenn du merkst, wie die Deutschen wirklich sind, diese Hunnen.«
Es war typisch Fred, dass ihn diese Ermahnung seines Vaters nur noch mehr darin bestärkte, Deutsch zu lernen. Oh ja, er würde »diese Hunnen« kennenlernen und seinem Vater zeigen, wie sie wirklich waren. Also nahm er sich vor, 1935 die langen Ferien zu nutzen, um sein Deutsch zu verbessern und die Wahrheit über die Deutschen herauszufinden. All die Bücher, die er gelesen hatte, konnten das eigene Erleben nicht ersetzen, er musste ganz in die Sprache und Kultur eintauchen. Ein glücklicher Zufall kam ihm zu Hilfe: Einer seiner Freunde kannte jemanden in Wien, der ihn für ein, zwei Tage bei sich unterbringen würde, während er sich nach einer Bleibe umsah. Das war doch wunderbar: Er hatte eine erste Anlaufstelle in einer Stadt, die als Kulturstadt ebenso berühmt war wie für ihre Schönheit. Auf nach Wien!
Fred und sein Jahrgang am King’s College bei der Graduierung 1934. Im Ausschnitt sieht man Fred in der zweiten Reihe, zweiter von links; Alan Turing ist der zweite von rechts in der ersten Reihe
***
So kam Fred Ende April 1935 in Wien an. Seine erste Sorge war, sich nach einer Unterkunft umzusehen – bei dem Bekannten seines Freundes, wo er die erste Nacht verbrachte, war es doch recht eng und unbequem gewesen. Und er hatte Glück: Ganz in der Nähe und mitten im Stadtzentrum, so erfuhr er, wohnte eine Frau namens Helene Schneider, die vielleicht ein Fremdenzimmer vermieten würde. Frau Schneider, eine Jüdin, war vor kurzem Witwe geworden und wohnte nun allein mit ihren beiden Söhnen Robert und Karl; wahrscheinlich konnte sie etwas Geld von einem Untermieter gut gebrauchen.
Am Tag nach seiner Ankunft macht sich Fred also auf den Weg in die Weihburggasse, wo Frau Schneider wohnen sollte. Es war der Erste Mai 1935, überall in der österreichischen Hauptstadt hingen weiß-rote Fahnen, die Stadt und der ganze Staat betonten damit ihre Souveränität und Unabhängigkeit. Aber noch wirkte das politische Chaos des Jahres 1934 nach, als Nationalsozialisten mit der Ermordung des österreichischen Kanzlers Dollfuß einen Staatsstreich zu inszenieren versucht hatten. Die Armee hatte den Aufstand niedergeschlagen und der Regierung Rückhalt gegeben, aber immer noch lag Spannung in der Luft, Hitlers Schatten lag schwer auf dem Land. Fred fragte sich, ob trotzig flatternde Fahnen reichen würden, Hitler in Zaum zu halten. Die Straßen waren voller Menschen, es war wie bei einem Fußballspiel. Fred drängte sich durch die Feiernden zur Weihburggasse, die er nach einigem Suchen auch fand. Und ehe er es sich versah, war er schon in die Wohnung hereingebeten und fühlte sich wie ein Gast des Hauses. Vielleicht war es das Neue daran, einen Ausländer beherbergen zu können, weshalb sie ihm so bereitwillig ein Zimmer überließen.
In den folgenden Wochen verbrachte Fred mehr und mehr Zeit mit Helene Schneider und den Jungen, bald hatte er das Gefühl, er gehöre zur Familie. Als er erfuhr, dass der Vater Selbstmord begangen hatte, empfand Fred eine noch tiefere Verbundenheit – warum, war ihm selbst nicht ganz klar. Helene und die Jungen sprachen nicht viel über die Tragödie in ihrem Leben, er wusste nicht, wann dieser Schlag sie ereilt hatte oder wie lange und wie tief sie um ihn getrauert hatten. Aber eines war klar: Der Vater fehlte in der Familie, und Fred stellte zu seiner Überraschung und Freude fest, dass er hier einen Platz ausfüllte.
Er merkte auch, dass die Familie einen Platz in seinem eigenen Leben ausfüllte. Fred sehnte sich nach liebevoller Zuneigung, er war des gesellschaftlichen Lebens in Cambridge überdrüssig, wo man die meiste Zeit eine Fassade aufrechterhalten und vornehm tun musste. Er war überall stets der jüngste gewesen, in der Schule und dann auch im College war er immer eine Art Nesthäkchen – er wollte doch auch einmal jemand sein, zu dem man aufblickte, der gebraucht wurde. Sogar sein neun Jahre jüngerer Bruder George war selbstbewusster und hatte es nie nötig gehabt, seinen großen Bruder um Hilfe anzugehen. Helenes Sohn Karl dagegen, ein kleiner, schmächtiger Zehnjähriger, sah in ihm eine Vaterfigur. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte Fred das Gefühl, dass jemand ihn brauchte und ihn bewunderte, und er genoss das. Er mochte den Jungen und aus der Zuneigung erwuchs Liebe.
Einmal, Fred war schon ein paar Wochen in Wien, nahm Karl ihn mit zu einem Fußballspiel. Fred murrte zwar, Fußball gehöre doch in den Winter, nicht an einen heißen Junisamstag, aber er ging mit und es sollte eine unerwartete Erfahrung werden. Es war sein erstes Match und obwohl er nicht gerade ein Fußball-Fan war, konnte er sich der Faszination der rhythmischen Schlachtrufe nicht entziehen. Er spürte, wie sein Blut in Wallung geriet und schließlich schrie er genau so laut wie die Österreicher um ihn herum. Zum ersten Mal spürte er, was Massenhysterie war.
Die Zeit verging wie im Fluge und ehe Fred es sich versah, musste er wieder zurück nach Cambridge. Er war nicht lang in Wien gewesen, aber Helene und ihre Jungen waren ihm ans Herz gewachsen. Kaum zurück in England, schmiedete er schon Pläne für einen zweiten, kürzeren Aufenthalt in Wien im Frühjahr 1936, unter dem Vorwand, er müsse seine Deutschkenntnisse verbessern. In Wahrheit wollte er die Schneiders wiedersehen, vor allem Karl. Er war sich über die Gefühle nicht ganz im Klaren, die in ihm aufkamen und deren er sich nicht erwehren konnte. Er konnte einfach nicht unbeteiligt bleiben.
Gegen Ende seines zweiten Besuchs in Wien machten die drei zusammen einen Abendspaziergang. Karl kickte ein Steinchen den Weg entlang, er konnte mit der Unterhaltung der beiden Erwachsenen nichts anfangen. Nach einer Weile murrte er »Das hat doch alles keinen Zweck«. »Ach, Karl«, sagte seine Mutter mit einem müden Lächeln, »das ganze Leben hat keinen Zweck, aber wir leben trotzdem alle gerne.« Und Fred dachte daran, wie diese Familie seinem Leben ganz unerwartet einen Zweck gegeben, ihn die Freude am Leben gelehrt hatte.
Nach seiner Rückkehr aus Wien blieb Fred mit Karl im Kontakt, sie schrieben sich Briefe und er schickte ihm ein Geschenk zum Geburtstag. Er hatte ein Foto von Karl mit nach Cambridge gebracht, das gut sichtbar auf seinem Schreibtisch stand. Einmal kam ein Freund herein, sah das Foto und meinte: »Sieht gut aus, der Junge. Aber geht das nicht in Richtung Kindesmissbrauch? Zehn? Fast elf? Ist vielleicht bei deinen klassischen Griechen in Ordnung, aber heute ist das nicht mehr angesagt, was, alter Junge?«
»Jetzt werd nicht eklig«,» knurrte Fred. «Der Bub bekommt gerne Post und ich kann dabei Deutsch üben. Weiter ist da nichts, komm mir nicht mit deinen Geschichten aus dem Internat!“ Sein Freund warf ihm einen skeptischen Blick zu. Aber Fred konnte an seinen Empfindungen für diesen Jungen nichts Schlechtes oder Falsches finden. Gut, in seinen Gefühlen herrschte Wirrwarr, aber über eines gab es keinen Zweifel: Seit seiner Rückkehr aus Wien war ihm deutlicher bewusst als je, wie gerne er Vater wäre – und er würde einen guten Vater abgeben, da war er sich sicher.
Im Juli 1936 – soeben war in Spanien der Bürgerkrieg ausgebrochen – erhielt Fred eine Nachricht von Helene. Sie führte mit ihrer Schwester zusammen in Wien ein Hutgeschäft und sie trugen sich mit dem Gedanken auszuwandern, nach London, oder Liverpool, oder auch nach Dublin. Das Geschäft in Wien lief schlecht und sie baten um Auskunft darüber, was die Aussichten für einen solchen Schritt wären. In seiner Antwort riet Fred ihnen eher davon ab, er wusste um die Schwierigkeiten für Einwanderer, gerade für Flüchtlinge aus Deutschland: Es gab kaum offene Stellen, eine Arbeitserlaubnis war schwer zu bekommen, und sich an das Leben in England zu gewöhnen war nicht so einfach. Die aus der gewohnten Umgebung herausgerissenen Jungen würden sich in ihrem neuen Leben nicht ohne Weiteres zurechtfinden; überdies kannte er auch deutsche Juden, die in ihrer Wahlheimat nicht eben glücklich waren, weil sie auch hier mit Antisemitismus zu kämpfen hatten. Und außerdem, schrieb er, sei es ja nicht dringend, falls es wirklich einmal nötig würde, hätten sie immer noch Zeit genug. Zwar erinnerte er sich an den Antisemitismus, der ihm in Österreich begegnet war – Helene kannte das und war es gewöhnt – aber er vertraute doch darauf, dass der Frieden in Österreich halten würde. Nein, Helene und ihre Kinder taten besser daran, in Österreich zu bleiben, dessen war er sich sicher.
Bald darauf schlief der Briefwechsel mit Karl und Helene ein, aber was er in Wien erlebt hatte, hatte in ihm etwas wie eine Obsession geweckt: Einen tiefen und wachsenden Abscheu gegenüber Hitler. Er hatte in Wien »Mein Kampf« gelesen – was die meisten Nazis, deren Bibel es doch war, nicht von sich sagen konnten – und das Buch war ihm ziemlich unverdaulich vorgekommen, er fand es von Anfang bis Ende einfach nur Schrott. Mit seinen 21 Jahren kam er, vielleicht in jugendlichem Ungestüm, zu diesem Schluss: Hitler war ein Schwachkopf, ein Wahnsinniger, ein mordlustiger Möchtegern-Napoleon.
Eine Frage trieb ihn dabei besonders um: Glaubten die Deutschen wirklich an die Nazi-Doktrin, die Hitler und seine Spießgesellen so lautstark predigten? War das möglich? Wenn er darauf eine Antwort finden wollte, gab es nur eins: Er musste es selbst erleben, musste nach Deutschland fahren und mitbekommen, was sich dort abspielte, was Nationalsozialismus im Alltag bedeutete. Er wollte wissen, wie es wirklich war, aber gleichzeitig zog ihn die Vorstellung an, er könnte bei allem vielleicht doch persönliche Kontakte knüpfen, könnte irgendwie Brücken bauen. Es mochte Optimismus sein, oder jugendlicher Idealismus, aber er hoffte, er könne etwas ausrichten.
Und so machte er es. Als er den Bachelor, den ersten Studienabschluss, mit Auszeichnung bestanden hatte und ein Forschungsstipendium für drei weitere Jahre an der Universität erhielt, nahm er eine Aus-Zeit von einem Jahr, um sich seinen Deutsch-Studien zu widmen. Er wandte sich an das Büro des Akademischen Austauschdiensts – wahrscheinlich wollen die einen guten Nazi aus mir machen, dachte er bei sich – und erhielt ein Schreiben von Dr. phil Max Helck, Rektor des Gymnasiums zu Heiligen Kreuz: Es war das Angebot, dort im Schuljahr 1936/37 Englisch zu unterrichten.
Dresden galt als eine der bedeutendsten Städte Deutschlands, berühmt wegen seiner Bauten und als Stadt der Bildung und Kultur. Vor dem Ersten Weltkrieg hatten in Dresden sogar viele Engländer gelebt. Die Schule selbst, bekannt als »Kreuzschule«, war, wie er erfuhr, die älteste in Dresden, schon seit dem vierzehnten Jahrhundert die Bildungsstätte für den weltberühmten Kreuzchor. Dort ein Jahr verbringen zu können, fand er ideal.
Aber in was für einem Sturm von widerstreitenden Gefühlen würde er sich finden: Da waren einerseits die hysterischen Aufgeregtheiten und die Brutalität des Nazi-Regimes, andererseits würde er in eine Gemeinschaft junger Männer kommen – mit all den verwirrenden Emotionen, die sich einstellten, wenn er bei ihnen Aufmerksamkeit, Respekt und Bewunderung erlangte, vielleicht sogar die Zuneigung der Jungen, nach der er sich so sehnte. Fred war klug genug, um sich Rechenschaft darüber abzulegen, in was für eine Feuerprobe er sich begab, aber seine jugendliche Hartnäckigkeit, sein angeborener Eigensinn und eine unstillbare intellektuelle Neugier ließen ihn alle Bedenken überwinden.
Und so reiste im Herbst 1936 ein jungenhaft aussehender Zweiundzwanzigjähriger namens Fred Clayton, im Vollgefühl seines mit Auszeichnung bestandenen Examens, mit der Bahn nach Dresden. Die Aussicht, in einer so weithin berühmten Bildungsstätte tätig zu werden wie der Kreuzschule, die Persönlichkeiten wie Richard Wagner zu ihren Alumni zählte, rief ihm seine eigene akademische Laufbahn bis zu diesem Punkt ins Gedächtnis. Die Fahrt quer durch Europa war lang genug: Fast zwei Tage dauerte sie, zunächst mit dem Zug von Cambridge nach London, dort vom Bahnhof King’s Cross durch die Stadt zur Victoria Station und dem Kanalzug nach Dover zur Fähre, über den Kanal nach Oostende, dann wieder in den Zug nach Berlin und dort noch ein letztes Mal umsteigen nach Dresden. Er hatte viel Zeit sich zu erinnern, während draußen die Landschaft an ihm vorbeizog.
Nachdenklich sah er aus dem Fenster. War das wirklich erst ein paar Jahre her? Diese unbändige Freude, als er die Nachricht vom Stipendium für das berühmte King’s College in Cambridge bekam? Er war so aufgeregt gewesen: Sie hatten ihm einen der lediglich vier Studienplätze zuerkannt, die nicht für die Schüler der Eliteschule von Eton reserviert waren.
Mit sechzehn hatte Fred schon die Aufnahmeprüfung fürs College abgelegt und an seinem siebzehnten Geburtstag, dem 13. Dezember 1930, bekam er das schönste Geburtstagsgeschenk seines Lebens. Er saß in seinem Zimmer, in ein Buch vertieft, das er geschenkt bekommen hatte, als seine Mutter ihn rief: »Fred, komm mal her, der Telegrammbote ist an der Tür, ich glaube es ist für dich!« Er stürzte zur Eingangstür, fast hätte er seine Mutter umgerannt. Wahrhaftig, da stand der Telegrammbote, ein adrett gekleideter Junge mit einem runden Käppi, am Gürtel die blank gewienerte Ledertasche mit glänzenden Messingschließen, die dunkelblaue Uniform war makellos und das Postfahrrad glänzte. »Telegramm für Herrn Frederick Clayton?« sagte er.
»Ja, das bin ich«, sagte Fred verwundert. War das ein Geburtstagsglückwunsch oder so etwas? Der Bote reichte ihm den versiegelten Umschlag, schnell riss er ihn auf – und konnte kaum glauben, was da stand. »Mama, es ist vom King’s College in Cambridge. Ich bekomme einen Studienplatz. Im Oktober geht’s los!«
Fred war immer noch erst siebzehn, als im Herbst 1931 sein neues Leben am »King’s« begann. Sein Studium der klassischen Sprachen war ein Triumphzug, Preise und Auszeichnungen, die Cambridge regelmäßig ausschrieb, gewann er in Serie. Auf den Preis für Aufsatz in lateinischer Sprache 1932 folgte 1933 der »Porson Prize«, der für die Abfassung griechischer Verse vergeben wurde – Fred erhielt ihn für seine Übersetzung einer Passage aus Shakespeares »Heinrich VIII.« ins Griechische Im Jahr darauf wurde ihm die seit 1813 verliehene Medaille der Universität für englische Lyrik zuerkannt. Er bekam sie für sein Gedicht »Die englische Landschaft. Verse verfasst in einer Industrievorstadt«. Es war eine Klage über den Verlust landschaftlicher Schönheit durch die wachsende Verstädterung, einen Verlust, dessen man erst gewahr wird, wenn er schon eingetreten ist. Hier schreibt Fred:
Oh liebes reines Himmelsblau! Doch ach
Blau ist der Rauch über dem blauen Schieferdach
Stahlblau der Lichtschwerter Gefunkel
Vom Gaswerk überm Fluss, der trübe fließt und dunkel,
Die Schlacke türmt sich dort, und gib auch acht
Im Wasser auf das Öl in bunter Farbenpracht
Bunt ist es wie der Regenbogen, doch ich seh’
Lieber den Bogen in der Höh’.
Ach, ich bin doch von überall betrogen,
Die Feinde sind so grellbunt angezogen,
Nie wieder seh’ ich ein Vergissmeinnicht
In seiner Schönheit, rein und schlicht.
Der Himmel bleibt im Nebligen, im Trüben
Wenn über mir die Narren ihre Künste üben
Und ganz gewiss ist mir ein Graus
Das Schieferdach, das Backsteinhaus
Dies England kenn ich nur zu gut
Dies andre Eden, halbe Höllenbrut.
Dann noch mehr Preise und schließlich der Höhepunkt, das Forschunsgsstipendium als Anerkennung für seine Abschlussarbeit über Edward Gibbon, den berühmten Historiker des 18. Jahrhunderts. Und während er sich immer für Shakespeare begeisterte, hatte ihm das Studium des Lateinischen und Griechischen doch eine ganz neue Welt eröffnet, in die er sich versenken konnte. Sprachen hatten für ihn immer eine besondere Schönheit gehabt, Worte konnten Menschen bewegen, konnten neue Wege, neue Welten aufzeigen, überdies hatten Sprachen eine bildende, formende Kraft. Und als er selbst zu schreiben begann, merkte er, dass ihm diese Kraft auch zur Verfügung stand.
Er liebte das Leben für die Wissenschaft und die abgesonderte Welt des Colleges, aber nur einige hundert Meilen entfernt lebten zur gleichen Zeit Menschen unter dieser seltsamen, erschreckenden, alles umwälzenden Bewegung, dem Nationalsozialismus, und wurden zu Fanatikern gemacht. Seine intellektuelle Neugier und sein ausgeprägtes politisches Bewusstsein brachten ihn dazu, dass er sich selbst ein Bild davon machen wollte, was in Deutschland unter der Herrschaft dieser »Nazis« geschah.
Fred (links) mit seinen Eltern, William und Gertrud Alison, und einem Nachbarjungen
Zweites Kapitel: Herbst 1936 Ankunft in Dresden
Fred beginnt seinen Unterricht an der Kreuzschule und lernt die Familie Büttner-Wobst kennen.
Endlich näherte sich der Zug Dresden, der Endstation seiner langen Reise, dem Ort, wo er nun ein Jahr lang zu Hause sein sollte. Sie fuhren über eine Brücke und Fred reckte den Hals, um einen ersten Blick auf die Silhouette der Altstadt am Südufer der Elbe zu erhaschen: Dort links war die Kuppel der Frauenkirche, sie sah aus wie eine steinerne Glocke, oben glänzte das goldene Turmkreuz in der Sonne. Weiter rechts erkannte er die katholische Hofkirche mit ihrem reichen barocken Figurenschmuck, dahinter war das Königsschloss zu erahnen. Fred staunte über die Vielzahl der Dächer und Türme, die sich vor dem hellen Himmel abzeichneten: Das also war das »Florenz an der Elbe«. Stunden hatte er in Cambridge damit zugebracht, in der Bibliothek Fotos der Stadt zu bestaunen, aber was er nun sah, übertraf seine Erwartungen, selbst wenn es nur ein Blick aus dem Zugfenster war. Viele der Barockbauten waren zwar vom Zug aus nicht zu sehen, aber er wusste, sie waren dort irgendwo und er konnte es kaum erwarten, sie selbst zu erkunden.
Der Zug hatte die Elbe überquert, bis zum Hauptbahnhof waren es nur noch wenige Minuten und Fred schaute gebannt, wie ein beeindruckendes Gebäude nach dem anderen am Fenster vorbeizog. Gleich hinter der Brücke war ihm ein exotisches Gebäude aufgefallen mit einer Kuppel wie in einer Stadt im Orient. Später sollte er zu seinem Erstaunen erfahren, dass es nichts weiter war als eine Zigarettenfabrik. Aber in dieser schönen Stadt war sogar eine Zigarettenfabrik ein wunderbarer Anblick.
Der Zug hielt und Fred stieg herunter auf den Perron. Er stellte sein Gepäck ab und sah sich um. Der Bahnhof war ungefähr so groß wie King’s Cross in London, wo er tags zuvor umgestiegen war – ihm kam es vor wie ein kleine Ewigkeit. Hier stand er unter einem beeindruckend großen, auf Eisenträgern ruhenden Glasdach, das die Bahnsteige überspannte und das Tageslicht einströmen ließ. Er sah sich nach einem Kofferwagen um, verstaute sein Gepäck darauf und machte ich auf den Weg in die Empfangshalle. Das riesige Gewölbe ließ ihn an eine Kathedrale denken, eine Weihestätte der deutschen Ingenieurskunst.
Ein überdimensionales Plakat sprang ihm ins Auge. Auf einem Felsen breitete der deutsche Adler seine Schwingen aus, dahinter waren Palmen zu erkennen und ein schneebedeckter Berg, die Hakenkreuz fahne wehte am Himmel. Unten stand in Frakturschrift: »Deutschland, Deine Kolonien!« Es war offenbar eine Forderung nach Rückgabe der afrikanischen Kolonien, die Deutschland nach dem ersten Weltkrieg hatte abgeben müssen. Die Zeitläufte hatten ihn sofort eingeholt. Ob die Rückgabe der Kolonien Hitlers Hunger nach »Lebensraum« stillen würde?
Fred hatte die Mitteilung erhalten, dass jemand von der Kreuzschule ihn am Bahnhof abholen und zu seiner Unterkunft bringen würde, also blieb er in der Bahnhofsvorhalle stehen und überlegte, wie lange er wohl würde warten müssen. Nach ein paar Minuten wurde er unruhig: Sie würden ihn doch nicht vergessen haben? Oder hatten sie sich am Ende die falsche Zeit aufgeschrieben?
Er war erleichtert, als ein junger Mann auf ihn zu kam: »Sie sind Herr Clayton, ja? Herzlich willkommen in Dresden!« Er stellte sich als Friedrich Jehn vor, Mathematiklehrer an der Kreuzschule. »Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn wir mit der Straßenbahn zu Ihrer Unterkunft fahren? Weit ist es nicht, aber mit dem Gepäck...« Er nahm zwei von Freds Koffern.
»Ja, gerne«, erwiderte Fred, »und bitte sagen Sie Fred zu mir.«
Jehn hatte schwarzes Haar, darunter blickten sanfte braune Augen irgendwie bekümmert drein, seine Hände waren weich. Er war offenkundig nervös, blickte sich ständig um, als hätte er Angst beobachtet zu werden, oder gar verfolgt. Ob das in Dresden so war? Musste man hier ständig auf der Hut sein?
Es war wirklich nicht weit vom Bahnhof zu Lüttichaustraße 20, wo Fred nun ein Jahr lang wohnen sollte. Mächtige mehrstöckige Wohnhäuser mit Sandsteinfassaden und einheitlichen Fensterfluchten säumten eine breite Stadtstraße, er sah Geschäfte, Hotels, Pensionen; auch die Straßenbahn fuhr hier entlang – wie angenehm. Jehn erzählte ihm, dieses Viertel sei einmal als »die englische Kolonie« bekannt gewesen: Um die Jahrhundertwende hätten über tausend Briten in Dresden gewohnt, die meisten in diesem Bezirk. »Es ist jetzt nur noch eine Erinnerung«, meinte er traurig. »Der Weltkrieg hat dem ein Ende gesetzt. Inzwischen sind nur noch wenige Engländer in unserer schönen Stadt zu Hause.«
»Nun«, erwiderte Fred lächelnd, »ich möchte schon hier zu Hause sein, wenigstens ein Jahr lang.«
Sie stiegen aus der Bahn und gingen ein paar Schritte die Straße hinunter bis zu dem Haus, wo Fred wohnen würde. Mit einem Dank dafür, dass er ihn hierher begleitet hatte, verabschiedete sich Fred von Jehn.
»Das ist gern geschehen«, gab Jehn zurück, »wir sehen uns dann in der Schule.«
»Wie weit ist es denn bis zur Schule?«
»Gar nicht weit, nur die Straße runter und dann links.«
Fred atmete tief durch, zumindest bis jetzt schien alles glatt zu gehen, und in Jehn hatte er vielleicht schon einen Freund gefunden. Ob wohl die anderen Kollegen an der Kreuzschule auch so nett zu ihm sein würden?
Freds Vermieterin war eine Witwe, Frau Professor Günther. Er suchte das Klingelschild ab: Ah hier, Günther. Auf sein Klingeln ging die schwere Haustür auf und er stieg die breite Treppe hinauf in den zweiten Stock, wo ihn Frau Günther begrüßte. Sein eigenes Zimmer lag noch ein Stockwerk höher im dritten Stock des Mietshauses (wie gut, dass er sein Gepäck nur dieses eine Mal würde hochschleppen müssen). Das Zimmer war bescheiden möbliert mit Tisch, Bett und Schrank, aber dabei recht gemütlich, und die beiden großen Fenster machten den Raum hell und luftig. Der Tisch stand vor dem einen Fenster, das gefiel ihm: Man konnte direkt auf die Straße hinunterblicken, und als er sich nun an den Tisch setzte, dachte er mit einem Lächeln: Hier kann ich dann Stunden zubringen, meinen Träumen nachhängen und dabei unten das Stadtleben vorbeiziehen sehen.
Das neue Schuljahr fing noch nicht sofort an, so blieben Fred ein paar Tage zum Eingewöhnen und die Stadt zu erkunden. Seine Wirtin hatte ihm gleich ein paar Tipps gegeben, auch einen Stadtplan hatte er von ihr bekommen. Als erstes machte er sich auf den Weg zu Kreuzschule, in der er die meiste Zeit zubringen würde.
Das imposante eingeweihte Gebäude der Kreuzschule am Georgplatz. Es fiel 1945 den Bomben zum Opfer
Es war tatsächlich nicht weit, er fand das imposante neogotische Gebäude rasch; mit seinen Pilastern und Spitzbögen erinnerte es ihn an seine Schule in Liverpool. Weiter Richtung Innenstadt kam er zur Prager Straße, von der Frau Professor Günther ihm erzählt hatte: Hier kämen die Leute von weit her zum Einkaufen. Fred hatte das nicht sehr beeindruckt – warum sollte jemand weite Wege auf sich nehmen, nur um einzukaufen, das war doch eher eine lästige Notwendigkeit als ein Vergnügen? Er sah sich um: Prächtige Gebäude säumten den Boulevard, sie strahlten Luxus aus, ein Inbegriff bürgerlicher Lebensart des 20. Jahrhunderts. In London war das die Oxford Street, hier also die Prager Straße. Besser gefiel es ihm weiter zum Elbufer hin, er schlenderte durch Gassen und über Plätze und konnte sich an den prachtvollen Bauten nicht sattsehen. Hier sollte er also nun ein Jahr leben, es war wie ein Traum.
Nachdenklich ging er zurück und kam wieder an der Kreuzschule vorbei. Beim Gedanken an den ersten Tag dort empfand er eine Mischung aus Hochgefühl und Beklemmung. Erneut musste er an das Gymnasium in Liverpool denken und seinen ersten Schultag dort, der sich ihm ins Gedächtnis eingebrannt hatte. Als Hochbegabter hatte er einen Jahrgang übersprungen und war nun der Jüngste in der Klasse. Er hatte so dringend raus gemusst, aber der Klassenlehrer hatte sich nicht um sein verzweifeltes Fingerschnippen gekümmert, da war er schließlich in Tränen ausgebrochen: Er hatte sich in die Hose gemacht. Ein beschämender Anfang war das gewesen und es hätte eine schlimme Schulzeit werden können. Nicht nur, dass er der Kleinste in der Klasse war, er war in Sport eine Niete und kam schnell ins Weinen, wenn es einmal rau zuging. Was hatte er anderes zu erwarten als ständig gehänselt und gemobbt zu werden? Vor allem, nachdem der Tränenausbruch am ersten Tag nicht der letzte blieb. Aber während der ganzen sieben Jahre auf der Schule gab es zwar immer wieder Hänseleien, doch sie waren gutmütig und freundschaftlich. Fred war überaus anhänglich und weckte freundliche Beschützerinstinkte. Er hoffte, er würde die Jungen an der Kreuzschule so behandeln können, wie er selbst behandelt worden war.
Fred in der Lüttichaustraße auf dem Weg in die Schule
Am Morgen seines ersten Schultags ging die Sonne strahlend auf, es wehte ein leichter Wind. Auf dem Weg in die Schule genoss Fred dankbar den milden Spätherbsttag, das schöne Wetter half ihm seine Nervosität zu überwinden. Beklommen trat er zum ersten Mal in seiner neuen Rolle auf den Schulhof, schüchtern schlängelte er sich durch die Schülermenge. Er kam sich sehr als Fremder vor, alle schienen ihn anzustarren. Ob er überzeugend aussah mit seinem Filzhut, weißen Hemd und Krawatte, dem Staubmantel und der schwarzen Aktentasche – oder war ihm der Junge anzusehen, der er eigentlich war?
Seine erste Stunde, hatte der Direktor ihm bei einem Vorgespräch gesagt, sollte in der Obertertia sein bei einem Herrn Klinge, er würde ihn an der Eingangstür abholen. Ob dieser Klinge wohl ein glühender Nazi war, ging es Fred durch den Kopf, als er die Stufen zur Eingangshalle hinaufstieg. Und die anderen Kollegen? Bei einer weiteren Begegnung mit Friedrich Jehn hatte er das Thema nicht angesprochen, aber Jehn hatte nicht den Eindruck eines überzeugten Nationalsozialisten auf ihn gemacht.
Klinge erwartete ihn schon. Er begrüßte ihn mit einem »Heil Hitler« und Fred hob ebenfalls den Arm zum Gruß, was sollte er auch anders tun, er wollte den Kollegen ja nicht gleich vor den Kopf stoßen. Klinge sah Fred skeptisch an, als habe er gespürt, dass sein Gegenüber die Geste nur notgedrungen erwidert hatte. »Herr Clayton, Sie sind wohl heute bei mir im Unterricht«, sagte er kurz angebunden, »kommen Sie.« Dann schlug er tatsächlich die Hacken zusammen, drehte sich um und marschierte vorweg, mit Fred ein paar Schritt hinter ihm, als wäre er Klinges Hündchen oder sein Diener.
In der Klasse führte Fred sich gleich mit einem Missgeschick ein: Er stolperte über eine Schultasche, worauf ihm ein automatisches »I’m awfully sorry« entfuhr. Sechzehn Schülerköpfe fuhren herum, er hatte sich schon verraten. Und sofort kam der nächste unangenehme Moment, als Klinge nun »Heil Hitler!« blaffte.
Die Klasse erwiderte im Chor »Heil Hitler!« und Fred war klar, er stand unter Beobachtung. Wie würde dieser Ausländer auf den Gruß reagieren?
Später schämte er sich dafür, dass er zusammen mit den anderen »Heil Hitler« murmelte, wenn auch nicht so laut und deutlich. Er stellte sich vor, wie seine Freunde in Cambridge vor Schreck zusammenzucken würden, dass er die Worte überhaupt in den Mund nahm, aber was sollte er machen?
»Wie ihr seht, haben wir einen Gast bei uns. Dies ist Herr Clayton aus England«, sagte Klinge. »Herr Clayton wird dieses Jahr bei uns unterrichten.« Fred wurde rot – die Augen von sechzehn Schülern blieben weiter auf ihn gerichtet, einige freundlich, andere herausfordernd, die meisten einfach desinteressiert.
Bei Klinge trat Fred sofort ins Fettnäpfchen. Der Lehrer forderte einen Jungen namens Wilhelm Schmidt auf, seine Hausaufgaben vorzulesen. Das tat er auch, aber mit einem derartigen Akzent, dass man ihn kaum verstehen konnte. Außerdem benutzte er ständig den Ausdruck »That will say« – das will sagen. Fred fühlte sich als Muttersprachler verpflichtet, einen Kommentar abzugeben.
»Wilhelm, ich glaube, wir haben nicht recht verstanden, was du vorgelesen hast, vielleicht kannst du deine Aussprache noch etwas verbessern? Und, nimm’s mir nicht übel, aber du sagst immer ›That will say‹, das sagen wir im Englischen nicht, das ist eine französische Wendung, keine englische.«
Sofort richteten sich alle Augen auf Klinge. Offensichtlich hatte er ihnen diesen Ausdruck beigebracht. »Ahh ja, Herr Clayton, vielen Dank für diese wertvolle Anmerkung«, säuselte Klinge. »Es ist so gut, dass wir einen richtigen Muttersprachler bei uns haben. Meint ihr nicht auch?« wandte er sich an die Klasse, die wenig begeistert Zustimmung grunzte. Klinge sorgte jedoch dafür, dass er das letzte Wort behielt, als er nun fortfuhr. »Ihr müsst aber auch ein bisschen vorsichtig sein: Seine Aussprache ist nicht die allerfeinste, er hat einen leichten regionalen Akzent. Bitte kopiert ihn nicht, er spricht, wie soll ich sagen, nicht das Englisch des Königs.« Fred lächelte gequält. Das konnten ja interessante Schulstunden werden mit Klinge.
Gleich in der nächsten Stunde landete Klinge denn auch einen Überraschungscoup: Er überließ Fred die Klasse ganz allein. »Reden Sie einfach Englisch mit ihnen. Sprechen Sie über das englische Schulsystem. Das verstehen sie schon, keine Angst.« Klinge war offensichtlich fest vom Erfolg seines Unterrichts überzeugt. Fred war peinlich berührt und merkte, wie er wider Willen rot wurde, aber es blieb ihm keine Wahl. Er versuchte, etwas Zusammenhängendes zu formulieren, stotterte sich etwas zurecht, stockte immer wieder, sprach viel zu leise und undeutlich, fast als wolle er sich entschuldigen, und dabei überlegte er die ganze Zeit, wieviel die Schüler wohl verstanden – ihren verständnislosen Blicken nach zu urteilen, herzlich wenig.
Während er sprach, fiel ihm ein Junge auf, leuchtend blaue Augen, himmelblauer Pullover und schwarze Cordhosen, keine Krawatte – er war ganz anders angezogen als die anderen, aber das schien ihm nichts auszumachen. Fred fiel ein seltsam störrischer Zug um seinen Mund auf, ernst und irgendwie in einer gewissen Abwehrhaltung gegen die Welt, als wollte er sagen, ihr kriegt mich nicht so leicht, und als könnte Fred einer von denen sein, die versuchten, ihm am Zeuge zu flicken. Er sah Fred mit einem amüsierten Lächeln an. Sie wechselten Blicke des Einverständnisses, sie schienen zu sagen: ›Was für eine bizarre Geschichte. Wir wissen beide, dass du wahrscheinlich kein Sterbenswort verstehst. Aber das ist nicht schlimm, es ist sowieso nur dahergeredet. Absurd, was?‹ Der Spaß ging auf Klinges Kosten, ganz offensichtlich war der kein so guter Englischlehrer, wie er glaubte.
Nicht lange nach dieser Stunde begegnete der Junge Fred auf den Steinstufen vor der Schule. Sie wechselten einen kurzen Gruß, der Junge höflich zuerst: »Heil Hitler«, deklamierte er mit todernster Miene. Fred zögerte einen Moment, dann versetzte er ebenso förmlich: »Heil Hitler«, mehr brachte er nicht heraus. Hinterher überlegte er, ob sich nicht in diesem Austausch des Hitlergrußes erneut ein Einverständnis zeigte, vielleicht machten sie sich wieder zusammen lustig. Fred bedeutete der Gruß nichts und er fragte sich, ob der Junge wohl etwas damit gemeint haben mochte. Der Gruß in der Klasse, oder sonst in einer Gruppe von Leuten, das war eine Sache, aber zu grüßen, wenn außer ihnen beiden niemand zugegen war, das war doch etwas ganz anderes. Machte er einen Witz, oder forderte er den Engländer heraus – zu Rebellion, zu offener Missachtung? Das musste die Zeit zeigen.
Als sie sich das nächste Mal begegneten, wollte Fred unbedingt die Chance nicht wieder ungenutzt verstreichen lassen, außerhalb der Schulgemeinschaft mit einem Deutschen in näheren Kontakt zu kommen. Er fragte ihn nach seinem Namen. »Götz Büttner-Wobst«, kam die Antwort.
»Und wie gefällt es dir in der Schule, Götz?« Der zuckte die Achseln.
»Ich mag die Schule nicht so. Ich weiß, zu Hause sind sie von mir enttäuscht. Mutti sagt immer, ich muss fleißiger sein. Aber es ist langweilig«.
»Nun«, versetzte Fred, »vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen? Meinst du, deine Eltern wären damit einverstanden?«
Hoffentlich klang das ruhiger und geschäftsmäßiger als er sich dabei fühlte – er sehnte sich nach Kontakt, nach Freundschaft, nach Verständnis. Vielleicht fand er über den Jungen einen Weg zu seiner Familie und zu Freundschaft. Er stellte sich schon vor, wie Götz zu Hause so nebenbei sagte, »ach, in der Schule, da ist dieser junge Engländer, der hat mich gefragt, ob er mir bei den Hausaufgaben helfen soll«. Würden seine Eltern die Idee gut finden? Würden sie sich für einen jungen Ausländer interessieren, einen Besucher aus der weiten Welt da draußen?





























