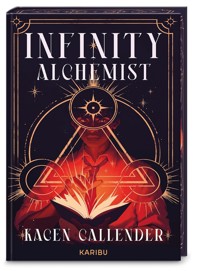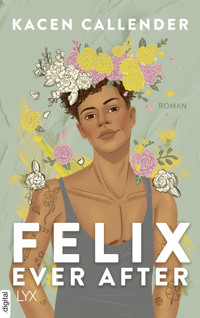
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom TIME MAGAZINE zu einem der 100 wichtigsten und einflussreichsten YA-Bücher aller Zeiten gewählt
Der siebzehnjährige Felix Love war noch nie verliebt - die Ironie daran geht ihm selbst ziemlich auf die Nerven! Seine größte Angst ist es, dass sich niemand in ihn verlieben wird, weil er einfach zu viele Ausschlusskriterien erfüllt. Braune Haut, queer und trans - die Vorstellung, dass er deshalb nicht liebenswert ist, lässt ihn in Schockstarre verweilen. Doch als Felix transfeindliche Instagram-Nachrichten bekommt, nachdem sein Deadname zusammen mit Fotos von ihm vor seiner Transition in der Schule veröffentlicht wurde, wird es für ihn endlich Zeit zu handeln. Felix schreibt seinem vermeintlichen Peiniger zurück, um herauszufinden, wer ihm das angetan hat, und verstrickt sich dabei in einem Netz aus ungeahnten Gefühlen, Identitätssuche und wahrer Freundschaft ...
"Felix' Geschichte ist so echt und herzzerreißend wie herzerwärmend und empowernd. Eine Liebeserklärung an die Buntheit des Lebens!" @DERUNBEKANNTEHELD
"Ein machtvolles Buch mit einem starken Protagonisten. FELIX EVER AFTER ist erfrischend authentisch: voller queerer Teenager, ihren chaotischen Fehlern, dem Leben und der Liebe. Wir brauchen diese Buch so dringend!" CASEY MCQUISTON
"FELIX EVER AFTER öffnet unsere Augen für die wunderschöne und chaotische Komplexität der Liebe in all ihren Formen. Dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite ein Geschenk." BECKY ALBERTALLI
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Leser:innen, die mit den folgenden Themen lieber nicht in Berührung kommen möchten, würden wir raten, ein anderes Buch zu lesen:
Queerfeindlichkeit, (internalisierte) Transfeindlichkeit, Dysphorie, Deadnaming, Misgendering, Mobbing, Zwangsouting.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nachwort von Kacen Callender
Danksagung
Glossar
Kacen Callender
Die Romane von Kacen Callender
Impressum
KACEN CALLENDER
Felix Ever After
Roman
Ins Deutsche übertragen von Maike Hallman
ZU DIESEM BUCH
Der siebzehnjährige Felix Love war noch nie verliebt – und die Ironie daran geht ihm selbst ziemlich auf die Nerven! Seine größte Angst ist es, dass sich bestätigen könnte, was er schon die ganze Zeit befürchtet: dass sich niemand in ihn verlieben wird, weil er anderen einfach zu viel ist. Braune Haut zu haben, queer und trans zu sein macht Felix das Leben selbst in einer Millionenmetropole wie New York nicht immer leicht. Und die Vorstellung, dass er nicht liebenswert ist, weil er für andere zu viele Ausschlusskriterien erfüllt, lässt Felix in Schockstarre verweilen! Doch dann hackt sich jemand in seinen Instagram-Account, hängt alte Fotos aus der Zeit vor seiner Transition für alle sichtbar in der Lobby seiner Schule auf und veröffentlicht außerdem Felix’ Deadname, den er nicht mal seinem besten Freund Ezra verraten hat! Als Felix dann auch noch transfeindliche Instagram-Nachrichten bekommt, wird es für ihn endlich Zeit zu handeln. Um herauszufinden, wer ihm das angetan hat, schmiedet Felix einen ausgeklügelten Racheplan, schreibt seinem Peiniger zurück – und verstrickt sich dabei in einem Netz aus ungeahnten Gefühlen, Identitätssuche und wahrer Freundschaft …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für alle trans und nicht-binären Jugendlichen.
Ihr seid schön. Ihr seid wichtig. Ihr seid wertvoll.
Ihr seid perfekt.
1
Wir stoßen die Glastüren des Apartmentgebäudes auf, raus geht’s in den gelben Sonnenschein, der ein bisschen zu hell und zu fröhlich ist. Es ist höllisch heiß – die Art Hitze, die einem auf der Haut klebt, im Haar, sogar auf den verdammten Augäpfeln.
»Ach scheiße, wieso noch mal haben wir uns das aufgehalst?«, fragt Ezra mit heiserer Stimme. »Es ist noch so früh. Ich könnte noch schlafen.«
»Na komm, elf ist jetzt nicht wirklich früh. Das ist – du weißt schon, eigentlich ist der Tag schon fast halb rum.«
Ezra zündet einen angebrochenen Blunt an, keine Ahnung, wo er den hervorgezaubert hat, reicht ihn mir, und im Gehen ziehen wir an dem kleinen Rest, der noch übrig ist. Vom Grillplatz eines nahen Parks wehen Reggaeton, Rauch und der Geruch angebrannten Fleisches herüber, dazu das Lachen und Schreien von Kindern. Wir überqueren die Straße, bleiben kurz stehen, als ein Typ auf einem Fahrrad vorbeizischt, aus dessen Gettoblaster Biggie dröhnt, und laufen die vor lauter Schimmel rutschigen Treppen der Bedford-Nostrand-Station runter. Gerade als wir unsere Fahrkarten in den Automaten am Drehkreuz schieben, rumpelt die Bahn auf den Bahnsteig.
Die Zugtüren schließen sich hinter uns. Es ist eine dieser älteren Bahnen, überall auf dem Boden klebt schwarz verfärbtes Kaugummi, und die Fenster sind voller Edding-Nachrichten. R + J = 4EVA.
Im ersten Moment will ich die Augen verdrehen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, spüre ich, wie Neid in mir aufkeimt. Wie es sich wohl anfühlt, jemanden so sehr zu lieben, dass man dazu bereit ist, mit einem schwarzen Edding für alle sichtbar Herz und Seele zu entblößen? Wie es wohl ist, überhaupt jemanden zu lieben? Ich heiße Felix Love, aber verliebt war ich noch nie. Ich weiß nicht, manchmal macht mir diese Ironie echt zu schaffen.
Wir ergattern zwei orange Sitze. Ezra fährt sich gähnend mit der Hand übers Gesicht und lehnt sich gegen meine Schulter. Letzte Woche hatte ich Geburtstag, und seitdem haben wir uns irgendwie angewöhnt, bis drei Uhr morgens wachzubleiben und den ganzen Tag rumzugammeln. Ich bin jetzt siebzehn, und ich kann bezeugen, dass es zwischen sechzehn und siebzehn keinen großen Unterschied gibt. Siebzehn ist nur eins dieser Übergangsjahre, die man leicht vergisst, so wie Dienstage – eingeklemmt zwischen der süßen Sechzehn und der volljährigen Achtzehn.
Uns gegenüber döst ein älterer Mann. Eine Frau steht neben ihrem Kinderwagen, der bis obenhin mit Einkaufstaschen beladen ist. Ein Hipster mit langem roten Bart hält sein Rad fest. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Ezra bemerkt, wie ich mich in den eisigen Luftstrom lehne, und legt mir einen Arm um die Schultern. Er ist mein bester Freund – mein einziger Freund, seit ich vor drei Jahren an die St. Catherine’s gekommen bin. Wir sind nicht zusammen, in keinster Art und Weise, aber irgendwie nehmen die Leute das trotzdem ständig an. Der ältere Mann wacht so unvermittelt auf, als hätte er die in der Luft liegende Gayness gerochen, und hört nicht auf, uns anzuglotzen, selbst als ich geradewegs zurückstarre. Der Hipster lächelt uns aufmunternd zu. Zwei kuschelnde schwule Typen in Brooklyn, das sollte sich eigentlich nicht allzu revolutionär anfühlen, aber plötzlich tut es das doch.
Vielleicht liegt es am Gras, vielleicht auch daran, dass das Erwachsensein auf einmal so viel näher gerückt ist, jedenfalls werde ich plötzlich ein bisschen übermütig. Ich flüstere Ez zu: »Wollen wir dem Typen ’ne Show bieten?« Mit einem Nicken deute ich auf den älteren Mann, der einfach nicht wegsehen will. Ezra grinst und streicht mir mit der flachen Hand über den Arm, und ich kuschle mich enger an ihn, lege ihm den Kopf auf die Schulter – und dann geht Ez von null auf hundert und schmiegt sein Gesicht an meinen Nacken, was … Okay, so richtig viel Action diesbezüglich gab’s bei mir bisher noch nicht (also, ich wurde noch nie geküsst), und allein seinen Mund dort zu spüren bringt mich aus dem Konzept. Ich gebe ein peinliches Geräusch von mir, halb Quietschen, halb Keuchen, und Ezra lacht gedämpft auf, den Mund noch immer an genau derselben verdammten Stelle.
Ich blicke auf und stelle fest, dass unser Publikum uns mit weit aufgerissenen Augen anstarrt. Ich wackle mit den Fingern in seine Richtung, ein sarkastisches, halbherziges Winken, das er offenbar als Einladung zu sprechen versteht. »Wisst ihr«, sagt er mit einem ganz leichten Akzent, »ich hab einen Enkel, der ist schwul.«
Ezra und ich sehen uns mit hochgezogenen Brauen an.
»Äh. Okay«, sage ich.
Der Mann nickt. »Ja, ja – ich habe nichts geahnt, gar nichts, und dann eines Tages wollte er mit mir reden, mit mir und meiner Frau Betsy, da hat sie noch gelebt, und er hat geweint, und dann hat er uns gesagt: Ich bin schwul. Er wusste es schon seit Jahren, aber er hat nie was gesagt, weil er solche Angst davor hatte, was wir wohl dazu sagen. Ich kann ihm kaum verübeln, dass er Angst hatte. Was man da für Geschichten hört. Und sein eigener Vater … Es bricht einem das Herz. Man sollte meinen, Eltern würden ihre Kinder immer lieben, ganz egal, was passiert.« Als die U-Bahn langsamer wird, unterbricht er seinen Monolog und sieht sich um. »Ich muss aussteigen.«
Er steht auf, die Türen öffnen sich. »Ihr würdet meinen Enkel bestimmt mögen. Ihr beide seht aus wie zwei nette schwule Jungs.«
Und damit verschwindet er im Gewühl der Station, und die Frau mit dem Kinderwagen steigt ebenfalls aus.
Ezra und ich sehen einander an, und ich platze vor Lachen laut heraus. Er schüttelt den Kopf. »New York, Mann«, sagt er. »Ernsthaft. Das gibt’s nur in New York.«
Lorimer/Metropolitan steigen wir aus, laufen eine Treppe runter und dann eine andere hoch, um zur L-Linie zu gelangen. Heute ist der 1. Juni – der erste Tag des Pride Month in der Stadt –, deshalb sind die gekachelten Wände voller regenbogenfarbener Sticker gegen Intoleranz und Diskriminierung. Am Bahnsteig stehen lauter Williamsburg-Hipster mit rosa Haut, und die Bahn braucht ewig.
»Scheiße. Wir kommen zu spät«, sagt Ezra.
»Jap. Na, was soll’s.«
»Declan wird stinksauer sein.«
Um ehrlich zu sein, ist mir das egal. Declan ist ein Arsch. »Da können wir jetzt eh nix mehr machen, oder?«
Als die Bahn kommt, entsteht ein Riesengerangel, weil alle sich mit reinquetschen wollen. Ich werde eng an Ezra gedrückt, die Luft riecht nach Bier und Schweiß. Die Bahn rattert und ruckelt so stark, dass es uns fast den Boden unter den Füßen wegzieht. Endlich kommen wir am Union Square an.
Es ist ein typischer überfüllter Nachmittag in der Stadt. Diese irrwitzigen Menschenmassen – das hasse ich an Lower Manhattan am meisten. In Brooklyn kann man wenigstens die Straße langgehen, ohne von zwanzig unterschiedlichen Schultern und Handtaschen angerempelt zu werden. Und in Brooklyn muss man sich keinen Kopf machen, mit brauner Haut ist man dort praktisch unsichtbar. Manchmal suche ich mir eine weiße Person, hinter der ich herlaufen kann, und wenn dann alle dieser Person hastig aus dem Weg springen, rempeln sie mich dabei wenigstens nicht an.
Ezra und ich arbeiten uns zentimeterweise durchs Gedränge vor und am Wochenmarkt vorbei, wo uns der Geruch nach Fisch verfolgt. Wir sind so angezogen wie immer: Auch jetzt im Sommer trägt Ezra ein schwarzes T-Shirt, dessen Ärmel er bis zu den Schultern hochgekrempelt hat, damit sein Tattoo von Klimts Judith und Holofernes zu sehen ist. Dazu eine enge schwarze Jeans, die ein paar Zentimeter zu hoch über den Knöcheln abgeschnitten ist, fleckige weiße Chucks und lange Socken mit Portraits von Andy Warhol. In der Nase hat er ein goldenes Septum-Piercing, das dichte schwarze Haar hat er zu einem Knoten hochgebunden, die Seiten sind rasiert.
Wenn ich mit Ezra unterwegs bin, beachtet mich niemand, alle starren ihn an. Ich habe dichte Locken und trage ein weites graues Tanktop, das die Narben auf meiner Brust hervorblitzen lässt, die dunkler sind als meine goldbraune Haut, kurze Jeans, mehrere kleine Tattoos hier und da, die ich für je zwanzig Dollar am Astor Place hab stechen lassen – beim ersten ist mein Vater ausgeflippt, aber inzwischen hat er sich dran gewöhnt –, und abgetragene Turnschuhe, die ich mit Kritzeleien und Sprüchen übersäht habe. Ezra findet, ich hab sie ruiniert. Er hat einen Spleen mit der Reinheit des ursprünglichen Designs.
Wir drängen uns zwischen den Menschentrauben vor den Ständen durch, an denen Marmelade und frisch gebackenes Brot und leuchtend bunte Blumen verkauft werden; Männer in Anzügen quetschen sich an uns vorbei, und ständig sind wir in Gefahr, über Hundeleinen und Kleinkinder auf Dreirädern zu stolpern. Endlich lassen wir den Markt hinter uns und laufen über einen Weg, der quer durch eine Grünfläche verläuft, auf dem mehrere Paare Picknickdecken ausgebreitet haben. Ein paar Kids geben mit ihren Skateboard-Künsten an, und auf den Bänken fläzen sich Mädchen in Sommerkleidern und mit Sonnenbrillen, Bücher in den Händen, die sie gar nicht wirklich lesen.
»Warum noch mal haben wir uns dafür entschieden, an diesem Sommerkurs teilzunehmen?«, fragt Ezra.
»Wegen der College-Bewerbung.«
»Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich nicht aufs College gehen werden.«
»Oh. Na ja, dann hab ich keine Ahnung, warum du das machst.«
Er grinst mich an. Wir wissen beide, dass er nach seinem Abschluss vermutlich von seinem Treuhandfonds leben wird. Seine Eltern sind stinkreich. So reich, dass sie Ezra eine Wohnung gekauft haben, damit er im Sommer während seines Kunstkurses in Bed-Stuy, einem Viertel von Brooklyn, wohnen kann. (Und heutzutage kosten Wohnungen wie die von Ezra ungefähr eine Million Dollar.) Die Patels verkörpern das Klischee der Manhattan-Elite: endlose Champagnerströme, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Galabälle und null Zeit für den eigenen Sohn, der von drei unterschiedlichen Kindermädchen aufgezogen wurde. Echt krank, aber ich muss gestehen, dass ich neidisch bin. Ezra wird alles auf dem Silbertablett serviert, während ich mit Zähnen und Klauen um jeden Brocken kämpfen muss.
Ich habe immer davon geträumt, auf die Brown University zu gehen, aber meine Noten sind nicht gerade überragend, meine Testergebnisse eher unterdurchschnittlich, und es werden nur neun Prozent der Bewerber:innen genommen. Ich habe es wirklich versucht. Hab wie blöd für die Tests gelernt und in den Kursen jedes Wort mitgeschrieben, um meine Gedanken am Abschweifen zu hindern. Aber wie mein Dad mal gesagt hat – mein Gehirn ist einfach anders verschaltet.
Weil ich es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf die Brown schaffen werde, fühlt es sich manchmal an, als müsste ich es gar nicht erst versuchen. Aber manche Leute haben es trotz beschissener Testergebnisse geschafft, und meine Noten mögen zwar nichts taugen, meine Kunst aber schon. Ich habe Talent. Das weiß ich. Das Portfolio fällt bei Student:innen, die sich mit einem Schwerpunkt in Kunst bewerben, sogar noch mehr ins Gewicht, und da es fürs Sommerprogramm der St. Catherine’s Extrapunkte gibt, könnte es sein, dass ich meinen Notendurchschnitt damit verbessern kann. Vielleicht hab ich doch noch eine Chance.
Leah, Marisol und Declan stehen schon auf den Stufen des Union Square, wo wir die Modeaufnahmen machen wollen. St. Cat’s folgt einem etwas anderen Zeitplan als die meisten New Yorker Schulen, offiziell hat das Sommerprogramm schon vor ein paar Tagen begonnen. An der St. Catherine’s startet es meist mit Projekten, bei denen wir die Schüler:innen aus den anderen Klassen kennenlernen. Ezra und ich haben uns für ein Modeshooting eingeschrieben und wollen einige seiner Designs verwenden. Leah mit ihrem buschigen roten Haar und der unglaublich blassen Haut hat ihre Kurven in einem Tanktop und ziemlich freizügigen Booty Shorts verpackt und hält ihre Kamera schussbereit in der Hand. Marisol modelt natürlich. Sie ist so groß wie Ezra, hat olivfarbene Haut, dichtes braunes Haar und Augenbrauen wie Cara Delevingne. Allein ihr Anblick reicht, damit ich jeden Herzschlag überdeutlich spüre. Ihr Haar ist ein gewaltiges Nest, an den Wimpern kleben grüne Federn, passend zu ihrem Lippenstift. Sie trägt das vierte Kleid unserer geplanten Reihenfolge: ein Paillettenportrait von Rihanna.
Declan Keane gibt bei der ganzen Angelegenheit den Regisseur, was mich total ankotzt. Er hat als Regisseur nicht das kleinste bisschen Erfahrung, aber irgendwie schafft er es immer, alles so hinzudrehen, wie es ihm in den Kram passt. Dass Declan es als seinen Lebensinhalt zu betrachten scheint, Ezra und mich wie Scheiße zu behandeln, macht die Sache auch nicht besser. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit zieht er über uns her. Er hasst uns und hat es zu seiner Mission gemacht, dafür zu sorgen, dass alle anderen uns ebenfalls hassen.
Declan redet gerade mit Marisol, da sieht er uns kommen. Seine Augen blitzen auf. Der Kiefer verspannt sich.
»Wie schön, euch zu sehen«, ruft er uns entgegen, so laut, dass ein paar der Leute, die auf den Stufen fläzen, die Köpfe wenden. »Ezra, vielen Dank, dass du dich extra herbemüht hast.«
Neben mir murmelt Ezra: »Hab doch gesagt, der wird stinksauer sein.«
Declan applaudiert gekünstelt. »Was für eine Ehre – nein wirklich, das ist es –, dass du zu deiner eigenen beschissenen Modenschau kommst.«
Ezra hebt eine Faust, tut so, als würde er daran kurbeln, und streckt langsam den Mittelfinger aus. Während wir näher kommen, starrt Declan Ez an und kneift die Augen zusammen.
»Bist du etwa high?«, will er wissen, und Ezra wendet das Gesicht ab. »Willst du mich verdammt noch mal verarschen? Wir warten hier seit über einer Stunde, und du bist high?«
Ich versuche dazwischenzugehen. »Mann, reg dich mal ab.«
Er sieht mich nicht mal an. »Schnauze, Felix, ernsthaft.«
»Du hast recht«, sagt Ezra. Er nickt Leah und Marisol zu, die auf den Stufen stehen und zusehen. »Sorry. Haben die Zeit vergessen.«
Declan verdreht die Augen und murmelt gedämpft: »Wie gottverdammt lächerlich«, – als wäre er selbst in seinem ganzen Leben noch nie zu spät gekommen. Früher mal, ehe er beschlossen hat, dass er sich für Ez und mich zu fein ist, sind wir oft zu dritt eine halbe Stunde zu spät zum Unterricht gekommen, so high wie nur was – aber jetzt auf einmal ist er die Wiederkunft persönlich? Gott, wie sehr ich ihn verabscheue.
»Wir sind sowieso schon halb fertig«, sagt Declan und streicht sich mit der flachen Hand über die Locken, als wäre es ihm im Grunde scheißegal, ob wir hier sind oder nicht. Declan ist mixed – seine Mom ist Schwarz und Puertoricanerin, sein Dad ein weißer und hellhäutiger Typ aus Irland –, deshalb hat er braune Haut, heller als meine, halblanges, lockiges braunes Haar mit rötlichem Schimmer, dunkelbraune Augen. Er ist ein bisschen stämmiger, mit breiten Schultern. Ein Athlet in Old-Navy-Klamotten: bedrucktes pinkes T-Shirt, weite verblichene Jeans, Flip-Flops.
Er kehrt uns den Rücken zu. »Beeilen wir uns und machen wir’s fertig. Ich wollte nicht den ganzen Tag hier rumhängen. Felix, du hältst den Reflektor.«
Ich rühre mich nicht. Ich bring’s nicht über mich, zu tun, was Declan Keane mir sagt. Nicht in diesem herablassenden Tonfall.
»Komm schon, Felix«, flüstert Ezra. »Bringen wir’s einfach hinter uns.«
Ich verdrehe die Augen und gehe die Treppen hoch, schnappe mir den Reflektor vom Ausrüstungsstapel. Declan hat sich immer noch nicht dazu herabgelassen, mich auch nur eines einzigen Blicks zu würdigen.
»Na dann«, sagt er, »machen wir mal weiter. Marisol, ich glaub, bei der Aufnahme solltest du nicht lächeln – die Kontrastierung des Rihanna-Portraits mit einem ernsten Gesichtsausdruck …«
Ich schalte so was von ab. 99,9 Prozent der Zeit redet Declan nur, um den Klang seiner eigenen Stimme zu hören. Die Session geht weiter, Leah umkreist Mari mit der Kamera, während sich Marisol dreht und wendet, in den Himmel starrt (was gut ist, weil es mir erleichtert, den Blickkontakt mit ihr zu vermeiden), bis es Zeit fürs nächste Outfit wird. Ich muss den Sichtschutz für Marisol halten und starre konzentriert zu Boden, während Ezra ihr hilft, ein anderes seiner Kleider anzuziehen, diesmal eins, das mit Manga-Bildfolgen aus Attack on Titan bedruckt ist. Als sie fertig ist, bellt Declan wieder seine Befehle.
»Leah, stell dich ein bisschen mehr nach rechts. Felix, halt den Reflektor ruhig.«
Marisol schirmt mit der Hand ihr Gesicht ab. »Und könntest du mir bitte nicht so in die Augen leuchten?«
Mari und ich sind eine Zeit lang zusammen ausgegangen. So ungefähr zwei Wochen lang, also es ist wirklich keine große Sache, aber trotzdem – irgendwie bin ich in ihrer Nähe immer ein bisschen durch den Wind, auch nach Monaten noch. Marisol benimmt sich, als wäre nie was gewesen, was zusätzlich Salz in die Wunde streut. Die Art, wie sie die Sache beendet hat, hilft auch nicht gerade.
Declan schnippt mit den Fingern in meine Richtung. Im Ernst, ich schwöre es, er schnippt verdammt noch mal mit den Fingern. »Ich hab gesagt, halt den Reflektor ruhig. Scheiße, pass doch mal auf.«
Ich halte den Reflektor höher. »Was für ein Scheißdreck«, brumme ich in mich hinein.
»Entschuldigung, was war das?«
Ich muss wohl ein bisschen lauter gesprochen haben als beabsichtigt – als ich aufsehe, starren mich alle an. Leah beißt sich auf die Unterlippe, Marisol zieht die Augenbrauen hoch. Ezra am anderen Ende des Sets schüttelt den Kopf und formt mit den Lippen: Nein, nein, bitte, Felix, nein. Das macht mich noch wütender. Wieso sollen wir es klaglos hinnehmen, wenn Declan uns behandelt wie Scheiße unter seinem Schuh? Ohne auf Ezra zu achten, sehe ich Declan direkt ins Gesicht. »Ich habe gesagt: Was für ein Scheißdreck.«
Declan neigt den Kopf zur Seite, verschränkt die Arme vor der Brust, auf den Lippen nur die leise Andeutung eines Lächelns. »Was für ein Scheißdreck denn genau?«
Ich zucke mit den Schultern. »Das hier.« Ich winke ihm mit dem Reflektor zu. »Du.«
Er stößt ein ungläubiges Lachen aus. »Ich bin Scheißdreck?«
»Du hast keine Ahnung von der Regie bei einem Modeshooting«, teile ich ihm mit. »Du bist nur hier, weil du reich bist und dein Dad der Schule einen Riesenhaufen Geld spendet. Selbst verdient hast du es dir jedenfalls nicht.«
Ich sehe, wie Ezra betreten zu Boden blickt, und verspüre einen Anflug von schlechtem Gewissen.
Declan fällt das nicht auf. Er grinst mich an, als wüsste er, dass mich das noch wütender macht. »Du bist doch nur sauer, weil du nicht der Regisseur bist«, sagt er, »und die Aktion hier nichts für deine Bewerbung bei der Brown taugt. Reflektorhalter ist nicht ganz so beeindruckend, oder?«
Leider hat er recht – ich bin wütend, weil ich nicht »Regisseur« auf meine Bewerbung schreiben kann, während Declan diesen Vorteil für sich nutzen kann, zusätzlich zu seinen fantastischen Noten und fast perfekten Testergebnissen, dazu noch sein familiärer Hintergrund … ich weiß, dass er sich auch bei der Brown bewirbt. Ich weiß, dass die Uni seine erste Wahl ist, denn als wir noch miteinander rumgehangen haben, haben wir gemeinsam geplant, auf die Brown zu gehen und einen dualen Abschluss zu machen, Brown und Rhode Island School of Design. Damals hat sich Ezra eingeschaltet und gesagt, er würde mit uns nach Rhode Island ziehen, und wir wären zu dritt, so wie immer. Sonderlich lange hat der Plan nicht gehalten.
Zu allem Überfluss vergibt die Brown University traditionsgemäß ein volles Stipendium unter allen Absolvent:innen der St. Catherine’s. Ich kann mir das College nicht leisten. Mein Dad kann die Studiengebühren nicht bezahlen. Ich werde einen Haufen Kredite aufnehmen müssen und mich vermutlich für den Rest meines Lebens verschulden, nur um Illustration zu studieren – und das, während ich mir niemanden vorstellen kann, der dieses Stipendium weniger braucht oder verdient als der verdammte Declan Keane. Beim bloßen Gedanken, er könnte es bekommen, will ich mir meine Stifte in die Augen rammen.
Declan grinst mich an. »Was? War’s das etwa schon?«
»Lass gut sein«, sagt Ezra zu mir.
Aber ich kann es nicht gut sein lassen. Leute wie Declan sind es viel zu sehr gewohnt, immer ihren Willen durchzusetzen. Er führt sich auf, als wäre er so viel besser und wichtiger als alle anderen. Genau so benimmt er sich mir gegenüber – und auch Ezra gegenüber. Ezra tut, als würde es ihm nichts ausmachen, aber ich könnte jedes Mal ausflippen, wenn ich Declan sehe und mich daran erinnere, wie er uns behandelt hat – wie er uns verraten hat.
»Weißt du was?«, sage ich zu ihm. »Fick dich. Du tust, als wärst du was Besseres, aber du bist nichts weiter als ein erbärmlicher Betrüger.«
Ezra schüttelt den Kopf, als wäre er jetzt sauer auf mich, als wäre er der Meinung, ich würde überreagieren, obwohl er genau weiß, was Declan für ein Arschloch ist. Leah und Marisol stehen ratlos da und starren Declan an, warten ab, was er sagen oder tun wird.
Declan beißt die Zähne zusammen. »Ich bin hier also der Betrüger? Echt jetzt?«
Ezra deutet mit dem Finger auf ihn. »Nein. Fang damit gar nicht erst an.«
Declan verdreht die Augen. »Mann, das meinte ich doch gar nicht.«
Aber die Andeutung ist gefallen – sie ist nicht mehr zurückzunehmen und hängt bitter in der Luft. Declan stößt einen tiefen Seufzer aus, sieht mich nicht an, und aus der Erfahrung zahlloser Auseinandersetzungen mit Declan Keane weiß ich, dass ich diesen Kampf gewonnen habe. Auch wenn seine letzten Worte mir schwer im Magen liegen. Ich habe gewonnen, und unter anderen Umständen würde ich mit Vergnügen hierbleiben und meinen Triumph auskosten – aber Marisol und Leah sehen überallhin, nur nicht in meine Richtung, und Ezra hat diesen überbesorgten Blick, und ich weiß: Wenn ich bleibe, wird er mich alle fünf Minuten flüsternd fragen, ob alles in Ordnung sei.
Ich lasse den Reflektor fallen. »Vergiss es.«
Ich bin erst halb die Treppe runter, da sagt Declan, er sei nicht groß überrascht, genau die Sorte Scheiße würde ich ja immer abziehen. Ich zeige ihm nur wortlos den Mittelfinger und laufe weiter.
2
Die Fahrt vom Union Square aus ist nicht so schlimm wie die Hinfahrt von Bed-Stuy, aber trotzdem brauche ich eine Stunde, ehe ich in Harlem an der 145er aussteige. Ich wohne erst seit einem halben Jahr hier. Früher haben mein Dad und ich ganz in der Nähe von Ezras neuer Wohnung am Tompkin Park gelebt. Ich vermisse Brooklyn wie verrückt, aber unser Vermieter hat die Miete saftig erhöht, und mein Dad konnte es sich einfach nicht mehr leisten. Unter der Woche arbeitet er als Nachtportier in einem Luxuswohnhaus in Lower Manhattan, und manchmal ergattert er zusätzliche Jobs, erledigt irgendwelche Lieferungen oder führt Hunde aus. Ich bekomme wegen meines künstlerischen Talents ein Stipendium, und trotzdem fließt alles, was er verdient, in mich und St. Catherine’s – nur damit ich meiner Leidenschaft für Kunst nachgehen kann. Der Druck, bessere Noten zu schaffen, ein imposantes Portfolio und eine ebensolche College-Bewerbung auf die Beine zu stellen, damit all diese Opfer nicht vergebens waren und ich wirklich auf der Brown angenommen werde … manchmal lastet er so schwer auf mir, dass ich kaum atmen kann.
Dad sagt mir immer, ich solle mir keinen Kopf machen. »Außerdem«, sagt er, »wollte ich schon immer in Harlem leben.« Ich hab keine Ahnung, ob er schwindelt, um mich aufzumuntern, aber tatsächlich hat das Viertel auch etwas Aufregendes an sich. Langston Hughes und Claude McKay und all die anderen Schwarzen queeren Renaissancedichter:innen stammen von hier und haben sich hochgearbeitet. Vielleicht wird Harlem mich aus meiner kreativen Blockade reißen, woher auch immer die kommt, und mich dazu inspirieren, eine großartige Bewerbung und ein fantastisches Portfolio zusammenzustellen – so gut, dass ich nicht nur an der Brown angenommen werde, sondern sogar das volle Stipendium bekomme. Himmel, wie unglaublich wäre das bitte? An der Brown anzufangen wäre, als würde ich all den Declan Keanes der Welt den Mittelfinger zeigen – diesen Leuten, die nur einen kurzen Blick auf mich werfen und befinden, ich sei nicht gut genug für sie.
Ich drücke mir die Kopfhörer in die Ohren, starte Spotify und entscheide mich für Fleetwood Mac, während ich den steilen Hügel runterlaufe, am Park vorbei, den ich um jeden Preis meide, seit ich eines Nachts quer über den Rasen gelaufen bin und plötzlich eine Ratte versucht hat, an meinem Bein hochzuklettern. Ich komme an Starbucks vorbei – dem unmissverständlichen Gentrifizierungssignal in einem Viertel – und am Dollar Tree, dem Fitnessstudio und dem Obststand am Straßenrand. In der Auslage liegen Zitronen, Weintrauben, Erdbeeren und die leuchtendsten Mangos, die ich je gesehen habe. Sie sehen aus wie Miniatursonnen. Ich zücke mein Handy und mache ein Foto für Instagram, obwohl ich mich eigentlich nicht als typischen #foodporn-User bezeichnen würde.
Der Verkäufer starrt mich argwöhnisch an. »Willst du was kaufen?«
Ich zucke mit den Schultern. »Nein?«
»Dann verpiss dich.«
Ich laufe weiter, am chinesischen Restaurant und dem KFC vorbei. Kinder reißen ihre Fahrräder hoch, fahren ein Stück auf dem Hinterreifen und zischen dann die Straße hinunter, ein paar Blocks weiter plärren Feuerwehrsirenen, ein Mann mit bloßem Oberkörper geht mit seinem unangeleinten Shih Tzu spazieren. Das Gebäude, in dem mein Dad eine Wohnung ergattert hat, besteht aus roten Ziegelsteinen, und im Innenhof sitzen ein paar Typen auf dem Rampengeländer. Ich gehe an ihnen vorbei in die Lobby mit ihren braunen Fliesen und Topfpflanzen in den Ecken. In der Nähe der Treppe steht ein Mädchen und telefoniert. Mit dem Aufzug fahre ich in den fünften Stock hoch, gehe einen Flur entlang, der mich an die Korridore in Shining erinnert, und schließe unsere Wohnungstür auf.
»Ich bin zu Hause«, rufe ich, nicht ganz sicher, ob mein Dad überhaupt hier ist. Captain, die mich offenbar im Flur gehört hat, wartet an der Tür auf mich. Sie stürzt sich sofort auf mein Bein, reibt den Kopf daran, macht schnurrend einen Buckel und zuckt mit dem Schwanz hin und her.
Ich habe sie in Brooklyn gefunden, als sie noch ein junges Kätzchen war. An einem Wintertag war ich mit Ezra zu meiner damaligen Wohnung in Bed-Stuy unterwegs, und weil ich Angst hatte, dass sie ohne meine Hilfe sterben würde, habe ich sie mitgenommen. Mein Dad war gar nicht begeistert, hat aber erlaubt, dass ich sie aufwärme und mit Milch füttere, und aus einem Tag sind mehrere Tage geworden, die zu mehreren Wochen wurden, und nach einigen Monaten hat mein Dad zugegeben, dass er sie ebenfalls liebgewonnen hat. Ich beuge mich runter, um Captain hochzuheben, aber da rast sie schon davon Richtung Küche.
Die Wohnung ist kleiner als die alte Wohnung in Bed-Stuy. Die Wände sind beige, der hellbraune Holzboden abgenutzt und voller Kratzer, und im einzigen Wohnzimmerfenster summt die hineingeklemmte Klimaanlage. Technisch gesehen ist es eine Zweizimmerwohnung, aber es gibt eine Art fensterlosen, winzigen Verschlag, der eigentlich als kleines Büro gedacht ist und mir jetzt als Zimmer dient. Der Platz reicht gerade so für meine Doppelmatratze, einen Beistelltisch und die dazwischengequetschte Kommode. Ich hab zu meinem Dad gesagt, dass ich mich fühle, als würde ich in einem Wandschrank schlafen. Es sollte ein Witz sein, aber ich hab mich bereits schlecht gefühlt, noch ehe ich den Satz beenden konnte. Mein Dad gibt wirklich sein Bestes, das weiß ich – und mich über mein neues Zimmer zu beklagen, während er sich für mich und meine Schulbildung totschuftet, war nicht gerade einer meiner Glanzmomente.
Der Holzboden knarrt unter meinen Schritten. In der Küche entdecke ich einen Karton von Jacob’s, dem billigsten und zugleich leckersten Lieferdienst der Gegend: Rindereintopf, Erbsen und Reis, Kochbananen und gebackene Käsemakkaroni. Dad ist also zu Hause – allerdings ist das kein Wunder, denn in ein paar Stunden muss er los zur Arbeit. Mein Dad hatte schon immer seltsame Jobs. Irgendwann hat er mir mal gesagt, dass seine Leidenschaft nicht der Arbeit gilt, sondern seiner Familie. Er wäre vollkommen glücklich damit gewesen, Hausmann und Vater zu sein. Mom hat als Krankenschwester in der Klinik gearbeitet, sie war wohl, nehme ich an, die Hauptverdienerin – aber als sie uns verlassen hat, brach alles zusammen. Jetzt rackert sich mein Vater ab, damit ich auf eine Schule voller reicher Kinder gehen kann und anschließend die Chance bekomme, eine Elite-Uni zu besuchen, während wir so tun, als müssten wir nicht darum kämpfen, uns über Wasser zu halten. Ich höre das Echo von Declan Keanes Stimme in meinem Kopf widerhallen: In Wahrheit sei ich hier der Betrüger. Am schlimmsten ist, dass er damit irgendwie recht hat.
Ich mache es mir im Wohnzimmer gemütlich. Ziehe mir mit den Füßen die Schuhe aus, schnappe mir meinen Laptop, der auf dem Couchtisch steht, und strecke mich auf dem gemütlichen Sofa aus. Und lande, wo ich immer lande: in dem Ordner mit meinen E-Mail-Entwürfen.
Er enthält 472 Mails. Alle sind an dieselbe Empfängerin adressiert: Lorraine Anders. Anders ist jetzt wieder ihr Nachname, seit sie fortgegangen ist und sich von meinem Dad hat scheiden lassen; sie hat den Namen Love abgelegt.
Ich klicke auf Verfassen, um eine neue Mail anzufangen, und tippe Hallo mal wieder in die Betreffzeile.
Hey Mom,
dies ist die 473ste Mail an dich, die ich anfange.
Das ist … ganz schön viel.
Ist das irgendwie seltsam? Würdest du mich für einen Freak halten, weil ich dir seit Jahren all diese Nachrichten schreibe, die ich niemals abschicke, sondern in meinem Entwürfe-Ordner sammle?
Auch diese hier werde ich niemals abschicken. Das weiß ich jetzt schon. Aber vielleicht bringe ich ja eines Tages doch mal den Mut auf, dir wirklich eine Mail zu schreiben, die du dann hoffentlich auch liest, und dann sitze ich vor meinem Laptop und lade ständig meine Mails neu, um zu sehen, ob du schon geantwortet hast. Ich weiß nicht mal, was in dieser Mail stehen wird. Wie geht es dir? Wie ist Florida so? Wie geht es meiner Stiefschwester und meinem Stiefvater? Denkst du manchmal an mich? Liebst du mich noch?
Wie auch immer. Das Sommerprogramm, an dem ich teilnehme, hat gerade angefangen, und ich hatte ein Gruppenprojekt. Um’s kurz zu machen, Declan Keane war auch dabei. Ich hab dir ja schon von ihm erzählt. Er hat mich aufgeregt, so wie immer. Aber – stell dir das mal vor – Ezra war wütend auf mich, weil ich mich mit Declan gestritten habe. Ich meine, was zur Hölle? Marisol war auch da. In ihrer Gegenwart bin ich immer so unbeholfen, und ich wünschte, ich wüsste, wie ich … ich weiß nicht, wie ich ihr beweisen kann, dass sie in Bezug auf mich falschliegt. Ich kann natürlich niemanden zu irgendwas zwingen, aber es fühlt sich einfach so beschissen an, wenn sie mich ignoriert oder so tut, als gäbe sie einen Scheiß auf mich oder meine bloße Existenz. Dann fühle ich mich … na ja, ich würde mal sagen, dann fühle ich mich ein bisschen so, wie ich mich deinetwegen fühle. Nur dass es bei dir noch 10 000 mal schlimmer ist. Weil du nun mal, na ja, meine Mom bist.
Okay, genug Selbstmitleid für heute. Vielleicht gehe ich diese Mails eines Tages mal durch und klicke bei jeder auf Senden, einfach nur, um deinen Posteingang zu überschwemmen. Aber bis dahin …
Dein Sohn
Felix
Die Schlafzimmertür öffnet sich, und mein Dad kommt heraus. Seine Augen sind blutunterlaufen. Schnell klappe ich meinen Laptop zu, dann wird mir klar, dass es wirken muss, als hätte ich gerade Pornos angesehen oder so, aber mein Dad achtet gar nicht darauf. Er trägt sein weißes Hemd samt Krawatte, das Jackett hängt über seinem Arm. Das graue Haar wird licht, und er scheint von Jahr zu Jahr dünner zu werden.
»Hey, Kid«, sagt er, denn er tut sich noch immer schwer damit, meinen Namen zu sagen.
Mein Dad und ich haben uns drei Tage lang nicht gesehen. Das Programm ist eigentlich ein klassisches Sommercamp, nur dass es in der Stadt stattfindet und nicht irgendwo im Wald. Die meisten anderen Teilnehmener:innen wohnen in dieser Zeit auf dem Campus, für »eine immersive kreative Erfahrung«, wie man auf der St. Catherine’s gern sagt, und da die Kurse ganz in der Nähe von Ezras Wohnung stattfinden, bin ich so viel wie möglich bei ihm. Mein Dad hat allerdings gesagt, er hätte mich lieber hier bei sich. Ich habe eingewandt, dass es wichtig für mich sei, vor dem College noch ein bisschen Lebenserfahrung zu sammeln und mich daran zu gewöhnen, allein zu wohnen, was nur zur Hälfte Bullshit war, und am Ende haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt: Ich wohne immer ein paar Tage bei Ezra und dann ein paar Tage zu Hause. Eigentlich der reinste Traum. Nur wenige Teenager haben die Chance, noch vor dem College ohne Erwachsene zu leben.
»Hast du schon was gegessen?«, fragt mein Dad und geht zu den Plastikbehältern vom Lieferdienst.
»Nein«, sage ich, klappe den Laptop wieder auf und schaue nach, wie viele Likes mein #foodporn-Post mit den Mangos schon hat. Zwei bisher: einen von Ezra, den anderen von Ezras Fake-Account.
»Und wie läuft’s bei dir?«, erkundigt sich mein Vater, den Mund voll Käsemakkaroni. »Wie geht es Ezra? Isst du genug und gehst halbwegs pünktlich ins Bett und erledigst deine Arbeit und alles?«
Ich zögere. Ich glaube nicht, dass er wissen will, dass wir bis drei Uhr morgens Gras geraucht haben oder dass ich immer noch darum ringe, meinen Scheiß auf die Reihe zu kriegen.
Er redet weiter: »Ich vertraue auf dein Verantwortungsbewusstsein. Das weißt du, oder?« Dann: »Ach scheiße – gottverdammt, die Katze hat schon wieder überall hingepisst.«
Ich helfe ihm dabei, mit Papiertüchern die Sauerei wegzuwischen, während er etwas darüber vor sich hinmurmelt, dass wir mit Captain zur Tierärztin müssen, und ich sage, dass Captain wahrscheinlich nur gestresst ist. Sie kann die neue Wohnung nicht leiden – das einzige Fenster lässt sich nicht öffnen, und es gibt weder einen Balkon noch eine Feuertreppe; nichts, wo man draußen sitzen könnte. Ich verstehe sie gut. Ich fühle mich in dieser Wohnung auch eingesperrt.
Mein Dad zeigt auf die Rolle Küchenpapier in meiner Hand und sagt meinen Namen – aber nicht meinen richtigen Namen. Er sagt meinen alten Namen. Den, den ich von meiner Geburt bis zum Beginn meiner Transition getragen habe, den er und meine Mom mir gegeben haben. Der Name an sich macht mir nichts aus, glaube ich – aber zu hören, wie er ihn laut ausspricht, wie er mich damit anspricht, fühlt sich immer an wie ein Messer in meiner Brust, in meinen Eingeweiden. Ich tue so, als hätte ich ihn nicht gehört, und meinem Dad fällt auf, dass ihm gerade ein Fehler unterlaufen ist. Kurz herrscht betretenes Schweigen, dann murmelt er rasch eine Entschuldigung.
Wir reden nie darüber. Darüber, dass er den Namen Felix nicht laut ausspricht. Dass er sich ständig vertut und die falschen Pronomen benutzt, ohne sich zu korrigieren. Dass er an manchen Abenden, wenn er ein bisschen zu viel Whiskey oder Bier intus hat, zu mir sagt, dass ich immer seine Tochter bleiben werde, sein kleines Mädchen.
Ich lege die Rolle weg, gehe die zehn Schritte in mein Zimmer und schließe die Tür leise hinter mir.
»Kid«, ruft mein Dad hinter mir her, aber ich antworte nicht, lege mich aufs Bett und starre die flackernde Glühbirne an der Decke an. Captain erscheint wie aus dem Nichts, springt auf meinen Schoß und reibt ihren Kopf an meiner Hand, und ich versuche, nicht loszuheulen, denn ganz egal, wie wütend ich auf meinen Dad bin, ich möchte nicht, dass er mich weinen hört.
Ich warte vor dem grauen Gebäude aus Stahl und Glas, in dem Ezra wohnt, eine Sonnenbrille schützt meine Augen vor dem grellen Sommerlicht. Es ist sieben Uhr morgens, und die Kühle der Nacht liegt noch in der Luft. Ez kommt das Treppenhaus heruntergesprungen und tritt durch die Tür nach draußen, ebenfalls mit Sonnenbrille. Irgendwie kann ich es nicht leiden, wie berechenbar wir gerade sind.
»Was ist denn mit dir los?«, fragt Ezra sofort. Er trägt die Haare offen, scheint sich aber nicht die Mühe gemacht zu haben, sie zu bürsten, und so fallen ihm zerzauste Locken in die Augen. Ezra entgeht es nie, wenn ich angepisst oder durch den Wind bin. Er sagt, er sei ein Empath. Auch wenn ich da so meine Zweifel habe!
»Nichts.« Wir gehen los, aber er sieht mich immer noch von der Seite an und wartet, also sage ich: »Nur mein Dad. Er hat mich mal wieder gedeadnamet.«
»Scheiße«, murmelt Ez. »Tut mir leid.«
Ich zucke mit den Schultern, denn obwohl ich den Impuls habe, »Ist schon okay« zu sagen, ist es das eben nicht. Manche trans Personen wissen von Anfang an genau, wer sie sind, sagen schon als Kleinkind, welchem Geschlecht sie angehören und mit welchen Pronomen sie angesprochen werden wollen, und bestehen darauf, andere Kleidung und anderes Spielzeug zu bekommen. Ich hingegen habe eine Weile gebraucht, um mir über meine Identität klar zu werden. Ich habe es immer gehasst, in Kleider gesteckt zu werden und Puppen geschenkt zu bekommen. Die Kleider und Puppen waren allerdings nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem war, zu verstehen, dass die Gesellschaft beides mit Mädchen assoziiert, und obwohl ich damals den Begriff trans noch nicht kannte, hat mich irgendwas daran, in die Mädchenrolle gedrängt zu werden, schon immer fürchterlich aufgeregt. Ich habe immer versucht, bei den Jungs zu bleiben, wenn die Lehrer:innen uns nach Geschlechtern getrennt haben. Auf dem Spielplatz bin ich den Jungs ständig hinterhergelaufen und war oft traurig, weil sie mich nicht beachtet oder sogar weggeschubst haben. Manchmal habe ich auch geträumt, mich in einem anderen Körper zu befinden – der Art Körper, von dem die Gesellschaft sagt, er sei männlich. Ich war so verdammt glücklich, aber dann bin ich aufgewacht und habe begriffen, dass sich nichts geändert hat. Ich erinnere mich noch daran, wie ich dachte: Wenn ich wiedergeboren werde, dann hoffentlich als Junge.
Erst mit zwölf, vor fast fünf Jahren, habe ich dann dieses Buch gelesen, in dem es eine trans Figur gibt: I am J von Cris Beam. J’s Geschichte zu lesen war … ich weiß nicht, es ging mir nicht einfach nur ein Licht auf, sondern es war, als käme die Sonne hinter diesen ewigen dunklen Wolken hervor, und alles in mir flammte auf in der Erkenntnis: Ich bin ein Typ.
Ich bin verdammt noch mal ein Typ.
Es dauerte noch ein paar Monate, in denen ich viel darüber gegrübelt habe, ob ich wirklich trans bin oder nicht. Ein paar weitere Monate, um zu überlegen, wie ich es meinen Eltern sagen soll. Dann habe ich meinem Vater gesagt, er solle sich im Wohnzimmer hinsetzen, das war noch in unserer alten Wohnung in Bed-Stuy. Mir war zumute, als müsste ich mich jeden Moment übergeben, und ich war so nervös, dass ich nicht mehr herausbekam als »Dad, ich muss dir was sagen« und »Ich bin trans«. Er war ganz still. Er hatte diesen verwirrten Gesichtsausdruck. Und dann hat er gesagt: »Okay.« Aber ich wusste, dass es nicht okay war, nicht für ihn – ich wusste, dass dieses ganze Coming-out nicht gut lief. Dann sagte er, er sei müde, und ging ins Bett, und damit war unsere Unterhaltung vorbei. Am nächsten Tag schrieb ich meiner Mom eine Mail, denn sie lebt mit meiner Stiefschwester und meinem Stiefvater in Florida, seit ich zehn war. Sie hat mir nicht geantwortet. Es war das erste und letzte Mal, dass ich eine Mail an sie tatsächlich abgeschickt habe.
Ich musste fast ein ganzes Jahr lang betteln, bis mein Dad endlich einwilligte, mich für eine Hormonbehandlung zum Arzt gehen zu lassen. Es ist nicht immer leicht, einen Platz für eine Hormonbehandlung zu bekommen, ich hatte also Glück, dass ich die Möglichkeit bekam. Ungefähr zu dieser Zeit stellte sich heraus, dass ich wirklich ein künstlerisches Talent besitze, und mein Dad beschloss, mich auf die St. Catherine’s zu schicken, was großartig war, weil ich nicht mehr zusammen mit Leuten zur Schule gehen musste, die mein altes Ich gekannt hatten. An der alten Schule hatte ich sowieso keine Freund:innen, also war es keine große Sache. Dank jeder Menge Überredungskunst und mit der Hilfe meines Arztes hat mein Vater vor fast einem Jahr schließlich sogar der Mastektomie zugestimmt. Ich weiß, wie glücklich ich mich deshalb schätzen kann. Nicht jede Person, die diese Operation machen lassen will, kann sie sich auch leisten. Mein Vater musste erst eine Menge Papierkram erledigen, Briefe schreiben, jemanden finden, der es macht, und er musste herausfinden, unter welchen Bedingungen meine Krankenversicherung zahlt. Und selbst dann musste er noch aus eigener Tasche dazuzahlen. Ganz egal, wie wütend ich manchmal auf ihn bin – ohne meinen Dad hätte ich niemals mit meiner körperlichen Transition anfangen können. Vielleicht ist es das, was mich am allermeisten verwirrt. Weshalb zahlt er für meine Hormonbehandlung, meine Operation, meine Arztbesuche, all das – weigert sich aber, meinen richtigen Namen auszusprechen?
Ezra hat mich ganz am Anfang meiner Transition kennengelernt. Wir haben im Unterricht nebeneinandergesessen, und der Sarkasmus des jeweils anderen zog uns so sehr an, dass wir irgendwann jede freie Minute miteinander verbrachten. Ezra hat mich immer nur als Felix gekannt. Weder ihm noch irgendjemand anderem habe ich jemals meinen alten Namen gesagt. Ich habe versucht, sämtliche Zeugnisse meines früheren Lebens zu vernichten: Fotos und Videos, auf denen ich lange Haare habe oder Kleider trage oder auf denen irgendein anderes Merkmal zu sehen ist, das die Gesellschaft Mädchen zuschreibt. Dieser Mensch bin ich nicht mehr – ich bin es nie gewesen. Eigentlich ist es witzig, im Grunde habe ich tatsächlich eine Reinkarnation erlebt. Ich habe einen neuen Lebensabschnitt gegonnen, in einer neuen körperlichen Gestalt. Ich habe genau das bekommen, was ich mir gewünscht habe.
Mein Dad hat mich darum gebeten, einige meiner alten Fotos aufzubewahren – zur Erinnerung, weil man nie wissen kann, ob man nicht irgendwann mal daran zurückdenken möchte, wer man früher gewesen ist. Aber in Wirklichkeit ging es nicht darum, was ich wollte. Er wollte diese Bilder gern behalten, als letzten Anker dessen, was ich in seinen Augen mal war oder immer noch bin, und das reicht, damit ich all diese Bilder aus der Welt entfernen will, bis keins mehr übrig ist. Ich habe sie auf Instagram gespeichert, und ich war schon mehrmals kurz davor, sie allesamt zu löschen. Wann immer mein altes Ich in der Galerie aufploppt, wird mir übel. Aber trotzdem behalte ich die Fotos. Es ist seltsam: Er macht mich so wütend, aber trotzdem ist er mein Dad, und auch wenn ich eigentlich nicht glauben sollte, dass ich ihm für seine Hilfe bei meiner Transition etwas schuldig bin, fühlt es sich trotzdem so an. Aber wahrscheinlich ist es im Grunde sowieso egal. Ich habe die Fotos vor der Öffentlichkeit verborgen. Nur ich habe Zugriff auf sie. Es schadet ja nicht, sie zu behalten, bis mein Vater endlich akzeptieren kann, wer ich bin.
Aber … selbst nach meinem Outing, sogar nach dem Beginn meiner Transition habe ich manchmal dieses Gefühl. Dieses Gefühl, dass irgendwas immer noch nicht stimmt. Fragen treiben an die Oberfläche. Diese Fragen ziehen an meinen Ängsten wie an einem Faden, und ich fürchte mich davor, dass sich, wenn ich zu fest daran ziehe, alles auflöst und ich auseinanderfalle. Vielleicht hasse ich es deshalb mehr als alles andere, wenn mich mein Vater mit meinem Deadname anspricht. Denn dann frage ich mich, ob ich wirklich Felix bin, ganz gleich, wie laut ich diesen Namen schreie.
3
Von Ezras Wohnung aus ist es nur ein kurzer Weg zur St. Catherine’s. Wir steigen über Risse im Gehweg und Hundescheiße hinweg, laufen an den Basketball- und Tennisplätzen vorbei und am Park, wo Typen an Klettergerüsten Klimmzüge machen und kleine Kinder unter Aufsicht ihrer Mütter Fangen spielen und kreischen. An der Ecke befindet sich ein brandneuer holzgetäfelter Coffeeshop – kein Starbucks, aber trotzdem schreit alles laut Gentrifizierung. Ich werfe Ezra einen Blick zu. Er ist vielleicht nicht weiß, aber trotzdem besitzt er diese Eine-Million-Dollar-Wohnung am Ende der Straße. Und was ist mit mir? Obwohl wir verdammt arm sind, machen mein Dad und ich doch auch nichts anderes, indem wir nach Harlem gezogen sind, oder?
Die Wohnungen werden zusehends bescheidener, bis uns schließlich lauter Kellerkneipen und Bars umgeben, an deren Türen Regenbogenflaggen wehen, und dann taucht der eingezäunte Campus mit seinen Hecken und Bäumen vor uns auf. St. Catherine’s gehört eigentlich zu einer Kunsthochschule, die ganze vier Blocks einnimmt, hat aber ein eigenes Gebäude in der Nähe des Parkplatzes. Wir sind etwa hundert Schüler:innen, die alle dank ihres Talents oder dank ihres Reichtums oder wegen beidem aufgenommen wurden. Die meisten aus meiner Klasse nehmen am Sommerprogramm teil, um ihr Portfolio für die College-Bewerbung zu ergänzen, und ich brauche bei meinem eigenen Portfolio so viel Hilfe, wie ich nur kriegen kann. Bisher habe ich noch nicht mal ein Thema dafür festgelegt, während alle anderen schon halb fertig sind. Brown hat eine der niedrigsten Aufnahmequoten des ganzen Landes, ich will – ich brauche dieses Stipendium, wenn ich dort studieren will. Natürlich gibt es auch andere gute Colleges, an denen man Kunst studieren kann, und bei einigen habe ich mich auch schon beworben, aber ich weiß nicht … wahrscheinlich will ich beweisen, dass ich für eine Universität wie die Brown gut genug bin.
St. Catherine’s ist ein altmodisches rotes Klinkergebäude mit riesigen, modernen schwarzen Glasfenstern. Ezra und ich schlendern zum Parkplatz, auf dem schon jede Menge anderer Schüler:innen im Schatten der Bäume rumhängt. Automatisch steuern wir auf Marisol zu, die am Gebäude lehnt und sich mit Leah unterhält und raucht, direkt neben dem Schild, das verkündet, dass das Rauchen im Umkreis von acht Metern nicht gestattet ist. Es nervt mich furchtbar, dass ich ihr noch immer nicht in die Augen sehen kann. Sie hat immer diesen Stahlblick drauf, Haare und Make-up sind ebenso perfekt wie die Fingernägel, und auf den Lippen liegt stets dieses leicht arrogante Lächeln. Es gibt Menschen, die sorgsam darauf bedacht sind, nur den Teil von sich zu zeigen, den sie andere sehen lassen wollen. Ich weiß, dass Marisol auch andere Seiten hat. Nur zeigt sie mir die nie.
»Scheiße, ich bräuchte noch so ungefähr fünf Stunden Schlaf«, sagt Marisol und bietet Ezra ihre Zigarette an. »Warum zur Hölle fängt dieses Programm so früh an?«
Ezra klopft die Asche vom Ende der Zigarette. »Wüsste ich auch gern.«
»Ich hab mal eine Studie gesehen«, sagt Leah, »da hat sich rausgestellt, dass es ungesund für Teenager ist, um, sagen wir mal, sieben Uhr morgens aufzustehen. Irgendwas mit unserer biologischen inneren Uhr.«
»Meint ihr, wir sollten Beschwerde bei der Dekanin einreichen?«, fragt Ezra. »Wir könnten offiziell gegen diese Bedingungen protestieren.«
»Ein Sitzstreik«, schlägt Leah vor, »bis der Unterrichtsbeginn auf mittags verlegt wird.«
Marisol schnaubt und spielt mit den Spitzen ihres dichten, lockigen Haars. »Erzähl, wie du das anstellen willst.«
Sie reden weiter, aber ich bin zu abgelenkt, um richtig zuzuhören. Als ich Marisol zum ersten Mal gesehen habe, hat sie mich beeindruckt – und eingeschüchtert. Irgendwas an ihrem Selbstbewusstsein war … berauschend. Marisol weiß, dass sie schön, talentiert und intelligent ist. Sie stellt sich gar nicht erst die Frage, ob sie Liebe und Respekt verdient. Als ich sie letzten Sommer gefragt habe, ob sie mit mir ausgeht, nur wenige Monate nach meiner Mastektomie, war ich noch sehr damit beschäftigt, mich an meinen veränderten Körper zu gewöhnen, verunsichert von all den Blicken der Leute, die mich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen konnten … und ich nehme an, ich hatte gehofft, Marisols Selbstbewusstsein würde irgendwie auf mich abfärben.
Marisol hat nur mit den Schultern gezuckt. »Na klar«, hat sie gesagt, als wäre nichts dabei – und für sie war es das vielleicht auch nicht. Sie hatte schon vorher Dates gehabt, für mich hingegen war es das erste. Unsere drei Dates waren fürchterlich seltsam. Ohne Ezra als Vermittler hatten wir keine Ahnung, worüber wir miteinander reden sollten, und ich merkte deutlich, wie gelangweilt Marisol von mir war – als ich von meinen Acryltechniken erzählte, starrte sie einfach nur ins Leere. Dass sie sich langweilte, kann ich ihr nicht verübeln – ich war furchtbar nervös und plapperte verzweifelt vor mich hin, um das Schweigen zu vertreiben. Bei unserem dritten Date schließlich, wir saßen bei Starbucks, sagte Marisol auf einmal: »Weißt du, ich war mir die ganze Zeit nicht ganz sicher, wieso ich nicht an dir interessiert bin, aber ich glaube, jetzt weiß ich es. Ich finde es einfach nicht richtig, mich mit einem Frauenfeind zu treffen.«
Ich zuckte zusammen, von der plötzlichen Furcht gepackt, versehentlich etwas Sexistisches getan oder gesagt zu haben. »Tut mir leid«, sagte ich automatisch. Und dann: »Wieso bin ich ein Frauenfeind?«
»Na ja«, antwortete sie, »du hast dich entschieden, dass du lieber ein Typ sein willst als ein Mädchen. Und das fühlt sich ganz klar frauenfeindlich an.« Dann erklärte sie mir: »Du kannst nicht gleichzeitig feministisch sein und beschließen, dass du keine Frau mehr sein willst.«
Die Angst wurde von Erschütterung abgelöst, von Wut, dann von Scham. »Okay«, sagte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte. Wir verabschiedeten uns voneinander, und seitdem haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Was sie zu mir gesagt hat, habe ich für mich behalten, ich schäme mich zu sehr, um es irgendwem zu erzählen. Und ein Teil von mir – es fühlt sich an wie ein kleiner Stachel in meiner Brust – fragt sich heute noch, ob sie ganz vielleicht recht hat. Ist eigentlich ganz schön ironisch. Ich hatte mir gewünscht, mit ihr auszugehen, um mir selbst zu beweisen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Doch stattdessen hat sie es geschafft, die langsam immer stärker werdende Vermutung zu untermauern, dass ich es nicht bin.
»Ich geh schon mal ins Klassenzimmer«, sage ich, aber Ezra hört mich nicht; er ist noch immer in die Unterhaltung mit Marisol vertieft, die sich inzwischen um die Frage dreht, ob Hazel und James in der Abstellkammer miteinander rummachen (Leah ist ganz sicher, dass die Antwort Ja lautet). Ezra kann einem hübschen kleinen Drama nie widerstehen, und da er nicht weiß, was Marisol zu mir gesagt hat, hängen die beiden immer noch ständig miteinander rum.
Ich marschiere durch die auseinandergleitenden Glastüren, mitten in die kalte Böe der Klimaanlage (echt jetzt, wieso wird die im Sommer immer bis zum Anschlag aufgedreht?), und schaffe drei Schritte auf dem weiß gefliesten Boden, ehe ich aufblicke.
An den Wänden der Lobby hängen Bilder. Während des Schuljahrs werden hier immer Kunstinstallationen der Schüler:innen gezeigt, also bin ich nicht weiter überrascht. Umso überraschter allerdings bin ich von den Bildern selbst. Es sind Fotos, vergrößert auf 40 x 40 Zentimeter.
Fotos von meinem Instagram-Account.
Fotos von der Person, die ich früher mal gewesen bin.
Langes Haar. Kleider. Bilder von mir mit diesem gezwungenen Lächeln. Ein Gesicht, dem man deutlich ansieht, wie unwohl ich mich fühle. So angespannt, als hätte ich körperliche Schmerzen.
Doch das damalige Unbehagen ist nichts im Vergleich dazu, wie ich mich in diesem Augenblick fühle.
Ich bekomme verdammt noch mal keine Luft.
Langsam nähere ich mich einem der Bilder, blinzle, als könnte ich nicht glauben, dass dies hier wirklich passiert. Unter dem Bild befindet sich ein Schild mit meinem Deadname und dem Aufnahmejahr. What the fuck? What the actual, holy fuck? Diese Fotos habe ich in meinem Instagram-Account auf privat gestellt. Wer um alles in der Welt war das? Wie zur Hölle ist er an meine Accountdaten gekommen?
Ich greife nach oben, versuche, das gerahmte Foto von der Wand zu nehmen. Ich kann es nicht mal ansehen, ohne dass sich mir der Magen umdreht, und so peinlich es ist, ich spüre, wie mir Tränen in die Augen schießen – ich bin zu klein, ich komme nicht dran, und da sind noch sieben weitere Bilder, die ebenfalls abgenommen werden müssen –
Die Tür gleitet beiseite, und mit einem Blick über die Schulter sehe ich ein paar Schüler:innen hereinkommen. Sie bleiben kurz stehen, blicken verwirrt drein, ehe sie – Gott sei Dank – weitergehen.
»Felix?«
Ich drehe mich um und sehe Ezra auf mich zukommen. Seine Lippen formen die Worte What the fuck, während er sich umsieht.
»Ist das … bist das du?«, fragt er.
»Nein, das bin verdammt noch mal nicht ich«, sage ich lauter, als ich wollte.
Er sieht mir in die Augen, und ihm geht auf, was er gerade gesagt hat. »Scheiße – tut mir leid, nein, ich weiß, dass du das nicht bist.«
Ohne ein weiteres Wort tritt er näher, streckt einen Arm an mir vorbei, bekommt den Rahmen zu fassen und nimmt das Bild von der Wand. Er hastet zum nächsten weiter, während ich an der Wand entlang zu Boden rutsche und dort sitze, den Rücken an die Wand gelehnt, und ihm zusehe. Mehrere Schüler:innen – ich glaube, aus dem Bildhauerkurs – kommen herein, blicken auf die Fotos, dann zu mir.
»Hier gibt es verdammt noch mal nichts zu sehen«, blafft Ezra sie an, und sie zucken zusammen und hasten über den Flur davon. Er bewegt sich immer schneller, bis er richtig rennt, von einem Rahmen zum nächsten, bis alle Bilder von der Wand verschwunden sind. Er legt sie aufeinander, sieht sich auf der Suche nach einem Versteck um, dann stellt er sie hinter den Schreibtisch der Wachperson, der jetzt im Sommer nicht besetzt ist. Wer auch immer diese Bilder aufgehängt hat, muss genau auf diese Gelegenheit gewartet haben.
Ich schließe die Augen und ziehe die Knie an die Brust. Ich spüre, wie sich Ezra neben mich setzt, sein T-Shirt streift mich am Arm – unsicher berührt er meine Schulter.
»Alles in Ordnung?«, fragt er leise.
Ich schüttle den Kopf. »Ich glaub, mir wird schlecht.«
»Soll ich dich zur Toilette bringen?«
Wieder schüttle ich den Kopf. »Nein. Nur – sag eine Weile einfach nichts. Lass mich …«
Wir sitzen da. Ich weiß nicht wie lange. Wieder höre ich die Glastür beiseite gleiten, Stimmen und Schritte. Jemand ruft etwas, will von Ezra wissen, ob mit mir alles in Ordnung ist. Er sagt nichts, aber ich spüre, wie er sich neben mir bewegt, als würde er die anderen mit einer Geste weiterscheuchen.
»Ich glaub nicht, dass viele Leute das gesehen haben«, flüstert er mir zu und reibt mir die Schulter. Statt mich zu übergeben, zuckt plötzlich ein entsetzlicher Schmerz in mir hoch, und ich beuge mich ruckartig vor. Tief in meiner Brust steckt ein Schrei fest. Er streichelt meinen Rücken. Die Schulglocke ertönt, und wir bleiben genau dort, wo wir sind.
Ich hole Luft, öffne die Augen, lehne den Kopf an die Wand hinter mir. Ezra beobachtet mich, das Gesicht voller Sorge, die Augenbrauen dicht zusammengezogen. Er schluckt schwer.
Als ich das Gefühl habe, dass ich wieder reden kann, sage ich zu ihm: »Ich will einfach nur wissen, wer zur Hölle das war.«
Er schüttelt den Kopf. »Ich meine – wer konnte es überhaupt auch nur wissen?«
Eine ganze Menge Leute, glaube ich. Ich halte es nicht direkt geheim. Ich verstecke die Narben von meiner Mastektomie nicht, und das Thema ist oft genug in Gesprächen aufgekommen, sodass ich davon ausgehe, dass alle Bescheid wissen. Aber das war noch nie ein Problem. Ich habe gedacht, es würde niemanden groß interessieren.