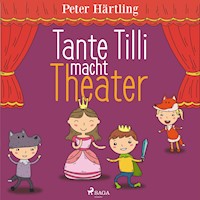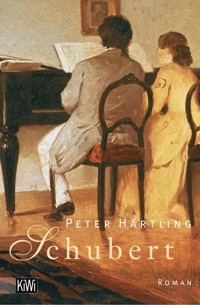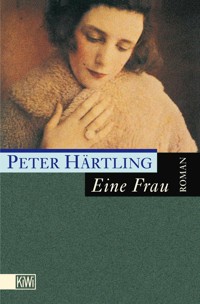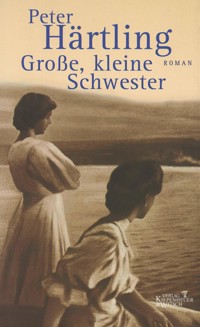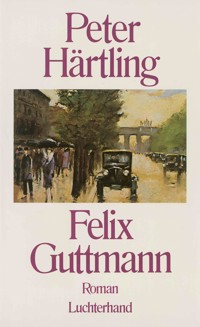
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Protagonist, geboren 1906, wächst behütet auf und beginnt in Berlin das Leben eines jungen Anwalts mit Zukunft. Distanziert beobachtet er die politischen Geschehnisse und versucht, sich der täglichen Gewalt und bindenden Verpflichtungen zu entziehen. Erst nach der 'Machtergreifung' fühlt er sich als Jude und hilft den Exilierten, bis er, spät genug, selbst nach Palästina entkommt. Trotz aller Schrecken fühlt er sich weiterhin als Deutscher und kehrt nach Kriegsende zurück. (Stiftung Lesen ).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Peter Härtling
Felix Guttmann
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Härtling
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Härtling
Peter Härtling, wurde 1933 in Chemnitz geboren. Er arbeitete als Redakteur bei Zeitungen und Zeitschriften. Anfang 1967 Cheflektor des S. Fischer Verlages in Frankfurt am Main, dort von 1968 bis 1973 Sprecher der Geschäftsleitung, seit 1974 freier Schriftsteller.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der Protagonist, geboren 1906, wächst behütet auf und beginnt in Berlin das Leben eines jungen Anwalts mit Zukunft. Distanziert beobachtet er die politischen Geschehnisse und versucht, sich der täglichen Gewalt und bindenden Verpflichtungen zu entziehen. Erst nach der ›Machtergreifung‹ fühlt er sich als Jude und hilft den Exilierten, bis er, spät genug, selbst nach Palästina entkommt. Trotz aller Schrecken fühlt er sich weiterhin als Deutscher und kehrt nach Kriegsende zurück. (Stiftung Lesen).
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Die Erstausgabe erschien 1985 im Hermann Luchterhand Verlag, Darmstadt und Neuwied.
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Kalle Giese, Darmstadt
ISBN978-3-462-30083-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Teil I: 1906–1924
1 Erinnerung an eine Figur, die es nicht sein wird
2 Das grüne Floß
3 Jona auf dem Tisch
4 Die falsche Adresse
5 Eine Veränderung
6 Casimir
7 Spiegel der Liebe
8 Coda
Teil II: 1925–1932
9 Der erste Tag
10 In falscher Gesellschaft
11 Mirjam
12 Drei Absagen
13 Ansichten eines Sommers
14 Jonas Rede für den Doktor
15 Telefonspiele
16 Der erste Fall: Eine Ballade für Kuddel
17 Vorzeichen
18 Zwei Friedhöfe
19 Jahreswende
Teil III: 1933–1977
20 Vogelfrei
21 Im Amt
22 Gespräch mit Eichmann
23 Felix
I(1906–1924)
Wie ein See, durch den das starke Treiben
eines jungen Flusses wühlt,
ist die ganze Stadt von Jugend und Heimkehr
überspült.
Ernst Stadler
1Erinnerung an eine Figur, die es nicht sein wird
Ich traue ihm alles zu. Er könnte wieder, wie vor Jahren, unerwartet im Treppenhaus stehen, nach den Kindern rufen, in der Küche nachsehen, was es zum Abendessen gibt, mich knapp grüßen, sich dann auf die Terrasse setzen, den abgenutzten Hut auf den Knien, und, kaum haben wir das Gespräch begonnen, wieder aufstehen und sich verabschieden. Er geht durch den Garten, zur Pforte hinaus, den Mantel, wie immer, offen, den Hut wieder auf, klein, sehr klein, doch unverletzbar, merkwürdig dauerhaft.
Nie hätte ich ihm gestanden, was ich ihm jetzt nachrede: daß er mein Freund gewesen ist, mehr noch, daß er mir, nach einer langen vaterlosen Zeit, den Vater ersetzt hat.
Er half, mischte sich freundlich und hartnäckig ein, nahm teil, erkundigte sich, war eines unserer Kinder krank, regelmäßig und besorgt nach seinem Befinden. Er zählte uns zu seiner großen, über die Welt verstreuten Familie. Litt er unter Schmerzen oder quälten ihn Erinnerungen, unterließ er es, uns zu besuchen, warf nur Briefe ein, kurzgefaßte Botschaften. Er ließ sich tagelang nicht sehen und kostete es aus, uns zu fehlen.
Manchmal, war er gut gelaunt, spielte er mir auf dem Flügel, auf dem sich Zeitungen stapelten, Chansons vor, Lieder, die er vor langer Zeit selbst komponiert hatte.
War ich verreist gewesen, mußte ich, kaum heimgekehrt, damit rechnen, daß das Telefon schellte, und er mich zu sich bat: Kommen Sie, aber gleich, und erzählen Sie. Ich bin ein alter Mann, erlebe nicht mehr viel. Was nun wirklich nicht zutraf. Jeder Tag bescherte ihm in seinem Büro neue Geschichten, die ihn vergnügten oder verdrossen, die er weiterdachte, deren gutes oder schlimmes Ende er voraussah. Dummheit und Gemeinheit seiner Klienten konnten ihn aufbringen, aber er redete von ihnen, als wisse er für jeden einzelnen ein besseres Leben, einen klügeren Kopf; seine Reserve an Freundlichkeit war unerschöpflich. Nur von sich gab er so gut wie nichts preis. Rechtsanwalt A. B., preußischer Jude mit israelischem Paß, 1948 zurückgekehrt nach Deutschland, von dem er mitunter schwärmte wie von Atlantis.
Ich habe ihn geliebt.
Das Haus, in dem wir seit beinahe zwanzig Jahren wohnen, in dem die Kinder groß wurden, verdanken wir ihm. Kommen Sie, schauen Sie sich den Kasten mal an. Sie müssen sich ja nicht gleich entscheiden. Was er allerdings voraussetzte. Er führte mir das Haus vor, füllte die Zimmer mit Leben, mit Zukunft, bagatellisierte den Schuldenberg, der mich einschüchterte.
Worüber regen Sie sich auf? Die meisten leben von ihren Schulden. Es genügt, wenn Sie mit ihnen leben. Als wir einzogen, wartete er mit mir auf den Möbelwagen, beruhigte mich, ließ mich nicht aus den Augen, als fürchte er, ich könnte im letzten Moment meinen Entschluß widerrufen.
Wie viele Umzüge, wie viele Einzüge, sagte er. Wenn die Möbel erst einmal an ihrem Platz standen, habe ich sie nie mehr umgerückt. Vielleicht aus Furcht, aus Aberglauben. Für Lampen, sagte er, müssen Sie sofort sorgen. Licht braucht man, Licht ist wichtig. Ich folgte seinem Rat. Den eilig eingekauften Lampen ist bis heute der damals gewährte Mengenrabatt anzusehen.
Auf einer Bücherkiste sitzend, beobachtete er, wie ich die Möbelträger dirigierte. Als sie das Klavier hereinschleppten, sprang er auf, drängte sie, sich zu beeilen, er wolle das Instrument ausprobieren. Zum ersten Mal hörte ich ihn spielen. Nun adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Warum gerade dieses Lied? Was ging ihm durch den Kopf? Welcher Abschied, welche Ankunft?
Es ist verstimmt, meinte er, hören Sie? Die Reise – danach sind Klaviere nie in Ordnung.
Er sah nach uns, viele Jahre. Bis er eines Tages nicht mehr erschien und die Kinder nach ihm fragten.
Er könnte wiederkommen. Ich trau es ihm zu. Dann könnte ich ihn endlich ausfragen. Ab und zu, wenn ihn ein Stichwort anrührte, wenn ihn ein alter Schlager im Radio sentimental stimmte, kramte er Fotografien aus Mappen, lachte, schob mir die Bilder zu wie Karten aus einem unvollständigen Spiel: das schmächtige Kind im Matrosenanzug, der junge Mann auf dem Kurfürstendamm, elegant aber ein bißchen zu herausfordernd gekleidet, der Theatergänger im schwarzen Anzug vor der Jahrhunderthalle in Breslau oder der in ein Gespräch mit einer Frau vertiefte Kibbuznik in Haifa.
Auf einem Spaziergang, kurz vor seinem Tod, begann er zu erzählen: Wissen Sie, wie meine Nachbarin in der Bleibtreustraße mich nannte? Ich hörte es zufällig. Meine Zeit als Assessor hatte ich hinter mir, mich eben als Anwalt niedergelassen. Die Wohnung diente mir als Büro. Das Schild für die Tür war zwar graviert, doch noch nicht angebracht. Ich stand unten im Treppenhaus, ein älterer Herr war mir eben vorausgegangen. Ich hörte ihn fragen: Wissen Sie, wo ich Herrn Doktor B. finde? Meine Nachbarin erwiderte:
Ja, das weiß ich. Das ist der kleine Herr von nebenan.
Er ging fröstelnd, den Hut in die Stirn gezogen, neben mir her, und plötzlich blinzelte er mir zu. »Der kleine Herr von nebenan.« Es war ein Zuruf, es könnte ein Anfang sein. Ich weiß viel zu wenig von ihm. Was ich am Ende meiner Erzählung von ihm wissen werde, würde ihm womöglich fremd sein. Ich habe ihm, um ihn zu finden, einen andern Namen gegeben: Felix Guttmann.
2Das grüne Floß
Kindheiten sind, wie alle Anfänge, einander ähnlich und dennoch unvergleichbar. Das erste Glück, der erste Schreck, die erste Angst, die erste Liebe. Zum ersten Mal eine fremde Gegend erkunden, zum ersten Mal allein im Garten, im Hof sein, zum ersten Mal allein in der Wohnung schlafen, zum ersten Mal einen Freund finden, zum ersten Mal die Eltern belügen, zum ersten Mal die eigene Haut spüren wie eine fremde, zum ersten Mal verreisen, zum ersten Mal die Berge oder das Meer sehen, zum ersten Mal eine Taste auf dem Klavier niederdrücken, zum ersten Mal auf eine Straßenbahn aufspringen.
Wie soll ich mit ihm beginnen?
Er sitzt im Gras, nicht auf einer Wiese, auf einem winzigen Rasenfleck, einem grünen Floß, das von fünf weiteren Flößen begleitet wird, die ein schmaler Kiesstreifen voneinander trennt. Manchmal sind zwei oder drei Flöße von Kindern aus den Häusern, die den Hof umschließen, besetzt. Die Häuser ragen hoch hinauf, sechs Stockwerke.
Er hat sein Floß nicht selber entdeckt und erobert. Elena hat ihn, unter begütigendem Gemurmel, in den Hof hinuntergetragen, auf dem grünen Viereck abgesetzt, ihn mit einer gelb angemalten Ente und einem Stoffesel allein gelassen. Er solle sich nicht schmutzig machen und das Sonnenhütchen nicht vom Kopf reißen. Ihr Schatten fiel über ihn, und ihre aufgeregte Freundlichkeit war ihm lieber als die Sonne, die Elena für gesund hielt. Dann zog sie sich schrittchenweise zurück, und er wußte nicht, ob er gleich schluchzen solle, um sie zurückzuholen, oder ob es sich nicht doch lohne, das Floß auszuprobieren und die andern Kinder im Hof zu beobachten. So blieb er still, blickte sich um. Die Kinder kamen näher, setzten sich auf eins der andern Flöße, starrten ihn an, aber sie redeten und spielten nicht mit ihm. Auch später nicht, als er ohne Elenas Hilfe in den Hof konnte und schon viel mit sich selber sprach. Etwas an ihm schien die Kinder zu bremsen. Er war feiner angezogen als sie, und keines wurde wie er regelmäßig von einer Elena besucht, sondern ab und zu rief es aus einem der Fenster, und dann sauste eines der Kinder ins Haus.
Bald liegen neben dem Esel, den er schont und liebt, Bücher im Gras. Er gibt vor, sie lesen zu können, blättert eifrig, spricht auf die aufgeschlagenen Seiten ein, betrachtet immer wieder die Bilder, auf denen Kamele und Beduinen durch die Wüste ziehen, herausgeputzte Damen unter Sonnenschirmen auf Parkwegen spazierengehen oder Matrosen an der Reling eines gewaltigen Schiffes aufgereiht stehen und salutieren. Auf seinem Lieblingsbild blickt der Kaiser, geschützt von einem Baldachin, angestrengt in die Ferne. Das ist der Kaiser, hat ihm Elena erklärt, als er fragte, wer der traurige Mann in der schönen Uniform denn sei. Wenn Papa auf den Kaiser zu sprechen kam, veränderte sich seine Stimme, wurde feierlich. Er sagte nie nur, wie Elena: der Kaiser. Er sagte stets: Unser Kaiser. So, als wären die beiden Wörter zusammengewachsen.
Zum Mittagessen holt Elena ihn nicht ab. Sie will die Töpfe in der Küche nicht unbewacht lassen, und auch Mutter beansprucht ihre Hilfe. Vom Balkon ruft sie ihn, wie es die andern Mütter auch tun. Felix! Jedesmal vergnügt es ihn, wie die Häuserwände mit seinem Namen spielen, sich die Silben zuwerfen, Fe- Fe- lix- lix- lix. Sofort packt er die Bücher und den Esel in das kleine Lackköfferchen. Papa kann es nicht ausstehen, wenn er trödelt und zu spät kommt. Stets sitzt er als erster am Tisch, die Serviette um den Hals gebunden.
Wasch dir die Hände und das Gesicht! Das geht nicht ohne Elenas Hilfe. Der Krug ist zu schwer, aus dem sie Wasser ins Lavoir gießt. Er stellt sich auf die Zehenspitzen, lugt über den Rand der Schüssel, wo er seine Hände wie abgelöst von seinen Armen schwimmen sieht. Guck, Elena, meine Hände. Aber sie begreift seine Verwunderung nicht, schüttelt den Kopf: No ja, Jungchen, was sonst?
Bei Tisch dürfen nur Vater und Mutter sprechen. Elena höchstens dann, wenn sie gefragt wird. Elena gehört zur Familie, seitdem er auf der Welt ist. Sie ist mit Mutter verwandt, doch entfernt, worauf Mutter Wert legt. Sie ist vieles nebeneinander: Dienstmädchen, Kindermädchen, manchmal Verkäuferin in Vaters Geschäft und natürlich auch Tante. Er weiß, worüber sie sprechen, worüber Vater spricht. Über das Geschäft, das ihm Sorgen macht. Über die teuren Engländer. Nur ist er ohne die feinen englischen Tuche der Konkurrenz nicht mehr gewachsen. Bei der noblen Kundschaft, die er sich herangezogen hat. Jedesmal, wenn Vater auf Kunden zu sprechen kommt, die er sich herangezogen habe, sieht Felix eine Schar von winzigen würdigen Herren, viel kleiner als er, die Vater im Lauf der Jahre wie junge Hunde mühevoll aufgepäppelt hat, bis sie genügend in die Höhe geschossen waren, um ausreichend Tuch von ihm kaufen zu können, das Elena dann zu Jona Rosenbaum bringen mußte, dem Schneider, mit dem Vater, wie er sagte, ein Herz und eine Seele war und den er den herangezogenen Herren eindringlich empfahl. Bei Rosenbaum, der ein falscher Onkel war, also mit den Eltern nicht verwandt, suchte Felix, sobald Mutter ihm erlaubt hatte, auch auf die Straße zu gehen, oft Zuflucht. Der Schneider wohnte um die Ecke, ein Messingschild am Hauseingang bezeugte sein Können, sein Ansehen. Zwei Gesellen und eine Büglerin arbeiteten für ihn, was Vater gelegentlich beim Mittagessen, wenn er sich mit Jona Rosenbaum beschäftigte, als übertriebenen Aufwand bezeichnete. Jona lebte allein. Eine unerklärliche Krankheit hatte seine Frau dahingerafft. Felix stellte sich vor, daß eine Riesenhand sie gepackt und mitgerissen hatte, zum Entsetzen von Jona, der dem Ereignis, mit gekreuzten Beinen auf dem Schneidertisch sitzend, hilflos zusah.
Der Statur nach hätte Jona nicht Schneider sein dürfen. Er war übermäßig dick, ein runder Kopf, ein Bauch, unter dem zwei kurze stämmige Beinchen hingen. Den Tisch, sein Arbeitsfeld, erklomm er mit Hilfe eines Schemels. Wenn er mühsam auf der Platte seinen Platz gefunden hatte, mußte er erst einmal verschnaufen. Jona ißt so gut wie nichts und schwillt dennoch, meinte Vater, er ist gefüllt mit Luft. Außerdem litt Jona unter einer Hasenscharte. Die hatte ihn zu einem aufmerksamen Zuhörer werden lassen. Er vermied jeden unnötigen Satz.
Wenn Felix ihn besuchte, und das tat er oft, saß er unterm Tisch. Er hörte Jona über sich und fühlte sich geborgen. Um Jona zu unterhalten, erzählte er, was er in den Büchern gesehen und gelesen hatte. Beinahe alles, was in der Straße, in der Stadt, im Land und auf der Welt vor sich ging, was in den Zeitungen stand oder was Felix in seinen Büchern fand, kommentierte Jona mit dem Satz: Es wird nicht gutgehen. Er sprach ihn keineswegs traurig aus oder bitter, sondern mit heiterer Gewißheit.
Nur selten gelang es Felix, mit einer Frage Jona zu einem längeren Gespräch zu bewegen. Weißt du, wie viele Anzüge du schon genäht hast, Onkel Jona?
Jona ließ verdutzt die Weste sinken, die er mit grauer, glänzender Seide fütterte, sein Blick richtete sich nicht gegen die sauber tapezierte Wand der Schneiderstube, sondern in eine Ferne, die mit seiner Vergangenheit zu tun haben mußte und mit all den Anzügen, die er genäht hatte. Du stellst Fragen, Felix. Was weiß ich. Wenn ich wollte, könnte ich sie zählen; ich habe von Anfang an Buch geführt. An meinen ersten entsinne ich mich noch gut, den ersten selbständigen, versteht sich. Das war noch in Lodz, wo ich aufwuchs, wie deine Mutter. Dort gibt es noch reichere Leute als in Breslau. Sie verjuxten das Geld wie es ihnen beliebte. Häufig hatten sie schlimme Einfälle, kann ich dir sagen. Einen der jungen Stutzer, einen Fabrikantensohn, konnte mein Meister nicht leiden und ich ebensowenig. Er verlangte innerhalb von zwei Tagen einen Frack, obwohl er schon zwei besaß; wütend überließ der Meister die Arbeit mir. Ich solle mich nicht sonderlich mühen. Der Frack war zum Termin fertig, allerdings hatte ich ihm die Ärmel zugenäht. Der Bursche beschwerte sich nie. Vermutlich hat er ihn kein einziges Mal angezogen. Es wird nicht gut ausgegangen sein mit ihm.
Ohne Jona wäre Felix nie darauf gekommen, über seinen Namen nachzudenken. Wieso auch? Seit eh und je wurde er so gerufen, und sogar im Traum hörte er auf ihn. Daß die Eltern auch andere Namen erwogen haben, konnte er sich nicht vorstellen. Jona wußte es besser.
Inzwischen ging er ein halbes Jahr zur Schule, Oberlehrer Sawitzki war mehr als zufrieden mit ihm, hatte es die Eltern auch wissen lassen, und Jona prophezeite ihm, ganz gegen die Regel, einen steilen Aufstieg. Das habe vielleicht mit seinem Namen zu tun. Hätte sich nämlich Guttmann, sein Vater, durchgesetzt, hieße er Leo, nicht Felix. Da Namen magische Wirkung ausübten, wären ihm bei Leo Muskeln unterm Fell gewachsen, eine Mähne um den Kopf und mit dem Verstand haperte es. Natürlich sei es riskant, mit dem Namen Glück zu beschwören – Felix! Aber schon immer habe der höhere Blödsinn die Welt regiert: Tu felix Austria, nube et impera. Das sei Latein. Bald werde er auf dem Gymnasium lernen, was dieser Ausspruch bedeute: Du, glückliches Österreich, herrsche und heirate. In der Vorstellung von Felix heiratete und regierte ein Felix Austria, unanfechtbar ein Prinz, den er sich als seinen Schutzpatron wählte. Aber das sagte er Jona lieber nicht.
Mit Felix Austria verbündete er sich, brach zu Abenteuern auf, wenn er bei Tisch schweigen mußte. Vater kaute jeden Bissen sorgfältig durch, ehe er ihn schluckte, das diene, so habe er aus einem wissenschaftlichen Artikel erfahren, der Verdauung. Darum mußte Felix immer wieder Pausen einlegen, um nicht vor ihm mit dem Essen fertig zu sein, was sich nicht gehörte. Sobald Vater den letzten Schluck aus dem Wasserglas trank, sich die Serviette vom Hals riß, durfte Mutter ungefragt reden; sie unterließ es meistens, nickte Elena auffordernd zu, und Elena begann, den Tisch abzuräumen. Du darfst dich jetzt ein wenig ausruhen, sagte Mutter. Im Grunde meinte sie: Du mußt. Sie mochte ihn nicht nötigen. Ihre Freundlichkeit machte sie oft umständlich, worüber Vater wütend wurde; sie ließ sich nicht beirren.
Bitte, Felix.
Ja, Mama, ich geh schon.
Elena wird dir helfen.
Das muß sie nicht.
Dennoch wird Elena ihn auf den Balkon begleiten, ihn auf dem Liegestuhl in die Decke wickeln, weil es so Übung ist. Diese Kur verdankte er Doktor Loebisch. Ehe er eingeschult wurde, ließ ihn Mutter untersuchen.
Doktor Loebisch widmete sich jedem Körperteil, bat ihn sogar, sich zu bücken, schaute ihm in den Hintern. Nachdem Mutter ihm beim Anziehen geholfen, die Jacke in Form gestrichen und geklopft hatte, erfuhren sie, worunter er litt: Es sei nichts, fing der Doktor zu erklären an, und doch mache der Junge ihm Sorgen. Die Konstitution. Das Kind wächst zu langsam. Mit Eisenwein, Lebertran, kräftigenden Mitteln können wir zwar nachhelfen, sich bewegen und essen muß er schon selbst. Nach der Schule und dem Mittagsmahl soll er mindestens eine Stunde ruhen. Wenn möglich im Freien, in der frischen Luft.
So hatte der Küchenbalkon endlich seinen Nutzen. Hier lag er, im Winter wie im Sommer, hörte die Kinder unten lärmen, wußte, daß sie sein Floß besetzt hatten. Im Halbschlaf träumte er davon, daß er mit einem Schlag wuchs, stark wurde, die Jungen unten verprügelte; alle würden ihn fürchten und bewundern, auch das blondzöpfige Mädchen in dem karierten Kleid würde mit ihm zur Schule gehen. Doch kein Muskel schwoll, kein Knochen streckte sich. Die Konstitution nahm keine Rücksicht auf Felix Austria.
Felix, rief Elena aus der Küche, es ist Zeit. Er wickelte sich aus der Decke, legte sie säuberlich zusammen. Mutter wartete auf ihn im Wohnzimmer. Nicht, um ihm bei den Hausaufgaben zu helfen, sondern um ihn dabei zu beaufsichtigen. Er schweife mit den Gedanken sonst zu viel ab und brauche zu lang. Das stimmte. Schon um ihrer Obhut zu entkommen, beeilte er sich.
Wenn Fibel und Schiefertafel in den Ranzen geräumt sind, kannst du gehen, Felix.
Ja, Mama.
Doch wohin?
Es ist seine Frage wie meine. Es ist die Frage der Schwächeren und Einzelgänger. Ich glaube, er könnte die Kinder überlisten, es gar nicht erst zu einer Prügelei kommen lassen, mit ihnen verhandeln und auf diese Weise sein Floß zurückerobern. Und vielleicht lassen sie ihn danach sogar in Ruhe.
So hat er, ein Siebenjähriger, nicht gedacht. So hat er denken gelernt. Er hat sie, ich bin sicher, tagelang vom Küchenbalkon aus beobachtet. Jeden einzelnen. Nicht alle kennt er beim Namen. Manchmal hat er sie durcheinandergebracht, und der auftrumpfende Friedrich im Russenkittel entpuppte sich als Jan. Der gab zwar schrecklich an, doch wenn der Hausmeister sich eines der Kinder herausgriff, wenn eine der Mütter wütend den Hof heimsuchte, wenn die Kinder untereinander Krach hatten, griff selbstverständlich Wilhelm ein; er war, spillerig und eine runde Brille auf der platten Nase, seinem Freund Jan an Schläue und Verstand bei weitem überlegen. Auf seine Einflüsterungen hörten alle Kinder. Selbst Grete, die manchmal ihren Kopf durchsetzte und, wenn das nicht gelang, in einer Hofecke schmollte. Sie war, das wußte Felix, die Tochter des Lehrers, den Vater einen anständigen Mann nannte und der zu seinen Kunden zählte.
Nie haben sie sich mit ihm abgegeben, immer haben sie ihn ausgespart. Und als er nun für ein paar Tage fehlte, nahmen sie sein Floß in Besitz, spielten weiter, als hätte er nicht drei Jahre lang unter ihnen gesessen und allein für sich gespielt.
Er schaute auf die Flöße hinunter, auf denen die Hofkinder lärmend dahintrieben. Er haßte, er verwünschte sie. Das würde ihm, wollte er sein Floß zurückerobern, nichts helfen. Er mußte sie überreden, überrumpeln. Aber wie? Sollte er ihnen Geschenke anbieten, ein paar seiner Spielzeuge, seiner Bücher? Würden sie ihn auslachen und davonjagen? Würde ihn Jan, aufgewiegelt von Wilhelm, in den Schwitzkasten nehmen, wie er es manchmal mit anderen Jungen tat, die nicht nach seiner Pfeife tanzten oder neu in den Hof kamen? Oder sollte er ihnen erlauben, sein Floß zeitweise zu benutzen? Wenn er auf dem Balkon ruhen mußte, blieb es sowieso frei. Aber würden sie es, wenn er hinunterkäme, auch gleich räumen?
Er hat die Schulaufgaben erledigt, saust aus dem Zimmer, ehe Mutter noch etwas sagen oder auftragen kann. Auf einem Treppenabsatz bleibt er stehen, hält den Atem an, kneift die Augen zusammen. Die Angst ist verflogen, er hat das Gefühl, zu wachsen, ein anderer zu sein, einer, der er immer schon hätte sein können, den er sich nur nicht zugetraut hat. Einer wie Robinson, nein, eher einer wie Lilienthal, der ausgelacht wurde, als er seinen Flugapparat baute, der allen davonflog und berühmt wurde. So einer. Sie trauten ihm nichts zu. Er war anders als sie, er wußte es besser.
Er kehrte noch einmal um, klingelte, Elena öffnete ihm, er ließ sie gar nicht zu Wort kommen, rannte in sein Zimmer, suchte hastig nach ein paar alten Spielsachen, zog zwei Bilderbücher aus der Truhe, schlug einen Haken, als Elena ihn aufzuhalten versuchte, hüpfte nun ohne Zögern die Treppe hinunter und stand, schneller als er wünschte, in der offenen Tür zum Hof. Er sah sie alle auf einmal, atmete ein, und die Luft blieb wie ein Knebel in seinem Schlund stecken. Langsam ging er los. Mit jedem Schritt schrumpfte er, wurde er kleiner, dünner, schwächer.
Wilhelm redete auf Jan ein. Die anderen Kinder rotteten sich um die beiden Anführer zusammen, nur Grete blieb für sich. Sie starrte ihn an, bohrte selbstvergessen in der Nase. Niemand rührte sich vom Fleck. Jetzt würde er reden müssen, reden, dürfte sie aber nicht zu Wort kommen lassen, auf keinen Fall.
Da, das könnt ihr haben, das schenke ich euch, sagte er. Ich bin jetzt wieder hier. Ihr müßt mich auch aufs Gras lassen. Ich bin krank gewesen.
Grete zog den Finger aus der Nase und lachte. Aber in der Schule warst du trotzdem, rief sie.
Ja, sagte er.
Also, rief Wilhelm, warst du krank oder warst du nicht krank?
Ich war krank. Bestimmt.
Du lügst. Jan trat einen Schritt auf ihn zu. Von ihm durfte er sich nicht einschüchtern lassen. Er mußte sich an Wilhelm halten. Mit Jan war nicht zu reden, der würde sofort schlagen.
Wilhelm, rief er und hielt wie eine Signaltafel die Bücher hoch.
Wilhelm hielt Jan nicht auf, musterte Felix vom Scheitel bis zur Sohle und fragte überraschend: Wie heißt du überhaupt?
Felix.
Und wie weiter?
Guttmann. Und wie heißt du?
Jan war nicht mehr weit entfernt. Es mußte ihm gelingen, den Handlanger Wilhelms aufzuhalten, mit einem Wort oder mit einem Geschenk, nur zurückweichen durfte er nicht, dann wäre alles verloren.
Wilhelm. Wilhelm Degenfeld.
Dann kenn ich deine Mutter.
Das glaube ich nicht.
Jan war stehengeblieben. Offenbar begann ihn ihre Unterhaltung zu interessieren.
Doch, das ist die mit den Blumen.
Gretes Gelächter steckte die andern an. Sie lachten, warfen die Hände über den Kopf, hielten sich den Bauch, Jan begann, von einem Fuß auf den andern zu hüpfen. Ihr Lachen sprang die Häuserwände hoch und stürzte in Echos ab. Nur Wilhelm war ernst geblieben. Ihr seid blöd. Was er sagt, stimmt. Das mit den Blumen.
Es wurde still. Die Kinder glichen, verdreht und erschrocken, Figuren auf einer abgelaufenen Spieluhr.
Mama mag Blumen, sagte Wilhelm.
Der Kampf war fast gewonnen.
Meine Eltern kennen deine Mutter. Vater sagt immer: Die Dame aus dem vierten Stock kommt jeden Tag mit einem schöneren Strauß.
Ja, das ist sie. Wilhelm nickte.
Einmal hat sie meiner Mutter einen Strauß Margeriten geschenkt.
Ist das wahr?
Du kannst ja deine Mutter fragen.
Wilhelm ging betont lässig auf Jan zu und erklärte: Er kann sein Wiesenstück haben. Er sagte Wiesenstück. Felix war nah dran, ihn zu verbessern, zog es jedoch vor, den durch die mütterlichen Blumen gesegneten Frieden nicht zu stören und wagte ein paar Schritte auf sein Floß zu. Die Kinder machten ihm Platz. Eines der Kleinen räumte seine Sachen beiseite.
Er hatte, stellte er erstaunt fest, nichts verschenken müssen, kein Buch, kein Holztier. Ein paar Sätze genügten, ein paar Worte. Es mußten nur die richtigen sein. Und Glück hatte er dazu gehabt, denn er konnte nicht ahnen, wie sehr Wilhelm an seiner Mutter hing.
Er legte, so wie er es gewöhnt war, das Spielzeug und die Bücher um sich herum, ein schützender Kreis, schaute nicht um sich, wartete, ob der Frieden anhalten würde. Grete traute sich als erste bis an die Kante seiner Insel.
Warst du wirklich krank?
Ja.
Was hast du denn gehabt?
Wie sollte er das erklären? Daß ihn Doktor Loebisch zu dünn und zu schwach fand, daß er nicht wachse, wie es sich gehöre?
Die Konstitution.
Was? Grete riß den Mund auf und sah ihn an, als breche diese unverständliche, aber gewiß schreckliche Krankheit ihm schon durch die Haut.
Ist das sehr schlimm?
Ach was, das gibt sich, da mach ich mir nichts draus. Grete schob sich, sichtlich erleichtert, ganz aufs Floß, setzte sich neben ihn und fuhr entschlossen mit dem Finger in die Nase.
Auch danach freundete er sich mit keinem der Kinder an. Manchmal ließ er sich von ihnen ins Spiel ziehen, achtete darauf, Jan nicht zu nahe zu kommen, schloß sich Wilhelm ein wenig an, der ihn seiner Mutter vorstellte, mit der er allein lebte – sein Vater sei kurz nach seiner Geburt gestorben. Und Grete führte ihm in seinen Träumen vor, daß sie unter ihrem Kattunkleid keine Hosen anhatte.
Laß dich nicht mit diesen Dreckfinken ein, warnte Elena, die ihm seit eh und je einen »feinen Freund« wünschte und sich nicht erklären konnte, weshalb er in der Schule denn keinen Anschluß finde. Wenn sie ihn drängte, und er nur die Schultern hängen ließ, um rasch zu verschwinden, fiel ihm ein, wie er die Kinder, sogar Jan und Wilhelm, bloß mit Worten bezwungen hatte.
3Jona auf dem Tisch
Das Haus, in dem Felix Guttmann am 22. Juli 1906 – ein Sommerkind, befand Elena – zur Welt kam, lag am westlichen Ende der Olauer Straße in Breslau, nahe der Schweidnitzer, dem Korso, wo sich an lauen Abenden das Stadtvolk traf und zeigte. Das habe ich nur gelesen, nie erlebt. Ich bin nur einmal, als Kind, mit meinem Vater in Breslau gewesen, an seiner Hand durch die Stadt gezogen, und betrachte ich heute die alten Pläne, lese Straßennamen, dann erinnere ich mich an Breslau wie an andere Städte, in denen ich für ein oder zwei Tage gewesen bin, unterwegs mit den Eltern, hochgestimmt und oft erschöpft von den langen Wegen, lauter unverstandene oder zu ausgiebig erklärte Bilder im Kopf, die in die Träume absanken und sich dort neu und wunderbar zusammensetzten. An ein einziges Gebäude kann ich mich erinnern. Nicht an das Rathaus, nicht an den Dom, nicht an das Oberlandesgericht, dort hatte mein Vater zu tun, sondern an die mächtige und dennoch, schwerelos erscheinende Kuppel der Jahrhunderthalle. Wir waren ein Stück die Oder entlangspaziert und unversehens wurde der Wunderbau in der Ferne sichtbar.
Für ihn, den ich als Felix erzähle, hat dort, ich weiß es, seine Theaterleidenschaft begonnen.
Aber so weit bin ich noch nicht mit ihm. Er ist vor einem Jahr zur Schule gekommen, der Ranzen, den ihm Elena auf den Rücken gepackt hatte, drückte ihn. Die wenigsten wollten glauben, daß er Schüler sei. Dieser Krümel? Um so nachdrücklicher pochte er auf seine Selbständigkeit, lehnte es ab, von Mutter oder Elena zur Schule begleitet zu werden.
Ich höre mit ihm den Lärm, die sich überschlagenden Kinderstimmen, bin mit ihm beeindruckt von dem strengen, alles wissenden Oberlehrer Sawitzki, der Buchstaben so schön wie kein anderer auf die Tafel malen kann. Ich fürchte mich wie er vor denen in der letzten Bank. Ich buchstabiere mit ihm das erste Wort.
Als mein Vater mich durch Breslau führte, war Felix Guttmann über dreißig Jahre alt, hatte Deutschland verlassen müssen, lebte in Palästina. Vieles, was seinen Tag bestimmte, was ihn umtrieb, erschreckte, entzückte, kenne ich nur vom Hörensagen, muß ich nachlesen.
Er war acht Jahre, als der Erste Weltkrieg begann. Ich war sechs beim Ausbruch des Zweiten. Die Zeiten brauchten ihre Helden, wir sammelten ihre Namen. Sein Admiral Tirpitz hieß für mich Kapitän Prien.
Der Krieg meldete sich mit Gerede. Ein wenig verängstigt lauschte Felix dem Oberlehrer, der nun beinahe in jeder Stunde, ganz gleich, ob sie rechnen oder schönschreiben sollten, in Rage geriet, sich an den Siebzigerkrieg erinnerte, als man es den Franzmännern endlich mal zeigte. Jedesmal wenn sich seine Stimme überschlug, er im nachträglichen Siegerglück den Tränen nah war, forderte er die Klasse auf, sich zu erheben, mit ihm einzustimmen in das deutsche Soldatenlied: »Fern bei Sedan«. Danach sangen sie die »Wacht am Rhein«. Bald hielt es Felix für selbstverständlich, von Sawitzki als zukünftiger Krieger behandelt zu werden. Er hatte sogar das Gefühl, durch die Lieder würden seine Muskeln fester und härter und sein Brustkorb begänne sich zu wölben.
Vater las die Zeitungen gründlicher und angespannter als sonst, ereiferte sich über den Balkan, den Felix eine Zeitlang für einen Banditen hielt, bis ihm Mutter, die eher noch stiller geworden war, aufklärte: Es sei eine Gegend unten im Süden, am Meer, wo die Menschen ungezügelter lebten. Der einzige, der die Zeitungen anders las als Vater, den Siebzigerkrieg anders erlebt hatte als Sawitzki, war Onkel Jona. Die Hochstimmung schien ihn zu bekümmern. Felix fand kaum mehr Zeit ihn zu besuchen, denn die Schulaufgaben nahmen ihn in Anspruch und die Kinder im Hof warteten. Auch sie bereiteten sich mit Holzsäbeln und Papierhelmen auf den Krieg vor. Es war vorauszusehen, daß es bald ernst werde.
Das meinte auch Jona.
Mutter hatte Felix gebeten, Jona ein Glas mit eingelegtem Fleisch zu bringen. Er mag es, sagte sie, und wer kümmert sich schon um ihn. Du gehst ihn auch kaum mehr besuchen. Und Papa kommt, seit die Herren Offiziere ganz versessen sind auf Galauniformen, nicht mehr zur Ruhe. Ständig sorgt er sich um die Lieferungen.
Mürrisch, versunken in sein Fett, hockt Jona auf dem Tisch, schaut kaum auf, als Felix ihn begrüßt und das Weckglas auf einer Truhe abstellt. Das schickt Mama. Auch die Gesellen ziehen verbissen die Nadel weiter durch den Stoff, nur das Bügelmädchen lächelt ihm zu.
Wie geht’s in der Schule, Felix?
Ganz gut.
Unauffällig versucht er, sich zur Tür zurückzuziehen, zu verschwinden, doch Jona, dem nichts entgeht, legt die fast fertige Hose mit den roten Biesen zur Seite, fängt ihn mit einem Satz ein: Was macht der Krieg, Felix, wird es Krieg geben?
Wieso fragt er ihn das? Wie kann er das wissen, wenn nicht einmal Oberlehrer Sawitzki sich schlüssig ist. Das habe Seine Majestät zu entscheiden. Aber wäre es nicht ungehörig, würde er Jona zurückfragen: Bin ich der Kaiser?
Plötzlich wird Jona munter, reckt sich, seine Hände, frei von Nadel und Faden, fassen in die Luft, streicheln und schlagen sie.
Setz dich, mein Junge.
Felix könnte sich, wie früher, unter den Tisch verziehen, aber es reizt ihn, Jonas Unruhe und Wut zu beobachten. Er schiebt den grüngepolsterten Sessel, auf dem sonst die feinen Herren vor und nach der Anprobe Platz nehmen, neben den Tisch. Jona holt tief Luft, und schon beim ersten Satz weiß Felix, daß er nichts mehr wird sagen müssen. Daß es genügt, dem bekümmerten, in seinem Fett zürnenden Jona zuzuhören.
Nichts werd’ ich dir erzählen vom Krieg, nichts von Helden, von Kanonen, von Tanks, von Ulanen. Was weiß ich, wann sie ihn anzetteln werden, ob morgen oder in einem halben Jahr. Ich weiß es sowenig wie du. Erzählen will, ich dir vom Menschen, der sich vergißt. Immer, bis ans Ende unserer Tage wird es welche geben, die sich anmaßen, stärker zu sein als die andern und es erproben wollen; haben möchten sie, was sie nicht haben, beherrschen, was ihnen noch nicht gehört. Schau sie dir an, wie sie kommen und sich einkleiden, sich Litzen aufnähen lassen, Kragenspiegel, Achselklappen, wie sie sich schmücken.
Die Erregung riß Jona in die Knie. Es war vorauszusehen, daß er sich ganz aufrichten, auf dem Tisch stehen würde, das Hemd aus der Hose und die Hose unterm Bauch.
Felix starrte ihn ehrfürchtig an. Noch nie hatte er einen Erwachsenen so außer sich gesehen. Vater würde sich das nie gestatten, selbst wenn er gereizt wäre, würde er darauf achten, daß sein Anzug ordentlich sei, die Uhrkette sich nicht verwickle, er würde sich den Bart glattstreichen.
Die beiden Gesellen hatten aufgehört zu arbeiten. Das Mädchen stand, das schwere Eisen in der Hand, entgeistert mitten in der Werkstatt. Die breiten fleischigen Lippen Jonas spuckten unausgesprochene Wörter aus, und nachdem sie ein unendlich trauriger Seufzer geöffnet hatte, reckte sich Jona und stand auf dem Tisch. Er blickte über sie hinweg, durch die Hände hindurch, auf die Welt, die in ihrem Elend ausgebreitet vor ihm lag.
Sie beten! Onkel Jona nickte den beiden kurzen Wörtern mit höhnendem Einverständnis nach. Danach wurde er laut, sein Bauch begann, unter dem unordentlich geknöpften Hemd zu vibrieren. Ja, sie beten. Sie flehen. Sie flehen ihren Herrgott an, daß er sie siegen lasse und die Feinde verlieren. Was muten sie ihrem Gott alles zu. Ihre Kanonen soll er segnen, selbst in den Läufen der Pistolen soll sein guter Geist walten. Haben sie keine Feinde, denken sie sich welche aus. Sie reden nicht mit ihnen, nein, das wäre zu viel verlangt. Sie verhandeln. Aber das nur, um recht zu bekommen: Dies ist der Feind. Wir haben alles versucht, wir haben ihn fabelhaft in die Enge getrieben, so daß wir ihm jetzt nur noch den Krieg erklären können. Den Tod, den sie beschwören, brauchen sie nicht selber zu sterben. Sollte die falsche Kugel sie aber treffen, die feindliche Granate sie zerreißen, so ist dies ein ehrenwerter Tod, für den Kaiser, für das Reich, für das Vaterland.
Felix bekam eine Gänsehaut. Jona hatte den Kaiser beleidigt. Er tat es, ohne daß die Erde zu beben begann oder die Tür eingebrochen wurde, Gendarmen hereinstürzten, um Jona ins Gefängnis zu schleppen. Nichts geschah, außer daß das Bügelmädchen vor Aufregung schmatzte und einer der beiden Gesellen ein warnendes Na, na sagte.
Jonas Zorn hatte sich erschöpft. Der dicke Mann sank in sich zusammen, ging in den Schneidersitz, schneuzte sich in einen Ärmel, den er aus einem Bündel unfertiger Kleidungsstücke zog, faßte Felix ins Auge und stellte überraschend mild fest: Wenn’s einen Krieg geben wird, mein Junge, und es wird einen geben, wirst du vielleicht an deinen Onkel denken. Geh heim, grüß deine lieben Eltern von mir, richte deinem Vater aus, daß der Oberst von Graevenitz – er kennt ihn schon – mit dem Uniformtuch nicht zufrieden war. Er besteht auf englischem, obwohl er den Briten Pech und Schwefel auf die Insel wünscht.
Felix war schon auf dem Weg zur Tür, als er hinzufügte: So ausführlich mußt du es deinem Papa wieder nicht erzählen.
Als er die Tür hinter sich zuzog, hörte er Jona ein letztes Mal: Was bin ich doch für ein Narr, seufzte er.
Felix richtete die Grüße Jonas aus, aber was er außerdem erfahren hatte, eine Rede des Propheten auf dem Schneidertisch, behielt er für sich. Sie wiederzugeben, traute er sich nicht zu, und außerdem fürchtete er, Jonas Ansichten könnten Vater aufregen und mißfallen.
Mit der Ankündigung des Krieges behielt Jona recht.
Tage nach dem Besuch bei Jona empfing Mutter ihn weinend, als er aus der Schule kam, der Erzherzog sei in Sarajevo einem Meuchelmord zum Opfer gefallen, und denk dir, seine arme Gemahlin ebenso, und Elena schilderte die Tat so anschaulich, als sei sie dabei gewesen, wie der Attentäter, eine Kreatur, sag ich dir, die Pistole hob und schoß und schoß, und das Blut aus der Uniformjacke des Thronfolgers quoll, sich über alles ergoß, über alle, auch über die arme schöne Frau, die neben ihm leblos in die Polster der Karosse sank, ach Kind, in welcher traurigen Welt müssen wir leben.
Elena irrte sich. Die Welt war zwar entsetzt und erschüttert, doch sie ließ es sich nicht nehmen, gleichzeitig zu feiern: Endlich war es soweit, endlich durften die Soldaten in die Schlacht ziehen.
Felix lernte in diesen Tagen ein neues Wort nach dem andern. Am häufigsten hörte er: Mobilmachung. Oberlehrer Sawitzki schmetterte es wie mit einer Trompete: das i zog er lang und siegesgewiß.
Das Wort wurde sichtbar, auf den Straßen, auf den Plätzen, in den Parks. Von ihm schien eine rätselhafte Kraft auszugehen. Anders konnte es sich Felix nicht erklären, als plötzlich in einem endlosen Zug Soldaten durch die Straßen marschierten, sich Frauen und Mädchen auch werktags anzogen, als ob es immer Sonntag wäre, Menschen sich in die Arme fielen, Unbekannte ihm über den Kopf streichelten und Sawitzki, Seine Majestät beschwörend, vor der Klasse in Tränen ausbrach. Die unerklärliche Macht erfaßte auch Felix. Er hoffte, der Krieg, der noch gar nicht ausgebrochen war und doch schon geführt wurde, werde eine ganze Ewigkeit dauern, so daß er auch noch eingezogen und möglichst schnell zum Offizier befördert werde.
Von Onkel Jona hielt er sich fern. Er war in dieser Zeit ein Spielverderber, hatte kein Verständnis für Heldentum.
Auch im Hof wurde mobil gemacht. Alle, selbst Grete, hatten sich gut ausgerüstet mit hölzernen Flinten, Säbeln und Dolchen, und die sechs grünen Inseln schwammen nicht mehr friedlich nebeneinander, sondern erklärten sich gegenseitig den Krieg.
Er hatte sich gefreut, mit den Kindern in Sturmangriffen den Feind in die Flucht schlagen zu können.
Sie verdarben ihm alles.
Immer bestimmten sie ihn zum Feind.
Du mußt der Franzmann sein, befahl Helmut.
Spiel heut den Russen, drängte Grete.
Es half auch nicht, daß Vater ihm eine zu klein geratene Feldmütze schenkte. Er schneide nur auf, fanden sie, sie stehe ihm überhaupt nicht. Das große Glück, das seinen Brustkorb füllte, schrumpfte zu einem kleinen, drückenden Geschwür.
Er hatte bei Elena gebettelt, länger unten bleiben zu dürfen. Den andern wird es ja auch erlaubt, bitte. Sie stand groß und knochig in der Tür: Ach die, diese Schmutzfinken.
Bitte, Elena, ich helfe dir morgen auch beim Wäschemangeln.
Sie lacht, tritt zur Seite, greift ihm unters Kinn, krault ihn: Du bist ein kleiner Schlaumeier. Immer setzt du deinen Kopf durch.
Er rennt die Treppe hinunter, ein Ritter, ein Retter, sie warten auf ihn. Die Tür zum Hof steht offen.
Das Licht des frühen Sommerabends sinkt herunter und gerinnt zu einem honigfarbenen Quader. Er bleibt auf der Schwelle stehen, wartet, daß sie ihn rufen, sie scheren sich nicht um ihn, palavern, stecken die Köpfe zusammen. Er drückt sich die Mütze in die Stirn. Elena findet, so sehe er besonders mutig aus.
Kameraden! ruft er.
Nur Helmut schaut auf. Haben sie dich noch einmal runtergelassen? Dann kannst du ja den Russen spielen.
Am liebsten würde er kehrtmachen, sich in seinem Zimmer verschanzen. Aber sie dürfen ihn nicht kleinkriegen, seine Angst nicht merken.
Komm doch! Sie sehen ihm alle erwartungsvoll entgegen.
Er rührt sich nicht, wird steif, seine Beine wehren sich. Das Schwert in seiner Hand wird schwer. Wenn ich nur Hagen von Tronje wäre, denkt er, der hat sogar Siegfried getötet.
Willst du mitspielen? ruft Helmut, und Gertrud setzt ein spöttisches Oder nicht? nach. Er läuft auf sie zu, verläßt den Schutz der Mauer, entfernt sich von der Tür, durch die er fliehen könnte. Sie schließen ihn in einen Kreis ein, halten ihn gefangen, lachen.
Der Russ!
Ich bin kein Russ!
Doch!
Er wagt einen Schritt nach vorn. Der Kreis schließt sich enger um ihn.
Guckt ihn doch an, den Russ! Gleich heult er los.
Er wird es ihnen zeigen. Sie ahnen nicht, welche Kraft ihn treibt, welcher Haß, welche Wut. Er schließt die Augen, reißt den Säbel hoch und stürzt sich auf die lebende Wand. Sie ist warm, atmet, schlägt zurück, drückt ihn zu Boden, stürzt über ihn, boxt, kneift und hämmert gegen seinen Kopf. Dann zerrt ihn jemand hoch. Helmut haucht ihm ins Gesicht. Sein Atem riecht so sauer, als habe er eben gekotzt.
Ich bin kein Russ!
Wieder lachen sie.
Was bist du dann?
Ein deutscher Soldat.
Sie können sich gar nicht beruhigen. Einer reißt ihm das Schwert aus der Hand. Helmut packt ihn am Hemd und redet in seine Augen hinein: Das kannst du gar nicht sein, du nicht.
Warum nicht?
Weil du ein Jud bist.
Helmut schüttelt ihn im Hemd hin und her. Ein Jud bleibt ein Jud.
Die Häuserwände reden mit, werfen sich das Wort zu: Ein Jud, ein Jud.
Vielleicht wächst er plötzlich über sich hinaus, geht einfach ruhig weg, vielleicht stürmt ein fremder Ritter den Hof, befreit ihn und schlägt die anderen nieder. Nichts geschieht. Nicht einmal Elena wird durch das Geschrei alarmiert und kommt auf den Balkon.
Sie sagen, er sei ein Jud.
Grete kreischt: Zeig dein Schwänzel. Den Juden schneiden sie ein Stück vom Schwänzel ab. Zeig’s!
Er geht in die Hocke, kauert sich zusammen, schützt sich. Sie dürfen ihn nicht weinen sehen.
Mach schon! Helmut zerrt an ihm.
Willst du nicht?
Nein.
Er macht den Buckel krumm, legt die Hände schützend um den Hinterkopf.
Es wird still. Er hört erst Geflüster, dann trabende Schritte. Sie laufen weg, denkt er, sie haben genug, sie haben es nicht geschafft. Ich bin stärker als sie.
Über ihm wird eine Männerstimme laut.
Was ist los, Felix, was haben die mit dir angestellt? Übertreibt ihr nicht ein bißchen?
Es ist der Hausmeister. Kein Held, kein Ritter. Vorsichtig, denn die gespannte Haut könnte reißen, taucht er unter dem Arm des Mannes weg, läuft. Im Gras liegt sein Schwert. Er hebt es nicht auf.
Elena öffnet ihm, erschrickt: Was haben sie mit dir angestellt?
Nichts, sagt er, und seine Stimme springt hoch. Das ist so im Krieg.
Geh dich waschen, zieh dich um und komm danach zum Abendbrot!
Er wünscht sich, daß sie ihn in die Arme nehme, aber sie murmelt nur: Diese dummen Kinder.
Er nimmt sich vor, mit niemandem darüber zu sprechen, diese Demütigung zu verschweigen. Später, viel später könnte er sich bei Jona erkundigen, weshalb ein Jude kein deutscher Soldat sein kann.
Den Tag darauf, am 1. August 1914, erklärte der Kaiser Rußland den Krieg.
4Die falsche Adresse
Zum ersten Mal spürte er die Bewegung von Zeit, spürte, wie etwas vergangen ist, sich in seiner Erinnerung allmählich auflöste, der Schmerz sich verlor. Er mied den Hof, obwohl er sich nach seinem Platz sehnte. Wenn er eines der Kinder im Treppenhaus traf oder auf der Straße, dann wich er aus.
Der Krieg ging ins zweite Jahr; er kam in die dritte Klasse. Streng dich an, wachsen mußt du, Jungchen, flehte Elena ihn an.
Und Tag für Tag brachte der Krieg ihnen neue Namen bei. Oberlehrer Sawitzki schrieb sie an die Tafel. In Tannenberg hatte Hindenburg die russische Armee unter Samsonow geschlagen, am Skagerrak traf die deutsche auf die englische Flotte, und bei Verdun und an der Somme gruben sich die Soldaten ein. Er schrieb auch Gerald Venzmer in großen Buchstaben hin und setzte ein Kreuz dahinter. Venzmer, unser junger und vielversprechender Kollege, wie Sawitzki, mit dem Stock auf den Namen einschlagend, erklärte, hatte sich freiwillig gemeldet. Er war an der Somme gefallen und nun ein Held. Sawitzki konnte mit seinen achtundfünfzig Jahren vorläufig noch keiner werden, was er bedauerte. Aber auch in der Heimat müssen wir unseren Mann stehen. Felix belustigte dieser Ausdruck. Wie wollte Sawitzki einen Mann stellen, der er anscheinend selber gar nicht war? Vielleicht machte diese Verdoppelung die Heimatfront besonders stark.
Jona, der überraschend an einem Abend erschien, um sich endlich mal wieder satt zu essen und für ein paar Stunden auf einem ordentlichen Stuhl zu sitzen, hielt, zu Vaters Ärger, von Helden nichts, nannte Ludendorff einen Bramarbas, was er nicht weiter erklärte, und hielt die Soldaten an der Somme allesamt für arme Schweine.
Felix traute sich nicht, ihm zu widersprechen. Er wußte es nicht zuletzt durch die Bilder und Geschichten in der Berliner Illustrirten, die Vater abonniert hielt, besser.
Ich bitte dich, Jona, rede vor dem Jungen keinen solchen Unsinn.
Jona aber ließ sich nicht zurechtweisen, blieb standhaft, schnaufte, tupfte sich mit der Serviette das dreifache Kinn, blies Felix ins Gesicht und sagte: Na, wie sieht’s aus, Felix, wann werden wir die Welt besiegt haben?
Felix schämte sich für Jona. Er fand ihn dumm und unmännlich, und er wunderte sich, warum er Jona trotz allem gern hatte.
Laß ihn, sagte Mutter.
Doch da hatten sie sich schon wieder von ihm entfernt, waren weit weg. Er saß neben ihnen und war nicht anwesend. Sie hatten keine Ahnung, wer er wirklich war und von dem, was ihn beschäftigte, wovon er träumte. Die Eltern hätten ihn nicht verstanden. Und wer, außer Jona, hätte ihn trösten können, als ihn die Hofkinder verspottet hatten.
Jona ging in die Synagoge, Papa nicht. Dein lieber Vater ist aufgeklärt, hatte Jona einmal auf seinem Schneidertisch zum besten gegeben, was weiß ich, wovon. Er muß es wissen. Danach hatte er Felix von einem Mann namens Herzl erzählt, der für die Juden einen Staat gründen wolle, wie es Bismarck für die Deutschen getan hatte.
Vergiß dich nicht, rief ihm Elena neuerdings nach, wenn er, nach den Aufgaben, schon träumend, die Wohnungstür hinter sich zuwarf. Sich vergaß er nicht, nein, aber alle andern.
Ich geh spielen. Ich habe einen neuen Freund, einen Schulkameraden. Den erfand er den Eltern und Elena zuliebe. Und sie gaben sich mit seinen Auskünften zufrieden. Er heiße Arthur Legal, wohne am Neuen Markt.
Endlich gebe er sich mit Kindern aus der Schule ab. Ob dieser Arthur zu ihm in die Klasse gehe?
Nein, in die vierte. Das ist nicht gelogen. Nur hat er nie ein Wort mit Arthur gewechselt, denkt auch nicht daran, denn er gehört zu den Großen, die ohne Mühe in die Uniform hineinwachsen werden.
Bring ihn doch mal mit, Felix.
Wenn er will. Er weiß ja im voraus, daß er nicht will.