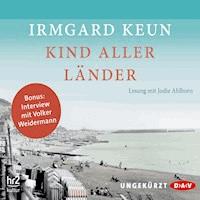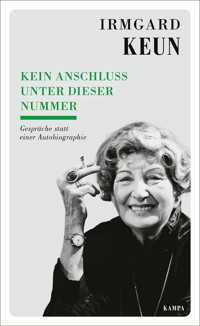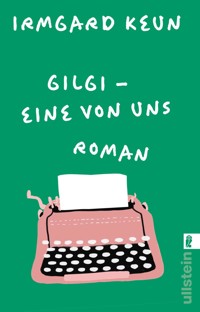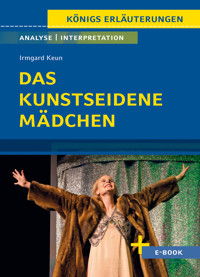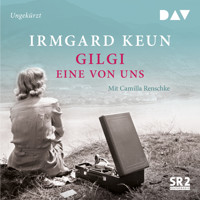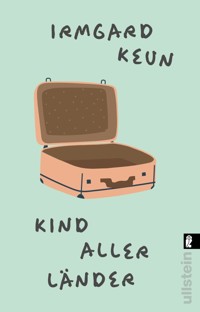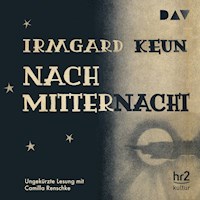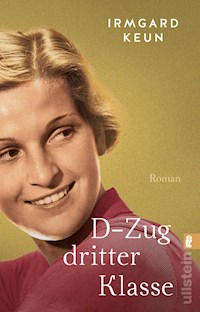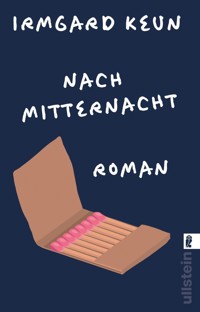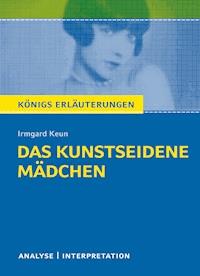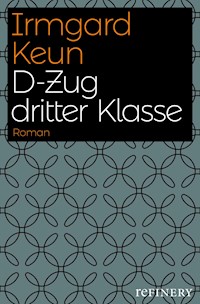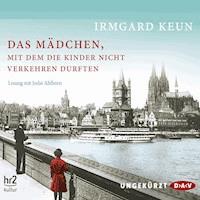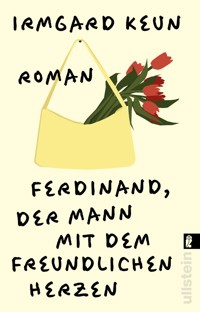
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der freundliche Ferdinand ist zu sanft für die raue Welt um ihn herum. Auf einer Bank am Fluss trifft er Luise, und ehe er sich versieht, sind sie verlobt. Doch Ferdinand lebt ein prekäres und unstetes Leben in den Trümmern von Nachkriegsdeutschland. Leider lässt Luise sich davon nicht so leicht abschrecken. Um sie loszuwerden und sich so immerhin einer Verantwortlichkeit zu entledigen, versucht Ferdinand, einen neuen Bräutigam für Luise zu finden. Irmgard Keuns Porträt des jungen, weichherzigen Ferdinands gehört trotz aller Tragik wohl zu ihren humorvollsten und warmherzigsten Romanen. »Ferdinand ist ein Mann unserer Tage, eine provisorische Existenz, wie wir es ja mehr oder weniger alle sind. […] Er zeigt, daß sogar eine provisorische Existenz ihren Reiz haben kann.« Irmgard Keun (1950)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen
Irmgard Keun, 1905 in Berlin geboren, feierte mit ihren beiden ersten Romanen, Gilgi – eine von uns und Das kunstseidene Mädchen, sensationelle Erfolge. 1936 ging sie ins Exil und kehrte vier Jahre später mit falschen Papieren nach Deutschland zurück, wo sie unerkannt lebte. Im Literaturbetrieb der Nachkriegszeit konnte sie zunächst nicht an die Erfolge ihrer ersten Bücher anknüpfen, bis ihre Romane Ende der Siebzigerjahre von einem breiten Publikum wiederentdeckt wurden. Irmgard Keun starb 1982 und zählt heute zu den wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts.
»Wie werde ich eine Braut los?«Der freundliche Ferdinand ist zu sanft für die raue Welt um ihn herum. Auf einer Bank am Fluss trifft er Luise, und ehe er sich versieht, sind sie verlobt. Doch Ferdinand lebt ein prekäres und unstetes Leben in den Trümmern von Nachkriegsdeutschland. Luise lässt sich davon nicht so leicht abschrecken. Um sie loszuwerden und sich so immerhin einer Verantwortlichkeit zu entledigen, versucht Ferdinand, einen neuen Bräutigam für Luise zu finden. Ferdinands Suche nach Freiheit wird zur Suche nach sich selbst – und vielleicht nach einem kleinen Stück Glück in der Nachkriegszeit. Irmgard Keuns Porträt des jungen, gutmütigen Ferdinands gehört trotz aller Tragik wohl zu ihren humorvollsten und warmherzigsten Romanen.
Irmgard Keun
Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstr. 126, 10117 Berlin 2019 © Claassen Verlag GmbH, Düsseldorf 1981 Erstveröffentlichung 1950 Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected] Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Titelabbildung: © Yuliya Fattakhova / iStockphotoAutorinnenfoto: © ullstein bild ISBN 978-3-8437-3687-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Ich schreibe eine Geschichte
Meine Cousine Johanna
Meine Braut Luise
Einen Mann für Luise
Meine Mutter Laura
Der freudige Ratgeber
Die Verwandten kommen
Das Fest der zerbrochenen Gläser
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Ich schreibe eine Geschichte
Motto
Diese Ausgabe wurde in neue Rechtschreibung übertragen und behutsam orthografisch angepasst. Manche der verwendeten Ausdrucksweisen sind heute nicht mehr zeitgemäß und müssen in ihrem historischen Kontext verstanden werden.
Ich schreibe eine Geschichte
Es wundert mich, dass es Menschen gibt, die Geld bei mir vermuten. Angefangen hat es mit dem Taschendieb. Geendet hat es mit Heinrich, der erstaunt war, weil ich fünfzig Mark Vorschuss von ihm haben wollte für die Geschichte, die ich ihm schreiben soll.
Ich habe noch nie eine Geschichte geschrieben, aber Heinrich hat mich darum gebeten, und ich kann nicht gut »nein« sagen, wenn man mich um etwas bittet. Seit einer Woche ist Heinrich Redakteur der überparteilichen Wochenzeitschrift »Die Morgenröte«, und er ist ein seiden-sanfter, guter Mensch.
Ich habe mir eine Flasche Mosel gekauft und eine Packung belgische Zigaretten und mich in mein Zimmer bei der Witwe Stabhorn gesetzt, um zu dichten. Frau Stabhorn hat mich mit einem Stück Kopierstift und dem zerknautschten Schulheft eines ihrer Enkel unterstützt. Das Papier ist willig, aber mein Geist ist schwach. Was soll ich schreiben?
Der Mosel schmeckt lasch und trübe wie die schal gewordene Menschenliebe eines unglücklich verheirateten Winzers. Die belgischen Zigaretten schmecken nach ranzigem Heu. Ich war während des Krieges nicht in Belgien, ich habe nie einem Belgier etwas Böses getan. Falls es sich bei diesen belgischen Zigaretten nicht um eine Kollektivstrafe, sondern um einen individualistischen Racheakt handeln sollte, ist wieder mal ein Unschuldiger das Opfer geworden. Graue Wehmut lähmt mein Denken. Und ich hatte mir Anregung durch Genussmittel versprochen.
Mein Zimmer bei Frau Stabhorn – Witwe Emmy Stabhorn, geborene Baske – ist kein richtiges Zimmer, sondern ein schlauchartig in die Länge gezogener Sarg, der die Wohnküche der Stabhorns mit ihrem Schlafzimmer verbindet. Es ist ein Durchgangszimmer ohne Türen. Die Tür zur Küche ist im letzten Kriegsmonat von der Nachbarin Lydia Krake entwendet und zerhackt worden. Wenigstens behauptet das Frau Stabhorn. Sie hatte den Verdacht, und ein einäugiger Hellseher aus der Engelbertstraße hat ihn bestätigt. Trotzdem wurde Lydia Krake von Zeit zu Zeit Frau Stabhorns beste Freundin.
Beide betrieben vor der Währungsreform einen vielseitigen Schwarzhandel. Sie betrieben ihn mit jener zähen Nervosität und hektischen Besessenheit, die den abenteuerlichen Finanzaktionen alternder Frauen den feurigen Glanz einer Art von Sexual-Abendrot verleihen.
Lydia Krake lieferte zeitweilig beträchtliche Mengen Fleisch, dessen Herkunft trübe und ungeklärt blieb. Für mich. Man vertraute mir, aber man weihte mich nicht ein. Um es genau zu sagen: man nahm mich nicht für voll.
Weil ich Hunger hatte, habe ich mal von dem Fleisch gegessen. Wahrscheinlich bot man es mir an, um zu sehen, wie sein Genuss auf den menschlichen Körper wirkt. Karitative Affekthandlungen lagen weder Frau Stabhorn noch Frau Krake. Das Fleisch hat mir nicht geschadet, es hat mich erfrischt. Zu den mir bisher bekannten Fleischsorten gehörte es nicht. Vielleicht war’s das Fleisch exotischer Tiere, die in einem zoologischen Garten gestorben waren. Hoffentlich war’s kein Menschenfleisch. Menschen sind oft nachwirkend unbekömmlich.
Der einäugige Hellseher war ebenfalls an dem Fleischhandel beteiligt, bis er eines Tages in hässlichen Gegensatz zu Stabhorn und Krake geriet. Zur tiefen Genugtuung der Damen musste er später ins Gefängnis wegen Lebensmittelkartenfälschung. Am Tage seiner Verhaftung schwelgten seine Gegnerinnen in Freundschaft und Harmonie. Sie legten einander die Karten, reumütig zum Brauchtum ihrer Mütter zurückkehrend. Ihr Glaube an die magischen Fähigkeiten des Hellsehers war erschüttert worden. Kurz darauf entzweiten sich die Damen eines sanft schiebenden Theologiestudenten wegen, dem Frau Stabhorn hundert elastische Strumpfbandgürtel in Kommission gegeben hatte. Lydia Krake hatte Geld in die Strumpfbandgürtel investiert. Der Theologiestudent verschwand spurlos. Gott mag wissen, was er mit den Strumpfbandgürteln gemacht hat. Neulich traf ich ihn vor einer Reibekuchenbude. Er habe umgesattelt und studiere jetzt Jura.
Durch die türenlose Öffnung zur Küche strömen die Stabhornschen Enkel. Sie schaukeln gern an der klebrigen Portiere, die mein Zimmer von Stabhorns Schlafraum trennt. Nachts höre ich Frau Stabhorn schnarchen. Tagsüber fällt alle zwei bis drei Stunden die Portiere herunter. Es gehört zu meinen Aufgaben, sie immer wieder zu befestigen.
Die Decke meines Zimmers besteht aus Löchern. Das Haus leidet an natürlicher Altersschwäche. Es erinnert an einen gichtkranken Armenhäusler, der beim besten Willen nicht weiß, wozu und für wen er noch gut riechen und sich rasieren soll. Auch in seiner Jugend kann dieses Mietshaus nicht reizvoll gewesen sein. Es trägt keine Spuren ehemaliger Schönheit – wie die alten Fürstinnen in den Romanen des Fin de siècle sie trugen. Dafür trägt es Spuren des Krieges.
Ich habe mehrfach versucht, die Löcher in der Decke zu vergipsen. Wahrscheinlich taugt der Gips nichts, denn er fällt immer wieder runter – zur Freude der Enkel, die damit Hüpfekästchen auf den Fußboden malen.
Die Familie Stabhorn besteht aus Frau Stabhorn und vielen kleinen Enkeln. Hin und wieder erscheinen auch Töchter und Schwiegersöhne der Frau Stabhorn, um die bereits vorhandenen Kinder lärmend und liebevoll zu begrüßen und ein neues Kind abzuliefern. Das Geschlecht derer von Stabhorn scheint fruchtbar und lebenskräftig.
Ich weiß, dass mangelnde Kinderliebe einen zum Ekel und Abscheu jeglicher Partei und der einschlägigen religiösen und unreligiösen Weltanschauungen macht. Kinder sind die holden kleinen Blüten im hässlich verrotteten Garten unseres Lebens. Augenblicklich versuchen ein paar holde kleine Blüten, mit Gips vermengte Marmelade an meine Arme und Beine zu kleben.
Frau Stabhorn schwarzhandelte nämlich unter anderem auch mit Marmelade. Irgendein Schwiegersohn von ihr sitzt an einer Marmeladenquelle. Überall stehen Marmeladeneimer, die ganze Wohnung klebt von Marmelade. Nach der Währungsreform hatte die Marmeladenflut für einige Zeit ausgesetzt. Die Marmeladenreste an Möbeln und Kindern begannen einzutrocknen und weniger zu kleben. Jetzt aber ist alles wieder beim Alten. Überall Marmelade. Eine giftig süße, giftig rote Marmelade. Eine ausgesprochen bösartige Marmelade, deren Genuss die Lebensfreude dämpft.
Ihrem Geschmack nach müsste die Marmelade eine grüne Farbe haben – giftgrün wie Absinth oder bläulichgrün mit einem Stich ins Violette wie der künstlerisch gestaltete Alpdruck eines gemütskranken Malers.
Man isst ja vieles, wenn man Hunger hat, aber ich glaube, wenn diese Marmelade auch noch grün statt rot wäre, würde ich sie nicht runterkriegen. Warum eigentlich nicht? Warum wäre mir eine blaue Tomate zuwider? Oder ein zitronengelbes Kotelett? Handelt es sich um ererbte Gewohnheit, um biologischen Konservatismus? Auf wie viele Vorurteile mag ich mich wohl noch ertappen, wenn ich ernsthaft nachdenke?
Ich könnte eine tiefschürfende Betrachtung oder eine surrealistische Elegie über die Marmelade schreiben. Aber ich glaube, dann würde Heinrich sagen, dass seine Leser so etwas Niederdrückendes nicht wollen. Oder ich müsste die Marmeladengeschichte für den Durchschnittsleser unverständlich und erhaben gestalten – etwa in der Art des späten Hölderlin oder des frühen Rilke. Unverständliches wird vom Leser immer respektiert. Er bildet sich ein, er verstehe es, und das hebt sein Selbstgefühl.
Hin und wieder wird mein Zimmer von der Witwe Stabhorn durchhüpft. Ihr gefahrvolles Dasein hat sie nicht zermürbt, sondern munter und jugendlich erhalten. Manchmal habe ich hässliche Gedanken und wünsche, sie möge ihre Enkelchen verprügeln, statt sie ständig mit Marmelade spielen zu lassen. Aber sie prügelt nicht. Sie ist von einer heiteren Aufgeregtheit und hüpft. Früher umhüpfte sie oftmals mein Bett. Nicht aus Fleischeslust, sondern weil sie unter meiner Matratze ihr schwarzes Zigarettenlager hatte. Ich weiß zwar nicht, um was man die Witwe Stabhorn außer ihrer Heiterkeit beneiden könnte, aber sie wird beneidet. Neidische Nachbarn, so behauptete sie wenigstens, hetzten ihr zeitweilig die Kriminalpolizei auf den Hals. Ich musste dann im Bett liegen, als armer, kranker Heimkehrer. Die Witwe Stabhorn weinte vor Rührung und Mitleid, wenn sie zu den Polizeibeamten von mir sprach. Nie ist mein Bett nach unerlaubter Mangelware durchsucht worden. Es geschah sogar, dass Polizisten mir von den Zigaretten anboten, mit denen sie kurz zuvor bestochen worden waren.
Auch über mein Bett könnte ich schreiben. Am Kopf- und Fußende hat es Gitter aus jämmerlichem Metall. Wer mag so was erfunden haben? Warum mag er es hergestellt haben? Wozu die Materialverschwendung? Wären die Gitter seitlich, so hätte das immerhin den Sinn, dass man als wüster Gewohnheitsträumer nicht rausfallen kann. Aber welcher Mensch ist je am Kopf- oder Fußende aus dem Bett gefallen? Also wozu die Gitter? Als Schmuck? Wer hält eine Nachahmung von Zuchthausgittern für Schmuck? Ich will nicht darüber schreiben. Leser mögen sicherlich keine Schilderungen von Zuchthausgittern, geborstenen Sprungfedern und den psychoanalytischen Abgründen eines Bettenfabrikanten.
Wie komme ich überhaupt dazu, eine Geschichte schreiben zu müssen?
Mit dem Taschendieb hat’s angefangen. Ich stand am Opernhaus und wartete auf die Straßenbahn, um zu meiner Cousine Johanna zu fahren.
Der Novembermittag war grau wie eine ganze Waggonladung voller Buß- und Bettage. Gott verzeih mir die Sünde, ich habe was gegen den Buß- und Bettag. Es beleidigt mein demokratisches Freiheitsgefühl, von irgendeiner Instanz, die mein Innenleben einen Dreck angeht, zur Buße angehalten zu werden. Bei unserem verruchten Klima ist der November ohnehin nichts anderes als eine einzige Buße, ob man nun büßen will oder nicht. Es müsste alles getan werden, um die armen Menschen in diesem Monat aufzumuntern. An jeder Straßenecke sollten Rotwein-Fontänen sprudeln, Flugzeuge blühenden Flieder vom Himmel schütten, vor Heiterkeit berstende Musikkapellen durch die Stadt ziehen. Rathäuser, Finanz- und Postämter sollten mit roten Lampions geschmückt sein, die Beamten Papageienfedern und Blumenkränzchen tragen und Staatsanwälte und Richter die Verhandlungen durch flotte Tanzdarbietungen unterbrechen. Regierungsoberhäupter, Wirtschaftspolitiker und ähnliche Geschöpfe dürften keine einzige Rede halten und zu keiner einzigen ernsten Frage des Tages Stellung nehmen – allenfalls dürfen sie ein Karussell zur kostenlosen Unterhaltung verwahrloster Jugendlicher bedienen.
Ein lockerer Lebenswandel müsste von zuständigen Stellen empfohlen werden. November und Nebel und Grau und Moral und Buße – das ist zu viel. Das zehrt am Mark des schaffenden Bürgers, das nagt am Lebensgefühl, das bringt den widerstandsfähigsten Volkskörper auf den Hund.
Ich stand an der Haltestelle im nieselnden Grau und dachte mir allerhand Buntes aus, um meine seelische Landschaft etwas zu beleben. Durch meine porösen Sohlen kroch wurmige Feuchte.
Als die Straßenbahn kam, setzte ein Gedränge ein, als würden im Wagen Tausendmarkscheine verteilt. Die Menschen drängten mit einem Fanatismus, als müssten sie zum Sterbebett ihrer Geliebten oder zum letzten Rettungs-Luftboot nach dem Mars.
Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass diese finster Drängenden vielleicht nur nach Haus wollen. Oder ins Geschäft. Oder in irgendeinen Dienst. Ellbogen wurden spitz, Muskeln gestrafft, Lippen schmal vor Entschlossenheit. Der Blick der Augen wurde hart und gespannt. Greisinnen kämpften mit muskelharten Arbeitern, mit bleich entschlossenen Büroangestellten und verbissen wütenden Hausfrauen um den Platz an der Sonne. Kinder heulten auf, von rasenden Müttern in den wüsten Nahkampf gezerrt. Jugendliche quetschten sich mitsamt Mappen in das gequälte Gewühl – sie hatten eine ausgezeichnete Quetschtechnik. Sie überholten alle, nur eine alte Frau nicht. Die gab nicht nach, die wich nicht zur Seite, ihr Einholenetz voll erdiger Möhren schob sich den Nachdrängenden in Haar und Gesicht. Sie stand auf dem Trittbrett, sie hielt den Griff mit der Linken, ihr Filzhütchen hing schief – sie drängte weiter, sie hatte die Plattform erobert, sie roch den Schweiß des Wagenführers. Sie hatte gesiegt! Ihre Augen blickten irr, sie keuchte. Vielleicht trainiert sie, um zur nächsten Olympiade zugelassen zu werden.
Das Ziel einer lebensgefährlichen Drängelei müsste doch für einen vernünftigen Menschen ein Paradies sein. Soweit man sich ein Paradies auf Erden vorstellen kann. Ich stelle es mir jeden Tag anders vor. Heute stelle ich es mir vor als ein sanftes Lager aus Wolken in lächelndem Licht, in blauem Himmel. Irgendwo sind orangene Kugeln und samtene Blätter aus Silber und dunklem Grün. Ein glühend rosa Flamingo fliegt mit der weit entfalteten Kraft eines in einsamer Weisheit gesättigten alten Adlers und singt dazu mit der Zartheit einer soeben erblühten Schlüsselblume am Waldeshang. Wie eine Nachtigall.
Mir fällt ein, dass ich noch nie eine Nachtigall gehört habe. Die Nachtigall ist der wichtigste Vogel der Literatur. Keine schlechte Lyrik ohne Nachtigall, keine gute Lyrik ohne Nachtigall. Die Nachtigall schluchzt, die Nachtigall weint, die Nachtigall singt und flötet. Seit vielen hundert Jahren zehren die Dichter von der Nachtigall. Ich habe so viel von der Nachtigall gehört und gelesen, dass ich ehrlich glaubte, ich kenne Nachtigallen mitsamt ihrem süßen Gesang durch und durch. Dabei habe ich noch nie eine Nachtigall gehört. Da sieht man, wie suggestiv Propaganda wirken kann, und ich habe immer gedacht, ich könne auf Propaganda nicht reinfallen. Ob es denn wirklich Nachtigallen gibt?
Man weiß ja nie, ob man morgen noch lebt. Wenn ich im nächsten Sommer noch lebe, will ich eine Nachtigall hören. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Man vergisst so viel und versäumt so viel. Ob alle die Dichter, die Nachtigallen bedichten und besingen, jemals eine Nachtigall gehört haben – mit eigenen Ohren?
Doch Nachtigallen hin und Nachtigallen her, ich möchte keine Geschichte von Nachtigallen schreiben, obwohl die Tagespresse es schätzt, wenn Autoren über Dinge schreiben, von denen sie nichts verstehen. Tiefe Unkenntnis wirkt auf weite Kreise der Leserschaft überzeugend, auf weitere Kreise liebenswert. Dem kritischen Rest kräftigt sie das Selbstbewusstsein, bestätigt ihm seine Überlegenheit und ermöglicht ihm Protestaktionen, die sein geistiges Muskelgewebe vor Erschlaffung bewahren. Ich nehme auch an, dass Nachtigallenthemen kontrollrätlich erlaubt sind und von der Mehrzahl unserer augenblicklichen deutschen Diktaturen nicht beanstandet würden. Aus Gründen der Sittlichkeit wird heute vieles beanstandet. Diktaturen sind immer sehr streng in Bezug auf das, was sie unter sittlich und Volksmoral verstehen. Die ehemalige deutsche Diktatur hat sich, nach Art niederer Lebewesen, durch Spaltung fortgepflanzt und heißt jetzt Demokratie.
An der Haltestelle drängte ich nicht mit. Ich habe Zeit in Hülle und Fülle, und was man hat, soll man auch mit Bewusstsein genießen. Während ich wartend stand und genoss, fühlte ich auf einmal eine Hand in meiner Tasche krabbeln. Ich griff nach der Hand und hielt sie fest am Gelenk. Ein Mann in mittleren Jahren wollte mich meiner Schätze berauben. Der arme Kerl. Ich besaß nur noch eine Knipskarte mit einer freien Fahrt, und die befand sich in meiner anderen Tasche. »Gehen Sie langsam, rennen Sie nicht, in Ihrem Beruf muss man Aufsehen vermeiden«, sagte ich zu dem Mann und ließ sein Handgelenk los. Wie besessen rannte er über den Rudolfplatz. Ein Anfänger wahrscheinlich, ein Amateur.
Ich fühlte mich geschmeichelt, dass der Mann mich bestehlenswert gefunden hatte. Ich trage nämlich weder Hut noch Mantel, sondern nur ein etwas eigenartiges Wämschen mit apartem kleinem Schoß. Es hat etwas vom New Look, und ich habe es mir selbst geschneidert aus einem Damenmantel mit Vorgeschichte, damals, als ich aus der Gefangenschaft gekommen bin. Meine Cousine Johanna behauptet, ich sähe wie ein Leierkastenaffe aus. Leierkastenaffen sind rührende Tiere. Ich würde aber lieber etwas imponierender aussehen.
Während ich mich noch über den Taschendieb freute, fuhr die Bahn fort, und ich wurde kraftvoll und leutselig auf die Schulter geklopft. Es war mein Vetter Magnesius, er ist ein berüchtigter Schulterklopfer. »Komm mit, ein Glas Bier trinken«, sagte er, und wir gingen in die nächste Wirtschaft.
Ich war erstaunt über Magnesius’ Großzügigkeit. Zwar gibt er gern, aber nur sich selbst. Er ist ein Mann in Glanz und Rosa. Leute, die unter Fleischmangel leiden, könnten Lust bekommen, ihn mal in die Backe zu beißen. Wieso ich mit ihm verwandt bin, weiß ich nicht recht. Ich bin mit so vielen Menschen verwandt, überall auf der Welt habe ich Verwandte. Meine sämtlichen Großeltern und Eltern haben Kinder über die Erde gestreut wie der Prinz Karneval Konfetti. Ich habe auch Verwandte, die Geld haben, aber die meiden mich wie eine Pestbazille. Armut ist nicht nur eine Schande, sondern auch die einzige Schande. Als Millionär kann ich ruhig auch mal im Zuchthaus gesessen haben, ohne an gesellschaftlicher Achtung einzubüßen.
»Du hättest ihn nicht laufen lassen dürfen«, sagte Magnesius. Er hatte das Ereignis mit dem Taschendieb beobachtet.
Du lieber Himmel, warum sollte ich den Mann nicht laufen lassen? Seit ich denken kann, sind überall auf der Welt Menschen damit beschäftigt, mich zu vernichten. Kriege denken sie aus für mich, wirtschaftliche und politische Katastrophen. Kleine Bomben, große Bomben, Atombomben, Super-Atombomben, Todesstrahlen, Giftgase und andere Schweinereien. Alles für mich. Und da soll ich einen biederen kleinen Taschendieb böse und gefährlich finden? Ich kann höchstens ein schlechtes Gewissen haben, weil ich den Mann enttäuschen musste.
Magnesius findet meine Moral bedenklich, das hat er von jeher getan.
»An die Allgemeinheit hast du zu denken, Ferdinand, an das Wohl der Allgemeinheit.« Er hebt einen runden, rosigen Babyfinger. »Wo kämen wir hin, Ferdinand, wenn jeder so dächte wie du!«
Wo käme Magnesius hin? Wenn er von Allgemeinheit spricht, meint er sich. Er ist ein netter Mensch und sich selbst das All, rund wie ein Globus. Als ich aus der Gefangenschaft kam, suchte ich ihn auf. Vielleicht hätte er mich als Chauffeur beschäftigen können oder als Bürodiener. Ich bin nicht ehrgeizig und eigne mich zu subalternen Beschäftigungen. Aber Magnesius wollte nichts von mir wissen. In mittellosen Verwandten sieht er eine akute Gefahr. Almosen gibt er prinzipiell nicht. Zweifellos hat er recht. Wenn reiche Leute gebefreudig wären, wären sie nicht reich.
Ich glaube, augenblicklich handelt Magnesius mit Schrott. »Zum Wohl, Magnesius, auf deine Gesundheit.«
Soldat ist er nicht gewesen und fühlt sich nun als Pazifist, Antimilitarist und Märtyrer – wie’s gerade gewünscht wird. Er ist stolz auf die Geschicklichkeit, die er während des Krieges aufgebracht hat, um nicht eingezogen zu werden. Magnesius gehört zu jenen breitgesäßigen Männern, die gefeit sind. Wo sie sind, fallen keine Bomben. Schiffe, auf denen sie fahren, gehen nicht unter. Züge, in denen sie sitzen, entgleisen nicht, zumindest bleibt der Waggon, in dem sie sich befinden, unbeschädigt. Die jeweils herrschende Weltanschauung passt sich ihnen an. Geld haben sie immer, und zu essen haben sie auch immer.
Intelligent ist Magnesius nicht. Meine Cousine Johanna findet ihn sogar dumm. »Oh, Ferdinand«, sagte sie, »ich verstehe es nicht. Er ist dumm wie ein Politiker oder ein wildes Kaninchen, aber noch nach fünf weiteren Kriegen wird er aus Bombenkratern Speiseöl und Schinkenspeck gewinnen. Er wird keinen Knollenschnaps, sondern französischen Likör trinken, wenn’s Europa schon längst nicht mehr gibt. Nach der hunderttausendsten Währungsreform wird er sofort wieder taufrisches Geld haben. Er wird mit Gespenstern Geschäfte machen, wenn keine Menschen mehr da sind, er wird …«
Natürlich wird er. Gerade weil er nicht intelligent ist. Kaninchen sind auch nicht intelligent, aber was sie an Futter brauchen, das wissen sie wohl zu finden. Besser als Kant, Kopernikus, Mozart, Rembrandt.
Prost, Magnesius! Einmal wird ihn der Schlag treffen, sanft und freundlich, und dann wird er Gott oder dem Teufel einen Stoff, aus nichts gemacht, für besonders gut wallende, dauerhafte Gewänder andrehen oder für Mond und Sirius einen Posten antik gewordenes Verdunklungspapier absetzen. Leben wird er, und gut wird er leben, auch wenn er tot ist.
Soll ich eine Geschichte von Magnesius schreiben? Lieber nicht. Deutschland soll umerzogen werden zur Demokratie. Wann hätte je Erziehung ein gewünschtes Resultat gehabt? Die Welt klirrt in Waffen, der innerste Erdkern wurde zum glühenden Uniformknopf, Laboratorien werden zu Superarsenalen, doch Antimilitarismus ist Gebot. Warum und wozu? Jeder General ist ein harmlos-süßes Parmaveilchen im Vergleich zu einem Chemiker. Und Magnesius? Der ewig Krieg-Feindliche? Der ewig Krieg-Liebende? Der da erntet, wo das Leben nichts hinstreute, und der Tod säte? Ich kenne junge und alte Soldaten, die den Krieg hassten wie die Stimme ihres Unteroffiziers und den Frieden liebten wie die Lippen ihrer Braut. Die mehr vom Arrest wussten als von Geschützen. Magnesius wäre fähig, durch seine Existenz oder deren Schilderung selbst diese zu Militaristen zu machen.
Magnesius bestellte noch eine Flasche Wein und sprach mit mir wie mit seinesgleichen. Von Wirtschaftskrisen, Bankkrediten, Bankrotten, Messeschwindel, gesunkener Geschäftsmoral. Ehrfurchtsvoll und erschüttert hörte ich ihm zu. Was in aller Welt mochte los sein mit ihm? So war er noch nie zu mir gewesen. Kürzlich las ich von Gehirnoperationen, die eines Menschen Persönlichkeit verändern. Oder Magnesius war in den Bannkreis radioaktiver Strahlen geraten? Oder ein Wunderdoktor hatte ihn auf zu hohen Blutdruck hin behandelt und unerwartete Resultate erzielt?
»Auf dein Wohl, Ferdinand. Du musst dein Geld anlegen, lieber Junge, ich könnte dir dabei helfen.« Ich verstehe Magnesius nicht. »Einen neuen Anzug müsstest du auch endlich haben, Ferdinand.« Ob Magnesius mir einen neuen Anzug schenken will? »Ja, und die hundert Mark kannst du mir ja später mal zurückgeben, Ferdinand.«
Ich ahnte, dass hier ein Missverständnis zu klären war. Bevor ich mit der Aufklärung begann, ließ ich Magnesius noch russische Eier bestellen. Vorsichtig versuchte ich das mir Wissenswerte zu erfahren.
Ich erfuhr Hässliches über Johanna. Meine Cousine Johanna ist reizend, aber skrupellos. Vor Kurzem hatte sie gewettet, es sei ihr möglich, hundert Mark von Magnesius zu bekommen. Ich hatte fünf Mark dagegen gewettet. Johanna hat nun Magnesius erzählt, ich hätte dreizehntausend Mark im Fußballtoto gewonnen und wünschte, das Geld bei ihm anzulegen. Er möge ihr daraufhin hundert Mark für mich mitgeben. Johanna ist eine überzeugende Lügnerin. Wann werde ich imstande sein, ihr die verwetteten fünf Mark zu geben?
Ich war zu feige, Magnesius aufzuklären. Er gehört zu den Menschen, die blau im Gesicht werden, wenn sie wütend sind. Das kann ich nicht sehen.
Ich tat zerstreut, verschämt, nervös. Ich verabredete mich mit Magnesius für die nächste Woche und bat ihn, mich allein zu lassen. Ich müsse über weitere Finanzaktionen nachdenken.
Magnesius ging, und Heinrich kam. Er stand vor meinem Tisch, dessen holziges Blond ich noch genießen wollte, still und allein. Es war doch mal was Wärmeres, Freundlicheres als die feuchten Novemberstraßen und mein Sargzimmer bei der Witwe Stabhorn.