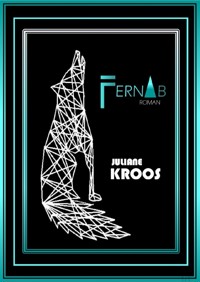
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Lubkow, Deutschland. Imke Fischer ist die neue Marketingleiterin beim Pharmazieunternehmen Pharmasee, Spezialisierung: Onkologie und Virologie. Eines Tages werden drei ihrer Kollegen abgezogen, um im zugangsgesicherten Keller zu arbeiten. Als diese das Firmengelände verlassen, nimmt sie, aus einem Impuls heraus, die Verfolgungsjagd auf und katapultiert sich in Machenschaften, aus denen sie nicht mehr entkommen kann. Nazreh, Portugal. Imke Fischer ist Profisurferin. Besorgt beobachtet sie die zunehmende Verschmutzung der Meere durch Kunststoff. Zusammen mit einem Biologie-Professor versucht sie, ihre geliebten Wellen zu retten. Dabei stoßen sie auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihren Atem stocken lassen. Merta, Peru. Imke Fischer schnappt sich ihren Rucksack und kehrt Deutschland den Rücken. Sie hat genug vom maroden Wirtschafts- und Wertesystem. Sie sucht ihr Heil in den Bergen von Peru, um am Einklang-Gedanken mitzuwirken. Die Essenz vom Sein verbindet die Menschen und das Ego muss vernichtet werden. Doch der Klimawandel und Veränderungen im Umfeld bringen ihre neue Philosophie ins Wanken. Wofür entscheidet sie sich: Gemeinschaft oder Individuum? Dann kommt es zum "Großen Kollaps". Unterirdische Station Barcelona. Zehn Jahre später. Die Welt hat ihr Äußeres verändert. Imke Fischer kämpft um ihren Platz in der Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lubkow, Deutschland. Imke Fischer ist die neue Marketingleiterin beim Pharmazieunternehmen Pharmasee, Spezialisierung: Onkologie und Virologie. Eines Tages werden drei ihrer Kollegen abgezogen, um im zugangsgesicherten Keller zu arbeiten. Als diese das Firmengelände verlassen, nimmt sie die Verfolgungsjagd auf und katapultiert sich in Machenschaften, aus denen sie nicht mehr entkommen kann.
Nazreh, Portugal. Imke Fischer ist Profisurferin. Besorgt beobachtet sie die zunehmende Verschmutzung der Meere durch Kunststoff. Zusammen mit einem Biologie-Professor versucht sie, ihre geliebten Wellen zu retten. Dabei stoßen sie auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihren Atem stocken lassen.
Merta, Peru. Imke Fischer schnappt sich ihren Rucksack und kehrt Deutschland den Rücken. Sie hat genug vom maroden Wirtschafts- und Wertesystem. Sie sucht ihr Heil in den Bergen von Peru, um am Einklang-Gedanken mitzuwirken. Die Essenz vom Sein verbindet die Menschen und das Ego muss vernichtet werden. Doch der Klimawandel und Veränderungen im Umfeld bringen ihre neue Philosophie ins Wanken. Wofür entscheidet sie sich: Gemeinschaft oder Individuum?
Dann kommt es zum „Großen Kollaps“.
Unterirdische Station Barcelona. Zehn Jahre später. Die Welt hat ihr Äußeres verändert. Imke Fischer kämpft um ihren Platz in der Gesellschaft.
Juliane Kroos, 1990 geboren, lebt und arbeitet in der Region Greifswald. Hauptberuflich ist sie als Krankenschwester tätig. In der Freizeit widmet sie sich, neben der Familie, ihrer Leidenschaft dem Schreiben. Als Selfpublisher veröffentlichte sie den Fantasy-Roman „Sternenstaub“ und das eigens illustrierte Kinderbuch „Das Api und die Kleine Einsiedelei“. Zudem nahm sie an mehreren Poetry Slam-Veranstaltungen teil.
╒ERNAB
ROMAN
JULIANE KROOS
Für Frieda, Linda, Stella und Dirk.
TEIL 1
Kapitel 1Lubkow, Deutschland
Der Tag beginnt vor dem Spiegel. Ich male mir die Lippen rot. Nicht ziegelrot. Nicht knallig und auch nicht auffallend. Eher so ein dezentes Rot, bei dem man sich fragt ob es natürlich ist oder doch nachgeholfen wurde.
Der Lippenstift vibriert. Meine Hand zittert. Nervosität, die es sich in meinem Bauch bequem gemacht hat und für Aufruhr sorgt.
Ich werfe einen abschließenden Blick auf mein Spiegelbild. Es lächelt mich verlegen an. Ich streife mit den Fingern durch mein rötliches Haar. Die Frisur sitzt. Die blauen Augen der Frau gegenüber sehen ein wenig müde aus.
Lebensmüde?, frage ich mich. Oder warum habe ich mich vor zwei Monaten dazu entschlossen meinen unbefristeten Job aufzugeben? Ohne Sicherungsseil oder Auffangnetz. Die Nervosität kribbelt in meinem Bauch. Ich lebe noch. War es die richtige Entscheidung? Entscheidungen – ein Massenmord an Möglichkeiten. Keine Entscheidungen – keine Bewegung. Keine Bewegung – Stillstand. Stillstand – Tod.
Ich verlasse das Bad, betrete den Flur und schmeiße mir den Mantel über. Ich greife zum Regenschirm und ziehe mir die Gummistiefel an. Die eleganten Hochhackigen verstaue ich im wasserfesten Einkaufsbeutel. Als ich nach draußen trete, begrüßt mich eine Regen-Schnee-Matsch-Mixtur. Es ist halt Ende Januar.
Ich schließe die Tür und verweile für einen kurzen Moment vor meinem Haus. Es liegt im Schoß einiger Kiefern mit ruhigem Blick aufs Meer. Lubkow, Eintausend-Seelen-Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Am Bodden und nicht an der Ostsee. Das hat durchaus seine Vorteile. Eine kleine Perle fernab des Massentourismus. Der Strand ist vier Kilometer lang und vollster feiner, weißer Körnchen, die sich in jede erdenkliche Ritze verkrümeln können. Das Wasser ist seicht, nicht immer klar, dafür meist mild. Selbst bei Stürmen lässt es eher Sanftmut walten.
Ich öffne die Gartenpforte und blicke zurück. Mein Haus, kein Kredit. So ganz ohne Sicherungsseil war meine Kündigung dann wohl doch nicht. Muss ich mir eingestehen.
Vor einigen Jahren siedelte sich das Unternehmen Pharmasee in einem alten Industriegebäude in Lubkow an. Rasch manifestierten sie ihr Standbein im Pharmaka- und Medizinprodukte-Sektor. Schließlich lässt der Lauf der Dinge jeden Menschen altern. Sie werden krank und brauchen Arzneimittel zur Heilung oder Linderung ihrer Leiden.
Lubkow war perfekt. Im Vergleich zum restlichen Deutschland geringe Standort- und Lohnkosten. Die Infrastruktur war bereits gut ausgebaut. Ein kurzer Weg nach Greifswald mit seinem Universitätsklinikum sowie nach Berlin und ins östliche als auch nördliche Europa.
Ich stehe unter den ausgebreiteten Armen einer wildfremden Kiefer. Ich luge an ihrem Stamm vorbei. Unweit entfernt befindet sich jenes Industriegebäude auf dessen Dach die fetten Letter von „Pharmasee“ thronen.
Ein prüfender Rundumblick. Die ollen Gummistiefel wandern in die Tüte und die eleganten Hochhackigen werden übergestreift. Für den guten, ersten Eindruck. Für den Schein, den Anspruch der Gesellschaft. Den Beutel mit den Gummistiefeln lasse ich am Baum stehen. Hoffentlich werden sie nicht pflügge, sondern warten auf mich.
Slalomlaufend weiche ich den unzähligen Pfützen aus. Als ich in der trockenen Eingangshalle von Pharmasee stehe, atme ich einmal tief durch.
Meine Füße sind nass. Trotz vorausschauendem Handeln. Die Kälte schleicht über meine Zehen hinweg und versucht sich den Rest meiner Extremitäten einzuverleiben. Meine Blase schlägt Alarm und übermittelt den Befehl „Pullern!“ ans Gehirn.
Hektisch scannen meine Augen den Eingangsbereich ab. Kein Hinweisschild für eine Toilette ersichtlich. Stattdessen nähert sich mir ein Mann mit Anzug. Mit breitem Grinsen und ausgestreckter Hand kommt er auf mich zu.
„Frau Imke Fischer?“, fragt er mich, während seine Pranke meine Hand schon umschließt und zur Begrüßung schüttelt.
„Ja, die bin ich“, folgt meine Antwort prompt. Kräftig zudrücken, denke ich. Souveränität ausstrahlen. Schließlich habe ich für eine Frau beachtlich große Hände. Doch im Vergleich zu seinen wirken sie fast winzig. Ich fühle mich mit meinen neununddreißig Jahren wie ein kleines Schulmädchen.
„Georg Bauer. Freut mich Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir bitte damit wir das Bewerbungsgespräch beginnen können.“
Ich folge und versuche die nassen Schuhe sowie die penetrante Blase wegzulächeln.
Kapitel 2Nazreh, Portugal
Unser beschauliches Dorf verwandelt sich für einige Male im Jahr zu einem Magneten. Ein Magnet, der sowohl die Surf-Elite als auch unzählige Touristen anzieht. Genauso in diesem Jahr. Statt der sonst eintausend Leute tummelt sich das Dreifache in den Straßen und am Strand. Sonst fernab, jetzt Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Meine Anreise ist kurz. Ich schaue aus dem Fenster wenn sich der Atlantik zu meterhohen Wellen auftürmt. Der Big-Wave-Weltcup steht vor der Tür. Beim Gedanken, auf der atemraubenden Tube zu schweben, durchströmt mich Adrenalin. Ein wahnsinniges Gefühl von Fliegen, Schwerelosigkeit und Fallen gleichzeitig. Obwohl die meisten Schaulustigen nie in den Genuss gekommen sind dieses Gefühl selbst zu erleben, scheint die Faszination greifbar. Vielleicht treibt sie auch die Sehnsucht her. Ein Traum von einem anderen Leben, den sie dann im Sommerhalbjahr als gestrandete Robben auf meinen Brettern verwirklichen wollen. Ein bisschen Surflifestyle bevor es wieder zurück in den Mief irgendeiner Großstadt geht. Nine to five, montags bis freitags.
Zugegeben, mir ging es damals ähnlich. Als Jugendliche liebte ich den Film „Gefährliche Brandung“. Ich hörte rund um die Uhr Jack Johnson, übte das Shaka, bei dem Daumen und kleiner Finger ausgestreckt und die restlichen Finger eingezogen sind – dann lässig die Hand hin- und herschwenken. Ich wollte in der Fantasie von einer anderen Version von mir selbst aufgehen. Ich bin zwar in einem kleinen Dorf namens Lubkow am Meer aufgewachsen, doch lieferte der Bodden in Deutschland keine brauchbaren Wellen. Windsurfen oder Kiten kamen für mich nicht in Betracht. Das war nicht dasselbe. Stattdessen schickten mich meine Eltern zur Musikschule. Da ich in der Übungsstunde keinen Ton aus der Klarinette herausbekam, lernte ich Querflöte. Statt zu coolen Surfspots zu fahren, bin ich damals von Altenheim zu Dorffest getingelt – mit den anderen pickelpubertierenden Jugendlichen der „Band“. Wir hatten von Klassikern bis hinzu Schunkel-Mitklatsch-Liedern alles im Repertoire. Rückblickend betrachtet war es eine schöne Zeit. Und noch heute, zur Dämmerung, wenn lediglich wenige Menschen an der schroffen Küste spazieren gehen, sitze ich auf der Klippe und spiele Querflöte. Ich begleite die Sonne wenn sie an Portugals Himmel im Wasser versinkt.
Als mich der Schaum der Brandung zum Ufer treibt, juchze ich vor Glückseligkeit auf. Der Strand hat sich in einen Ameisenhaufen verwandelt. Trotz der Vielzahl an Menschen hört mich keiner. Das tosende Meer ist einfach zu laut, zu mächtig. Ich bin gerade eine Welle von neunzehn Metern gesurft und habe sie gestanden. Ein anderer Ausdruck wäre vermessen. Gemeistert, gebändigt, besiegt – alles Worte von jemanden, der nur ein Mikro in der Hand hält, aber selbst noch nie auf einem Board stand.
Zu unbedeutend, zu klein, zu machtlos ist der Mensch im Angesicht der Kräfte des Meeres.
Kaum dem Wasser entronnen, noch immer im Rausch, stürzt schon der erste Reporter samt Team im Schlepptau auf mich zu. Viel zu früh reißt er mich mit seinem Fragenbeutel, den er mir jäh um die Ohren schlägt, aus der Euphorie. Das missfällt mir. Doch genau damit bestreite ich eben auch meinen Lebensunterhalt. Also lächle ich und ergebe mich dem Interview. Gute Presse bringt mehr Touristen in meine Surfschule.
„Imke Fischer, herzlichen Glückwunsch. Wahnsinns Ritt. Und das mit neununddreißig. Respekt!“, begrüßt er mich mit einem breiten, nahezu aufgesetzten Grinsen.
Schön weiterlächeln, denke ich. Das wirkt im Fernsehen besser und überzeugt mögliche Sponsoren mehr. Doch durch die Endorphine, die mir die Welle als Geschenk mitgeben hat, fällt es tatsächlich nicht ganz so schwer.
„Für den Sieg wird es wohl heute nicht ganz reichen. Sind Sie enttäuscht?“
„Auf den Sieg kommt es nicht an. Ich habe bereits gewonnen. Ich habe diese krasse Welle überlebt und dazu noch gesurft.“
Kapitel 3Merta, Peru
Was weiß man in Deutschland schon von Peru? Es ist ein Land irgendwo in Südamerika. Reiselustige haben bestimmt schon mal von Machu Picchu gehört und Historiker, Anthropologen und nicht ganz Weltfremde von den Inkas. An panflötenspielende, schwarz- und langhaarige Männer mit bunten Ponchos auf deutschen Marktplätzen muss ich zwangsläufig denken. Auch an Lamas, dann wiederum an diesen einen Disney-Film, „Ein Königreich für ein Lama“.
Was hört man sonst so in den deutschen Nachrichten von Peru? Erstaunlich wenig. Das ist meines Erachtens und für mein Anliegen auch gut so. Ich will so weit wie möglich weg vom Nabel der Welt - fernab. Weg von Europa, weg von den USA, China oder sonstigen Mächten, die den Takt des Welttanzes vorgeben. Peru ist kein kommunistisch regiertes Land – demnach nicht im Fokus von westlichen Demokraten, die einen Regierungswechsel anvisieren. Peru scheint weltpolitisch für wenig Aufsehen zu sorgen. Diese Tatsache finde ich gut als ich mit meinem Backpackerrucksack in der Empfangshalle vom Flughafen BER stehe – mitten im Hotspot, im Schmelztiegel der Kulturen, bewacht von waffentragenden Polizisten in Uniform.
Ich bin früh da. Noch zwei Stunden bis der Flieger startet. Auch wenn es jetzt gilt, die Zeit totzuschlagen, bin ich froh, dass ich in der Nacht aufgestanden bin um meine Reise von Lubkow anzutreten. Gerade im Januar, wo eine einzige Schneeflocke die hochtechnologisierte Bahn aus dem Konzept und aus jegelichem Zeitplan werfen könnte.
Ich bringe mein Gepäck zum Check-in. Die Schlange ist kurz und ich gleich dran. Sechzehn Kilogramm spuckt die Waage aus. Auf den Schultern fühlt sich die Last deutlich schwerer an.
Zuhause saß ich einen ganzen Tag lang vor diesem Rucksack, lediglich damit beschäftigt den verfügbaren Platz am effektivsten auszunutzen. Statt für ordentliche Baumwollhandtücher entschied ich mich für diese Mikrofaserreisehandtücher, die man in professionellen Outdoor-Geschäften zu kaufen bekommt. Sie sind tatsächlich äußerst leicht und platzsparrend, aber auch äußerst nutzlos. Aber was soll’s. Ich bin im Begriff ein Abenteuer zu wagen und da gehört so ein bisschen verrucht, feuchte Haut doch dazu. Genauso wie die super praktikable Zip-Hose von der Marke mit dem Fuchs sowie die superleichte, wasserdichte und auf Faustgröße verstaubare Dauenenjacke mit der Wolfstatze. Zur Sicherheit, also wirklich nur zur Sicherheit, lasse ich mir diese mit Pulver und katzenfutterartigem Essen gefüllten, brieftaschengroßgepressten Fertigkunststofftüten einpacken. Ich bin gegen diese ganzen E’s, aber an Hunger will ich auch nicht verrecken. Und wie gesagt, diese Tüten sind ja wirklich nur zur Sicherheit.
Als ich meine Tasche packte, Dinge ein- und wieder aus- und dann wieder einsortierte, gelangte ich zu der Weisheit, dass alles, was nicht in den Innenraum des Rucksacks passte, Luxus war. Auf dem Weg nach Berlin stellte ich dann ernüchternd fest, dass alles, was ich nicht auf meinen Schultern tragen konnte, auch Luxus war. Noch auf dem Weg sortierte ich das Duschgel aus. Mit Haarshampoo kann man sich sicherlich auch problemlos den Körper waschen. Ich schmiss die volle Tube in den Müll. Just als sie unten im Eimer auf den Boden klatschte, überkam mich das schlechte Gewissen. Ich versuchte sie noch mit der ausgestreckten Hand zu fischen. Vergebens. Ich hätte sie lieber einem Obdachlosen schenken sollen. Obwohl – hätte ich jenen mit solch einer Aktion brüskiert, da allein Duschen für ihn Luxus bedeutete?
Dennoch fühlte ich mich ertappt, beschämt über mein verschwenderisches Handeln. Gerade weil ich dabei war, ein neues, anderes Leben zu beginnen. Ich müsse es ja auch erst noch richtig üben. Mit diesen Worten besänftigte ich mich und verschlief dann die halbe Zugfahrt nach Berlin.
Ich lege meinen Reisepass auf den Schalter und betrachte dabei die rothaarige Frau auf dem Foto. Sie schaut ernst. Ihre blauen Augen scheinen müde und aufgeweckt zugleich. Als ich das Bild für den Pass machen ließ, war ich müde meines Lebens in Deutschland und hungrig auf einen Neubeginn in Peru.
Die Dame von der Fluggesellschaft entzieht mir förmlich das Dokument aus meinen Händen. Imke Fischer, neununddreißig, Wohnort Lubkow.
Den Pass in ihre Hände zu übergeben, ist, wie mein Leben in Deutschland abzustreifen. Wie eine alte, zu klein gewordene Schlangenhaut. Genau das wollte ich. Aber jetzt, in der tatsächlichen Situation, fühlt es sich irgendwie komisch an.
„One way?“, fragt sie mich.
„Ja, genau“, nicke ich ohne zu zögern. Vorfreude und Tatendrang steigen in mir auf. Mit Zip-hose und Daunenjacke bekleidet verfolge ich meinen Rucksack auf dem Laufband. Richtung: neues Leben. Ich will so schnell wie möglich hinterher, nach Merta in Peru.
Kapitel 4Lubkow, Deutschland
„Wie ist es gelaufen?“, ruft Kathi mir entgegen als ich zur Tür reinkomme.
„Ich weiß nicht. Ich habe kein so gutes Gefühl“, antworte ich und schüttle noch den Regen vom Schirm, bevor ich vollends in den Flur trete. Die Tür zum Wohn- und Schlafraum steht auf. Wie immer, wenn ich sie besuchen komme. Mindestens einmal in der Woche.
Wieder schallt ihre Stimme durch die Wohnung, wobei sie selbst ungesehen hinter der Wand verborgen bleibt. „ Komm schon. Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen!“
„Bist du noch gar nicht aufgestanden?“, frage ich im Gegenzug. Ich mag mich gerade nicht mit dem Gefühl des eigenen Versagens auseinandersetzen.
„Nein!“, kommt es mir prompt entgegegeflogen, umhüllt von einem süßlich riechenden Rauch.
„Kiffst du schon wieder?“, hake ich nach, während ich mir die Hochhakigen von den Füßen streife. Meine Tüte mit den Gummistiefeln stand natürlich nicht mehr an dem Platz, wo ich sie zurückgelassen hatte. Wer klaut denn bitteschön Gummistiefel?, frage ich mich. Also musste ich den ganzen Weg mit den Mistdingern zurücklegen. Blasen an Fersen und Zehen sprießen.
„Mir geht es heute beschissen. Und nun erzähl von deinem Bewerbungsgespräch!“
Tapsend und rutschend gleite ich mit meiner nassen Strumpfhose über die weißen Fliesen im Flur. Sie sind wie immer blitzeblank geputzt. Penelope, die peruanische Reinigungsfee, leistet tolle Arbeit. Hätte ich weiße Fliesen, würden sicher überall Haare und Fussel prächtig zur Geltung kommen. Um dem entgegenzuwirken hätte ich dann bestimmt die ganze Wohnung mit irgendwelchen Läufern gepflastert. Geschickt den Dreck kaschieren.
Ich betrete den Wohnraum, der gleichzeitig als Schlafzimmer fungiert. Das eigentliche Schlafzimmer mit Blick in den Hinterhof ist verwaist. Sie liegt in ihrem Pflegebett, das Kopfteil leicht aufgerichtet, und zieht an einem Joint. Der Blick starr zum Fenster gerichtet. Sie späht über ihren Balkon hinweg. Hier aus dem dritten Stock hat sie eine tolle Sicht auf den Bodden.
Der Wind hat leicht zugenommen und bringt das Meer langsam in Wallung.
Ich ziehe mir einen Stuhl zu ihrem Bett heran. Dann setze ich mich.
„Ziemliche Lackaffen waren das da. Selbstsicher und arrogant, total von sich eingenommen. Was ich mir so unter dem Job vorstellen würde, wie ich meine Perspektive im Unternehmen sehe, so als Quereinsteiger. Das wollten sie wissen. Ob ich loyal und vertrauenswürdig bin. Was meine Motivation für die Bewerbung war. Das halt.“
„Und was war deine Motivation?“ Sie grinst mich höhnisch an.
„Na ja, ich war lebensmüde. Mir fehlte der Kick, mein Alltag war fade. Ich weiß auch nicht.“
„Aber das hast du so nicht gesagt, oder?“
„Natürlich“, kurze Pause, „nicht.“ Ich schmunzle. „Ich habe von dir und deiner Krankheit erzählt, dass ich Menschen helfen möchte. So was kommt doch immer gut an.“
„Dann ist ja gut.“ Sie lächelt. „Möchtest du auch einen Zug? Der hat es heute in sich.“ Sie hält mir den glimmenden Joint entgegen.
Ich zucke mit den Achseln. Schon sauge ich den beruhigenden Qualm in mich ein.
Die Zeit vergeht. Wir schweigen. Und wir rauchen. Ich denke an Kathi. An ihr Schicksal. Während ich mir eine Träne verkneifen muss, blickt sie wieder lächelnd zum Fenster hinaus. Die Wellen werden mit jeder zunehmenden Minute tobender.
„Bist du nicht lebensmüde?“
„Manchmal.“
Sie wendet ihren Blick vom Fenster ab und schaut mir direkt in die Augen. Ihre Augen lächeln genauso wie ihr Mund. Ich schäme mich meiner Wehwehchen wegen.
Kathi ist fünfundvierzig. Vor dreizehn Jahren begannen die ersten Symptome. Ein bisschen Taubheitsgefühl in den Fingern. Kribbeln in den Beinen. So als wenn einem Ameisen über die Haut laufen würden. Manchmal sah sie Doppelbilder. Sie fühlte sich zunehmend erschöpft und matt. Eine Rückenmarkspunktion sowie ein MRT brachten letztlich die Gewissheit: MS – Multiple Sklerose. Eine chronisch-entzündliche Krankheit, bei der das Immunsystem fälschlicherweise die eigenen Nervenfasern angreift und zerstört. Die Weiterleitung von elektrischen Impulsen ist fehlgesteuert. Nicht heilbar, nur behandelbar.
Kathi gehört zu den Patienten, bei denen die Krankheit mit Schüben anfing. Mittlerweile ist sie chronisch fortlaufend. Mittlerweile ist Kathi auf den Rollstuhl angewiesen. Zwar nicht zu jeder Zeit, aber öfter als lieb. Ihr fällt es schwer das Gleichgewicht zu halten und sich koordiniert vorwärts zu bewegen. In Schüben hat sie oft schmerzhafte Muskelkrämpfe oder eine verwaschene Sprache. Zeitweise muss sie sich selbst, wenn die Blase schon bis zum Platzen gefüllt ist, katheterisieren, um ihren Urin ablaufen zu lassen.
Kathi war zweiunddreißig, als sich die ersten Symptome bemerkbar machten. Sie hatte wenige Jahre zuvor ihr Medizinstudium beendet, Schwerpunkt Infektologie. Sie hatte einen guten und sicheren Job. Sie war glücklich liiert und hatte ein tolles Hobby. Die Wochenenden verbrachte sie damit an Triathlonwettbewerben teilzunehmen.
Nun ist Kathi fünfundvierzig. Für das Institut arbeitet sie lediglich auftragsweise. Ihr Lebensgefährte hat sie verlassen, weil in dem Wort „Lebensgefährte“ für ihn anscheinenden zu viel „Gefahr“ steckte. Als es darum ging eine gemeinsame Zukunft mit allem Pipapo zu gestalten, zog er den Schwanz ein. Mögliche Kinder mit MS, ein Haus, das nicht selbst gereinigt werden konnte und Reisen mit Rollstuhl waren ihm zu viel. Triathlon betreibt Kathi nur noch, wenn sie die Fotos von damals im Album anschaut.
Kapitel 5Nazreh, Portugal
Die Wellen sind wieder auf ein normales Maß geschrumpft. Der Trubel vom Surfweltcup ist vorbei. Jegliche sensationshungrigen Journalisten und Touristen sind wieder in ihre Flieger sowie Autos gestiegen und haben Nazreh bis auf weiteres den Rücken zugekehrt.
Unser Ort wirkt abermals verschlafen und ruhig. Für die Frühjahrs- und Sommerreisenden ist der Januar noch zu kalt und zu rau. Im April werden sie wieder langsam eintrudeln, um meine Surfschule zu fluten. Bis dahin muss ich sehen, wie ich über die Runden komme. Da ich einigermaßen talentiert bin Wörter aneinanderzureihen, schreibe ich ab und an für die Lokalzeitung. Ich schreibe berichtend über Dorffeste, Sportveranstaltungen und Ähnliches. Lokalnachrichten eben. Aber nicht wie jene Journalisten vom Surfweltcup, denen es um extravagante Schlagzeilen geht, Sensationsmeldungen, vielleicht auch nicht immer um die Wahrheit, sondern ums Geld. Dabei spielt der Journalismus eine extrem wichtige Rolle für die Meinungsbildung der Bevölkerung indem meinungsfrei und sachlich berichtet wird. Einige Journalisten verstehen sich darin, Gedankenblasen zu erschaffen, in denen man sich bewegen kann und denkt, man sei frei in seiner Meinung. Andere machen keinen Hehl daraus ihre Meinung als die richtige zu proklamieren. Es ist schwierig geworden, heutzutage Wahrheit von Unwahrheit zu trennen. Hinzu kommt dann noch die ganz persönliche Wahrheit von jedem Einzelnen.
Wenn ich neben der Arbeit Zeit finde, nutze ich jede Sekunde und fahre mit meinem kleinen Auto raus aus Nazreh. Nach wenigen Kilometern wird die Küste schroffer. Die Klippen und Dünen türmen sich auf. Der rötliche Sandstrand ist dann noch einsamer. Dort fühle ich mich am wohlsten. Ich schwinge mich auf mein Board und paddle mit meinen Armen hinaus aufs weite Meer. Dem Horizont entgegen. Vom Land aus gesehen bin ich nur noch ein verschwommener Fleck, der eins mit der Natur geworden ist.
Die erste große Welle erwischt mich und treibt mich wie einen Fremdkörper, den es loswerden will, Richtung Land. Ich juchze vor Freude. Das Surfbrett eiert sanft unter meinen Füßen. Ich verliere die Kontrolle und springe ab. Augen zu. Wasser an. Mein Fall wird gebremst, ich rudere nach oben. Plötzlich legt sich etwas Einvernehmendes über mein Gesicht. Ich durchbreche die Oberfläche. Es nimmt mir die Luft zum Atmen. Ich greife mit meiner Hand zu und ziehe mir eine olle Plastiktüte vom Kopf. Scheißding.
Meine Gedanken nehmen mich auf eine Zeitreise mit. Ich denke an früher, an meine Heimat in Deutschland. An Lubkow und an den Bodden. Ich kann mich nicht erinnern dort jemals so viel Müll am Strand vorgefunden zu haben wie hier rund um Nazreh. Ich weiß noch wie ich kopfschüttelnd die Ökoheinis belächelte, die mit erhobenem Zeigefinger auf die Problematik der Plastikentsorgung hinwiesen. Ich war der Meinung, dass das Thema künstlich aufgebauscht wurde. Sensationsschlagzeilen der geldgeilen Journalisten.
Erst in Portugal erfuhr ich am eigenen Leib, dass nichts davon aufgebauscht war. Als ich das erste Mal unbekümmert über den Strand zum Wasser rannte, schnitt ich mir die Sohle an einem scharfen Plastikteil wund. Ich blickte hinab und erschauderte. Ich stand in einem Mülleimer. Vor meinem inneren Auge spielten sich drastische Szenen ab. Süße Schildkröten, die einen Beutel um den Hals geschnürrt hatten, eine Möwe, die versucht eine Riegelverpackung hochzuwürgen und ein Wal, der mehr Plastikmüll in seinem Magen hatte als ich zuhause in meinem gelben Sack.
Mir wurde auf einem Mal schlagartig bewusst, dass der Bodden ein sehr eingegrenztes Gewässer war. Nochmal eine Abgrenzung von der Ostsee, welche ja auch schon eine Abgrenzung von der Nordsee und dem dazugehörigen Atlantik war. Was sollte dort schon mit den Meeresströmungen angeschwemmt werden? Wenn man Müll am Strand fand, dann meist von irgendwelchen Hirnis, die ihre Bierbüchsen voll zum Strand hingeschleppt bekamen, sie aber leer und leichter dann nicht mehr zurücktragen konnten. Die Erkenntnis lag die ganze Zeit direkt vor mir. Mit einem Blick auf die Landkarte hätte es Klick machen müssen. Aber ich war blind oder hatte Scheuklappen auf.
Der Atlantik war anders. Ein weiter, offener Ozean, verbunden mit den restlichen Meeren des Globus. Hier in Nazreh fand ich nicht nur die Bierbüchsen von ansässigen Hirnis, sondern den Müll aus aller Welt. Und das zu Hauf.
Ich knülle die Plastiktüte zusammen und stopfe sie mir unters Hosenbein von meinem Neo. Klebrig klatscht sie mir an meinee Haut. Ich ekel mich ein wenig. Doch ich will nicht so wie die Hirnis sein. Ich will sie nicht zurücklassen. Ich klettere auf mein Brett und lasse mich ans Ufer zurücktreiben.
Als ich festen Boden unter den Füßen spüre, setze ich mich. Die Gischt umsäuselt meinen Körper. Heute verspüre ich keine Lust mehr aufs Board zu steigen. Ich packe meine Sachen zusammen und gehe zum Auto. Heimfahrt.
Zuhause angekommen, klappe ich meinen Laptop auf. Suchmaschine: Plastik.
Synthetisch hergestellte Kunststoffe auf der Grundlage von Erdöl, Kohle, Erdgas. Nicht-regenerierbare Energien. Endliche Rohstoffe. Riesige Plastikinseln. Fünf. Die größte so groß wie ganz Mitteleuropa. Ich sehe die Schildkröte, die Möwe und den Wal wieder vor Augen.
Ich beginne meinen Artikel mit: Eine Schildkröte, die nach Luft japst, eine Möwe, die verzweifelt würgt, ein Wal mit Bauchweh – Willkommen im Plastikzeitalter.
Meine Finger hauen auf die Tasten. Sie klimpern eine Melodie voller Eifer und Leidenschaft für eine Sache. Allegro. Ich füge Fotos aus meinem Bilderordner ein, die ich über die Jahre von den umliegenden Stränden Nazrehs geschossen habe. Sie zeigen wunderschöne Landschaften, zugedreckt mit Müll, der nur schwer vergeht. Am Ende rufe ich die Leute zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion auf. Nazreh räumt auf! Nächstes Wochenende schon. Die Brisanz des Themas brennt mir unter den Fingernägeln. Ich kann nicht mehr still sitzen bleiben und einfach nur zuschauen.
Ich teile das Happening und den Bericht auf meiner Facebook-Fanseite. Als professionelle Surferin habe ich mir im Laufe der Zeit eine gewisse Fanbase erarbeiten können. Anschließend fahre ich persönlich zu der Verlegerin der Lokalzeitschrift nach Hause. Ich klingel Sturm an ihrer Tür. Sie öffnet. Ich übergebe den Artikel.
„Bitte sofort drucken. Ich möchte kein Geld dafür. Danke.“
Dann bin ich wieder weg.
Kapitel 6Merta, Peru
Ich lande in Lima. Als ich den Flieger verlasse, trifft mich das Klima wie ein Faustschlag ins Gesicht. Natürlich habe ich noch die Hosenbeine an meiner Zip-Hose dran und trage die dicke Daunenjacke, die ich in Deutschland bitter nötig hatte.
Es sind dreißig Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit beträgt neunzig Prozent. Es regnet aber nicht. Mir quillt sogleich der Schweiß aus sämtlichen Poren. Doch verdunsten tut er nicht. Wo soll er auch hin? Die Luft selbst ist ja schließlich schon feucht genug. Mir wird ein bisschen schummerig und ich japse ein wenig nach Luft. Hecktisch zerre ich mir die Jacke vom Leib und verstaue sie klitzeklein zusammengepackt in meinem Rucksack. Ich öffne den Reißverschluss an den Hosenbeinen und lasse sie erschöpft zu den Knöcheln sinken. Sie finden halt an meinen Wanderstiefeln. Ich bin zu erledigt, um mir die Botten nun aufwendig aus- und wieder anzuziehen.
Den anderen Passagieren folgend, trabe ich über das Flughafenfeld bis zur klimatisierten Halle. Die Luft ist angenehm kühl. Fast augenblicklich beginne ich zu frösteln. Meine Armhaare richten sich auf. Ich ziehe mir meine Hosenbeine wieder hoch und bin außerordentlich glücklich darüber, sie vorhin nicht vollends ausgezogen zu haben.
Ich steige in den nächsten Flieger und lande nach etwas über einer Stunde in Cusco. Hier ist die Luft nicht mehr ganz so schwül und auch nicht mehr so heiß.
Den Anweisungen meiner peruanischen Freundin Penelope folgend, steige ich in den Bus mit der Nummer zweiundvierzig. Ich bin einer der ersten Passagiere und nehme freudig am Fenster Platz. Ich bin aufgeregt. Gespannt auf den ersten Eindruck meiner neuen Heimat.
Nach kurzer Zeit ist der Bus rappelvoll. Die Sitzplatzkapazität reicht für die ganzen Fahrgäste nicht aus. Doch das scheint hier niemanden zu stören. Neben mir hat sich eine Frau mittleren Alters hingesetzt. Sie sieht dürr aus. Die Haut ist sonnengegerbt, ein wenig faltig. Sie hat volles, schwarzes Haar. Sie trägt es zu einem Zopf zusammengebunden. Hier und da lugen graue Strähnen hervor. Ob sie älter aussieht als sie ist?
Der Bus fährt los.
Penelope hatte mir einst von Merta erzählt. Als wir zusammen am Strand in Deutschland einen Cocktail schlürften. Sie kannte jemanden, der in dem peruanischen Ort lebte. Das Dorf versuchte autark zu leben, sich vom Rest der Welt abzukapseln. So weit es eben ging. Von den sogenannten normalen Leuten wurden die Bewohner als Hippies oder weldfremde Esoteriker betitelt. In Merta gab es wohl soetwas wie Friedens- und Einklangstheorien. Mein Interesse war geweckt.
Ich begann sie wie eine Zitrone auszuquetschen. Doch sie konnte mir nicht viel mehr Informationen liefern. Es entsprach nicht ihrer Lebensphilosophie.
Ich hatte keinen Bock mehr auf die gesellschaftlichen Zwänge, die mir Deutschland aufdrängte, auf dessen Bürokratie, auf ein Leben, in dem man nur etwas wert war, wenn man arbeitete und viel Geld scheffelte. Ich hatte keinen Bock mehr auf Konsum und Heuchelei. Ich war ein braver Hamster im Hamsterrad gewesen. Ich bin immer schnell gelaufen. Ich war gut. Doch ich war müde.
Mit Penelopes Hilfe verfasste ich eine E-Mail auf Spanisch an ihren Freund in Merta. Darin stellte ich mich vor und bekundete meine Absicht, ein Teil der Dorfgemeinschaft zu werden.
Eine lange Woche musste ich auf die Antwort warten. Dann kam die Einladung. Ich war glücklich. Augenblicklich kündigte ich meinen Job, buchte meinen Flug, lud mir eine Spanisch-Lern-App runter, kaufte meine Outdoor-Survival-Sachen und packte meinen Backpackerrucksack. Ich konnte es kaum erwarten mein altes Leben zurückzulassen. Naja, nicht ganz. Ich konnte es nicht übers Herz bringen mein Haus zu verkaufen. Also gab ich es in die besten Hände, die ich kannte. Ich überreichte die Schlüssel meiner besten Freundin. Sie war chronisch krank und konnte den Platz gut gebrauchen. Penelope würde ihr schon mit der Bewerkstelligung der anfallenden Arbeiten helfen.
Wir fahren immer weiter bergauf. Die Landschaft wird karger und dürrer. Doch irgendwie gefällt mir das. Beschränkung auf ein Minimum. Weite Flächen, über die man hinwegsehen kann. Dann immer wieder Gebirge, gefolgt von Tälern.
Meine Sitznachbarin schaut mich neugierig an. Eher verlegen und heimlich. Ich spüre allerdings ihren Blick auf meinem Gesicht. Sie mustert meine helle Haut, meine blauen Augen und die roten Haare. Ob sie wohl schon mal rote Haare gesehen hat? Wahrscheinlich fragt sie sich, was ich hier in der Pampa verloren habe. Ihr Blick wird mir mit zunehmender Zeit unangenehm.
Mit einem Mal erstrecken sich riesige Felder vor uns. Soweit meine Augen die Szenerie erfassen können, nur Felder. Damit habe ich nicht gerechnet. Ein leises „Oh!“ entfährt meinen Lippen. Ich höre die Frau neben mir schmunzeln.
Ich krame ein paar gelernte Brocken Spanisch aus meinem Hirn zusammen. Ich drehe mich zu der Peruanerin und frage sie, was hier angebaut wird. Sie zuckt erschrocken zusammen. Damit hatte sie wohl nicht gerechnet. Weder damit angesprochen zu werden noch, dass es auf Spanisch geschieht. Sie fängt sich und lächelt verlegen.
„El oro blanco“, sagt sie. Das weiße Gold.
Ich nicke, weiß aber nicht genau, was sie damit meint. Ich zucke mit meinen Schultern. Aus meinem Rucksack krame ich das Spanischwörterbuch hervor. Ich reiche es ihr. Sie blättert. Sie stoppt. Sie zeigt auf ein Wort.
Baumwolle.
Wir beginnen einen Mix aus Spanisch und Zeichensprache zu sprechen. Irgendwie verstehen wir uns. Zumindest das Gröbste.





























