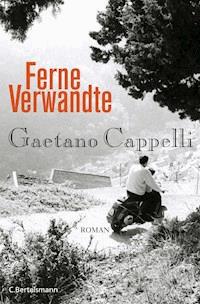Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Copyright
Für Harold Budd und zum Gedenken an Angelina Sofia Morone (1927-1980), meine Mutter
You were slim and smooth as a fishYou were a new world. My new worldSo this is America, I marvelledBeautiful, beautiful America.
Ted Hughes, 18 Rugby Street
1
Ich bin ein Waisenkind, eine arme Vollwaise. Das ist das Erste, was ich mit Sicherheit über mein Leben weiß, aber es regt mich nicht weiter auf.
Das heißt, am Anfang war es wohl schon schwer, nur dass ich mich nicht mehr daran erinnere, an diese Anfangszeit. Ich muss viel geweint haben – was natürlich ist. Du bist vier und hängst noch am Rockzipfel der Mamma, und plötzlich ist deine Mutter weg, und alle – deine Tanten, deine Onkel, vermute ich mal – sagen dir ständig, dass sie weg ist, aber irgendwann wiederkommt und du nicht zu verzweifeln brauchst. Aber sie kommt nicht wieder.
Mein Vater übrigens auch nicht, aber der ist sowieso nie da gewesen. Nonnilde hat sein Foto von seinem Stammplatz auf dem Klavier genommen und auf die Kommode im Schlafzimmer gestellt, neben das von Großvater Carlo, Onkel Arcangelo und den vielen anderen, die ich nicht kenne. Daneben hat sie das Foto von meiner Mutter platziert – ein Foto mit Farben, die wie die Flecken eines misslungenen Aquarells aussehen: Sie trägt ein Kleid aus grüner Seide, neigt sich so zur Seite, dass ihr Haar auf die Schulter fällt, und lächelt, obwohl sie am Rand eines finsteren Bergkamms steht. Jeden Morgen werfe ich der Mamma eine Kusshand zu und auch dem Babbo eine, dann bekreuzige ich mich und renne barfuß ins Klo, weil ich dringend muss. Nachts wache ich manchmal auf und weine. »Sei still. Schlaf«, sagt Nonnilde dann ungerührt. Und ich bin still und schlafe. Bei ihr gibt es keine Diskussionen – daran kann niemand in der Familie rütteln.
Seit Großvater Carlo tot ist, führt sie das Kommando. Wenn man das gemeinsame Foto von Großvater und Großmutter betrachtet – unser Haus ist voller Fotos, und dieses befindet sich im Salon mit den Jugendstilmöbeln: er hager, elegant, mit Schnauzer und mit einem Spitzbart auf dem vorgereckten Kinn, die großen Augen sehr sanft, sie im dunklen Kleid mit Blümchenmuster nach französischer Art, zwischen den Fingern die Steine einer ihrer hundert Halsketten und etwas Bedrohliches im Blick -, wenn man sich also die beiden auf diesem Foto ansieht, ist klar, dass es immer schon die Großmutter war, die das Sagen hatte. Es wurde am Tag ihrer Hochzeit aufgenommen. Nonnilde ist nicht in Weiß, weil kurz zuvor ihr Bruder Arcangelo massakriert wurde, der Dichter und Afrika-Legionär – tatsächlich ist er bis auf ein Schienbein aufgefressen worden, wie ich aus einer jener gewundenen Familiengeschichten weiß, die ich hin und wieder aus ihrem Mund höre. Und obwohl sie nicht mehr ganz jung war – sie wird wohl schon über dreißig gewesen sein – und die Ehe mit Großvater Carlo kaum zwei Jahrzehnte dauerte, ist es ihr gelungen, ein Dutzend Kinder auf die Welt zu werfen. Vier von ihnen – Gioacchino, Isidoro, Betta und Agnese – hat sie als Kleinkinder, dahingerafft von Lungenentzündung, Typhus und Masern, zu Grabe getragen und eines, nämlich Enrico, meinen Vater, als Erwachsenen. Von den Überlebenden haben sich zwei in die Klausur eines Klosters zurückgezogen. Die Übrigen sind ordnungsgemäß verheiratet und haben das große Haus, in dem wir unter ihrer unanfechtbaren Herrschaft leben, niemals verlassen. Und Nonnilde kennt wirklich keine Gnade.
Klein, knochig und mit abstehendem, von schwarzen Strähnen durchzogenem Silberhaar tigert sie wie eine Wildkatze durch die stillen großen Zimmer, eine faszinierende Tscherkessenkönigin mit räuberischen Krallen, die in einem fort die Perlen ihrer Ketten malträtieren, und flinken, bohrenden Augen unter finsteren Brauen. Mit einem einzigen Blick kann sie ihr Gegenüber vernichten.
Der kritische Moment des Tages ist das Mittagessen. Jeden Tag sind wir fast dreißig Personen an dem langen Tisch – wer irgend kann, versucht, außer Haus satt zu werden -, reumütig wie die Bauern auf Millets Angelus, das an der Wand hängt. Sie jagt uns Schauer über den Rücken, wenn sie uns der Reihe nach mustert – ein Katzenwesen, das sein Opfer aus der Herde herauspickt -, obgleich ihre wahre Leidenschaft darin besteht, ihre Wut an den Erwachsenen auszulassen, an den Söhnen oder Töchtern, Schwiegersöhnen oder Schwiegertöchtern, ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Verwandtschaftsgrad – in dieser Hinsicht ist sie absolut unparteiisch. Wenn nichts Geschäftliches anliegt, begnügt sie sich mit irgendetwas anderem – mit einer Gabel, die über den Teller kratzt, mit einem Fleck auf dem Hemd, mit einer noch so geringen Verspätung -, stets bereit, aus der Haut zu fahren. Es kommt allerdings selten vor, dass es nicht um »Geschäftliches« geht, will sagen, nicht um den Olivenöl produzierenden Familienbetrieb Premiata F.lli Di Lontrone Olii Superfini, gegründet 1859 – wie das Etikett auf den Flaschen ausweist -, dessen Besitz sich die Großmutter mit Onkel Richard teilt. Aber der weilt in Amerika, und das erklärt alles.
Wir Kleinen wohnen diesen Wutausbrüchen mit angehaltenem Atem bei, starren bestürzt auf den jeweiligen Verlierer, der sich vom Tisch erhebt, manchmal den Teller hinknallt, häufiger aber noch die Tränen zurückdrängt oder es gar nicht erst versucht. Es ist grauenhaft und eindrucksvoll zugleich zu beobachten, wie sie, die zum Umpusten aussieht, so harte Knochen wie Onkel Erminio zermalmt, einen schweigsamen, strengen Riesen, der ohne Weiteres ganze Rudel aufmüpfiger Tagelöhner an die Kandare nehmen kann. Und am Ende bin jedes Mal ich es, den sie – erhobenen Hauptes und mit einer Art Lächeln auf den blutleeren Lippen – so ansieht, als wollte sie sagen: Lern was draus! Denn ich bin nicht nur ein Waisenkind, sondern darf mich eines weiteren Vorzugs rühmen: Die überlebenden Di Lontrones haben sich zwar mächtig ins Zeug gelegt, aber trotzdem nur Mädchen in die Welt gesetzt – meine zwanzig Cousinen -, sodass ich der einzige männliche Erbe bin und letztlich für den Fortbestand des Geschlechtes sorgen werde. Für Nonnilde ist der Name der Familie alles, auch wenn ihr dynastisches Denken ein Rätsel bleibt angesichts der Geringschätzung, die sie den Di Lontrones – und hier spreche ich nicht nur von den Kindern der Di Lontrones! – immer entgegengebracht hat. Warum hat sie zum Beispiel einen Mann wie Großvater Carlo überhaupt geheiratet? Vielleicht hatte sie Angst, als alte Jungfer zu enden, obwohl ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass die Großmutter vor irgendetwas Angst hat. Vielleicht war es für eine Frau einfach selbstverständlich, irgendwann einmal zu heiraten, und sie hatte den kritischen Zeitpunkt bereits überschritten. Vielleicht aber war die Sache noch einfacher, und sie fand den Großvater schlichtweg amüsant.
Denn jedes Mal, wenn sie mir von ihrem Mann erzählte, musste sie lachen. Er hatte dem Vino Aglianico tüchtig zugesprochen und war ein glückloser Jäger mit Sitzfleisch gewesen – ganze Tage verbrachte er zigarrerauchend unter einer Eiche und wartete gedankenverloren darauf, dass ihm irgendeine Beute vor die Büchse lief, was praktisch nie geschah. Die einzige Aktivität dieses eleganten Mannes mit den liebenswürdigen Manieren außer jener, die größtmögliche Anzahl von Frauen zu erobern, bestand in der Organisation von Ozeanüberquerungen für die Auswanderer. Seiner Zeit weit voraus, hatte er eine Art Reiseagentur gegründet und kümmerte sich um die Cafoni, die Hinterwäldler vom Dorf, die sich in der großen Hafenstadt zu wenig auskannten, um sich allein einschiffen zu können. Unweigerlich verirrte er sich dann selbst in den Gassen von Neapel, obwohl er zehn Jahre dort gelebt hatte, und steuerte nach »Dienstschluss« sicheren Schrittes auf die cafés chantants und die Bordelle zu, wo er das Zehnfache dessen ausgeben würde, was er verdient hatte, ohne allerdings zu vergessen, bei seiner Heimkehr Geschenke für seine Frau und seine Kinderchen mitzubringen. Kam die Rede jedoch auf den Bruder ihres Mannes, Riccardo – oder Onkel Richard -, dann lachte die Großmutter nicht mehr. Ihrem Schwager brachte sie nichts als Hass entgegen, während sich ihre Feinde – und mit der gelegentlichen Ausnahme ihrer Kinder war dies der Rest der Menschheit – mit einer diffuseren Variante von Verachtung zufriedengeben mussten. Und doch war es nicht immer so gewesen.
Riccardo ist jünger als Großvater Carlo. Im Gegensatz zu ihm ist er klein und stämmig, hat aber einen großen Kopf, der ihn zu einer imposanten Erscheinung macht. Anders als sein Bruder hat er sein Dorf niemals verlassen, und nachdem er nach dem Tod des Vaters die Leitung übernommen hat, wird der Firma Di Lontrone Olii Superfini sogar das Prädikat »Premiata« zuerkannt. Ferner wird sie ausgezeichnet mit der Goldmedaille des Landwirtschaftsministeriums, mit dem Verdienstdiplom Seiner Majestät des Königs und Kaisers und dem Erhabenen Kreuz Seiner Heiligkeit Pius XI., was man ebenfalls alles auf den Flaschen lesen kann, und sie erreicht neue Gipfel der Rentabilität, die allseits gewürdigt werden. Nicht jedoch von ihm. Er hat Ideen und verfügt über die Intelligenz, diese auch umzusetzen – selbst die Großmutter muss das zugeben -, aber wie soll das gehen in einem so gottverlassenen Nest wie jenem, in dem er geboren wurde? So lässt er sich eines schönen Tages von seinem Bruder begleiten, um sich nach Amerika einzuschiffen – und an jenem Tag verirrt sich Großvater Carlo nicht.
Nach Riccardos Abreise ist Nonnilde an der Reihe. Sie muss seinen Platz einnehmen, und dies zu einer Zeit, da ein Großteil der Frauen nicht im Traum ans Arbeiten denkt, geschweige denn daran, einen Betrieb zu führen, noch dazu in einem Kaff im Süden. Sie dagegen ist niemals zufriedener gewesen. Bis dahin hatte sie sich damit begnügen müssen, ihren Mann, ihre Sprösslinge und ihre Bediensteten zu tyrannisieren, aber jetzt eröffnen sich ihr, dank der Abwesenheit ihres Schwagers, neue Horizonte: An einer ganzen Schar von Bauern, Halbpächtern und Arbeitern kann sie nun ihre Machtgier austoben.
Von Riccardo verliert sich bald jede Spur. Wer sich dankbar seiner erinnert, ist Großvater Carlo, der zwar einen Bruder verloren, sich dafür aber von seiner Frau befreit hat. Schon deutlich trauriger gestimmt sind die Lohnempfänger der Firma, zumindest jene wenigen, die sich mit den Schikanen Nonnildes abgefunden haben und nicht ebenfalls in irgendeinen fernen Winkel der Erde ausgewandert sind.
Dann mögen wohl sechs oder sieben Jahre ins Land gegangen sein, und aus Amerika treffen diese großen Pakete ein, voller Kleider, Konserven, Schallplatten, kleiner Gläser mit einer unbekannten Substanz – Erdnussbutter – und gewaltiger Mengen Schokolade – in Gestalt von Pulver, Tafeln und Sirup. Kurz zuvor ist der Krieg zu Ende gegangen und Großvater Carlo dem Typhusfieber erlegen. Die Firma Olii Superfini steht kurz vor der Pleite, und Nonnilde sieht sich von einer Schar kleiner Kinder umgeben, deren Mäuler sie stopfen muss. Um das zu bewerkstelligen, hat sie einen Teil des Mobiliars verkauft – den anderen hat sie zu Brennholz zerhacken lassen, denn nie hat es längere und kältere Winter gegeben -, außerdem hegt sie eine echte Leidenschaft für Schokolade. Sie muss ihrem Schwager also wieder dankbar sein. Der hat sich in der Zwischenzeit nicht nur einen hervorragenden Namen in der amerikanischen Finanzwelt gemacht, Kathryn Hudds aus der Familie der berühmten Glasindustriellen geheiratet und den kleinen William in die Welt gesetzt, sondern sich auch einiger Buchstaben entledigt, und so signiert er die liebevollen Briefe, die er den Paketen beilegt und die Nonnilde so liebevoll, wie es ihr möglich ist, beantwortet, nun mit Richard. Tatsächlich sollte noch einige Zeit vergehen, bis ihre Beziehung vollends in die Brüche ging, und zwar für immer.
Wenn eine Frau ein Dutzend Kinder zur Welt bringt, vier noch als Wickelkinder verliert, zwei weitere an die Kirche abtreten muss und wenn es sich bei dieser Frau um die Witwe eines unbekümmerten Genussmenschen handelt, eine Frau zudem mit einer angeborenen Neigung zum Kommandieren, die sie noch zu Lebzeiten ihres Mannes veranlasst hat, sich den Familienbetrieb aufzuhalsen, dann ist es nur natürlich, dass diese Frau unter dem Rest ihres Wurfes denjenigen auswählt, der sich am besten eignet, ihre Mission fortzusetzen, und diesen Jemand findet sie zweifellos in Enrico, meinem Vater.
Enrico ist das einzige ihrer Kinder, das keine Probleme mit dem Lernen hat. Er verbringt einen großen Teil seiner Jugend in Neapel, wo er sein Landwirtschaftsstudium in Rekordzeit abschließt. Das Angebot, an der Universität zu bleiben, lehnt er ab – wie freiwillig, ist unbekannt – und beginnt stattdessen in der Firma zu arbeiten, wo er sofort seine große, von der Mutter und vielleicht auch vom amerikanischen Onkel ererbte Entschlusskraft sowie seine erstaunliche fachliche Kompetenz unter Beweis stellt. Es sind verheißungsvolle Jahre. Der Betrieb erreicht wieder die alte Produktivität, ja, übertrifft sie sogar, und die Großmutter kauft einen Großteil ihrer Möbel zurück. Leider hat der junge Mann aber auch das Blut seines Vaters in den Adern und von diesem, außer der Eleganz der Erscheinung, auch die Leidenschaft für die Frauen geerbt. Das müsste an sich noch kein Nachteil sein, wenn nicht Enrico, sobald er in den Zustand der Verliebtheit eintritt – und das passiert ziemlich häufig -, seine Arbeit vollkommen vergessen würde.
Die späte und umso schmerzlichere Entdeckung dieser erblichen Belastung stürzt Nonnilde in düstere Trostlosigkeit. Ihr bleibt nur eine Möglichkeit: die passende Gelegenheit abzuwarten und ihn zu zwingen, wie man so schön sagt, in den Hafen der Ehe einzulaufen. Sie braucht nicht lange zu warten. Enrico verliebt sich in Maddalena Doni. Maddalena ist ein blühendes, schönes Mädchen mit schwarzer Mähne, aus gutem Hause zumal, die einzige und innig geliebte Tochter von Ferruccio Doni, der im Ort für die Steuereinnahmen verantwortlich ist. Für Papà wäre sie eine von vielen geworden, doch dank der Intervention der Großmutter wird sie meine Mutter. Die beiden treffen sich jeden Nachmittag im außerhalb des Dorfes gelegenen Lager der Ölfabrik, und Nonnilde richtet es so ein, dass Ferruccio Doni, Maddalenas Vater, die beiden eines Tages ertappt.
Der in seiner Ehre gekränkte Vater ist nicht nur Steuereinnehmer – ein Aspekt, der bei der Wahl der Großmutter eine Rolle gespielt haben muss, denn welcher Unternehmer möchte nicht mit einem solchen verwandt sein? -, er ist auch der getreue Prior der Bruderschaft vom Allerheiligsten Sakrament sowie Provinzrat der Katholischen Aktion, weil er nämlich alles versucht, um mittels der Religion die Ausbrüche seines sanguinischen und von Natur aus aufbrausenden Charakters – der ihn zu einem der hitzigsten Teilnehmer des Marsches auf Rom gemacht hatte – abzumildern. Die Heirat mit Donna Nora, der edlen Nichte von Don Ferdinando Talete, dem Päpstlichen Geheimkämmerer, der schon zu Lebzeiten im Geruch der Heiligkeit stand, hatte ihn auf diesen Weg gelenkt, aber dass ihm in dieser Hinsicht kein voller Erfolg beschieden ist, bezeugen die öffentlich ausgetragenen Handgreiflichkeiten, zu denen es alljährlich aus nichtigem Anlass kommt. Doch ist es gerade sein gewalttätiges Naturell, das Nonnilde zu ihrer Wahl bewegt: Wer wäre besser geeignet als ein nicht nur bigotter, sondern auch noch rauflustiger Schwiegervater, um die Launen eines zügellosen Schwiegersohns im Zaum zu halten? Und so geht Enrico, kaum drei Monate nachdem ihn Großvater Ferruccio in flagranti mit Maddalena erwischt hatte – er ist buchstäblich mit einem blauen Auge davongekommen -, eine regelrechte Mussehe ein.
Bis hierhin scheint sich alles nach den Plänen der alten Dame zu entwickeln, doch unter den Geschenken, die bei den Jungvermählten eintreffen, befindet sich auch ein Flugticket in die Vereinigten Staaten von Onkel Richard. Nach der Rückkehr von diesen unvergesslichen Flitterwochen ist Papà nicht mehr derselbe. Er ist traurig, abgestumpft und niedergeschlagen. Endlich hat er verstanden, was unter dem American Dream zu verstehen ist, und zwar in seiner vollkommensten Erfüllung. Nach allem, was er gesehen hat, kann er sein Leben im Dorf nur noch als entwürdigend und den Umsatz der Premiata nur noch als demütigend empfinden. Er möchte in Onkel Richards Fußstapfen treten und ebenfalls nach Amerika auswandern, doch als Großvater Ferruccio dieser Wunsch zu Ohren kommt, hätte er beinahe wieder auf ihn eingedroschen. »Meine Tochter bewegt sich keinen Schritt von hier fort, und du, der du ihr Ehemann bist, müsstest schon über meine Leiche gehen!«, brüllt er mit hochrotem Gesicht. Nonnilde blinzelt zufrieden. Mein Vater dagegen wird immer trauriger und trostloser. Er lebt nur auf, wenn er jemanden findet, der ihm bereitwillig zuhört – was nach den ersten Monaten immer seltener der Fall ist – und dem er von dem märchenhaften Reichtum der fernen Verwandten erzählen kann, von ihren weißen Villen am Hudson River, den Abenden im Theater, den Männern im Smoking, den Frauen mit ihren Juwelen, die hinter den Scheiben riesiger Straßenkreuzer und vor der düsteren, aber merkwürdig romantischen Masse der Wolkenkratzer funkeln, den Partys auf Tuchfühlung mit Filmstars wie Ava Gardner, die ihn anstarrte, bis er dahinschmolz, oder Frank Sinatra, der, nachdem er ihn um Feuer gebeten hatte, mit seinem Drink bei ihm stehen blieb und herumscherzte, um ihn schließlich für die Woche darauf zu einem Fest bei sich zu Hause einzuladen … Doch just in dieser Woche hatte er abreisen müssen. Am Ende seufzt er jedes Mal ausgiebig, und sein Blick nimmt den untröstlichen Ausdruck eines Verliebten an, der seine einzige, seine wahre, seine große Liebe für immer verloren hat. Mit der Zeit jedoch scheint er sich mit seinem Schicksal abzufinden. Was bleibt ihm schon anderes übrig bei einer solchen Mutter und vor allem einem solchen Schwachkopf von Schwiegervater? Binnen eines Jahres passieren dann allerdings zwei Dinge, die seine Existenz – oder das wenige, was ihm davon noch bleibt – zutiefst erschüttern sollten.
Eines Tages macht sich Großvater Ferruccio in aller Frühe auf die Reise nach Salerno. Er muss die Unterlagen für seine Pension einreichen und wird am Abend zurück sein; das sagt er zumindest Großmutter Nora, die besorgt die ganze Nacht auf ihn wartet, bis die Carabinieri an die Tür klopfen. Natürlich können sie ihr nicht mitteilen, dass ihr Ehemann am Morgen zuvor im Hotel Lux in Vico Equense aufgekreuzt war, und zwar in Begleitung von Mara Saturno, einer Nutte, und deren Tochter Olga, einer Nutte praktisch von Geburt an, und dass er dieselbe Suite mit Meeresblick verlangt hatte, in der Mussolini einst eine heiße Nacht in ungefähr derselben Gesellschaft verbracht hatte, mit Mara Saturno nämlich und deren Mutter wiederum – eine wahre Dynastie von Nutten, diese Saturno-Damen. Bei der ganzen Dringlichkeit des Falles beschränken sich die beiden Carabinieri darauf, Großmutter Nora zu berichten, dass die Leiche ihres Gatten in einem Zimmer des besagten Château aufgefunden wurde, aber dies genügt der armen Frau, um zu begreifen: Über Jahrzehnte hat sie in den keineswegs seltenen Augenblicken der Intimität die Phantasien ihres Gemahls über jene wilde Nacht, die er in seiner Eigenschaft als treuester Anhänger des Duce selbst organisiert hatte, über sich ergehen lassen müssen. Der Schlag ist so schwer, dass die fromme Frau eine Herzattacke erleidet und innerhalb weniger Stunden ihr Leben aushaucht. Auf den Fotos von den Beerdigungen der Großeltern Doni – es war dies eine Epoche, in der man wirklich alles fotografierte -, die in einem Aufwasch zelebriert wurden, verrät der Blick meines Vaters in der allgemeinen Trauer endlich eine gewisse Heiterkeit: Unverhofft hatte er sich von der schwersten seiner Ketten befreit. Allein, das genügt nicht.
In einem der Pakete, die im Halbjahresrhythmus aus Amerika eintreffen, befindet sich außer den üblichen Stärkungsmitteln – denen sich im Laufe der Jahre die kleinen Wunderwerke der US-amerikanischen Technik hinzugesellt haben: Küchenmixer, Staubsauger, Rasierapparate, Transistorradios, elektrische Dosenöffner – und dem üblichen liebevollen Brief von Onkel Richard an Nonnilde ein weiterer Brief von Onkel Richard, der für Enrico, meinen Vater, bestimmt ist. Der Onkel aus Amerika bietet ihm einen auf sechs Monate befristeten Arbeitsvertrag an, falls er in Kalifornien am Aufbau einer Artischockenplantage mitwirken wolle. Und hier liegt der Grund für Nonnildes Hass auf den Schwager; das ist es, was sie ihm nie verzeihen wird. Enrico bereitet es nach dem Hinscheiden seines reizbaren Schwiegervaters nicht die geringste Mühe, wortwörtlich über dessen Leiche zu gehen. Zu der Großmutter – seiner Mutter – und zu seiner Frau, die im Begriff ist, meine Mutter zu werden – sie ist im zweiten Monat schwanger -, sagt er: »Das ist eine Erfahrung, die ich einfach machen muss: Bis jetzt ist niemand imstande gewesen, in Amerika so etwas anzubauen, Artischocken, und außerdem komme ich gleich wieder zurück.« So aufgeregt ist er, dass er Probleme mit der Syntax bekommt.
Aber es vergingen die sechs vertraglich vereinbarten Monate, ich, sein Sohn Carlo, kam zur Welt, und mein Vater kehrte nicht einmal wegen dieses freudigen Ereignisses nach Hause zurück – danach übrigens auch nicht. An seiner statt trafen immer größere Pakete ein, mit immer kürzeren Briefen darin. Die Mamma las sie mir abends am Bett vor, das mir so riesig vorkam wie der Ozean, der uns vom Babbo trennte, und die Decke hatte ein Muster wie ein wogendes Meer und fühlte sich kalt an. »Dein Vater schreibt, dass er dich liebhat, Carlino«, sagte sie. »Und ich hab dich lieb, und Nonnilde, Tante Ines, Onkel Teodorino, Tante Emma …«, antwortete ich zerstreut, weil ich völlig gefesselt war von dem Spielzeug, das Papà nie für mich dazuzupacken vergaß. Ich war dermaßen glücklich, dass ich überhaupt nicht begriff, warum die Mamma jedes Mal weinend davonlief und mich wie einen Schiffbrüchigen in diesem Riesenbett zurückließ, während draußen vor den Fenstern der Wind über das Tal pfiff.
So geht das vier Jahre lang, bis die Großmutter Besuch von einem ehemaligen Pächter bekommt, der ebenfalls nach Amerika ausgewandert ist. Er ist einer von den vielen, die kommen, um ihr mit gesenktem Haupt und Taschen voller Geschenke ihre Huldigung darzubringen – man weiß nicht recht, warum, da diese Leute in der Zwischenzeit ihr Glück gemacht haben und Nonnilde ihrerseits niemals auch nur die geringste Spur von Großherzigkeit, für die man sich erkenntlich zeigen müsste, an den Tag gelegt hat. Sie empfängt im Arbeitszimmer – einem kahlen Raum mit wenigen dunklen Möbeln, in die grimmige Klauen und Köpfe eingeschnitzt sind -, sitzt in einem Sessel, der wie ein Thron aussieht, und wirkt hochmütiger als eine russische Aristokratin vor der Revolution. Während die Besucher von ihren Erfolgen erzählen, von den angehäuften Ersparnissen, von dem Haus und den Grundstücken, die sie inzwischen im Heimatdorf erworben haben, hört sie mit unbewegter Miene zu, und die Finger spielen nervös an einer ihrer Halsketten herum. Dann schneidet sie ihnen ohne jede Vorwarnung mitten in der überschwänglichsten Schilderung das Wort ab und demütigt sie mit Sätzen wie: »Cafone warst du, und Cafone bleibst du«, »Der Sohn eines Schweinehirten stinkt nach Schweinen« – wie oft habe ich sie, während ich eingerollt wie eine Katze auf ihren Knien lag, noch schlimmere Dinge sagen hören. Aber dieser hier ist nicht der übliche Schollenknecht. Er arbeitet als Gärtner auf dem Anwesen, das an eine von Onkel Richards Villen grenzt, und sieht meinen Vater oft. Deshalb behandelt die Großmutter ihn freundlich, ja, sie scheint sich geradezu für seine Angelegenheiten zu interessieren und bestürmt ihn mit Fragen, bis sie plötzlich explodiert – angesichts ihrer Körpergröße bemerkt man kaum, dass sie aufgesprungen ist. »Wie kannst du es wagen, du Bettler … Raus aus meinem Haus!«, wirft sie ihm an den Kopf, zusammen mit anderen Liebenswürdigkeiten, die ich hier lieber nicht wiederhole. In Wirklichkeit ist sie alles andere als wütend: Sie hat soeben genau das erfahren, was sie brennend zu wissen begehrt hatte, nämlich dass mein Vater eine Geliebte hat – doch die Familienehre muss trotzdem verteidigt werden. Während sich die Tür langsam hinter dem verdatterten Gesicht des Viehhüters schließt, öffnen sich die Lippen der Großmutter zu dem Lächeln eines Menschen, der sich endlich von einer großen Last befreit hat. Hätte ihr Sohn sie und die Firma aus den üblichen Gründen im Stich gelassen – Zerplatzen übersteigerter Jugendträume, ökonomische Erfolglosigkeit, Frustration oder Melancholie als Folge eines weit verbreiteten Syndroms, das sich mit der räumlichen Entfernung von den neuralgischen Zentren der Welt erklären lässt -, dann wäre die Angelegenheit ernst gewesen. Jetzt aber hatte sie die Bestätigung dafür erhalten, dass, wie sie von Anfang an geargwöhnt hatte, eine Frau dahintersteckte. Und da Nonnilde gegenüber den Vertreterinnen ihres eigenen Geschlechts immer schon die größte Gleichgültigkeit hat walten lassen – nicht einmal den unzähligen Geliebten ihres Gatten ist es gelungen, ihr mehr als ein Schulterzucken zu entlocken -, weiß sie aus Erfahrung, dass bei den Problemen, die von einer Frau hervorgerufen werden, nur eine andere Frau – am besten eine Ehefrau und Mutter – Abhilfe schaffen kann. So bestellt sie meine Mamma zu sich und teilt ihr mit, was sie erfahren hat. Sie erwartet, dass der Kummer sich irgendwie auf die Fülligkeit der Schwiegertochter auswirkt, die, an sich schon eine blühende Person, dank der im Süden traditionell mit dem Eintritt in den Ehestand verbundenen Gewichtszunahme richtiggehend fett geworden ist. Da aber der Gram keine nennenswerten Resultate zeitigt, setzt Nonnilde sie einen Monat auf Wasser und Brot, dann packt sie ihr den Koffer, steckt das Foto von Onkel Evaldo dazu, das mich weinend unter dem Weihnachtsbaum zeigt, und verfrachtet sie, in ihrer ganzen wiedererlangten Pracht, in ein Flugzeug Richtung New York.
Ich weiß nicht, ob mein Vater, als er kaum eine Woche später mit der Mamma ein Flugzeug besteigt, in sein Kaff zurückkehren oder nur seine Frau dorthin zurückbringen oder vielmehr seinen wimmernden Sprössling abholen will, um mit der ganzen Familie im Land seiner Träume zu leben. Ich kann es nicht wissen, weil das Flugzeug, eine viermotorige Constellation der letzten Generation, auf seinem ruhigen Flug in tausend Metern Höhe ausgerechnet gegen den Pico Redonta prallt, den einzigen Felsen, der aus dem ganzen Atlantik herausragt, die einzige Landmassenkapriole in einem unendlich weiten Meer. Und so ist es gekommen, dass ich Vollwaise bin und manchmal in der Nacht aufwache und weine. Im Übrigen regt es mich, wie gesagt, nicht weiter auf, zumal die Situation ja durchaus ihre positiven Seiten hat.
Du wächst heran, gehst deinen Weg, hast fast alles vergessen, aber die Leute hören nicht auf, dich gerührt zu betrachten und lieb und nett zu dir zu sein. Vor allem die Frauen. Keine einzige, die sich nicht als deine Mutter fühlte, und das gilt sogar für die Nonnen im Kindergarten, die als ledige Frauen solche Gefühle eigentlich gar nicht haben dürften. Sie überhäufen dich mit Aufmerksamkeiten und Liebkosungen und werden zusätzlich von so manchem theologischen Zweifel gequält – ›Gelegentlich braucht es den ganzen heiligen Glauben, um die Ratschlüsse unseres Herrn zu akzeptieren‹. Die kleinen Mädchen in ihren weißen Kittelschürzen wiederum streiten sich jeden Tag, wer sich mit dir die Brotzeit teilen darf. Aber auch bei den Männern wirkt es: Wenn ich vor den dahinschmelzenden Gläubigen als Messdiener fungiere – »Sieh ihn dir an. Sieht er nicht aus wie ein Engelchen? So ein Unglück, der Ärmste« -, gibt mir der Erzpriester immer das schönste Chorhemd, und in der Schule lässt mir der Lehrer, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, das durchgehen und denkt: ›Was kann man von einem armen Waisenkind schon erwarten?‹, und fragt meinen Banknachbarn ab. Was mein Banknachbar und die anderen in der Klasse denken, weiß ich nicht genau. Ich muss ihnen wie eine Art Märtyrer vorkommen, wie ein kleiner Held, der einem fürchterlichen Massaker entronnen ist und dem man jedes Privileg schuldet, das man ihm wohl nicht ohne einen gewissen Neid auch gewährt. Zu Hause schließlich behandelt man mich zuvorkommender als einen Prinzen. Ich werde gleich nach Nonnilde bedient, bekomme aber die feinsten Bissen, und am Morgen bin ich der Einzige – außer ihr, natürlich -, der das Recht auf den Zabaione mit Marsala hat. Verwöhnt, wie ich bin, taumle ich von einer Umarmung meiner Tanten und meiner unzähligen Cousinen in die nächste. Ganze Tage verbringen sie damit, Sommerhemden und Anzüge und Pullover für mich anzufertigen – und so sind es jene Jahre, in denen ich meinen Sinn für Eleganz entwickle. Sogar die Großmutter geht nachsichtig mit mir um, zumindest bis zu einer bestimmten Nacht – jener Nacht, in der ich feststelle, dass die trotz allem glückliche Zeit meiner Kindheit leider zu Ende ist.
2
In dieser Nacht schlief ich bei Tante Ines und nicht bei Nonnilde wie sonst, seit die Mamma »fort« ist, aber das allein hätte nicht gereicht, um diese Nacht zu einer besonderen zu machen. Die Großmutter muss die Rechnungen überprüfen, die Arbeiter beim Olivenpressen überwachen, den Säuregrad des Öls, die Flaschenabfüllung und den Versand kontrollieren, oder sie muss, was belangloser ist, aufpassen, dass der Bäcker, während er das Brot backt, nicht ein paar Kilo Mehl beiseiteschafft – zu jener Zeit kaufen nur arme Leute Brot -, und hat also so viel um die Ohren, dass sie sich oft nicht einmal hinlegt. Dann muss ich mich im Bett einer meiner Tanten einrichten.
Auch nicht die Hitze, die so außergewöhnlich ist, dass man im Dorf schon ein warnendes Vorzeichen darin sieht, die Ankündigung irgendeines Unglücks, das über uns ängstliche Terroni, uns arme, unwissende Süditaliener, hereinbrechen wird, hätte genügt, diese Nacht zu einer besonderen zu machen, und tatsächlich: Wenn ich mich hin und her wälze und nicht einschlafen kann, geschieht das weder wegen der Hitze noch wegen der Angst vor einem Unglück: Woher soll ich wissen, dass ausgerechnet ich der wahre Adressat jener himmlischen Warnung bin? Nicht einmal das Licht des Mondes, das grell durch das offene Fenster fällt, hätte mich wach gehalten, wenn es nicht ausgerechnet meine Cousine Tea beleuchtet hätte.
Tea ist siebzehn und verlobt mit dem Austrungarico – einem kleinen Glatzkopf, der sich Wunder was einbildet wegen seiner Stellung als Präfekturbeamter in der ehemaligen k.u.k. Stadt Triest – und schon deswegen anders als meine übrigen neunzehn Cousinen. Obwohl sie eine Erstgeborene ist, trägt sie nicht, wie alle anderen erstgeborenen Mädchen, aus Respekt vor der Großmutter den Namen Ilde. Sie hat helle Augen, strohblonde Haare und ein martialisches Wesen: Allen ist unbegreiflich, wie sie das Produkt von Tante Ines und Onkel Teodorino sein kann, die beide dunkel, phlegmatisch und zartbesaitet sind. Tea lernt wie eine Wilde, weil sie Buchhalterin werden will. Sie geht jeden Tag in der ersten Messe, der Sechs-Uhr-Messe, zur Kommunion, übt sich in einem halben Dutzend Sportarten – und das in einem Nest, das noch nicht einmal über eine Turnhalle verfügt! – und zeigt sich als Einzige für mein Unglück vollkommen unempfänglich. Mit derselben Kälte behandelt sie die ganze Familie. Sie führt ein vollkommen eigenständiges Leben, als wäre sie ein Pensionsgast auf dem Weg zu höheren und unergründlichen Zielen, und ist eigentlich die ideale Frau für den Austrungarico. Vor allem aber hat sie zwei große, zwei riesengroße Brüste, und tatsächlich ist es der Anblick derselben, der diese Nacht im späten Frühjahr zu einer besonderen macht.
Von einem unbekannten Impuls getrieben – ich bin schließlich noch ein Kind -, starre ich die Dinger erstaunt an, während sie sich im Mondlicht rhythmisch heben und senken, und ich weiß nicht, was ich darum geben würde, dürfte ich sie berühren, aber wie, da doch zwischen mir und ihrer Besitzerin Tante Ines liegt, die in Abwesenheit ihres Gatten neben ihr hatte schlafen wollen, in einem weiteren vergeblichen Versuch, töchterliche Liebe in ihr zu wecken? Jedenfalls wälze ich mich herum und höre die belegte Stimme der Tante sagen: »Aber was hast du denn, Carlino? Warum schläfst du nicht, mein Schatz?«
»Ich muss mal … Ich muss Pipi machen«, stammle ich das Erstbeste, was mir einfällt.
»Dann geh doch, los«, flüstert sie verständnisvoll.
Ich seufze und gehe. Ich durchquere ein Zimmer nach dem anderen. Ich schaue auf die Leinenvorhänge vor den Fenstern, die wie träge Gespenster wallen. Ich höre die Vitrinen klirren, die vollgepackt sind mit Tellern, Bestecken und Gläsern. Ich sehe, wie die Statue der heiligen Barbara ihre zugespitzte Hand – eine Art mit Rasierklingen gespickte Peitsche – bewegt: Ich weiß, es geschieht, weil der Boden unter meinen Füßen bebt, so alt und ramponiert ist dieses Haus, aber trotz meines zarten Alters ist mir ebenso klar, dass ich gesündigt habe und dass die heilige Barbara zwar die Schutzpatronin der Feuerwehrleute ist, aber auch eine so schreckliche Heilige, dass sie im Dorf mit einem einzigen Blitz ihre eigene Kirche zerstört hat. Was könnte sie also mir, der ich auf die Brüste meiner Cousine geschielt habe, nicht alles antun? Während ich noch darüber nachdenke, kommt es mir vor, als wäre die Statue von ihrem Sockel heruntergesprungen, um mich in der Hölle zu versenken … Bis ich endlich das Klo erreiche, die Tür absperre und mich unter dem Licht der nackten Glühlampe in Sicherheit fühle.
Ich betrachte die Illustrierten mit den herausgerissenen Seiten, die als Toilettenpapier dienen, die bunten Etiketten der Reinigungsmittel gegen das weiße Schwammzeug an der Wand, das kleine Radio, dessen Batterien mit Heftpflaster befestigt sind: Dies ist eine Insel der Realität inmitten eines Meeres der Finsternis. Es ist einer jener Aborte, die man an die alten Häuser drangeklebt hat und die an über dem Tal schwebende Schilderhäuschen erinnern, und obwohl die blühenden Bäume weiß durch die Ritzen leuchten, durchrieselt mich beim Pipimachen ein Schauer, als striche die eisige Winterluft um mich herum. Ich tue einen Schritt zur Seite, richte den Strahl neu aus und sehe zu, wie er sich an der angeschlagenen Emailleschicht der Schüssel bricht. Für gewöhnlich frage ich mich, wo er endet: gewiss doch im Garten, und dann? Wie oft habe ich den Verlauf der in die Wand eingelassenen Leitung studiert und gesehen, wie sie in der Erde verschwindet, habe ihre mutmaßliche Bahn bis zum moosbewachsenen Mäuerchen verfolgt und mit Schwindelgefühlen den darunter gelegenen Felsüberhang betrachtet – wie oft, ohne je die Antwort zu finden? Am Ende schüttle ich mich ein wenig und verräume meinen Pimmel, zusammen mit dieser brennenden Frage. Als ich allerdings die Tür öffne, packt mich erneut die Angst. Eine Hand auf dem Herzen, bleibe ich starr stehen: Ich bitte die heilige Barbara wegen meiner schlimmen Gedanken um Vergebung, und sobald ich überzeugt bin, dass sie mir verziehen hat, renne ich den ganzen Weg mit Überschallgeschwindigkeit zurück. Aber kaum bin ich im Zimmer von Tante Ines – hinter mir noch der Höllenschlund, der mich beinahe verschlungen hätte -, fällt mein Blick auf Teas Riesentitten, diese zwei friedlichen Inseln, die sich aus dem bleichen Meer der Leintücher erheben, und ich zögere nicht: Statt an meinen Platz zurückzukehren, lege ich mich neben sie, neben meine Cousine Tea.
Mir ist bewusst, dass ich etwas riskiere. Wie ich Tea kenne, ist sie im günstigsten Fall imstande loszuschreien, und was würde Tante Ines sagen, und vor allem Nonnilde? Aber Tea ist so nachgiebig, als ich meinen Platz einnehme und mich in die Wärme ihres mächtigen Körpers schmiege. Irgendwann habe ich ihren Arm unter meinem Kopf und die Objekte meiner Begierde direkt vor Augen: Groß sind sie, unendlich und voller Geheimnisse. Und so halte ich den Atem an, strecke eine Hand aus, lege sie sanft auf das glatte Nylon ihres Nachthemds und verharre regungslos, um zu sehen, was passiert.
Nichts passiert. Tea bleibt träge liegen, während mir selbst zumute ist, als hätte ich einen Stromschlag bekommen. Mit wild klopfendem Herzen beginne ich sie zu massieren, erst um die eine Brust herum und dann zur anderen hinüber, ich höre sie stöhnen – es ist nicht zu erkennen, ob sie schläft – und matte Worte murmeln, die mir unbekannt sind.
Immer noch ungläubig staunend über das, was da vor sich geht, tauche ich die Hand in das fleischige Universum, aber jetzt schüttelt meine Cousine Tea heftig den Kopf und stößt ein gewaltiges Schnauben aus. Ich halte inne, fange wieder an, und sie wacht beinahe auf. Es ist klar, dass ich aufhören und mich mit den erzielten Erfolgen begnügen müsste, aber ich bin dermaßen aufgewühlt, dass es mir einfach nicht in den Sinn kommt.
Ich weiß es noch nicht, aber zum zweiten Mal in einer einzigen Nacht – kurz zuvor hatte ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wo mein Pipi landen würde – verspüre ich jene ungestillte Neugier und den Wissensdurst, die dem Menschengeschlecht eigen sind und den Anstoß zu den großen Entdeckungen der Zivilisation gegeben haben, wie ich einige Jahre später von dem aus Marcianise gebürtigen Professor Sabino Corelli erfahren sollte. In jenem düsteren Raum des Klosters, der uns als Klassenzimmer diente, sagte er mit seiner brüchigen Stimme: »Kinderchen, glaubt ihr vielleicht, dass einem die Dinge in den Schoß fallen? Nehmt Christoph Kolumbus zum Beispiel, wie hat der wohl Amerika entdeckt? Die anderen sind zum Meer gegangen, um mit ihrem Schatz den Sonnenuntergang zu betrachten oder Fische zu fangen. Ihm hat das nicht genügt, er wollte wissen, was hinter der fernen Linie des Horizonts lag.« Auch ich will in dieser schwülen Spätfrühlingsnacht wissen, was hinter dem spitzenbesetzten Horizont von Teas Nachthemd liegt, doch wie lässt sich dieser Schatz ans Licht befördern? Ich könnte meine Hand in die Tiefe tauchen und durch einen gezielten Stups von unten ihre Titten auftauchen lassen wie ein Floß aus den Meeresfluten, wenn plötzlich Ballast abgeworfen wird. Aber hier ist kein Ballast, den man abwerfen könnte. Man musste nur die rechte Brust meiner Cousine – sie war von der Stelle aus, an der ich mich befand, leichter erreichbar – in Augenschein nehmen, um zu begreifen, dass bei einem derartigen Gewicht ein enormer Energieaufwand erforderlich wäre und selbst die entrückteste Schläferin wachgeschreckt würde. Und das war Tea sowieso nicht mehr. So zog ich einen Träger herunter, so vorsichtig, wie ich eine Banane schälen würde, und ließ ihn ganz langsam auf ihren Arm gleiten, bis die Aureole ihrer Brustwarze bloßlag, dieses erhabene Atoll, und auch die Brustwarze selbst, strack und gerunzelt wie die Spitze eines Vulkans, die ganze Brust in ihrer runden Pracht und Vollkommenheit also, und nach getaner Arbeit versenkte ich mich in die Betrachtung dieser Naturerscheinung mit demselben Staunen, das ein Heiliger angesichts seiner ersten Vision empfinden mochte. Dann näherte ich ohne jede weitere Hemmung meinen Mund diesem Wunder und sog und sog und sog.
In diesem Moment erwachte Tea und reagierte in einer Weise, die ihres Charakters absolut würdig war: Sie schlug mit solcher Heftigkeit nach mir, dass ich aus dem Bett fiel, auch wenn sie gleich danach, selbst verunsichert wegen des Vorgefallenen – ich war schließlich kaum sieben Jahre alt -, seufzte: »Aber was machst du denn da, Carlino?«
Ich weiß nicht genau, was mich trieb – bis dahin war es ja noch nie passiert -, vielleicht war es der nackte Instinkt, der mich wie jedermann in den tragischen Augenblicken der Existenz auf jene Gestalt zurückgreifen ließ, die ich für immer verloren hatte und an die ich mich kaum noch erinnern konnte, jedenfalls wimmerte ich mit der zittrigsten Stimme, die mir zu Gebote stand: »Mammina, ich will zu meiner Mammiinaaa!«
Dieses Gejammer besänftigte selbst Teas österreichisch-ungarische Strenge. Ihr hartes Herz schmolz dahin, und während ich mich vom Boden aufrappelte, vernahm ich ihre tröstliche Stimme: »Mein armer, armer Kleiner.« Mit einer unvergleichlich größeren physischen Erleichterung spürte ich, wie sie mein Gesicht gegen das ersehnte Objekt – ihren großen, weichen Busen – presste. Diese zärtliche, ungestüme Umarmung war eine weitere, unverhoffte Bestätigung der Vorteile, die sich aus dem Status eines armen Waisenkindes ergaben, und das unerreichbare Vorbild künftiger Anwendungsmöglichkeiten. Natürlich konnte ich nicht ahnen, dass dieses Bollwerk der Gewissheiten kaum ein paar Stunden später in seinen Grundfesten erschüttert werden sollte.
Der anbrechende Morgen wirft gerade sein erstes Licht auf die verblichenen Muster der Tapete, als sich mit einem Ruck die Tür öffnet und Nonnilde auf der Treppe zum Zimmer steht, kerzengerade, mit bleichem Gesicht und zerzaustem Silberhaar, das Gewand von Mehl fluoreszierend, ein wahrer Racheengel: Statt des Schwertes schwingt sie eine Terrine Tagliolini mit Milch und Zimt, die, wie es am Himmelfahrtstag Brauch ist, frühmorgens den Armen und nahen Verwandten serviert werden – in Befolgung dieses eindrucksvollen Brauchs hatte sie sich die Nacht um die Ohren geschlagen. In einer aufsteigenden Woge der Angst wird mir bewusst, dass ich nicht nur neben meiner Cousine geschlafen habe – und folglich gegen eines der wenigen Verbote verstoßen habe, die trotz des gegenwärtigen Wohlwollens der Großmutter für mich gelten -, sondern sogar zwischen ihren Titten. Tatsächlich haben Tea und ich uns in dieser Mutter-Kind-Position vom Schlaf übermannen lassen, und obwohl ich an Polypen leide, war ich nicht nur nicht in der Atmung behindert worden, sondern habe, im Entzücken dieser Umarmung, auch noch vergessen, mich rechtzeitig auf meinen Platz zurückzudrehen. Und Tea, die sich schlagartig aufgesetzt hat, erbringt einen weiteren Beweis unserer Schuld: Von der Taille aufwärts ist sie nackt! Heilige Muttergottes, was für Titten! Sie sind wirklich sehenswert, und auf denen bin ich eingeschlafen! Aber mir bleibt nur die Zeit, mich zu beglückwünschen, als etwas passiert, was ich nie wieder vergessen sollte.
Augenblicklich war Nonnilde bei uns, packte Tea, stieß ihren Kopf gegen das Bett und schrie zu meiner Tante hinüber: »Ineees, du schläfst, und in der Zwischenzeit … Deine Tochter, sieh sie dir an, ganz nackt mit Carlino, sieh sie dir an, diese Schlampe!« Nachdem sie ihr einen weiteren mörderischen Stoß versetzt hat, bin ich an der Reihe. Sie nimmt die Terrine Tagliolini mit Milch und Zimt vom Nachttisch und lässt mich, vom Zorn überwältigt, den ganzen Inhalt hinunterschlingen. Es ist nur natürlich, dass ich es zunächst, des unlängst errungenen Erfolges eingedenk, auch bei ihr versuche und zwischen zwei Löffeln heule: »Mam-miiina, ich will zu meiner Mam-miiina!« Aber je mehr ich plärre, desto mehr stopft sie mich voll – seither kann ich Zimt nicht einmal mehr riechen, ohne mich zu übergeben.
Nun könnte es einem Außenstehenden unverständlich erscheinen, dass selbst eine eher sexualfeindliche Großmutter es so schlimm findet, wenn sich eine ihrer Enkelinnen in einer derartigen Hitze ein wenig entblößt – einer Hitze, die so drückend ist, dass sie schon für ein böses Omen gehalten wird – und so neben ihrem kaum siebenjährigen Cousin, einem vater- und mutterlosen Cousin zudem, einschläft. Um das besser begreifen zu können, muss man sich an die Stelle der alten Dame versetzen.
Sie betritt also das Zimmer ihrer Tochter Ines mit jener Fröhlichkeit und gesunden Geistesverfassung, die ihr ein von Natur aus herber Charakter zugesteht – hatte sie nicht in Vorfreude auf diesen triumphalen Auftritt stundenlang gearbeitet? -, und erkennt in den Augen ihres einzigen männlichen Enkelkindes, des letzten Stammhalters – in meinen schlaflosen Augen also -, statt des kindlichen Staunens über die feierliche Huldigung, tiefbetrübt jene Lüsternheit wieder, die sie so viele Male in den Augen ihres Ehemannes und – schmerzlicher noch, angesichts seines tragischen Endes – in denen ihres Sohnes Enrico, meines Vaters, hatte aufscheinen sehen. Wie pervers musste meine Natur sein, dass ich mich, noch nicht einmal geschlechtsreif, zwischen die Titten ihrer Enkelin gelegt hatte, und ich bin mir sicher, dass sie in diesem Moment die lauernden Gefahren bedachte und auch die möglichen Gegenmaßnahmen, die zu ergreifen waren, um eine x-te und dieses Mal definitive Schmach für die Familie abzuwenden. Die erste dieser Maßnahmen war – wie mir während der Tagliolini-Tortur mitgeteilt wurde – meine Vertreibung aus dem weiblichen Universum, das mich bis dahin zärtlich umfangen hatte.
Und so vollzog sich mein Eintritt in die Welt der Erwachsenen.
3
Meine Haupttätigkeit zu Beginn des folgenden Sommers bestand darin, beim Melken von etwa zehn Stück Braunvieh zu helfen. Die Großmutter hatte mich nämlich zu Genuario, einem ihrer Pächter, verbannt, der in der Zeit, in der er nicht für ihre Firma, die Premiata Olii Superfini, arbeitete, also meistens, bei seinem Vieh draußen auf dem Land blieb.
Genuario – über vierzig, immer einen Hut von der Farbe ausgeblichenen Tabaks auf dem Kopf, passend zum dunklen Honigblond seiner Haare, und so hager, dass er einem groß vorkommt – hat ein kantiges Gesicht wie ein amerikanischer Schauspieler. Er ist auch schweigsam wie ein amerikanischer Schauspieler, einer von denen, die im Film immer ein schlimmes Ende nehmen. Ich vermute, dass er das nicht weiß, denn er hat keinen Fernseher und dürfte selten in seinem Leben ins Kino gegangen sein – stattdessen hört er Radio. Jetzt im Sommer hat er es draußen stehen, auf einem Fensterbrett im Hof. Abends nach dem Essen schaltet er es ein. Ich sehe die Kontrolllampe immer heller werden wie ein Asteroid, der aus der Ferne des Weltraums auftaucht, und während Genuario auf einer Stufe sitzt und sich eine Zigarette dreht, höre ich diese rätselhafte Sprache.
»Das ist Jugoslawisch«, erklärte er mir beim ersten Mal, »da bin ich im Krieg gewesen, in Jugoslawien.« Dann sagte er nichts mehr, obwohl ich ihn bat, mir etwas vom Krieg zu erzählen – wie alle Kinder war ich scharf auf blutrünstige Geschichten. Dass er meiner Bitte eigentlich nachkommen wollte, erkannte ich an der Falte, die sich auf seiner Stirn abzeichnete, aber in der Zeit, die er brauchte, um sich zu entscheiden, erklang schon wieder eines jener Musikstücke mit Violinen und Bläsern. Den Kopf gegen die Tür gelehnt und die Augen geschlossen, bedeutete er mir, den Mund zu halten.
Man merkt sofort, dass er ungern redet, dass ihm das Reden schwerfällt. Aber nicht aus diesem Grund habe ich ihn seither nichts mehr gefragt, sondern weil mir am Ende des Tages die Worte ausgegangen sind, sodass ich auf dem Liegestuhl unter der Pergola ebenfalls lieber stumm bleibe und mich von den schwermütigen Liedern einlullen lasse. Ansonsten herrscht eine große Stille: Man hört nur die Grillen und im Haus Vitina. Vitina ist die Frau des Pächters und der wahre Grund meiner Erschöpfung.
Von hier aus kann ich sie sehen, neben Fausto, ihrem zweiten Sohn, der an dem niedrigen Tisch sitzt, an dem wir gerade zu Abend gegessen haben, und wie immer auf eine bestimmte Stelle an der Wand starrt. »Er iss’n bisschen verwildert, aber ihr könnt Freunde werden«, hatte sie mir bei meiner Ankunft gesagt, obwohl ich seither aus seinem Mund kein einziges Wort vernommen habe. So ist Vitina auch jetzt die Einzige, die spricht, wie übrigens den ganzen Tag. Trotz ihres Namens, der etwas Rankes, Schlankes suggeriert, ist sie riesig und massig, viel größer als ihr Mann, und nur wenn man genau hinschaut, merkt man überhaupt, dass es sich um eine Frau handelt. Ihre Schultern, Arme und Beine sind wahre Muskelpakete, und ihre Waden scheinen zu explodieren in den schottischen Kniestrümpfen, auf die sie mächtig stolz ist: »Die sind so praktisch, die bringt mir Piètr aus Milàn mit.« Sie bindet sich ein Riesentuch um den Kopf, immer dasselbe, eines mit violetten Blumen, und es reicht ihr bis an die Augen, die kugelrund sind wie die von Fausto. Von Piètr, dem »Mailänder« Sohn, steht ein Foto auf dem Kamin, wie er in der Dorfkapelle mitspielt: Er ist eine gelungene Kopie seines Vaters. Vitinas einziges weibliches Attribut ist ihre Stimme – fein, vibrierend, hüpfend und schwebend, ganz nach Art der Nachtigall, aber man hat gerade noch Zeit, sich darüber zu wundern, wie eine solche Megäre eine derart harmonische Musik hervorbringen kann, schon hat sie einem den Verstand geraubt. An dem Tag jedoch, da die Großmutter mich aufs Land verfrachtet hatte, war es genau diese Stimme gewesen, die mich rettete.
An jenem Tag, es war der erste Tag nach Schuljahresschluss, blickten mich alle mit zärtlicheren Augen an als sonst. Tante Ines gab mir einen Kuss, schlug sich dann auf den Mund und lief davon. »Sie hat Zahnweh«, sagte Onkel Erminio und fragte mich, ob ich ihn im Lastwagen begleiten wolle. Und ich freue mich doch immer so, wenn er fragt! Irgendwann bog er in eine Straße ein, an deren Ende ein rosa Haus stand. Vor dem hielt er an, und ich stieg fröhlich aus und schlug die Tür fest zu – was zu den Dingen gehört, die einem das Gefühl vermitteln, erwachsen zu sein. Doch als ich dann die Worte hörte, die der Onkel an Genuario richtete, nahm ich den grimmigen Blick dieses Unbekannten und das in der Morgenluft bläulich schimmernde Dorf hinter ihm ins Visier, und schlagartig war mir alles klar. Natürlich habe ich versucht, wieder in den Lastwagen zu klettern, aber der Pächter hielt mich am Arm fest. Dann warf ich mich auf den Boden, weinte und brüllte: »Mammiinaa, ich will zu meiner Mammiina!«, aber schon ohne rechte Überzeugung, so genau stand mir mein Schicksal vor Augen. Und doch ist da plötzlich eine Kraft, die mich nach oben zieht, und zwar so steil nach oben und in die Schwerelosigkeit, dass ich mir einbilde, die Mamma sei höchstpersönlich aus dem Paradies herabgestiegen – wo sie sich mit Sicherheit befindet -, um mich zu retten und zu sich zu holen, ihren lieben Kleinen, heraus aus diesem Jammertal.
Die Illusion währt kaum einen Augenblick, jenen Augenblick nämlich, in dem ich mich in die Umarmung flüchte, um dann aber sofort zusammenzuzucken, als ich die ungeheuerliche Besitzerin der Arme – Vitina eben – erkenne, und beinahe wäre ich in eine noch düsterere Verzweiflung gestürzt, hätte sie nicht zu sprechen angefangen, mit dieser Stimme, die mich hypnotisiert. Wie in Trance lasse ich mich ins Haus bringen. Ich bin im dichten Netz ihrer Worte gefangen, im wirbelnden Singsang der Riesin, die inzwischen begonnen hat, mir die Geschichte von den beiden Söhnen zu erzählen, einem braven und einem Verschwender, der viele böse Sachen macht, aber am Ende bereut, worüber sein Vater sich derart freut, dass er ein Kalb schlachtet. Als ich merke, dass Onkel Erminio weg ist, ist es schon zu spät, und es tut mir auch nicht mehr leid – vielleicht weil dieser andere Sohn, dieser Verschwender, ich sein könnte und weil Nonnilde mir dann nach meiner Rückkehr ins Dorf vergeben und ein Kalb umbringen wird, wobei mir, ehrlich gesagt, nicht ganz klar ist, warum es unbedingt getötet werden muss. Vielleicht trauere ich Onkel Erminio auch deshalb nicht nach, weil es hier auf dem Land so viele vergnügliche Dinge zu tun gibt.
Zusammen mit Fausto laufe ich den ganzen Tag hinter der Riesennachtigall her, die das Wasser vom Brunnen holt (ich ziehe den Eimer hoch), den Gemüsegarten hackt (ich hacke auch), die Hühner füttert (auch ich gebe ihnen Futter), das Obst erntet, aus Mehl einen Teig knetet (ich knete mit) – und dies alles, ohne je aufzuhören, Geschichten über reuige Sünder und allerhand Wunder daherzuzwitschern. So bin ich am Abend, wenn ich in mein Bettchen gelegt werde – eine Art aus einem groben Holzblock gehauene Wiege, die eher an einen kleinen Sarg erinnert -, so müde, dass mir fürs Weinen die Kraft fehlt, obwohl ich einen Augenblick daran denke, dass ich das eigentlich tun müsste.
Am nächsten Morgen fällt es mir wieder ein, und ich treffe bereits Anstalten, als sie auch schon wieder da ist, die Nachtigall. »Aufwachen, Euer Wohlgeboren!« – so nennt sie mich. Die Sonne ist kaum aufgegangen, und schon plappert sie und plappert und plappert und zieht mich aus dem Bett, und ich brauche mich nicht einmal wie zu Hause zu waschen – ein weiterer Punkt, der für das Leben auf dem Land spricht. Draußen im Gemüsegarten pinkelt der stumme Sohn gegen einen Baum, denn hier haben sie nicht einmal ein Schilderhäuschen-Klo. Ich pinkle gegen denselben Baum, als ob es nicht genug andere gäbe, atme die frische Luft ein, die nach feuchtem Gras riecht und nach … Doch, mir scheint, dass ich mich nicht geirrt habe. Aber ich habe ihn noch nicht richtig identifiziert, diesen anderen Geruch, da trillert Vitina auch schon aus dem Stall: Euer Wohlgeboren hin, Euer Wohlgeboren her, und ich lande unter einer braunen Kuh, und mir bleibt die Spucke weg, als ich sehe, was Vitina da zwischen den Fingern hält: nicht einmal die von Tea sind so groß!
Von da an lief ich jeden Morgen pünktlich los. Natürlich war es anstrengend – warum man diese Kühe schon in der Morgendämmerung melken musste, war mir ein weiteres Rätsel -, aber die Mühe lohnte sich, davon war ich in höchstem Maße überzeugt, wenn ich mich in der Betrachtung jener zyklopischen Euter verlor, der prächtigen Runzeln, die diese kolossalen Zitzen umgaben, und der glitschigen Flüssigkeit, die aus ihnen herausspritzte und nach und nach den Eimer füllte. In denselben Eimer tauchte man dann eine Tasse, die man ausschlürfen musste: eine ganze Tasse Milch, die schaumig, aber vor allem noch warm war – und ich habe warme Milch immer schon verabscheut. Nach den ersten Tagen, an denen ich sie stets erbrochen hatte, rührte Vitina einen ordentlichen Schuss Kaffee hinein, und so erinnerte sie fast an Cappuccino – wohl weil ich selten welchen getrunken habe (die Großmutter ist zu allem Überfluss auch noch knauserig, und so gab es bestenfalls am Sonntag mal einen, wenn ich mit einem meiner zu Blödsinn aufgelegten Onkel zur Piazza hinunterging) oder weil auf Vitinas Tisch immer ein Panettone steht, der sich vom Duft her nicht so sehr vom Buondì Motta unterscheidet. Nach Buondì Motta bin ich nämlich verrückt, und man kommt sich in einem kleinen Nest im Süden dieses Landes, das noch weit von der flächendeckenden Versorgung mit Knabberzeug entfernt ist, schon privilegiert vor, wenn man sich aus dem Automaten in der Bar einen dieser Panettoni herausfischt. Und wie groß ist erst der Genuss, wenn man ihn aus dem Zellophan befreit, das man nie aufbekommt, sondern mit den Zähnen aufreißen muss, und einem dann dieses festlich duftende Aroma in die Nase steigt!
Ich fragte Vitina, warum sie im Juni immer noch Panettoni von Weihnachten übrig hatte. Sie lächelte verschmitzt und führte mich in ihr Schlafzimmer, Fausto immer im Schlepptau. Dort war alles durchdrungen vom Geruch nach kandierten Früchten und Hefeteig, und da waren sie dann, in einem polierten Holzschrank mit Spiegeln auf den mittleren Türen: eine glitzernde Masse, Dutzende und Aberdutzende von Panettoni in ihren goldenen Schachteln, übereinandergestapelt bis unter die von der Sonne bestrahlte Decke. »Die hat Piètr aus Milàn mitgebracht«, erklärte sie stolz. »Iss’n tüchtiger junger Mann. Hat sich’ne Stellung verschafft, bei der Alemagna, und da ham sie ihn gleich zur Hallenaufsicht gemacht. Ehrlich gesagt, hab ich gemeint, dass er mal was Heiligeres machen tät.«
Und sie erzählte mir, wie sie als junge Frau jeden Morgen zu Fuß ins Dorf und in die Kirche gegangen war, auch wenn es schneite und es viel Arbeit im Haus gab, und dass sie in der Nacht von einem blonden jungen Mann geträumt hatte – »Piètr, genau!« -, der die Messe las, »aber mit’nem ganz weißen Gewand, wie der Papst, umgeben von Licht und Farben und’nem Haufen Leute rundum. Ich hab ihn sogar nach San Giovann Rotonn geschickt, zum Padre Pio, und hab geglaubt, der Herr hätt ihn berufen, aber nach’nem Jahr sagt er:’S hat nicht geklappt. Jetzt hab ich Fausto, und wer weiß: Der Herr kann auch ihn berufen, und dann bin ich die Erste, die das merkt … Natürlich, Piètr hätt auch vom Typ her zum Priester gepasst, aber er hat mir gesagt, dass er sich wie’n Künstler fühlt, und ich hab mich bekreuzigt, aber dann hat der Padre ihm erst mal’ne Posaune gegeben. Dann hat er in der Blaskapelle gespielt. Dann hat er auch davon die Nase voll gehabt. Dann iss er nach Milàn gegangen, und nach nicht mal’nem Monat iss er zur Alemagna, und da haben ihn alle so gern, dass sie ihm diese vielen Panettoni schenken. Aber er iss zu weit weg, und für eine Mamma iss das’n Stachel im Herzen.«
Sie hielt einen Moment inne: Selbst sie hatte gemerkt, dass sie eine Taste angeschlagen hatte, die man bei mir, einem armen Waisenkind, besser nicht anschlagen sollte. Aber dann nahm sie den Faden gleich wieder auf. »Er iss so elegant, wenn er zurückkommt, dass man nicht glaubt, dass er der Sohn von mir und Genuario iss.
Aber ich hoff ja bloß, dass er nicht so’n leichtfertiges Weib aufgabelt, das ihn mir verdirbt, denn Euer Wohlgeboren sind noch jung und können es nicht verstehen, aber die Weiber aus der Stadt verderben die jungen Burschen … Aber wieso muss ein braver Sohn eigentlich in der Fremde arbeiten, wenn er doch im eigenen Dorf arbeiten kann? Ich bin schon zu Donnilde gegangen, ob sie mir die Gnade erweist, ihn in die Ölfabrik … Wieso fragt nicht Ihr Eure Großmutter? Wieso nicht? Wenn einer so’n braver Kerl iss, und …?« Jeden hätte man so zur Strecke bringen können! Tatsächlich merkte ich, wie mich die übliche Schläfrigkeit übermannte, und schlafen tut gut, das leugne ich nicht. Nach der ersten Zeit voller Überraschungen hielt ich die kleinen Freuden des Landlebens nicht mehr aus; erstarrt, wie ich war, ertrug ich den Rest des Tages nur noch in Erwartung der Morgendämmerung mit ihren Wundern im Viehstall. Aber auch dieser Zauber verlosch.
Es geschah an jenem Morgen, an dem die Nachtigall mich endlich selber melken ließ. Erfüllt von einer Mischung aus Erregung, Angst und Widerwille – diese tierischen Euter lösten doch ein wenig Ekel bei mir aus -, schloss ich die Finger um eine der hochempfindlichen Zitzen, und für einen Augenblick durchströmte mich dasselbe Gefühl von Glück und Befriedigung wie in der Nacht mit Tea. Ja, ich war sogar noch glücklicher – wahrscheinlich, weil ich nichts Schlimmes machte, nichts, wofür ich bestraft werden müsste, ich molk schließlich nur eine Kuh. Aber genau das ließ mich in die größte Gleichgültigkeit stürzen, weil mir plötzlich bewusst wurde, welches Ergebnis mein Hantieren zeitigte, nämlich nur die kümmerlichen paar Milliliter schaumiger Milch.
So schlief ich von jenem Tag an länger in meinem kleinen Sarg, und auch die Tatsache, dass ich mich am Morgen nicht waschen musste, war nicht mehr so etwas Tolles. Meine Haare waren verdreckt, und es juckte mich überall, mal abgesehen von dem Gestank, den ich ausströmte, und ich begann mich nach der Schrubberei in den Bottichen meiner Tanten zurückzusehnen. Und wenn ich dann unter Faustos Baum auch mein großes Geschäft erledigte, war es nicht wie zu Hause mit den geheimnisvollen Rohrleitungen. Hier sah man genau, wo es landete, und ich hatte schnell begriffen, woher der andere Gestank kam. Man musste höllisch aufpassen, dass man nicht in die Kacke trat, die Genuario, Vitina und Fausto hinterlassen hatten. Da war sie, direkt neben dem Salat, wie ekelhaft! Irgendwann wählte ich einen anderen Baum und stieg zum Brunnen hinunter, und es erschien mir selbst unglaublich, aber mit diesem frischen, wenngleich sumpfig stinkenden Wasser wusch ich mich sogar unter den Achseln. Um mich herum schlugen die Buchfinken, und die Sonne wärmte mir die Haut, während ich wieder zum Bauernhof hinaufging. Ich trank den falschen Cappuccino zum falschen Buondì, streckte mich friedlich unter dem Baum aus und beobachtete, wie Vitina die Kannen auf den grauen Lieferwagen lud, während ihr Herr Gemahl auf der Treppe zur Eingangstür saß und eine Zigarette rauchte – den ganzen Tag über machte er nichts anderes, und wenn sie fertig war, fuhr ich mit ihm die Milch ausliefern.
Wir brachten sie in das Dorf im Tal. Mitten hindurch floss ein Fluss, und an beiden Ufern standen hinter dicht belaubten Buchen so imposante, von Dachgauben gekrönte Häuser, dass es gar nicht wie ein Dorf aussah. Als wir stehen blieben, lud ein Riese mit einer gelben Plastikschürze die Kannen ab. Dann überquerten wir wieder die Allee und gingen in eine Bar. Genuario bestellte sich einen Espresso, und ich aß ein Eis und betrachtete die supermodernen Chromteile der Espressomaschine, die auf Spiegel geschriebenen Preise, die Gäste, die Zeitung lasen und mit einem Akzent diskutierten, der sich von unserem unterschied, dann den brummenden Verkehr hinter der Fensterscheibe, und es war, als wäre man in einer echten Stadt, in so einer, wie ich sie aus dem Fernsehen kannte. Jeden Tag lief das so, mit einer Ausnahme.
»Es ist Donnerstag, Markttag.« Das war einer der beiden einzigen Sätze, die der Pächter im Laufe einer ganzen Woche zu mir sagte. Zunächst machten wir ebenfalls an der Bar halt. Aber den Espresso trank er im Stehen, und ich nahm mein Eis mit ins Auto, und sobald wir am Ziel eingetroffen waren, lud er, im Gegensatz zu sonst, die vollen Kannen selbst ab und die leeren Kannen auf. Dann kam er zusammen mit einer kleinen Frau mit brünettem Krauskopf wieder heraus. Sie ging durch die Tür neben dem Milchladen, während er an den Lieferwagen herantrat, um den zweiten Satz der Woche zu sagen: »Warte, ich bin gleich wieder da.« Nach höchstens zehn Minuten kam er mit seinem phlegmatischen Gang zurück, setzte das Auto in Bewegung und drosselte genau vor dem Marktstand, hinter dem der Riese mit der gelben Schürze stand, das Tempo. Der Riese fragte: »Alles in Ordnung, Genuà?« Der nickte und beschleunigte wieder. So ging es, bis er einmal etwas länger brauchte und ich ausstieg und zum Fluss hinunterging.