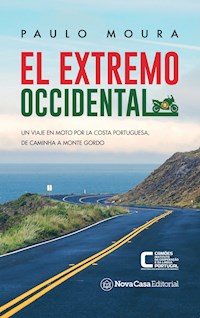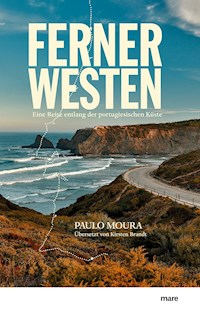
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paulo Moura, der sonst als Kriegsberichterstatter ferne Länder bereist, hat sich auf den Weg gemacht, die eigene Heimat zu erkunden: immer an der Küste entlang, von der Costa Verde bis in den Südosten der Algarve. Im kleinen Dorf Afife stößt er auf ein verlassenes Tanztheater mit einer erstaunlichen Entstehungsgeschichte, in Tamera auf eine Kolonie deutscher Aussteiger. Er begleitet die Hafenarbeiter von Lissabon und die Fischer von Sesimbra bei ihrer harten Arbeit und erzählt von den portugiesischen Literaten, die im 19. Jahrhundert den vornehmen Badeort Figueira da Foz für sich entdeckten. Indem Moura all diese Geschichten versammelt, zeichnet er ein stimmungsvolles und nuanciertes Bild der Seele Portugals, denn das Wesen der wechselnden Landschaften, durch die er reist, liegt in den Schicksalen der Menschen, die sie bewohnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paulo Moura
FERNER WESTEN
Eine Reise entlang der portugiesischen Küste
Aus dem Portugiesischen von Kirsten Brandt
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel
Extremo Ocidental: Uma Viagem de Moto pela Costa Portuguesa, de Caminha a Monte Gordo bei Elsinore, Amadora.
Copyright © Paulo Moura / Elsinore 2016
© 2022 by mareverlag, Hamburg
Lektorat Lisa Fabian, Hamburg
Karte Peter Palm, Berlin
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung Erikreis/Dreamstime.com
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-805-2
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-669-0
www.mare.de
Inhalt
1000 Kilometer entlang der Küste
Kapitel 1
Der Strand ist das Beste an uns
ÍnsuaEine Insel ruft um Hilfe
AfifeEin Casino im Dorf
Die Städte am Meer
Vila do CondeWer hat den Herrgott vom Sicheren Geleit entführt?
PortoDas Gefährt ist die Reise
São JacintoVerfallenes Gebäude am Meer mit Pförtner
Figueira da FozSeebäder und Literatur
Lesen am Strand
Estrada Atlântica
Kapitel 2
Das Meer ist eine Stadt
Vieira de LeiriaDie geheime Formel der Familie Tomé Feteira
PenicheDas Meer ist nicht wild
BerlengaDas Lachen der Möwen
Santa CruzDie letzte Nacht der Living Opera
Kapitel 3
Eine stetig zurückweichende Fata Morgana
Wer sich auf den Weg macht, fährt in Richtung Süden
LissabonDie Argonauten der Flussmündung
Eine Demonstration der Hafenarbeiter
Fonte da Telha»Hier ist alles illegal«
Costa da CaparicaDer Eindringling von Zelt 3009
Klassiker und Romantiker
Mit den Fischen leben
SesimbraDie »Schmerzen der See«
Kapitel 4
Land des Neubeginns
SinesEine Begegnung in der Burg
Ilha do PessegueiroBis jemand ihren Namen sang
Porto CovoOhne alles am Strand
TameraDas Paradies sind die Wörter
Die letzten Zelter
SagresDas Geheimnis der »Portugaises«
Kapitel 5
Zu einer verlassenen Insel aufzubrechen, ist leicht
Die Verwandlungen der Lagune
Ilha da Barreta»Jeder Tag in der Stadt ist ein Tag Leben weniger«
Ilha da Culatra»Wenn der Levante weht, gibt es keinen besseren Ort als Farol«
Ilha da Armona»Als ich zur Welt kam, war ich so tot wie dieser Aschenbecher«
Der Sturm
Ilha de TaviraDas steinerne Floß
Ilha de Cabanas»Der Sand bewegt sich«
Kapitel 6
Schiffe aus Stein
Das Erdbeben von Agadir
Monte GordoEin Schiff, gestrandet in den Dünen
MarokkoEin Mittsommernachtsball in Port-Lyautey
Nächtliche Runde
Der erste Bikini von Monte Gordo
Literatur
1000 Kilometer entlang der Küste
Ein Motorrad, ein Zelt, ein Notizblock. Das waren die Ausgangspunkte, die die Reise bestimmten. Das Motorrad, weil es mit einem Minimum an Gepäck und Hilfsmitteln ein Maximum an Mobilität und Einsatz gewährleistet. Das Zelt, weil es einen frei, leicht und unabhängig macht. Der Notizblock zum Aufschreiben und Erzählen. Alles auf das Wesentliche reduziert: eine schwarze Triumph Tiger 800, ausgestattet mit zwei Alu-Seitenkoffern für Wäsche, Bücher, Kochgeschirr zum Zubereiten kleinerer Mahlzeiten, Laptop und Adapter, um ihn an die Motorradbatterie anzuschließen, hintendrauf ein wasserdichter Sack mit Zelt, Schlafsack, Luftmatratze und einem kleinen Klappstuhl.
Das waren die Voraussetzungen. Das Ziel: die portugiesische Küste abfahren, von Caminha bis Sagres und von dort weiter bis Monte Gordo, auf der Suche nach Geschichten.
Für mich waren Reisen immer Abenteuer, aber nicht immer Freizeit. Sie interessant zu machen, ist harte Arbeit. Es genügt nicht, einfach irgendwo hinzufahren. Man muss Dinge anstoßen. Suchen, fragen, forschen, sich einmischen. Man braucht Erzählfäden, Vorwände, aus denen sich Handlungsstränge entwickeln.
In ihrem Buch Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft zitiert Swetlana Alexijewitsch, Literaturnobelpreisträgerin von 2015, einen Mann, der 1942 an der großen Schlacht um Moskau teilnahm. Seine Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sieht folgendermaßen aus: »Ich habe im Schützengraben gesessen. Habe geschossen. Dann wurde ich durch eine Explosion verschüttet, und Sanitäter holten mich halb tot raus.« Erst Jahre später, nachdem er Bücher gelesen und Filme gesehen hatte, erkannte er, dass er Teil eines der entscheidendsten historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts gewesen war. Er war dort, erlebte sein persönliches Drama, hätte beinahe sein Leben verloren, aber verstand nichts.
Ein aktiv Reisender ist das genaue Gegenteil. Natürlich ist eine sommerliche Motorradfahrt entlang der portugiesischen Küste nicht gerade eine Kriegsreportage, doch das heißt nicht, dass man sich der Kontemplation und dem Müßiggang hingeben dürfte. Es gibt unterschiedliche Formen des Reisens, und ich reise immer als Reporter.
Deshalb war dies auch keine ununterbrochene Reise. Zwar hatte sie einen Anfang und ein erklärtes Ziel: Im Juli 2015 machte ich mich von Caminha aus auf den Weg, um für die Revista 2, die (2015 eingestellte) Beilage der Tageszeitung Público, eine Reihe von Geschichten zu produzieren. Aber genau wie Swetlanas Kämpfer fahre ich an manchen Dingen vorüber, ohne sie zu sehen. Sie setzen sich in irgendeiner dunklen Ecke meiner Erinnerung fest und zeigen sich erst nach und nach, wie die allmählich hervortretenden Linien bei der Entwicklung eines Bildes.
Das bedeutet, man muss zurückgehen, Umwege machen, an manche Orte wiederkehren. Die Geschichten, die ich in diesem Buch erzähle, sind nicht alle auf dieser ersten Reise entstanden. Manche entstanden später, andere früher, und zwei kamen durch Abweichungen vom Weg – wenn auch nie vom Ziel – zustande. Etwa ein Dutzend Mal musste ich die Straße verlassen und ein Boot besteigen.
Von Caminha bis Monte Gordo kann man so gut wie immer direkt am Meer entlangfahren. Mehr als 1000 Kilometer gleitet man über kurvenreiche Strecken, einsame Landstraßen und Touristenrouten, fährt durch Dünen und Pinienhaine, erklimmt Küstengebirge, durchquert Flussmündungen, Landzungen, Flüsse, Rias, Lagunen, Strände, Schluchten und Städte am Meer.
Es ist eine wundersame, unvergessliche Reise. Geruhsam wie der Flug der Störche und nervös wie das Auf und Ab der Raubtiere entlang der Gitterstäbe. Es ist die große portugiesische Reise. Man kann sie einmal im Leben machen oder ein Leben lang; aber man muss sie gemacht haben.
Kapitel 1
Der Strand ist das Beste an uns
Ínsua
Eine Insel ruft um Hilfe
Zwei Boote fahren hinaus nach Ínsua: das Boot des Restaurants und das von Mário. Die Insel liegt etwa 200 Meter vor der Küste gegenüber dem Strand von Moledo und dem Wald von Camarido, aber wer zu ihr gelangen will, muss zum Restaurant O Forte da Ínsua in Caminha fahren. Dort befindet sich am Ufer des Grenzflusses Minho die gemeinsame Anlegestelle der drei Konzessionäre: Mário Gonçalves de Vasconselos, vierundsechzig, ein ehemaliger Fischer und Besitzer eines kleinen Holzboots, Pedro Machado, dreiunddreißig, und Sebastião Nunes, siebenundzwanzig, von denen der eine das Unternehmen Minhaventura und der andere das Restaurant betreibt und die ein modernes Motorboot besitzen.
Obwohl sie verlassen ist, darf die Insel ausschließlich von diesen beiden Booten angelaufen werden. Niemand weiß, wer Ínsua verwaltet – und das heißt, dass niemand sie verwaltet. Aber die Bootseigner haben einen allgemein anerkannten Sonderstatus. Sie haben Zugang zu der Insel, also gelten sie als ihre Besitzer. So war es schon immer.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts floh eine Gruppe von Mönchen aus Galicien und Asturien in die Region Minho, nachdem sie sich mit Kastilien überworfen hatten, weil das Land während des Großen Abendländischen Schismas den Papst in Avignon unterstützte. Unter der Leitung von Pater Diogo Arias erbauten sie das Kloster Santa Maria da Ínsua.
Im Jahr 1462 erhielten die zwei Fischer, die die Mönche regelmäßig nach Ínsua übersetzten, einen Sonderstatus. Seither ist der Zugang zur Insel mit dem Boot fast mit einem Adelstitel vergleichbar. Die Fischer wurden gewissermaßen zu den Grafen von Ínsua.
Die militärische Nutzung der Insel begann 1580, als Portugal seine Unabhängigkeit verlor. Eine galicische Armada besetzte das Kloster, um ihre Unterstützung für König Philipp II. von Spanien zu demonstrieren. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die Insel mehrfach Angriffsziel von Piraten, zumeist Engländer, deren Krone sich im Krieg mit der spanischen befand. Die Unsicherheit war so groß, dass 1623 nur noch zwei Mönche im Kloster lebten.
Nach Wiedererlangung der portugiesischen Unabhängigkeit 1640 wurde die Insel dann endgültig in ein Militärquartier verwandelt, um sicherzustellen, dass von ihr keine Gefahr mehr ausging. Dom Diogo de Lima, Militärgouverneur der Provinz Minho, beaufsichtigte den Bau der Festung.
Das darauffolgende Zusammenleben von Mönchen und Soldaten auf der Insel war nicht frei von Konflikten. Während der französischen Invasion wurde Ínsua 1807 von einer spanischen Einheit besetzt, die im darauffolgenden Jahr vor den napoleonischen Truppen kapitulierte. 1834 schafften die Liberalen die religiösen Orden ab, und seither lagen sowohl das Kloster als auch die Festung verlassen.
Mit der Zeit verfiel das architektonisch komplexe Gebäude. Die Verantwortung dafür ging vom Verteidigungsministerium auf das Finanzministerium über, von dort zum Denkmalschutz und zuletzt zum Polytechnischen Institut von Viana do Castelo. Alle diese Institutionen können stolz auf das sein, was sie erreicht haben: Heute ist die Festung eine Ruine.
*
Mário ist Fischer, seit er ein Junge war. Vierzehn Jahre lang hat er Kabeljau gefischt, hat für andere auf großen Fangschiffen gearbeitet und sich anschließend selbstständig gemacht. Auf der Senhora das Candeias spezialisierte er sich darauf, Fische auszunehmen, was ihm den Spitznamen Faca Negra, »Schwarzes Messer«, eintrug. Als die Senhora das Candeias aufgrund der EU-Richtlinien abgewrackt werden musste, fand Mário eine Anstellung im Clube da Ínsua, einem schicken Club in Moledo, zu dem eine Anlegestelle gehörte.
Später erwarben Sebastião Nunes und sein Bruder die Räumlichkeiten des Clubs und eröffneten darin das Restaurant Ínsua, dessen Spezialität Polvo a lagareiro ist, Tintenfisch mit Kartoffeln, Rübstiel und Knoblauch. Seither ist Mário wieder selbstständig. Er bietet Bootstouren zur Insel und auf dem Minho an und steht damit in Konkurrenz zu Sebastião und Minhaventura. Das Tourismusunternehmen bietet einen Fahrrad- und Bootsverleih, geführte Wanderungen zur Vogelerkundung, Überfahrten zur Insel oder Paddeltouren im Mondschein.
Rund um die Insel ist das Meer dunkelblau und wild. Ein kleines Gummiboot fischt in den Wellen, gefährlich nah an den Felsen, die die Flussmündung markieren. Die eine Seite der Insel besitzt einen Strand, die andere ist felsig. Ein paar Strandurlauber kommen mit dem Boot, um hier zu baden, und hinterlassen eine Spur aus Flaschen und Plastikverpackungen. Die Festung ist von einer Gruppe alter Amateurfunker besetzt, die hier zwei Wochen im Jahr ihre Antennen aufbauen dürfen. Sie sind empört über meine Anwesenheit. »Das hier ist militärisches Sperrgebiet«, sagen sie und rufen die Polizei.
»Sie dachten also, Sie könnten einfach so mir nichts, dir nichts die Insel besuchen?«, sagt der Polizist am Telefon eines Amateurfunkers zu mir. »Dazu braucht es eine Erlaubnis.«
Halb vergraben im Sand glitzert eine verschlossene Flasche wie eine Nachricht, die ein Schiffbrüchiger nicht abschicken konnte. Ínsua, die einzige verlassene Insel Portugals, ruft um Hilfe.
Afife
Ein Casino im Dorf
Folgt man dem Minho mit seinen Sandbänken und den spanischen Bergen am anderen Ufer bis nach Moledo, gegenüber von Ínsua, zeigt sich das Meer grün und aufgepeitscht von Strömung und starken Winden, und die Strände sind weiß und wild.
Die wichtigste Straße auf diesem Reiseabschnitt ist die Nationalstraße 13 nach Viana do Castelo. Aber kurz vor Vila Praia de Âncora zweigt eine kleine Straße ab, die direkt am Strand entlangführt. Danach folgt man dann wieder der N 13 bis Gelfa und Afife, durch bescheidene kleine Dörfer in einer fruchtbaren Ebene voller Maisfelder zwischen Bergen und Meer. Von gewaltigen Felsen durchzogen, geht die Wasserfläche so unmerklich in den Strand über, dass man meinen könnte, alles wäre ein einziger Archipel aus Nebel und leuchtenden Farben.
Afife liegt nicht direkt am Meer. Es ist so gut wie unsichtbar, und man muss die Landstraße verlassen, um es zu finden. Im Dorfzentrum steht zwischen Grundschule und Rathaus ein prächtiger zweistöckiger Palast mit gelben Wänden und weißen Fenstern: das Casino Afifense.
Es verströmt das Flair mediterraner Boheme der Zwischenkriegszeit, Monte Carlo, angehaucht von einem südamerikanischen Wunschtraum. Und man stellt sich vor, wie es wäre, wenn man einträte: wie das Orchester aufspielen und sich im Saal die Menschen drängen würden, wie die herausgeputzten Bürger von Afife junge Mädchen beim Foxtrott übers Parkett schöben und unauffällig in die Winkel lotsten, wo sie vor den Blicken der in den Logen sitzenden Eltern sicher sind. Doch die Türen sind verschlossen. Das Gebäude ist bestens erhalten und sieht einladend aus – aber man kommt nicht hinein. Eine verbotene Welt.
Schuld daran ist der Vorsitzende des Vereins, klagen einige Einwohner, der das Casino nicht öffnen will. Leute, die zu sehr an der Vergangenheit hängen, sagt der Vereinsvorsitzende.
Erstaunlich ist jedoch nicht, dass das Casino geschlossen ist; erstaunlich ist, dass hier, in diesem Ort mit kaum mehr als tausend Einwohnern, überhaupt ein Casino existiert.
Geöffnet hat nur die Bar in einem Nebentrakt des Gebäudes mit ihrer Außenterrasse auf der Dorfpromenade und ihren Stammgästen, von denen kaum einer jünger als sechzig ist. Tomás Pinto, ein gewissenhafter, rühriger Mann, der sommers wie winters kurze Hosen trägt, kommt Tag für Tag hierher, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Weißes Haar, sonnengegerbte Haut, der Blick eines unverstandenen Künstlers – Pinto ist dreiundsechzig, aber man kann ihn sich gut mit achtzehn vorstellen, wie er in Krawatte und Anzug, das Jackett laut Vereinsregeln zugeknöpft, den Veranstaltungssaal des Casinos von Afife betritt, zum Caldo-Verde-Ball, einem »legalen« Glücksspielabend, oder zu einer Aufführung der Antigone, bei der selbst die Helme der athenischen Soldaten von einheimischen Küfern fabriziert wurden.
Alles ist noch an seinem angestammten Platz. Tomás Pinto genauso wie das Casino oder das Dorf Afife hinter dem Meer, der Ebene und den Maisfeldern. Nichts hat sich verändert, und alles hat sich verändert.
Auf den Durchreisenden wirkt Afife wie der typische Ort für die Sommerfrische, ein Refugium von unverfälschter Schönheit, in dem ein paar Neureiche Ferienhäuser gebaut haben und gewisse erfolgreiche Künstler und die alteingesessenen Familien englischer Portweinhändler Ruhe und Erholung suchen.
Im Gegensatz zu Moledo und anderen Strandorten der Gegend ist man hier fernab vom Meer und von neugierigen Blicken. Der Ort ist gänzlich ungeeignet für das prahlerische Zurschaustellen der eigenen Wichtigkeit und ist es aufgrund seiner geografischen Lage schon immer gewesen.
Afife ist kein Fischerdorf wie Âncora und andere Ortschaften entlang der Küste Nordportugals. Der Ort lebt von der Landwirtschaft, und die Ernten waren schon immer so mager, dass die arbeitstauglichen Männer seit Menschengedenken emigrierten. Sie gingen nach Lissabon, Porto und Coimbra und von dort aus in alle Winkel des Landes, um auf Baustellen als Anstreicher, Lastenträger und Verputzer zu arbeiten. Einige wanderten nach Spanien, Brasilien, Uruguay, Argentinien oder in die Vereinigten Staaten aus.
Aber seit dem 18. Jahrhundert verlegten sie sich – offenbar in Porto – zunehmend auf einen ganz speziellen Beruf. In einem Rechnungsbuch der Kirche Santa Marinha in Vila Nova da Gaia sind für die 1745 begonnenen Restaurierungsarbeiten die Brüder Manuel und Mateu Alves Bezerra aus Afife, Viana do Castelo, aufgeführt, und zwar als Meisterstuckateure. Im selben Buch wird ebenfalls erwähnt – wahrscheinlich, um den großzügigen Lohn von vier Münzen zu rechtfertigen –, dass die Brüder Bezerra unter Leitung des italienischen Architekten Nicolai Nasoni bereits zuvor an der Clérigos-Kirche und dem Glockenturm, dem Wahrzeichen Portos, mitgearbeitet hatten.
Vermutlich erlernten die Männer von Afife bei diesem Architekten und seinen Leuten die Kunst der Herstellung von Stuck, die bei den Aufbauarbeiten nach dem Erdbeben von 1755 ungeheuer nützlich war. Von da aus verbreitete sie sich im ganzen Land, wurde von Generation zu Generation weitergegeben und perfektioniert. Nach dem Ersten Weltkrieg fanden viele Stuckateure aus Afife Arbeit in Frankreich, wo sie lernten, aus Kalk und Gips Ornamente im Stil Louis-quinze, Louis-seize und im Empirestil zu fertigen.
Im 19. und 20. Jahrhundert finden Stuckateure aus Afife als Baumeister oder Begründer von Schulen in ganz Portugal Erwähnung.
Die Bezerras und ihre Nachkommen zeichneten für bedeutende Bauwerke in Lissabon, Porto, Guimarães und anderen Städten verantwortlich. Legendäre Stuckateure waren auch die Brüder Ferreirinha, Meister José Moreira, genannt Der Franzose (angeblich, weil seine Mutter während der französischen Invasion 1810 von einem napoleonischen Soldaten vergewaltigt worden war), und der mit dem Komturkreuz des Christusordens ausgezeichnete Domingos Meira, der unter anderem den Großen Saal im Palácio da Pena in Sintra, die Säle im Palácio das Necessidades in Lissabon, im Palast des Duque de Loulé in Cascais und in Dutzenden anderen Palästen ausschmückte.
In diesem Goldenen Zeitalter zwischen dem 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts blieben praktisch nur die Frauen in Afife zurück, um die Felder zu bearbeiten. Die meisten Männer arbeiteten als Stuckateure oder in ähnlichen Berufen und lebten fern der Heimat. Sie waren überall geachtet und geschätzt und galten weniger als Handwerker denn als Intellektuelle. Auf der Baustelle erschienen sie – wie Avelino Meira, selbst Sohn und Enkel von Stuckateuren, in seiner Monografie berichtet – in Gehrock und Zylinder oder in Frack, weißer Weste, ausgefallenen Hosen und Melone.
Sie machten sich nicht die Hände schmutzig, sondern überwachten nur die Bauarbeiten. Ging es dann an die konkrete künstlerische Ausgestaltung, schickten sie die Arbeiter fort, schlossen sich auf der Baustelle ein und arbeiteten allein, damit die Geheimnisse ihres überragenden Kunsthandwerks gewahrt blieben.
Und es waren diese nicht durch Handel, sondern durch ihre Kunstfertigkeit reich gewordenen Männer, gewissermaßen der aus dem Volk stammende Geistesadel, die eine Leidenschaft fürs Theater entwickelten.
Natürlich hatte es in Afife, wie in allen Dörfern, zuvor schon geistliche Stücke gegeben, die auf dem Kirchhof, vor der Kapelle der Muttergottes von Lapa oder auf der Wiese vor dem Haus eines gewissen »Firrança da Pôça« aufgeführt wurden. Aber irgendwann im Laufe des 19. Jahrhunderts bekamen diese Volksstücke einen ernsthafteren Charakter. Einige Männer spezialisierten sich aufs Schauspielen, die Ansprüche stiegen.
Das gab ihnen die Möglichkeit, sich heimatverbunden und doch zugleich anders als der Rest zu fühlen, zu zeigen, dass man über gehobenen Geschmack verfügte und danach trachtete, sich über die einfache bäuerliche Existenz zu erheben.
1859 erfolgte die Gründung des ersten einer ganzen Reihe von Vereinen zur Förderung von Kultur, sozialen Projekten und Unterhaltung, die Sociedade do Teatro Afifense. Ein Dorfbewohner stellte ein Grundstück zur Verfügung, achtundzwanzig Bürger schlossen sich zu einer Gesellschaft zusammen und zahlten eine Quote von je einem Goldpfund, und so konnte ein Theater aus Stein und Kalk errichtet werden, in dem Stücke wie Die Wunder des heiligen Antonius, Die Erbin von Val-Flôr, Faust und andere aufgeführt wurden.
Fast alle Stuckateure erlernten die Schauspielkunst, einige wurden sogar sehr gut, wie es heißt, und zwar sowohl im tragischen wie im komödiantischen Fach. Manchmal holte man Regisseure von außerhalb, aber die Schauspieler stammten ausnahmslos aus Afife. Natürlich waren es alles Männer, denn für die Damen jener Zeit wäre es unschicklich gewesen, sich auf der Bühne zu zeigen. Und so wurden auch die weiblichen Rollen von Männern gespielt, und zwar, wie der Autor der bereits erwähnten Monografie berichtet, »von manchen mit großer Natürlichkeit«.
Camilo Ramos, achtundsechzig, ehemaliger Standesbeamter und Vorsitzender des Casino Afifense, erinnert sich, wie sein Vater, ein Stuckateur, von einem Schauspieler erzählte, der eine Frauenrolle spielte, aber sich weigerte, seinen Schnurrbart abzunehmen.
Wenn Camilos Vater in Lissabon arbeitete, übte er in dem Zimmer, in dem er zur Miete hauste, gemeinsam mit anderen Künstlern aus seiner Heimat das ganze Jahr über seine Rolle für das Weihnachtsstück in Afife ein.
Dass die Stücke im ganzen Land bekannt wurden, war das Verdienst des Regisseurs Lúcio Amorim, der den obszönen Spitznamen Pirilau trug. Ein großer Frauenheld und Bonvivant in jenen glanzvollen Zeiten, machte er Camilos Mutter den Hof und wurde später ein Freund seines Vaters. Jahre später, so berichtet Camilo, betrat Pirilau das Casino von Afife ganz besonders schick gekleidet, in Anzug und Krawatte, um eine Partie Solo zu spielen, ein Spiel, das zu der Zeit gerade in Mode war. »Auf in den Kampf«, witzelten seine Freunde in Anspielung auf seinen legendären Ruf als Don Juan. Doch diesmal ging es nicht darum. Was Pirilau machte, machte er richtig, und so verlebte er noch einen großartigen Abend, bevor er sich, wie in einem zuvor verfassten Abschiedsbrief angekündigt, das Leben nahm.
*
Der Erfolg des Theaterclubs führte 1885 zur Gründung der Sociedade Recreativa Afifense, des »Vereins für Freizeitgestaltung von Afife«. Mit seinen siebenundfünfzig Mitgliedern hatte er anfangs seinen Sitz am Cruzeiro-Platz und zog später in das alte Theatergebäude um. Neben den Theateraufführungen organisierte der Verein auch Bälle und unterstützte den Fortschritt im Dorf. Eine seiner Errungenschaften war, nach sieben Jahren hitziger Debatten während der Vereinssitzungen, die Errichtung einer Grundschule für Mädchen.
Ein Argument gab den Ausschlag für diese gewagte Initiative: Den jungen Frauen sollte das Schreiben beigebracht werden, sodass sie ihren Verlobten, die fern der Heimat weilten, selbst Liebesbriefe schreiben konnten, denn wären sie zum Verfassen dieser Briefe auf Dritte angewiesen, dann wären ihre zarten Backfischgeheimnisse bald in aller Munde gewesen und hätten ihre Familien für alle Zeiten in Verruf gebracht.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts führten Zwistigkeiten zwischen den Anhängern der Monarchie und den Befürwortern einer Republik zu einer Spaltung des Vereins. 1899 entstand der republikanisch geprägte Club Afifense, der seinen Mitgliedern zusätzlich zu den bereits bestehenden Aktivitäten medizinische Versorgung bot.
Jahrelang bestanden die Vereine nebeneinander, und beide verzeichneten wachsende Mitgliederzahlen, bis sie beschlossen, sich wieder zusammenzutun. So entstand 1929 die Associação do Casino Afifense mit Sitz in den Räumen der alten Sociedade Recreativa, bis 1935 das neue Gebäude errichtet wurde.
*
Niemand weiß, warum die Bezeichnung Casino gewählt wurde, aber wahrscheinlich geht sie auf galicischen oder französischen Einfluss zurück. Es ist bekannt, dass nie beabsichtigt war, ein Spielcasino zu errichten, sondern ein Zentrum für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen. Man weiß auch nicht, von wem der Originalentwurf für das Gebäude stammt, ob von einem von außerhalb kommenden berühmten Architekten oder vom Mentor des Projekts selbst: Tomás Fernandes Pinto, einem aus Afife stammenden Stuckateur, der vierzig Jahre lang in Brasilien lebte, wo er reich wurde.
Tomás Pinto engagierte sich schon früh am Theater. Zum ersten Mal findet sich sein Name in den Protokollen des Clubs aus dem Jahr 1914, als er in dem Stück Ein Stierkampf im Ribatejo auftrat. Auch als Probenleiter findet er Erwähnung.
Nachdem er lange Zeit im brasilianischen Bundesstaat Maranhão als Bauingenieur tätig war, kehrte er als reicher Mann nach Afife zurück und brachte – ein umgekehrter Fitzcarraldo – den Traum mit, in seiner Heimat ein Theater zu errichten.
Das war nicht einfach. Die Idee war größenwahnsinnig und teuer und stieß auf Widerstand. Zunächst wurde eine Baufirma gegründet, die Edificadora, Lda., dann wurden durch Sonderbeiträge der Vereinsmitglieder, Spenden, Feste und Veranstaltungen und sogar staatliche Beihilfen die nötigen Mittel aufgebracht. Aber allein der Erwerb des Grundstücks kostete 186 000 Escudos, und die ursprünglich veranschlagten Kosten von 75 000 Escudos wurden um ein Vielfaches überschritten.
Bei der Generalversammlung des Casinos verkündete der Bauunternehmer António Folha, in Anbetracht dieser Kosten werde er ein so gewaltiges Vorhaben nicht übernehmen, da er fürchte, sein Geschäft zu ruinieren. Doch da erhob sich Tomás Pinto und erklärte in einer denkwürdigen Rede, er werde den Bau höchstpersönlich übernehmen und sämtliche notwendigen Gelder aus eigener Tasche aufbringen. Schließlich war Folha bereit, als Subunternehmer zu agieren, aber alle (beträchtlichen) zusätzlichen Kosten wurden von Tomás getragen.
1935, vier Jahre nach Baubeginn, war das eindrucksvolle Casino Afifense fertiggestellt, ein Denkmal der Hartnäckigkeit, des guten Geschmacks und der Macht. In der ganzen Gegend gab es nichts Vergleichbares.
Es besteht aus einem prächtigen Veranstaltungs- und Ballsaal für fünfhundert Personen mit Rang und zwei Galerien. Die weiträumige Bühne besitzt einen Bühnenvorhang und einen gewaltigen, vor über hundert Jahren vom Künstler Ferreira Alves kunstvoll bemalten Vorhang für das Proszenium, der ursprünglich im alten Theater hing und dann für das größere Casino erweitert wurde.
Der Boden des Ballsaals ist zweistufig verstellbar: Für Bälle oder Feste kann er auf die Höhe der Bühne angehoben werden, für Theateraufführungen wird er amphitheaterförmig auf bis zu anderthalb Meter unter der Bühne abgesenkt. Die Absenkung erfolgt auf höchst raffinierte und ungewöhnliche Weise durch vier Spindeln, die zeitgleich von vier Männern im Kellerraum des Gebäudes betätigt werden müssen.
Darüber hinaus gibt es im ersten Stock noch den Prunksaal, ein Spielzimmer und die von einheimischen Künstlern im Louis-seize-Stil mit Stuck verzierte und in Elfenbeintönen mit feinen Goldstreifen gehaltene Bibliothek.
»Wer zu den Bällen und Veranstaltungen im Casino ging, galt als etwas Besonderes«, erklärt António Jardim, achtundsechzig, der derzeitige Vereinsvorsitzende. Das Casino war kein Ort für alle, sondern in dieser armen Gegend voller Fischer, Bauern und Seetangsammler ein Zeichen von Distinguiertheit und Exklusivität.
Zugang hatten nur Vereinsmitglieder, und nicht jeder konnte Mitglied werden. Man musste von einem anderen Mitglied vorgeschlagen werden, und dann bedurfte es noch der Zustimmung der Generalversammlung, die im Allgemeinen nur zögerlich erteilt wurde.
Fast fünfzig Jahre lang, in Zeiten von Monarchie und Republik, während der gesamten Militärdiktatur des Estado Novo bis hin zur Demokratie und dem Niedergang des Casinos in den Achtzigern, fanden dort Theateraufführungen, Feste und Bälle statt. Hier traf sich die Tertúlia, der literarische Zirkel des aus Afife stammenden Dichters Pedro Homem de Melo, sogar über seinen Tod hinaus. Die Gefangennahme Gungunhanas, des letzten Bantukönigs, der in Mosambik gegen die Herrschaft der Portugiesen rebelliert hatte, wurde mit einem großen Ball gefeiert. 1969 hingegen, während des Streiks der Studenten von Coimbra, trat der Liedermacher José Afonso, dessen Lied Grândola, Vila Morena fünf Jahre später zum Startsignal für die Nelkenrevolution werden sollte, im Casino auf und sang Os Vampiros, während sieben Mitglieder der Geheimpolizei PIDE die Veranstaltung bewachten. Camilo Ramos, damals Jurastudent in Coimbra und einer der Köpfe der Initiative, wurde auf die Wache bestellt, weil man ihn verdächtigte, José Afonsos Gage von achttausend Escudos heimlich an die Streikenden weitergegeben zu haben.
Später, nach der Nelkenrevolution von 1974, die das Ende der Diktatur bedeutete, gab es Veranstaltungen mit Hunderten von Künstlerinnen und Künstlern, so zum Beispiel 1984 eine Lyriklesung mit vierhundert Dichterinnen und Dichtern, darunter Natália Correia und Ary dos Santos, und der Musik von António Vitorino de Almeida, Carlos Paredes und Trovante.
Aber das war bereits der Schwanengesang in einer Zeit, in der alle möglichen Bürgerinitiativen aus dem Boden schossen und das Casino seine Daseinsberechtigung verlor. Für Tomás Pinto, den Großneffen des Brasilien-Auswanderers und Erbauers des Casinos, ist die Welt in jenen Nächten der Sechzigerjahre stehen geblieben, in denen er auf Sommerbällen oder Karnevalsfeiern hier tanzte und flirtete.
Damals dauerten die Feierlichkeiten – die sich vermutlich nicht wesentlich von denen vergangener Jahrzehnte unterschieden – bis zwei Uhr morgens und waren etwas ganz Besonderes, Momente prallen Lebens. Andere Vergnügungen gab es nicht, und die jungen Mädchen durften, abgesehen von diesen Ereignissen, praktisch nie das Haus verlassen. Wenn eine von ihnen es wagte, abends ein wenig länger draußen zu bleiben, trug ihr das sofort heftige Schelte ihrer Mutter ein: »Mit der Laterne musste ich dich auf der Straße suchen gehen!«
Tomás weiß noch, wie Conjunto Alegria, die Band des Vaters von Quim Barreiros, dem Schlagersänger, Walzer, Tango oder Foxtrott spielte. Er erinnert sich daran, wie der Twist in Mode kam, der Vorgänger des Rock ’n’ Roll, gespielt von der neuen Band Os Xornas, und wie die altmodischeren Vereinsmitglieder sich darüber aufregten. »Es war ein Kampf. Die Leute spuckten aus den Logen auf uns, wenn wir Twist tanzten.«
Im Allgemeinen waren die Regeln streng, und es wurde genauestens auf gutes Benehmen geachtet. Die Männer mussten blank gewienerte Schuhe, Krawatte und Anzug tragen, das Jackett musste zugeknöpft sein. Manchmal war es im Sommer, wenn sich im Ballsaal fünfhundert Menschen dicht an dicht drängten, so heiß, dass der Vorstand zu einer Dringlichkeitssitzung zusammentrat und den Männern erlaubte, die Knöpfe zu lösen.
Die jungen Mädchen im heiratsfähigen Alter saßen auf Stühlen an der Längsseite des Saals aufgereiht und warteten darauf, aufgefordert zu werden; sie mussten die bäuerliche Tracht der Region Minho tragen, mit Rock, Mieder, weißer Bluse und Kopftuch.
»Beim Tanzen musste man stocksteif bleiben«, erinnert sich Tomás. Zudem mussten sich alle gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sich nicht gegenseitig in die Quere zu kommen oder zusammenzustoßen. Der Saalchef achtete unerbittlich auf gebührenden Abstand zwischen den Tanzpartnern, mahnte und drohte, wenn die jungen Männer sich vergaßen. »Hier muss noch mehr Luft sein«, sagte er dann und schob seine Hand zwischen die Oberkörper der jungen Leute.
Wer wiederholt gegen die Regeln verstieß, wurde herausgeholt und zur Casinoleitung gebracht, wo man ihm den Kopf wusch oder ihn gleich nach Hause schickte. In schwerwiegenderen Fällen bekam man von den Ordnern eine kleine Abreibung verpasst und konnte nachträglich auf einer Mitgliederversammlung vom Verein ausgeschlossen werden.
Diese Maßnahmen sollten bei den Bällen, um die Afife in der ganzen Region beneidet wurde, ein stilvolles Ambiente gewährleisten. Aus diesem Grund durften Frauen auch nicht unbegleitet zu den Festen erscheinen (Vereinsmitglied konnten sowieso nur die Familienoberhäupter werden, und die durften dann ihre Frauen, Töchter und Hausangestellten mitbringen). Einmal im Casino, durften die Damen tanzen, aber sich nicht allein zum Büfett begeben. Auch den Dienstmädchen war das Tanzen erlaubt, aber erst später, wenn die Senhoras die Tanzfläche geräumt hatten.
Die jungen Männer sammelten sich an der Bühne; von dort aus gingen sie zu den Mädchen hinüber und forderten sie auf. Wurde eine Aufforderung ausgeschlagen, galt das als Schande. Dann sagten die Älteren, die in den Logen saßen und alles beobachteten: »Da hast du dir aber eine Abfuhr geholt. Geh an die Bar und trink was, um es zu vergessen.« Noch peinlicher war es, wenn der Grünschnabel dann sein Glück beim nächsten Mädchen versuchte und wieder einen Korb kassierte, was ziemlich wahrscheinlich war, weil das Mädchen nicht wollte, dass es so aussah, als gebe sie sich mit weniger zufrieden als ihre Freundin.
Tomás vermied das, indem er sich von hinten an die jungen Frauen heranschlich. Deshalb gibt es keine Zeugen der zahllosen Niederlagen, die er erlitt, bis es ihm endlich gelang, die Gunst des Mädchens zu erringen, mit dem er heute verheiratet ist.
Heutzutage ist das Casino Afifense ein leer stehender alter Kasten, aber Tomás kommt immer noch täglich her. Er setzt sich in die Bar, um zu plaudern, er nimmt an den Vereinssitzungen teil wie Camilo Ramos und viele andere und hält die alten Diskussionen und Auseinandersetzungen am Leben. »Die Metallstützen hätten nicht in die Säulen eingebaut werden dürfen. Das ist nicht harmonisch«, schimpft er, als ob das von Belang wäre.
António Jardim, der ursprünglich nicht aus Afife stammt und vor Kurzem nach einem Machtvakuum den Vereinsvorsitz übernommen hat, schmiedet Pläne für das Casino. »Es könnte nach dem Theater Sá de Miranda und dem Kulturzentrum von Viana zum dritten kulturellen Aushängeschild der Region werden«, erklärt er. Er ist schon bei der Stadtverwaltung von Viana do Castelo vorstellig geworden, um sich um kommunale Zuschüsse zu bewerben. »Es könnte ein Theater für kleinere Aufführungen werden, für ein Nischenpublikum.«
Das Casino von Afife ist ein Verein, der aus der Zeit gefallen ist. Dabei spielt es dann auch keine Rolle, dass seine Mitglieder inzwischen allesamt das Rentenalter erreicht haben und deshalb keine Beiträge mehr zahlen.
Die Städte am Meer
Viana do Castelo ist die Grenze zwischen zwei Welten. Nördlich von dort herrscht die Natur. Alle menschlichen Bauwerke sind ihren Gesetzen unterworfen, ihrer Vollkommenheit.
Instinktiv sucht der Blick nach den Unvollkommenheiten der Landschaft, geht dann von ihnen aus tief atmend in die Runde und berauscht sich an Grün, Nebel und Wasser. Ein Gefühl, vergleichbar mit der wohltuenden Wärme, die einen überkommt, wenn man gelernt hat, die am wenigsten begehrenswerte Rundung eines Körpers zu lieben.
In Richtung Süden hingegen überwiegt der Kompromiss zwischen Mensch und Natur. Das leuchtende Esposende, an der Mündung des Cávado gelegen, bildet gemeinsam mit den Stränden von Ofir und Fão einen geschlossenen Komplex, in dem viele Einwohner von Porto, Braga oder Guimarães ihre Ferienhäuser stehen haben. Die Lagune ist hübsch, aber domestiziert. Man kann an ihr immer direkt am Wasser entlangfahren. Anschließend kehrt man auf die N 13 zurück, die bis Porto parallel zur Autobahn A 28 verläuft. Ich folge ihr von Fão über Apúlia und A-Ver-o-Mar und von dort weiter nach Póvoa de Varzim und Vila do Conde.
Bei A-Ver-o-Mar übernachte ich auf einem dieser Pseudocampingplätze, die in Wirklichkeit eine Ansammlung von Wohnwagen mit Anbauten aus Segeltuch und Blech sind, in denen Fernseher und Waschmaschinen stehen. Und auf dem Weg von Póvoa nach Vila do Conde, die mit dem zwischen ihnen liegenden Fischerdorf Caxinas einen lang gestreckten Ballungsraum bilden, hat man vielleicht mehr als irgendwo sonst an der Küste das Gefühl, in einer Stadt am Meer gelandet zu sein.
Zum ersten Mal seit Beginn meiner Reise packt mich die Faszination, die von einer komplexen menschlichen Gemeinschaft ausgeht. Vila do Conde übt eine unerklärliche Anziehungskraft auf mich aus, und ich bekomme Lust, ihre Geschichten und Geheimnisse zu erkunden.
Vila do Conde
Wer hat den Herrgott vom Sicheren Geleit entführt?
Während er den Platz in Richtung des Cafés O Forninho überquert, faucht der Mann in unsere Richtung: »Pass bloß auf, man wird schon besoffen, wenn man nur mit ihr spricht.« Armandina, die neben dem scheußlichen, erst vor zwei Tagen errichteten Bildstock steht und sich mit mir unterhält, funkelt ihn wütend an. »Du bist derjenige, der hier besoffen ist!«, brüllt sie aus vollem Halse. »Deshalb hat deine Frau dich auch sitzen lassen!«
Der Mann verdrückt sich ins Café, kommt dann wieder heraus und macht sich zwischen den auf der Terrasse sitzenden Gästen davon, die ihm neugierig hinterherblicken, als Armandina ihm nachruft: »Deine Frau ist weggegangen, weil sie dich nicht mehr ertragen hat! Alter Säufer.« Der Mann weiß nicht mehr, wohin. Warum zum Teufel hat er sich auch mit Armandina angelegt?
Die hört nicht auf, peinliche Details aus seinem Leben hinauszuposaunen, was sie für einen Augenblick vom eigentlichen Ziel ihres Zorns ablenkt: dem Bildstock. So ist Armandina, siebzig, weißes Haar und Donnerstimme, nun einmal: Wenn sie aufgebracht ist, ist sie nicht zu bremsen. »Sie ist mit einem anderen durchgebrannt …«
Dann wendet sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Bildstock zu. »Dieses Scheißding! Sie glauben doch nicht im Ernst, dass irgendjemand vor diesem Unding eine Kerze entzündet? Vor dieser Witzfigur.« Tatsächlich ist keine einzige Kerze zu sehen. Und kein vernünftiger Mensch würde das hier als Kunstwerk bezeichnen. »Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen?«, fragt Armandina jeden, der auf der Terrasse sitzt. Sie spricht ein Paar mittleren Alters an, dann eine magere Frau mit einer riesigen Sonnenbrille, rotem Lippenstift und einem Buch von Ruy Belo in der Hand. »Sagen Sie schon, gefällt Ihnen etwa dieses Ungetüm, dieser Mist?«
Nein. Die solchermaßen direkt Angesprochenen trauen sich nicht, wegzusehen, und sagen Nein. Dann tun sie, als wären sie beschäftigt, nicht dass Armandinas Zorn sich als Nächstes über sie ergießt.
Das Denkmal am Ende der Promenade besteht aus einem marmornen Rahmen, der auf eine lange Sitzbank montiert ist. In der Mitte des Rahmens steht auf einem Sockel das Kruzifix oder, besser gesagt, eine in der Mitte aufgeplatzte schmiedeeiserne Stange, die an eine geschälte Banane erinnert. Ein stilisierter Christus, der niemanden überzeugt.
Armandina macht ihrem Unmut mit Geschrei und Gezeter Luft. »Sie sollten hier lieber den Schädel von dem Glatzkopf ausstellen!«, schreit sie. Damit ist Mário Almeida gemeint, der ehemalige Bürgermeister. »Er hat gelogen, und die jetzige Bürgermeisterin hat auch gelogen! Sie haben den Leuten versprochen, die Steine des alten Bildstocks aufzubewahren und ihn hinterher wieder hier aufzubauen, und jetzt sagen sie, dass die Steine verloren gegangen sind. Das weiß ich ganz genau, ich gehe nämlich immer zu den Sitzungen im Rathaus. Und ich sage es freiheraus: Die neue Bürgermeisterin hat auch gelogen.«
Früher befand sich an dieser Stelle, am Ortseingang von Vila do Conde, direkt neben dem Kreisel, in dem die Rua dos Benguiados, die Avenida Júlio Saúl Dias und die Avenida Comandante Coutinho Lanhoso aufeinandertreffen, ein Bildstock: Auf einer steinernen Plattform, zu der ein paar Stufen hinaufführten, stand unter einem von vier Steinsäulen getragenen Schutzdach eine hölzerne Tafel mit dem Bild des Senhor dos Benguiados, des Herrgotts vom Sicheren Geleit. An der vorderen Säule, in Richtung Süden, hing eine Öllampe, die immer brannte. Es war keine richtige Kapelle, aber alle Zeugen, mit denen ich gesprochen habe, sagten übereinstimmend aus, dass es für Einheimische wie Durchreisende, vor allem aber für die Fischer von Caxinas, ein wichtiger Andachtsort gewesen sei.
»Es war keine Pilgerstätte, aber die Leute kamen und zündeten eine Kerze für die armen Seelen an«, erinnert sich eine Frau, die direkt gegenüber wohnt. Sie ist sechzig und will ihren Namen nicht nennen. Ihr Mann kommt die Treppe herunter und zeigt mir ein altes Schwarz-Weiß-Foto des Bildstocks.
»Die Leute haben ihn sehr geliebt. Dieser Platz hier war der Largo dos Bem Guiados, wissen Sie«, sagt Armandina in einem Tonfall, als würde sie gleich zuschlagen wollen. »Glauben Sie etwa, vor diesem Mist hier könnte man Gelübde ablegen?«
Der Bildstock mit dem Herrgott vom Sicheren Geleit wurde im Jahr 2000 abgerissen, als zuerst der Kreisel und anschließend ein mehrstöckiges Wohnhaus errichtet wurden, in dem sich das Café O Forninho befindet. Er war nicht wirklich im Wege, aber Armandina behauptet, »die fanden, so eine Kapelle aus alten Steinen würde sich neben der Konditorei schlecht machen«.
Also wurden die Steine des alten Bildstocks beim Abriss erhalten, nummeriert und eingelagert, um irgendwann die »Kapelle« wieder aufbauen zu können.
Doch das ist nie geschehen. Auf Drängen der Opposition, vor allem der rechtskonservativen CDS, musste Elisa Ferraz, die derzeitige Bürgermeisterin, die wie ihr Vorgänger den Sozialisten angehört, letzten Monat im Stadtrat eingestehen, dass die Steine verloren gegangen seien. Ein paar Wochen später wurde dafür der Christus an der aufgeplatzten Eisenstange errichtet, »damit die Opposition Ruhe gibt«, wie Armandina sagt.
»Und O Forninho hat davon profitiert!«, schreit Armandina in Richtung Café. »Denen haben sie hier eine Bank hingestellt, auf der die Leute picknicken können.« Sie und mehrere andere Quellen erzählen mir, dass es ein Abkommen mit der Firma gegeben habe, die das Haus errichten ließ. Demzufolge habe sich der Bauherr verpflichtet, die Steine einzulagern und nach Beendigung der Arbeiten die Kapelle wieder zu errichten. Doch das hat er nicht getan.
»Hören Sie mal, sind Sie der Besitzer des Herrgotts vom Sicheren Geleit?«, hat Armandina einmal den Besitzer des Cafés gefragt. Woraufhin dieser angeblich erwiderte: »Irgendwann werden die Steine schon wiederauftauchen.«
Aber niemand scheint zu wissen, wer sie aufbewahrt und wo sie sind. Die Frau von gegenüber behauptet, sie einmal in einer Autowerkstatt in der Nähe gesehen zu haben. Andere versichern, der Polsterer vom Laden an der Ecke hätte sie an sich genommen. Im Rathaus heißt es, sie seien eingelagert.
Wie auch immer: Die Steine sind verschwunden. Und mit ihnen die jahrhundertealte Holztafel, die unter dem Schutzdach stand und Jesus zeigte, wie er inmitten der Seelen in den Himmel aufsteigt. Wer ist im Besitz dieser möglicherweise fast tausend Jahre alten Schätze? Warum wurde dieses kleine Heiligtum zerstört, warum war es wichtig und für wen? Wo ist der Herrgott vom Sicheren Geleit?
*
Artur Sousa do Bonfim übt einen fast ausgestorbenen Beruf aus: Er ist von der Stadt bestallter Eichmesser. Eigentlich, so erzählt er mir, wollte er immer Flieger werden, doch ein Motorradunfall ließ diesen Traum früh platzen. Seither widmet er sein Leben der Inspektion von Waagen, Metermaßen, Messkrügen für Milch, Öl oder Getreide. Ein Mann, der daran gewöhnt ist, dass die Dinge genau geregelt sind. »Wenn mir jemand erzählt, dass es irgendwo besonders schön ist, frage ich sofort: ›Und wie viele Sehenswürdigkeiten gibt es dort? Vila do Conde hat mehr.‹ Es ist die schönste Stadt im ganzen Land.«
Seine Liebe stützt sich auf messbare Fakten, und er lässt sich nichts vormachen. Deshalb zieht er für die Erforschung der Geschichte und Bedeutung sämtlicher Sehenswürdigkeiten von Vila do Conde zeitgenössische Quellen zurate wie alte Magazine oder die Aussagen gelehrter Männer, wie sein Vater einer war, der Leiter der Zeitung Renovação, mit dem er in den Jahren vor dessen Tod stundenlange Gespräche führte, die er aufzeichnete. Dieses kostbare Material, das er andächtig auf einem kleinen digitalen Aufnahmegerät verwahrt, nutzt er in seinen Artikeln für die Zeitung Terras do Ave. Einer der letzten Artikel handelte von der Kapelle des Herrgotts vom Sicheren Geleit.
Arturs Ansicht nach wurde sie zu Zeiten der Nonnen von Santa Clara errichtet, also im 11. oder 12. Jahrhundert. »Dieser Bildstock ist uralt. Im Gegensatz zu neueren Bildstöcken, bei denen die Heiligenbilder auf Azulejos, meist quadratischen, glasierten Keramikfliesen, gemalt sind, diente hier eine Holztafel als Untergrund.«
Der Ort war immer stark frequentiert, von Pilgern auf dem Jakobsweg ebenso wie von einheimischen Durchreisenden, da er an der einzigen Verbindungsstraße zwischen Vila do Conde und Póvoa de Varzim lag. Die Rua de Santa Luzia führte bis zur Rua dos Ferreiros in Póvoa. »Fischer, Bauern, Reisende, alle zündeten vor dem Heiligenbild eine Kerze an«, sagt Artur. Es gab eine Art Hüter, einen Angehörigen der Confraria das Almas, der »Bruderschaft der Seelen«, der dafür sorgte, dass die Öllampe nie erlosch. Sie sollte den verlorenen Seelen den Weg aus dem Fegefeuer weisen (in der modernen Version des Bildstocks werden die Seelen praktischerweise durch zwei elektrische Lampen geleitet).
Ihr, die Ihr vorübergeht, erbarmt Euch der armen Seelen, stand auf der kleinen hölzernen Tafel unter dem Bildnis Jesu, umgeben von den Köpfen der vom Flug verzerrten Seelen, um die Gläubigen zu Spenden zu bewegen. Die Früchte erntete die der Diözese unterstellte Bruderschaft der Seelen – und wurde offenbar reich dabei.
In einem Artikel der Zeitschrift Illustração Villacondense vom 26. Oktober 1911 ist die Rede von dem » … bescheidenen Bildstock, mit dem die Bruderschaft der Seelen, die im Schoße unserer erhabenen Kirche entstand, in früheren Zeiten üppige Erträge erzielte, die aber mit dem Bau der Nationalstraße einbrachen«.