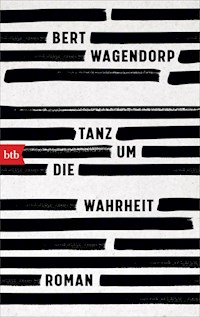17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die vier Jugendfreunde Bart, Joost, David und André treffen sich in Ferrara, Fahrradstadt im Norden Italiens und Perle der Renaissance. Vor fünf Jahren haben sie sich zuletzt gesehen, am Mont Ventoux. Inzwischen sind sie in ihren Fünfzigern, und alle suchen sie nach einer neuen Lebensperspektive: Gemeinsam wollen sie ein Designhotel aufmachen. Doch selbst in Ferrara holt die Realität des Lebens sie ein. Barts Tochter Anna trifft eine Entscheidung, die ihrem Vater gar nicht gefällt, eine alte Fischerhütte im Po-Delta birgt ein düsteres Geheimnis, und Unsterblichkeit bleibt auch hier eine Illusion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Die vier Jugendfreunde Bart, Joost, David und André treffen sich in Ferrara, Fahrradstadt im Norden Italiens und Perle der Renaissance. Vor fünf Jahren haben sie sich zuletzt gesehen, am Mont Ventoux. Inzwischen sind sie in ihren Fünfzigern, haben einen Freund begraben und ihrer großen Liebe Laura abgeschworen. Alle suchen sie nach einer neuen Lebensperspektive: Gemeinsam wollen sie ein Designhotel aufmachen.
Aber sie stellen fest, dass auch in Ferrara, im süßen Italien, das Leben nicht unbedingt einfach ist. Barts Tochter Anna, die als Auslandskorrespondentin arbeitet, trifft eine Entscheidung, die ihrem Vater gar nicht gefällt, ein »Padellone« im Po-Delta entpuppt sich als etwas ganz anderes als nur eine alte Fischerhütte auf Pfählen im Wasser, und Unsterblichkeit bleibt auch hier eine Illusion.
»Ferrara« ist der Folgeroman zu Wagendorps Bestseller »Ventoux«. Ein unterhaltsamer, packender und auch nachdenklicher Roman über Freundschaft, Loyalität, Schicksal, über Humor als Rettungsanker und das unverbrüchliche Band zwischen Vater und Tochter.
Zum Autor
BERT WAGENDORP, Jahrgang 1956, ist als Kolumnist für die niederländische Zeitung De Volkskrant und eine flämische Tageszeitung tätig. Zwischen 1989 und 1994 berichtete er unter anderem von der Tour de France. Zudem hat er das literarische Radrennmagazin De Muur mitbegründet. Sein Roman »Ventoux« war der große Überraschungsbestseller der letzten Jahre in den Niederlanden und wurde dort erfolgreich verfilmt. Die Arbeiten an der Verfilmung von »Ferrara« haben bereits begonnen.
Bert Wagendorp
FERRARA
Roman
Aus dem Niederländischenvon Andreas Ecke
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Ferrara bei Uitgeverij Pluim, Amsterdam/Antwerpen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2019 Bert Wagendorp
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Shutterstock/nikiteev_konstantin; ArtMari
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26589-2V002
www.btb-verlag.de
facebook.com/btbverlag
Für Hannah und Wilma
»Die Plinii sind am Vortag des Festes des heiligen Andreas hier eingetroffen. Es ist ein Wunder, wie sehr ihnen Ferrara gefällt. So schön, so anziehend, so anmutig, so lieblich – denn das ist das richtige Wort – ist diese Stadt, dass sie glauben, kaum je dergleichen gesehen zu haben. […] Man kann nichts Angemesseneres oder Wahreres über Ferrara sagen als das, was ich in meiner Vorrede zu den Studien behauptet habe: dass es der Wohnsitz der Musen und der Venus selbst sei.«
Rudolf Agricola in einem Brief an Johannes von Plieningen, Ferrara, 5. August 1476
»Ach, könnten wir uns doch so ergeben, ohne Hoffnung, irgendwo weiterzuleben, und ganz ohne Angst vor einem Urteilsspruch, nur mit dem Gedanken: Verdammt schön war es doch.«
Willem Wilmink, Das Ende ihres Daseins
1
Sehr lange ist der Tod für uns kein Gesprächsthema gewesen. Auch nicht, nachdem Peter gestorben war, als wir noch keine zwanzig waren. Schon die Idee des Todes an sich fanden wir verabscheuungswürdig. Peter war am Ventoux gestorben, das ließ sich nicht leugnen, vor unserer Nase war es geschehen, aber das war doch etwas anderes als Tod in der Bedeutung Ende, aus, wie bei den Wörtern The End im Kino.
Wir waren eine florierende Genossenschaft geteilter Erinnerungen, und Peter gehörte weiterhin dazu. Jeden Moment konnte er bei uns auftauchen, mit diesem ausgeprägten Dichterkopf – mehr noch: Er war regelmäßig bei uns. Wir waren jung und hatten nicht vor, jemals alt zu werden. Wer alt wird, landet in der Gefahrenzone, und das kam einfach nicht infrage.
Keith Richard und Mick Jagger waren unsere Helden, und wir ließen kein Konzert aus. Nicht wegen ihrer Musik, die kannten wir ja allmählich, sondern weil sie auf der Bühne als Apostel der Ewigkeit unser Credo verbreiteten: Tod ist Unsinn und Altwerden eine Unverschämtheit, reden wir nicht mehr davon.
Wir waren auch bei Leonard Cohen, als er im Ziggo Dome mit einem langen, unvergleichlichen Konzert seinen neunundsiebzigsten Geburtstag feierte. Als er drei Jahre später dann doch starb, war er für uns ein unzuverlässiger Buddhist.
Verleugnen der Wirklichkeit? Was spricht eigentlich gegen das Verleugnen? Verleugnen ist ganz in Ordnung und macht das Leben um einiges angenehmer. Die Wirklichkeit zu verleugnen ist nichts Jämmerliches, wie manchmal behauptet wird. Es erfordert Mut und Entschlossenheit. Die Anerkenner, die sind die Pest. Sie machen alle Hoffnung zunichte.
Wir – ich meine David, Joost, André und ich – hatten uns lange hinter Hoffnung und einem Gefühl der Unverwundbarkeit verschanzt; nicht jeder für sich, sondern gemeinsam, ein uneinnehmbares Bollwerk gegen Sterblichkeit und Verzweiflung.
Die ersten Risse in der Verteidigungsanlage bilden sich, wenn man Kinder bekommt. Der Gedanke an ihren Tod macht einen schier wahnsinnig. Es ist der Moment, in dem man zum ersten Mal denkt: Wenn schon unbedingt gestorben werden muss, dann bin ich dran. Plötzlich ist man bereit, die eigene Endlichkeit anzuerkennen, nicht von Herzen, sondern unter Protest und nur bedingt, aber man schwenkt die weiße Fahne und ergibt sich ins Unvermeidliche.
2
Der Abstand zwischen Joost, David, André und mir war variabel, aber die Bande zwischen uns waren unzerreißbar. Diese Freundschaft war uns eingeschrieben. Manchmal hatten wir monatelang keinen Kontakt, bis einer von uns die Zugkraft spürte und alle zusammenrief – wobei wir uns hüteten, viel Aufhebens davon zu machen.
Mit David sprach ich regelmäßig, telefonisch oder bei ihm zu Hause, dort immer öfter zusammen mit meiner Tochter Anna. Er wohnte in der Lange Hofstraat über De Vriendschap, seinem Caférestaurant. David war der geborene Gastgeber, der sich mit offenem Ohr und großer Geduld die Geschichten seiner Gäste anhörte. »Menschen jammern nun mal gern ein bisschen«, sagte er. »Sie ertragen das Leben, solange es jemanden gibt, bei dem sie lamentieren und klagen können und der ihnen dabei auch noch ein frisches Pils einschenkt oder ihnen eine warme Mahlzeit vorsetzt. So einfach ist das.«
Seit einem Jahr arbeitete sein Neffe George im Café, ein zwei Meter zehn großer Surinamer, der sich als sanfter Riese rührend um die Gäste kümmerte. »Vielleicht wird es Zeit, das Café an George abzugeben«, sagte David eines Mittags, als Anna, er und ich zusammen aßen. »Ich hab ein paar kleinere gesundheitliche Probleme, und dann ist es nicht so günstig, wenn man jeden Abend bis ein Uhr hinter der Theke steht.«
»Was für Probleme?«, fragte Anna.
»Nichts Besonderes. Hoher Blutdruck und so. Müdigkeit.«
»Du musst abnehmen«, meinte Anna.
Joost hatte versucht, seine wissenschaftliche Karriere wiederzubeleben, doch das Plagiatsvergehen, bei dem man ihn ertappt hatte, seiner Ansicht nach eigentlich nicht der Rede wert, verfolgte ihn. Er war zu einem Paria geworden, dem seine früheren Kollegen aus dem Weg gingen. Zunächst hatte er sich bei einer Referentenagentur angemeldet, um populärwissenschaftliche Vorträge über die neuesten Entwicklungen in der Physik zu halten, aber er bekam nur Einladungen zu Veranstaltungen, bei denen er von seinem Untergang erzählen sollte, und damit hatte er nach dem dritten Mal aufgehört. »Ich hab keine Lust, mich für fünfhundert Euro und eine Flasche billigen Fusel anderthalb Stunden lang an den Pranger zu stellen.«
Anschließend hatte er in Leiden einen kleinen Laden für italienische Spezialitäten (Salami, Wein, Olivenöl, Trüffel) aufgemacht. Am Eröffnungstag nahm er viel ein, vor allem weil David, André und ich uns eindeckten, doch danach ging es schnell bergab. »Es ist sehr schwer, seinem Leben eine neue Richtung zu geben, wenn einem die große Leidenschaft genommen wurde«, erklärte Joost, »denn im Grunde interessiert mich alles andere kein bisschen. Dieses Gelaber über Piemonteser Rotweine hing mir schon nach einer Woche zum Hals raus. Und das merken die Kunden, sie schwärmen von schwarzem Trüffel aus Umbrien, und hinter der Kasse steht einer, der viel lieber über schwarze Löcher sprechen würde. Dann wird’s Zeit für was anderes.«
André bewohnte noch dieselbe geräumige Wohnung in Rotterdam, aber seine russische Freundin war ausgezogen. Er hatte mir ein Foto seines Wohnzimmers gemailt und dazu nur den Text: »Schön viel Platz!« Es klang fröhlich, aber ich kannte ihn lange genug, um zu wissen, dass er nicht glücklich war.
»Dir denn?«, lautete seine Gegenfrage, als ich ihn anrief und fragte, ob es ihm gut ging.
»Ach ja, geht so. Aber ich weiß, was du meinst. So ein nagendes Gefühl, eine Mutlosigkeit, als ob man sehr lange an einem Bild gearbeitet hätte und plötzlich sehen würde, dass die Farbe verlaufen ist und die Farbtöne nicht stimmen. Eigentlich müsste man von vorn anfangen, aber man hat gar keine Lust mehr. Also behauptet man einfach, dass die Schlieren gewollt waren. Glaubt kein Mensch, am wenigsten man selbst. Das kann einen ganz schön deprimieren.«
»Das meine ich. Wir sind Bluesbrüder, Bart.«
Wir waren Fünfziger geworden.
3
Im Frühherbst 2016 lud uns André zu einer gemeinsamen Radtour ein, die wie immer in Zutphen beginnen sollte, der Stadt, die unsere Jugenderinnerungen bewahrte, nachdem wir – mit Ausnahme von David – in den Westen des Landes gezogen waren. »Wir entscheiden dann spontan, wohin wir fahren«, erklärte André in unserer WhatsApp-Gruppe The Four Horsemen of the Apocalypse, »es geht darum, mal wieder Neuigkeiten auszutauschen. Für abends hab ich einen Tisch im Schloss Engelenburg reserviert, bringt also halbwegs ordentliche Klamotten mit. Ich will mich nicht für euch schämen müssen.«
David sagte, er habe sein Rad schon seit Monaten nicht mehr angefasst, aber wir versicherten ihm, dass auch wir in mieser Form seien und im Seniorentempo fahren würden. Der Einzige, bei dem ich mir nicht sicher war, ob er die Wahrheit sagte, war André. Er sah toll aus und hatte immer noch den durchtrainierten Körper eines Athleten. »Laufband und Rudergerät«, sagte er.
Es war einer dieser typischen späten Septembertage voll sanfter Erinnerungen an den Sommer; die Sonne wärmte noch ein wenig, aber das Licht war schon diffuser, als würde sich Zutphen für den Herbst verschleiern, als dürfte es nach dem harten Licht des Sommers allmählich wieder für ein paar Monate in einen Dämmerzustand versinken. Die Lichtreflexe auf dem Wasser der IJssel waren wie Zuckungen, Signale, die vor der nahenden stillen Dunkelheit warnten.
In Davids Wohnung zogen wir uns um. Die alte Vertrautheit stellte sich sofort wieder ein; wer uns nicht kannte, hätte gedacht, wir würden uns täglich sehen. Updates zum Stand der Dinge in unserem Leben wurden ausgetauscht, ein Stakkato kurzer Sätze und Codewörter, Andeutungen, hinter denen sich eine nur uns bekannte Welt verbarg, kleine Sticheleien, die mit dem Hochziehen einer Augenbraue oder einem Grinsen beantwortet wurden.
Für einen Aufwärmkaffee fuhren wir zum Vaticano am Houtmarkt, setzten uns draußen an einen Tisch und beobachteten die Leute, die vorbeikamen, in der Hoffnung, jemanden von früher zu erkennen. David beteiligte sich nicht an dem Spielchen, er kannte vermutlich sowieso drei Viertel von ihnen. Joost zeigte auf einen Mann mit einer vollen Albert-Heijn-Tüte, der von einer Frau begleitet wurde.
»Kennt ihr den noch?«
»Keine Ahnung.«
»Frits Hesseling. War eine Klasse über uns.«
»Mensch, du hast recht«, sagte André. »Sieht nicht besonders glücklich aus. Und seine Frau auch nicht. Kommt mir übrigens bekannt vor.«
»Mia soundso«, sagte ich. »Ich vermute, sie hat sich in einen Kollegen verliebt und spielt nach dreißig Jahren mit dem Gedanken, Frits zu verlassen. Die Kinder sind aus dem Haus, und sie hat auf einmal keine Lust mehr.«
David lachte. »Ihr projiziert eure eigenen Probleme auf nichts ahnende andere Menschen. Frits kommt manchmal zu uns ins Café. Aber nicht mit ihr.«
»So? Mit wem denn dann?«
»Berufsgeheimnis.« Er hob die Hand, und Frits erwiderte den Gruß.
»Fritsie!«, rief Joost. Frits reagierte nicht, seine Frau musterte uns argwöhnisch.
»Jeden Sonntagvormittag bin ich hier mit meinem Vater zum De Korenbeurs gegangen«, sagte ich. »Da hat er Kaffee getrunken und die Zeitung gelesen. Und ich Donald Duck. Mit einem Kakao. Ich glaube, so hat er die Illusion aufrechterhalten, dass er noch ein eigenes Leben hätte.«
»Mit dir als Beweis des Gegenteils neben sich«, meinte Joost.
»Ich bin immer mit meiner Mutter zum Markt gefahren, hinten auf ihrem Rad«, sagte André. »Sie hat jedes Mal dieselben Marktstände abgeklappert, Käse, Kartoffeln, Obst, zuletzt ging sie zum Fischstand, wo sie zwei Heringe kaufte. Und all die Typen haben mit ihr geflirtet, und meine Mutter hat verführerisch gelächelt. Es machte mich eifersüchtig, ich hatte das Gefühl, dass sie mich vergaß.«
»Weißt du noch, wie du hier mal auf meinen Schultern gesessen hast, Dré?«, fragte Joost. »Hopp, Joossie, hopp, hast du gerufen. Es goss wie aus Eimern, aber das machte uns nichts aus.«
»Weiß ich noch!«, antwortete André. »Ich war zu stoned, um auch nur einen Schritt zu gehen. Und anschließend sind wir zu dir nach Hause, da haben wir Strammen Max gegessen.«
»Und du hast das Sofa vollgekotzt. Wovon Mutter Marjolein nicht begeistert war. Und David hat saubergemacht. Peter hat sich die ganze Zeit halb totgelacht. War Laura eigentlich auch dabei?«
»Nein«, sagte David. »Wenn ich mich recht erinnere, war das nicht lange vor unseren Abschlussprüfungen, Frühjahr 1982. Das heißt, sie hat natürlich gepaukt.« Wie immer ergänzte David die Details. »Ein halbes Jahr später war alles kaputt.«
»Aber das wussten wir damals zum Glück nicht«, erwiderte Joost. »Sonst wären wir nicht so gut gelaunt gewesen.«
»Nichts wussten wir«, ergänzte ich.
»So ist es auch heute, Bart. So ist es immer.« Während er das sagte, grüßte David mit erhobener Hand eine junge Frau. »David!«, rief sie fröhlich.
»Freundin von George. Enkelin von Giesma, Mathe.«
André schüttelte ungläubig den Kopf. »Irre, hier geht alles einfach immer weiter. Ist er noch am Baudartius-Kolleg?«
»Ja. Geht aber demnächst in Pension.«
»Die Menschen hier haben das Rätsel der Zeit geknackt«, erklärte Joost. »Das sagen sie nur niemandem, denn sonst wäre hier bald viel zu viel los. Aber in Zutphen bleibt alles für immer gleich.«
André winkte der Kellnerin. »Noch einen Kaffee, und dann sind wir weg.«
Wir fuhren die IJssel entlang nach Bronkhorst. Niemand erhob Einwände, als David vorschlug, uns dort kurz an einen der Tische vor dem Restaurant Wapen van Bronkhorst zu setzen. Joost sagte, er habe mein neuestes Buch gelesen.
»Wie hat’s dir gefallen?«, fragte David.
»Gut«, antwortete Joost, »hab mir gleich Sorgen gemacht, Bart. Wollte dich noch anrufen, bin dann aber irgendwie wieder nicht dazu gekommen. Klasse, wie du diesen Premierminister beschreibst. Saukomisch.«
»Man borgt sich hier was, klaut da was, denkt sich den Rest aus, so ungefähr macht man das als Romanautor.«
»Ihr Schriftsteller dürft das«, sagte Joost. »Ihr macht nichts anderes, als zu plagiieren. Ihr tut so, als würdet ihr euch was ausdenken, dabei stammt alles unmittelbar aus der Wirklichkeit.« Er starrte einen Moment trübsinnig vor sich hin. »Los«, sagte er dann, nachdem er einen Zwanziger auf den Tisch gelegt hatte. »Wir brechen auf. Die Fähre wartet.«
Und dann, als wir am anderen Ufer der IJssel weiterfahren wollten, verkündete Joost plötzlich, er habe vor auszuwandern, nach Ferrara, Italien. Er habe das Vorkaufsrecht auf ein Haus in der Stadt. Kein Ferienhaus, sondern ein alter Palazzo, den er in ein Designhotel verwandeln wolle. André bremste scharf ab. David lachte laut auf, ich legte Joost die Hand auf die Schulter und starrte ihn fassungslos an.
»Joost in der Sendung Ich wandere aus!«, rief André. »Hast du schon bei denen angerufen? Hast du gesehen, wie die Leute nach zwei Wochen in einem Schweinestall irgendwo in den Bergen flennend auf den Knien darum betteln, nach Heerhugowaard zurück zu dürfen? Okay, wir begeben uns zum nächstgelegenen Etablissement, und da erzählt uns Joost alles von seinen Plänen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.«
Das nächstgelegene Etablissement war das Café in Bronkhorst, weshalb wir kurz danach wieder auf der Fähre standen. »Es hat uns auf dieser Seite nicht gefallen«, sagte Joost zu dem Schiffer.
Auf der Terrasse vor dem Wapen van Bronkhorst bestellten wir Strammen Max. »Schon wieder zurück?«, fragte der Kellner. »Wir haben Heimweh gekriegt«, antwortete Joost. Der Kellner nickte verständnisvoll. »Ich fahr da auch nie hin. Am anderen Ufer fängt der Westen an.«
Wenn Joost einen Entschluss fasste, geschah das selten impulsiv. Was er tat, basierte auf Axiomen, Gleichungen, Formeln. Als wir 1982 den Ventoux hinaufgefahren waren und seine Zeit eine andere war als vorher von ihm berechnet, anders gesagt, als ich schneller gewesen war als er, lag das nicht an seinen Berechnungen, nein, seiner Ansicht nach stimmte mit der Wirklichkeit etwas nicht.
Bei der Auswahl seines neuen Wohnortes war er gründlich vorgegangen. Er hatte versucht, alles Zufällige auszuschließen, denn er wollte nicht nur einen geeigneten Ort für sein weiteres Leben finden, sondern einen Ort, an dem er endlich glücklich werden und jener ideale Joost sein konnte, der ihm seit jeher vorschwebte, aber bisher ein unerreichbares Ziel geblieben war. Er dachte in Gleichungen, deren Ergebnis, wenn man alle Unbekannten richtig errechnete, zwangsläufig der neue Joost sein musste, vollkommen glücklich in seinem selbstgeschaffenen Paradies.
Wir mussten lachen, als er uns seine Methode erklärte. Wir kannten ihn ja nicht anders, aber diesmal schien er bei seinem Versuch, jedes Risiko eines Scheiterns auszuschließen, noch einen Schritt weiter zu gehen; für Experimente blieb keine Zeit mehr.
»Erst einmal musste ich mich für ein Land entscheiden«, sagte er. »Option Nummer eins, in den Niederlanden bleiben, fiel weg, das ist wohl klar. Ich hab hier nichts mehr zu suchen, man stellt mir wegen dieser unbedeutenden Affäre hartnäckig nach, ich werde nie wieder eine Chance bekommen. Nächste Frage: Welches Land denn dann? Ich hab’s gern warm und sonnig, Punkt eins. Also in den Süden. Aber nicht zu weit nach Süden, dann wird’s zu warm, und man landet in der Sahara. Irgendwas am Mittelmeer also. Nicht zu weit entfernt von meinen Töchtern. Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Kroatien, übersichtliche Auswahl. Dann vergleicht man: Bruttonationalprodukt, Wirtschaftswachstum, Komplexität der Sprache, Einstellung gegenüber Fremden, Steuerlast, kulturelles Klima, Erreichbarkeit, Tourismus, Rolle der Religion, Frauen, kulinarisches Niveau et cetera et cetera.«
André musterte ihn neugierig.
»Joost …«
»Moment, André. Alle diese Faktoren trägt man in eine Excel-Tabelle ein, damit sie sich leicht vergleichen lassen. Bei jedem Thema versucht man, zu einem objektiven Urteil zu kommen. Nicht einfach, ganz sicher nicht, aber am Ende schafft man es. Ich habe insgesamt etwa sechzig Kriterien formuliert, von denen ich weiß, dass sie von Bedeutung für mein Wohlbefinden sind. Danach habe ich dann jedes Land bewertet, nach bestem Wissen und Gewissen, und ich darf sagen, das war eine ziemlich herausfordernde Selbstevaluierung.«
»Joost«, warf ich ein, »sag, dass das ein Scherz ist.«
Er tat, als hätte er mich nicht gehört. »Es ist im Grunde nicht anders als in der Wissenschaft. Man führt Daten zusammen, und heraus kommt eine Schlussfolgerung, ganz einfach. Und die Schlussfolgerung war glasklar: Italien. Da war ich froh, denn wenn man mich vorher gefragt hätte, welches Land ich vorziehen würde, hätte ich gesagt: Italien. Als ich meinen Laden hatte, bin ich ja regelmäßig nach Italien gefahren, einer der wenigen Vorteile. Was an Italien gut ist, ist die Moral. Nicht diese Calvinisten, die einen bis in alle Ewigkeit mit ihrem Gewissen und ihrem Sündenbewusstsein verfolgen, nein, in Italien ist man da ganz flexibel, das spricht mich an.«
»Das ist also der wichtigste Grund«, sagte David, »und den kanntest du schon.«
»Ich fange mit den gesicherten Daten an, den Fakten. Darauf lasse ich dann mein Bauchgefühl los – nicht umgekehrt! Intuition ist in der Wissenschaft von entscheidender Bedeutung, aber sie muss sich auf Forschungsergebnisse stützen, sonst gerät man auf Abwege.«
»Und wenn die Forschungsergebnisse von jemand anderem stammen und die Intuition von dir?« André grinste.
»Genau das meine ich, diese holländische Mentalität. Verdammt noch mal, Dré, du bist hier auch für immer der ehemalige Drogenkriminelle. In Italien würdest du ein respektierter Mann sein, da wäre alles längst vergeben.«
»All I want is respect.« André imitierte wieder Marlon Brando in Der Pate.
»Ach, Dré, verflixt …«
»He, ich bin nie verurteilt worden. They never got me, son.«
»Okay, Italien«, sagte ich. »Aber Italien ist groß. Was die Moral betrifft, gehst du wohl am besten nach Sizilien.«
»To my cousins in Corleone«, sagte eine heisere Stimme.
»Man geht im Grunde nach dem gleichen Prinzip vor. Ich habe sämtliche Regionen aufgelistet und analysiert. Immobilienpreise, Infrastruktur, Korruptionsanfälligkeit, Touristendichte. Irgendwann schält sich ein Führungstrio heraus, in meinem Fall Emilia-Romagna, Piemont und die Marken. Also nicht die Toskana, was mich doch ziemlich überrascht hat. Die Daten von diesen drei schlüsselt man weiter auf. Und man ergänzt sie um das, was man bei Interviews und Nachforschungen an Ort und Stelle erfährt.«
»Du fährst hin und laberst in den Kneipen rum«, so fasste André die Joost-Methode zusammen.
»Zu stark vereinfacht, aber es läuft darauf hinaus. Natürlich habe ich mit einer sorgfältig formulierten Fragenliste gearbeitet.«
»Und nie eins in die Fresse gekriegt?«
»Die Antworten der Respondenten …«
»Ich hab genug gehört, Joost«, unterbrach ihn André, der allmählich die Geduld verlor. »Ich leite hieraus zwei Dinge ab. Erstens, dass du verrückt bist, und zweitens, dass du in Ferrara einem scharfen Weib begegnet bist und gedacht hast: Okay, Ferrara also.«
»Soll ich euch noch erklären, wie mir die Idee mit dem Designhotel gekommen ist?«
»Nein, lieber nicht«, antwortete ich.
»Davon hast du sicher in irgendeinem Magazin beim Zahnarzt gelesen«, meinte André. »Ich wette, vor ein paar Wochen hast du nicht mal gewusst, was ein Designhotel ist. Ich weiß es übrigens immer noch nicht. Bart, weißt du’s?«
»Ich bin mal in Maastricht in einem Designhotel gewesen. Seltsame Farben, kahle Böden und ein Kunstwerk an der Wand.«
»De Vriendschap ist ein Designcafé«, sagte Joost. »Das bedeutet, dass man über die Einrichtung nachgedacht hat, dass man ein Thema gewählt hat, eine Idee.«
»Ich dachte, wir hätten einfach Caffè San Marco in Triest kopiert«, sagte André.
»Stimmt. Man lässt sich inspirieren. Kunst. Ein Designer ist jemand mit ästhetischem Gespür und einer Antenne für den Zeitgeist.«
»Ein Phrasendrescher mit Porsche, grüner Brille und Bärtchen, der dreihundert Euro pro Stunde nimmt.« André machte eine wegwerfende Handbewegung.
»David!«, rief Joost. »Sag du doch mal was zu diesem Kokser.«
»Hast du Fotos?«, fragte David.
Joost holte sein iPhone aus der Tasche.
»Der Kerl kann so schwätzen, dass er das Wichtigste vergisst«, sagte André fassungslos. »Uns die Villa zu zeigen, die er kaufen will. Statt uns zu erklären, aufgrund welcher wissenschaftlicher Daten du das Vorkaufsrecht erworben hast, dafür ist später noch Zeit.«
»Das ist eine lange Geschichte«, begann Joost.
»Später!«
Joost zeigte uns Fotos von einem großen Stadthaus aus rotem Backstein in einer schmalen Straße. Es hatte eine hohe Eingangstür, zwei hohe Fenster links und ein großes Fenster rechts davon. Auf der ersten Etage gab es vier etwas kleinere Fenster und auf der zweiten, gleich unterm Dach, vier quadratische. Auf den Fotos vom Inneren des Hauses konnte man erkennen, dass es schon seit längerer Zeit unbewohnt war. Die Räume waren leer, die Wände farblos und rissig. Eine breite Treppe zur ersten Etage sah so aus, als könnte sie jeden Moment einstürzen.
»Mein Gott, Joost«, sagte ich. »Das ist kein Haus, das ist eine …«
»Alt«, sagte André, plötzlich äußerst interessiert.
»Vierzehntes Jahrhundert«, sagte Joost. »Stadtpalast. Der ehemalige Palazzo von Stella de’ Tolomei, der Geliebten des Niccolò d’Este, auch Stella dell’Assassino genannt. Das heißt …«
»Da muss einiges gemacht werden«, stellte André fest, »das ist offensichtlich renovierungsbedürftig.«
»Mörder. Dieser Niccolò hatte zehn Kinder mit zehn verschiedenen Frauen. Eines Tages geht eine von ihnen fremd, mit einem seiner Söhne. Er lässt beide einen Kopf kürzer machen. So war das damals. Und er will gleich noch ein Gesetz erlassen, das die Todesstrafe für Ehebrecher vorsieht …«
»Wie …«, begann ich.
»Aber seine Ratgeber sagen, das geht nicht …«
»Was kostet so was …«
»Weil Ferrara dann bald entvölkert wäre. Haha! Tolle Geschichte, was?«
»Bart möchte wissen, wie du das finanzierst«, sagte André.
»Gute Frage. Ich hab mich von der Universität nicht zum Nulltarif in die Wüste schicken lassen, das ist das eine. Mein Haus in Leiden hab ich vor kurzem zum Höchstpreis verkauft. Und dann gibt’s da noch einen geheimen Finanzier …« Er schaute André an.
»Jetzt ist es kein Geheimnis mehr«, sagte André mit scheinbar empörtem Blick. »Okay, vor gut einem Jahr hab ich Joost gesagt, dass er von mir eine kleine Hypothek bekommen kann, wenn das mal nötig sein sollte. Zu vernünftigen Zinsen. Hatte ich fast schon vergessen.«
»Darüber müssen wir nachher mal kurz sprechen.«
»Andrés Bank Nederland«, sagte André. »Wie ist das mit dem Vorkaufsrecht?«
»Das Haus gehört der Kommune. Ich habe beim Makler mit einem Beamten gesprochen und gesagt, dass ich ernsthaft interessiert bin, dass sie aber noch ein bisschen Geduld haben müssen. Ich musste natürlich erst mit dir darüber reden.«
»Wie viel brauchst du?«
»Ferrara ist nicht so teuer.«
»Ab wann könntest du’s haben?«
»1. April.«
»Warte noch kurz, bevor du was unterschreibst.«
»Warum?«
»Ich kenne jemanden in der Gegend. Wie weit ist es von Ferrara nach Mailand?«
»Ich schätze, zweihundertfünfzig Kilometer.«
»Ich ruf sie gleich an. Adresse?« Schon waren die Rollen vertauscht, André übernahm die Initiative, Joost beantwortete kleinlaut seine Fragen.
»Via Cammello 13.«
»Der Name des Maklers? Sie braucht einen Schlüssel.«
»Sie?«
»Sie. Name des Maklers?«
»Bruno Buzzoni, Corso della Giovecca.«
»Die Böden? Hast du die mal begutachten lassen? Die Deckenbalken? Wie steht’s mit der Elektrizität? Nach den Schaltern zu urteilen noch aus der Zeit von Garibaldi. Heizung?« André wartete nicht einmal mehr Joosts Antworten ab, er hielt sich schon sein iPhone ans Ohr.
»Bianca«, sagte er herzlich. »Come stai?« Er ging zu einem ruhigen Eckchen der Caféterrasse.
»Kann er denn Italienisch?«, fragte Joost.
»Bart?« David schaute mich fragend an. »Anfang Mai nach Ferrara? Wenn Joost es am 1. April bekommt, hat er vier Wochen Zeit, um es ein bisschen herzurichten und ein paar Betten aufzustellen.«
»Anfang Mai nach Ferrara.« Ich wusste nicht auswendig, ob ich im Mai und den Monaten danach irgendwelche Verpflichtungen hatte, aber wenn ja, waren sie hiermit aus dem Terminkalender gestrichen.
André kam zurück. »Geregelt«, sagte er, während er sein Telefon auf den Tisch legte. »Morgen fährt sie hin.«
Joost starrte André verwirrt an. »Wer ist Bian…«
»Klassefrau. An ihr wirst du noch deine helle Freude haben.«
»The Italian Connection«, sagte ich.
»Ich hab gerade zu Bart gesagt, dass wir Joost nicht allein nach Ferrara gehen lassen können«, sagte David, »das wird nichts. Er kann ein paar geschickte Helfer gebrauchen.«
»Natürlich kommen wir mit«, erwiderte André, »wenn du’s nicht vorgeschlagen hättest, hätte ich es. Joost würde in so einer Stadt untergehen.« Er hatte wieder nach dem iPhone gegriffen, um seinen Terminkalender zu studieren.
Joost blickte mit offenem Mund von André zu David.
»Anfang Mai nach Ferrara«, wiederholte David.
»Ausgezeichnet. Wir machen einen Arbeitsurlaub draus. Wie mein Pegoretti sich freuen wird, endlich in die Heimat.« Das Pegoretti war seine italienische Rennmaschine, von der er immer sprach, als wäre sie sein Kind.
Es war wieder wie früher, wenn wir uns langweilten und einer von uns vorschlug, nach Amsterdam zu fahren. Dann standen wir auf, gingen zum Bahnhof und fuhren los, als hätte es schon seit Monaten auf dem Plan gestanden.
»Was ihr vielleicht nicht wisst«, sagte Joost, »Ferrara ist die Fahrradhauptstadt Italiens.«
Natürlich wussten wir das.
»SPAL«, sagte ich und sah fragende Blicke. Ich war der Einzige von uns, der jeden Montag nach den Ergebnissen im italienischen Fußball schaute.
»Der Fußballverein von Ferrara. Società Polisportiva Ars et Labor. Stehen gerade ziemlich weit oben in der Serie B. Vielleicht bekomme ich noch die letzten Spiele und das Play-off mit.«
»Dann bin ich dabei«, sagte André.
»Italien, Jungs«, sagte Joost, »da fällt alles mit der Kunst zusammen. Damit bräuchte man unserer ersten Liga gar nicht zu kommen.« Ich war mir sicher, dass er noch nie von der SPAL gehört hatte.
»Die biancazzurri«, sagte Joost mit triumphierendem Grinsen.
4
Niemanden kenne ich so lange wie André. Wir sind zusammen aufgewachsen, und bis wir achtzehn, neunzehn Jahre alt waren, gab es nur wenige Tage, an denen wir uns nicht gesehen haben. Er ist mein Bruder und dennoch immer ein Fremder geblieben. In unserer Jugend war mir das nicht bewusst; als wir siebzehn waren, dachte ich noch, man könnte einen anderen Menschen genauso gut kennen wie sich selbst, oder zumindest annähernd. So war es mit André und später auch mit Joost und David.
Ich hatte immer geglaubt, ich wäre für André, Joost und David ein offenes Buch, wie sie für mich, als gäbe es ein Gruppenbewusstsein, in dem unser individuelles Dasein aufging. So denkt man, wenn man seine Illusionen noch nicht verloren hat. Erst später geht einem auf, dass alles viel komplizierter ist, dass man von sich selbst überrascht werden kann, dass es im eigenen Geist dunkle Regionen gibt, die sich nur schwer erkunden lassen und die man lieber meidet. Und wenn man sie schon selbst nicht betreten will, wie sollen andere wissen, wer man ist? Und wie soll man dann den anderen kennen? Man stellt fest, wie herrlich naiv das eigene Selbstbild gewesen ist, und preist die Zeit, in der einem dieses Glück noch vergönnt war – die Tage, in denen alles noch so einfach und harmlos erschien. In denen man glaubte, die eine Seele könne sich mühelos der anderen öffnen.
So entdeckt man die Einsamkeit. Ich habe unsere Freundschaft nie verleugnet, auch nicht in den langen Jahren nach Peters Tod, in denen wir uns nicht gesehen haben. Aber mir wurde klar, dass ich die Bedeutung von Freundschaft überschätzt hatte, dass Offenheit zwischen Menschen Grenzen hat. In meinem Umfeld konnte ich Experimente mit vollkommener Transparenz beobachten, und ich sah, dass Menschen daran kaputtgingen; dass sie ihre Seele preisgaben und zurückblieben wie eine geplünderte Stadt.
Die eigene Innenwelt ist auch ein Unterschlupf, und wer ihn verlässt, geht große Risiken ein. Das wird uns in Zukunft noch große Probleme bereiten: dass andere durch das Anschlagen einer Taste unsere tiefsten seelischen Regungen sichtbar machen werden, wie sie in der giftigen Suppe aus Daten und Algorithmen an die Oberfläche kommen, fehlerlos, besser, als wir selbst sie jemals hätten erkunden können, so dass wir plötzlich uns selbst und andere deutlich wie nie zuvor sehen und unser Innerstes vor allen entblößt wird. Dann gibt es nur noch einen Weg, den durchbohrenden Blicken zu entkommen und Ruhe zu finden.
So wie David, André und Joost nur einen Teil von mir kannten, wie mir nun klar war, so war natürlich auch mein Wissen über sie begrenzt. Mal spürten sie genau, was ich nach fünfzig Jahren Freundschaft erwartete (ein Wort, einen Blick, einen Scherz), doch im nächsten Moment wurde ich völlig überrascht, sogar von André, der plötzlich rechts abbog, wenn ich mir ganz sicher war, dass er sich für links entscheiden würde; der über etwas lachte, was er meiner Erinnerung nach früher nie komisch gefunden hatte, oder den irgendetwas, was ich sagte, wütend machte, etwas Harmloses, das ich schon hundertmal gesagt hatte.
Es ist nicht nur so, dass wir den anderen schlecht kennen, er verändert sich außerdem ständig, er und seine Standpunkte, seine Haltung, seine Überzeugungen, seine Ziele.
André hat einmal zu mir gesagt, er habe das Gefühl, dass ich ihn beobachte, dass ich alles, was er sagt, irgendwo notiere, um es später in einem Roman verwenden zu können. Ich habe nicht widersprochen.
5
Am Tisch im Restaurant von Schloss Engelenburg sagte André, er verliere allmählich sein Talent für Monomanie. »Ich werde ruhiger, langsam verflüchtigt sich der Drang, mich zu beweisen. Mich mir selbst zu beweisen, meine ich, nicht mal anderen. Das brauchte ich, um morgens im Spiegel jemanden zu sehen, den ich respektieren konnte, einen, der Dinge tat, die andere nicht ohne Weiteres nachmachen würden.«
»Ganz schön kompliziert, Mann«, sagte Joost. »Du hast also jeden Morgen im Spiegel jemanden gesehen, der nicht der war, der er sein wollte.«
»Ja, ich hab mir selbst Aufträge erteilt. Du musst dies tun, du musst jenes tun. Sonst bleibst du für immer eine Null. So hab ich mich dann wieder aufgerafft.«
»Meine Güte.«
»Hat mir viel gebracht. Ich hab mir vor langer Zeit den Auftrag erteilt, ein vermögender Mann zu werden. Das hat geklappt. Dann wollte ich raus aus dem dreckigen Milieu. Hat auch geklappt.«
»Die Reihenfolge war gut gewählt«, meinte Joost. »Ich rasiere mich morgens vor dem Spiegel einfach nur und denke an gar nichts.«
»Nein, und deshalb bleibst du ewig dieselbe arrogante Pfeife. Ich glaube, du übst vor dem Spiegel immer noch deine Nobelpreisrede ein.«
»Wie viel hat dir der Kokshandel eigentlich insgesamt eingebracht, Dré?« Joost setzte sein falsches Lächeln auf. »Darauf war ich immer schon neugierig. Drei Millionen? Fünf?«
»Du denkst viel zu klein, Mann. Borniertes Arztsöhnchen.«
»Und wo ist dann der ganze Zaster? Natürlich alles schwarz, es wird doch immer schwieriger.«
»Liegt sicher in einem Koffer unter meinem Bett, in Zwanzigern. Und jetzt werd ich das Geld waschen, indem ich dir eine kleine Hypothek gebe.« André blickte von einem zum anderen und machte mit drei Fingern und Daumen eine Plappergeste. »Dieser Kerl hat von nichts Ahnung. Labert nur so drauflos, unglaublich.«
»Was ist das nächste Ziel?«, fragte ich.
»Das nächste Ziel ist die Ziellosigkeit.« Er schaute uns der Reihe nach triumphierend an, als hätte er uns das Geheimnis des Lebens offenbart. »Ich glaube, das Geheimnis des glücklichen Alterns liegt im Akzeptieren der Ziellosigkeit.«
»Blödsinn«, entgegnete Joost. »Picasso ist glücklich alt geworden, weil er bis weit über neunzig Ziele hatte. Meistens das Modell, das gerade nackt in seinem Atelier stand.«
»Das steckt nicht in dir, Dré«, sagte ich. »Ziellosigkeit tritt bei dir erst ein, wenn man dich begraben hat. Vielleicht.«
»Ich spüre, dass die Ruhe kommt«, sagte er. »Ich muss nicht mehr unbedingt was erreichen.«
André und ich rauchten noch, obwohl wir beide behaupteten, wir hätten eigentlich aufgehört.
»Mit David ist irgendwas«, sagte er, als wir auf der Terrasse vor dem Restaurant standen.
»Wie meinst du das?«
»Es ist sein Blick. Nicht die ganze Zeit, aber manchmal. Als ob ihm plötzlich etwas einfällt, das ihm Angst macht. Ich kenne diesen Blick. Ich kenne ihn von mir selbst und von anderen. Der kann einen verraten.«
»David handelt nicht mit Koks.«
»Es ist auch nicht die Angst vor dem Schurken, der dir gegenübersteht, nicht direkt jedenfalls. Man hat Angst, dass man zerstört wird.«
Mir war schon öfter aufgefallen, dass ihm seine Jahre als Kokaindealer zu überraschenden Einblicken in die menschliche Psyche verholfen hatten. Er kam aus einer Welt, in der jeder nur seinen eigenen Vorteil im Auge hatte. Aus einem amoralischen Universum, in dem dennoch eine Art Reinheit existierte, ohne Beiwerk und ohne alles Unechte, und mit einem einzigen Wert: Überleben. Einer Welt ohne die Heuchelei der wohlanständigen Gesellschaft, in der es genauso brutal zugeht, nur verdeckt und tief unter der Oberfläche. Das Leben in dieser Welt hatte Andrés Sinne geschärft, es hatte ihn gelehrt, auf jedes noch so unauffällige Signal zu achten, weil es Unheil ankündigen konnte.
»Er ist müde«, sagte ich. »Die Arbeit in der Gastronomie schlaucht. Hoher Blutdruck. Ein paar Wochen italienische Sonne werden ihm guttun.«
6
Bei der Tour de France fahren jedes Jahr Söhne von Radrennsportlern mit, die ein Vierteljahrhundert zuvor selbst daran teilgenommen haben. Unsere Wahlfreiheit ist begrenzt, durch Bequemlichkeit, den Widerwillen gegen neue Wege oder unseren natürlichen Hang zu dem, was wir kennen. Auf jeden Fall ist Anna auch Journalistin geworden. Sie hatte Literaturwissenschaft studiert, dieses Studium aber genau wie ich abgebrochen. Nach ihrer Entscheidung für den Journalismus war sie in kürzester Zeit aufgeblüht. Alles, was in ihr steckte, aber lange verborgen geblieben war, wurde auf einen Schlag freigesetzt: Schreibtalent, Fleiß, Idealismus; sie hatte ein Ziel und steuerte geradewegs darauf zu, mit einer Begeisterung, die ich selbst nie gekannt hatte. Sie meinte, es gebe nur ein Mittel gegen die zahlreichen Versuche, die Wahrheit zu verschleiern und zu manipulieren, nämlich die kompromisslose Suche nach den Fakten. Sie hatte ihre Rolle gefunden.
Nach nicht einmal zwei Jahren als Journalistin bekam sie für einen Bericht über einen Bauern, der Selbstmord begangen hatte, nachdem Grundstücksspekulanten ihn in die Mangel genommen hatten, einen wichtigen Preis. Plötzlich sah ich sie in Talkshows, in denen sie einleuchtend darlegte, warum sie ihre Arbeit für wichtig hielt. Die Zukunft lag ihr zu Füßen, sie musste nur noch aus all den Möglichkeiten, die sich ihr boten, die richtige Wahl treffen.
Was mich noch mehr als alles andere erstaunte, war ihr Selbstvertrauen. Sie strahlte eine Selbstsicherheit aus, die mir völlig fremd war.
Ende Oktober, ein paar Wochen nach der Fahrradtour durch den Achterhoek, lud sie mich zu einem Essen ein, »um etwas Wichtiges zu besprechen«. Wir verabredeten uns wie immer im Il Colosseo, einem kleinen italienischen Restaurant in einer schmalen Straße in Alkmaar.
Ich saß schon am Tisch, als sie hereinkam, und das Erste, was mir auffiel, war das Zögernde in ihrem Blick. Sie ist schwanger, dachte ich – der Urgedanke jedes Vaters, der in den Augen seiner Tochter eine gewisse Reserviertheit und Bedrücktheit liest, und darunter große Freude.
»Na, raus damit«, sagte ich, um es ihr einfacher zu machen, als sie auf ihrem gewohnten Platz an der Wand saß und die Frau des Kochs ein Bier und einen Weißwein auf den Tisch gestellt hatte.
Anna schaute mich fragend an. »Du denkst natürlich: Sie ist schwanger.«
»Och, nein, nicht direkt …«
»Doch, das hast du gedacht. Aber ich muss dich enttäuschen, Papa. Damit warte ich noch ein paar Jahre. Außerdem hab ich noch keinen geeigneten Vater gefunden.« Ich versuchte, meine Erleichterung zu verbergen, es war jetzt besser, den etwas Enttäuschten zu spielen. Sie blätterte in der Speisekarte, obwohl es zu unseren Ritualen gehörte, hier immer das Gleiche zu bestellen. Ich beschloss, für den Rest des Abends ihr die Regie zu überlassen.
Sie war schweigsam. Auf meine Fragen antwortete sie nur knapp. Ja, sie arbeite an ein paar interessanten Sachen (an welchen, sagte sie nicht). O ja, ihren Freundinnen gehe es auch sehr gut (außer der einen, die einen Burn-out habe). Einen Burn-out mit siebenundzwanzig? (»Es gibt ziemlich viele junge Frauen, die an Burn-out leiden.«)
Ich vermutete, dass sie nach den richtigen Formulierungen suchte. Je mehr Zeit verging, ohne dass sie geeignete Worte fand, desto besorgter wurde ich.