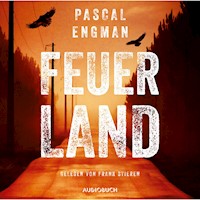
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Stockholm wird ein exklusiver Uhrenladen überfallen, kurz darauf verschwinden zwei reiche Geschäftsmänner. Vanessa Frank beginnt zu ermitteln und deckt Verbindungen zu einer Klinik in Chile auf, die illegale Organtransplantationen vornimmt. Im Auftakt der Thriller-Serie muss die Kriminalkommissarin sich der Macht des Organisierten Verbrechens stellen. Kann sie allein ein ganzes Netzwerk zu Fall bringen? Schweden: Vanessa Frank, Kriminalleiterin der Sonderkommission Nova, wurde betrunken am Steuer erwischt und vom Dienst suspendiert. Nicht das Einzige, was in ihrem Leben momentan schiefläuft. Doch anstatt einen Gang runterzuschalten, stürzt sie sich von ferne in neue Ermittlungen. Ein exklusiver Uhrenladen wurde ausgeraubt, aber keine einzige Uhr entwendet. Kurz darauf werden mehrere Geschäftsmänner entführt und nach Erpressung eines hohen Lösegeldes unversehrt wieder freigelassen. Außer ihrem dicken Bankkonto verbindet die Männer nichts miteinander. Und niemand von ihnen will auch nur ein Wort sagen. Was zunächst wie zwei seltsame Einzeltaten wirkt, entpuppt sich schon bald als brisanter Fall, der Vanessa Frank um den halben Erdball bis nach Chile jagt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Eldslandet«
bei Piratförlaget, Stockholm
© 2018 by Pascal Engman
Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden
Für die deutsche Ausgabe
© 2020, 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero-Media.net, München
Fotos: Landschaft © Jonathan Chritchley / Trevillion Images
Vögel: © FinePic®, München
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50492-7
E-Book: ISBN 978-3-608-11572-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
TEIL EINS
TEIL ZWEI
TEIL DREI
TEIL VIER
TEIL FÜNF
TEIL SECHS
TEIL SIEBEN
TEIL ACHT
TEIL NEUN
TEIL ZEHN
TEIL ELF
Autoreninfo
Zum Gedenken an die junge idealistische Generation chilenischer Männer und Frauen, denen die Folterkammern der Diktatur das Leben und ihre Träume genommen haben.
Die Colonia Dignidad war eine deutsche Kolonie im Süden von Chile, deren Fläche in etwa der Größe Liechtensteins entsprach. Seit 1961 wurden dort Kinder von Sektenmitgliedern, von denen viele frühere SS-Soldaten waren, sexuell missbraucht.
Nach dem Militärputsch im September 1973 kooperierte die Colonia Dignidad mit der DINA, der Geheimpolizei von General Augusto Pinochet. Die Deutschen nahmen Folterungen und Hinrichtungen vor und stellten Chemiewaffen her, durch Stacheldraht, elektrische Zäune und Bewegungsmelder von der Umwelt abgeschirmt.
Frauen und Männer lebten getrennt voneinander. Die Kinder wurden ihren Müttern sofort nach der Geburt weggenommen. Kalender, Zeitungen und Uhren waren verboten.
Sowohl die CIA als auch der Nazijäger Simon Wiesenthal behaupteten, dass sich Josef Mengele, der »Todesengel«, berüchtigt für seine grausamen Experimente an Juden, zeitweise in der Colonia Dignidad aufgehalten hat. Es ist dokumentiert, dass Augusto Pinochet die Sekte besucht hat.
Der Gründer der Kolonie und Anführer der Sekte, der ehemalige Nazi-Offizier Paul Schäfer, wurde 2006 zu dreiunddreißig Jahren Haft wegen sexueller Übergriffe auf fünfundzwanzig Kinder verurteilt.
Die Siedlung gibt es noch immer.
Sie heißt heute Villa Baviera.
PROLOG Nie zuvor in ihrem dreiundzwanzigjährigen Leben war Matilda Malm so unglücklich gewesen. Vor einer Woche hatte ihr Freund Peder sie gebeten, sich mit ihm aufs Sofa zu setzen, hatte ihre Hand in seine genommen und ihr tief in die Augen gesehen.
Sie hatte die Situation missverstanden. Hatte geglaubt, dass er endlich seinen Mut zusammengenommen hatte, dass es endlich so weit sein würde. Und während Peders Lippen sich zu bewegen begannen, überlegte Matilda, welcher ihrer Freundinnen sie zuerst von der Verlobung erzählen wollte.
Doch stattdessen teilte er ihr mit, er habe eine andere kennengelernt. Eine Sara. Bislang hatte Peder sie immer nur als nette Kollegin beschrieben, mit der er manchmal zu After-Work-Partys ging und mit der er während der langweiligen Arbeitsabendessen mit den Kunden der PR-Agentur witzeln konnte. Doch nun war alles anders.
Die Taschen standen gepackt im Schlafzimmer.
Nachdem er die Tür hinter sich zugeschlagen hatte, stürzte Matilda ans Fenster und ließ ihren Blick über die Brantingsgatan schweifen, wo Peder seine Habseligkeiten in einen Taxi-Stockholm-Kombi lud. Sie rief ihm nach. Doch Peder sprang auf den Beifahrersitz, und das Auto fuhr davon.
Seitdem hatte sie ihn genau fünfundsechzig Mal angerufen.
Und er war kein einziges Mal rangegangen.
Matilda hielt die Patek Philippe ins Licht. Das Armband glänzte, die Zeiger verrieten ihr, dass es Mittagszeit war. Die Faszination, die sie in den ersten Wochen empfunden hatte, wenn sie eine Uhr in den Händen hielt, die fast eine halbe Million Kronen wert war, war verschwunden. Dieses Exemplar gehörte einem Grafen, der es zur Reparatur gebracht hatte und es am Nachmittag wieder abholen wollte.
Sie legte das kostbare Stück in die Schachtel und schob sie in den Safe.
In der Biblioteksgatan hasteten gut gekleidete Passanten zu ihrem Dreihundert-Kronen-Lunch. Zwei Touristen drückten ihre Nasen am Schaufenster platt. Hinter ihnen ging mit großen Schritten ein Wachmann vorbei.
Matilda strich ihren dunklen Bleistiftrock glatt. Sie wollte gerade ins Büro hinuntergehen, um ihre Chefin Laura zu fragen, ob sie Mittagspause machen könne, als das Telefon klingelte.
»Guten Tag, Sie sprechen mit Matilda von Bågenhielms Uhren«, meldete sie sich protokollgemäß.
»Ja, hej. Mein Name ist Carl-Johan Vallman, ich habe mal eine Uhr bei Ihnen gekauft, die ich jetzt überprüfen lassen möchte.«
Matilda wusste sofort, wer der Mann war. Vergangenes Jahr hatte er gleich zwei Patek Philippe gekauft. Der Gesamtpreis lag knapp unter einer Million Kronen. Carl-Johan Vallman sah nicht direkt reich aus, eher wie ein Surfer, mit seinen schulterlangen Haaren und löchrigen, verwaschenen Jeans. Deswegen hatte sie, sobald er das Geschäft wieder verlassen hatte, seinen Namen gegoogelt. Hatte herausgefunden, dass er, als er in ihrem Alter gewesen war, einen Fonds gegründet hatte. Dieser Fonds wurde aktuell auf eineinhalb Milliarden Kronen geschätzt.
»Sehr gerne«, sagte sie. »Sollen wir die Uhr abholen?«
»Nein, ich schicke einen DHL-Boten«, erwiderte er. »Er müsste jeden Augenblick bei Ihnen eintreffen. Ich hätte früher anrufen sollen, aber es kam ein bisschen was dazwischen.«
»Kein Problem.« Matilda nahm eine Bewegung an der Tür wahr, ein Mann stand davor, bekleidet mit der gelben Jacke und Kappe des DHL-Paketdienstes. »Er ist sogar schon da. Am besten, ich lasse ihn herein und rufe Sie später zurück, dann können Sie mir in Ruhe erklären, was wir machen sollen.«
»Perfekt.«
Matilda beendete das Gespräch und drückte auf den Knopf neben dem Kartenlesegerät. Der DHL-Bote hob einen Daumen und schob mit der Schulter die Glastür auf. Ihr erster Gedanke war, dass er ungewöhnlich gut aussah. Braune Locken ragten unter der Kappe hervor. Er hatte breite Schultern, war über einen halben Kopf größer als sie, hatte blaue Augen und einen markanten Kiefer. Ihr zweiter Gedanke war, dass sie in der letzten Woche über keinen anderen Mann so gedacht hatte.
Er stellte das Päckchen vor ihr ab. Erst da kam ihr ein dritter Gedanke: Obwohl es August war, trug er sowohl eine Jacke als auch dünne weiße Handschuhe.
»Ich werde dir nichts tun, das verspreche ich. Verstehst du?«
Sie machte verwundert den Mund auf, aber er legte einen Finger an seine Lippen.
»Du brauchst nicht zu reden, tu einfach, was ich dir sage, dann bin ich gleich wieder weg.«
»Okay …«
Sein Blick verharrte auf ihrem Revers. »Matilda?«
Der Mann strahlte vollkommene Ruhe aus.
Matilda wurde klar, dass er ernst meinte, was er sagte; wenn sie sich seinen Anweisungen nicht widersetzte, würde er ihr nichts tun. Sie nickte.
»Gut.«
»Mach die Tür zum Büro auf.«
Matilda umrundete den Tresen. Ihre Hand zitterte, als sie den vierstelligen Code eingeben wollte.
Ein rotes Lämpchen leuchtete auf.
»Entschuldigung, ich …«
»Ganz ruhig«, unterbrach er sie. »Ich mach das. Wenn du mir den Code sagst.«
»Vierunddreißigzweiundfünfzig.«
Er gab die Zahlen ein. Streckte langsam den Arm aus. Matilda zuckte zusammen, als er behutsam nach ihrer Hand griff.
»Den Daumen, Matilda«, sagte er. Er schien fast belustigt.
»Ent… Entschuldigung.«
Er drückte ihren Daumen vorsichtig auf den Fingerabdruckscanner. Die kleine Lampe leuchtete nun grün. Das Schloss klickte.
»Ich muss dich bitten mitzukommen«, sagte er gedämpft und machte die Tür auf.
»Meine Chefin ist da unten«, flüsterte sie.
»Ich weiß.«
Sie gingen die Treppe hinunter. Sie voran, er dicht hinter ihr.
»Matilda?«
Lauras Stimme. Die Tür zum Büro stand offen. Ihr Herz klopfte wie wild. Matilda überlegte, was der Mann von Laura wollte. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter, ging an ihr vorbei und bedeutete ihr mit einer Geste stehen zu bleiben.
Er verschwand in Lauras Arbeitszimmer. Matilda schwankte, sie musste sich an der Wand abstützen. Dann hörte sie Lauras Rufe. Gleich darauf seine Stimme, ruhig, aber bestimmt. Sollte sie nach oben laufen, um den Alarmknopf zu drücken?
Aber dann wäre Laura allein mit ihm hier unten. Und sie war sich nicht sicher, ob ihre Beine sie tragen würden. Es klang, als gäbe er Laura Anweisungen. Sein Ton war nicht aggressiv, eher sachlich.
Kurz darauf stand er wieder im Türrahmen. Matilda drückte sich an die Wand, um ihn vorbeizulassen.
»In drei Minuten könnt ihr raufkommen, aber solange müsst ihr hier warten«, sagte er im Vorbeigehen.
Vor der Tür hielt er noch einmal inne, rückte seine Kappe zurecht und drückte auf den Türöffner. Dann war er verschwunden.
TEIL EINS
Eins Mit ihren zweiundvierzig Jahren würde Kriminalkommissarin Vanessa Frank heute zum ersten Mal auf eine Psychotherapeutin treffen. Sie war die einzige Patientin im Wartezimmer. Rechts neben ihr lag ein Stapel Zeitschriften. Sie nahm sich eine und blätterte nachlässig darin herum, während sie den Snus-Portionsbeutel wechselte. Wenn sie nicht aß, schlief oder trainierte, hatte sie immer einen Göteborgs Rapé unter der Lippe. Seit fünfzehn Jahren war das nun schon so. Denn nach ihrer Rückkehr aus Kuba hatte sie die Zigaretten gegen Snus getauscht.
»Vanessa? Vanessa Frank?«
Vanessas Blick fiel auf eine kleine Frau mit Kurzhaarfrisur, die eine senfgelbe Tunika trug. Dazu kam noch eine Hornbrille, wodurch sie alle Vorurteile bestätigte, die Vanessa gegenüber der äußeren Erscheinung von Therapeuten hegte.
»Ich bin Ingrid Rabeus«, sagte die Therapeutin mit einem freundlichen Lächeln.
Vanessa stand auf und streckte Ingrid Rabeus die Hand entgegen, doch diese wandte sich ab und ging einen schmalen Flur entlang.
Sie führte Vanessa in einen Raum mit Schreibtisch und zwei Polstersesseln – einem grünen und einem blauen. Ingrid Rabeus deutete auf den blauen, der mit der Lehne zum Fenster stand, und bat Vanessa, Platz zu nehmen.
Auf einem runden Couchtisch stand eine Vase mit einer einzelnen weißen Blume, daneben lag ein Päckchen Taschentücher. Sie beugte sich vor, um an der Blüte zu riechen. Sie war aus Plastik.
Die Psychotherapeutin setzte sich Vanessa gegenüber und schlug die Beine übereinander.
»Ich möchte mit der Frage beginnen, warum Sie hergekommen sind.«
»Ich lasse mich gerade scheiden und saß mit Alkohol am Steuer«, gab Vanessa zurück.
»Scheidungen sind schwierig«, sagte Ingrid Rabeus neutral.
»Nicht besonders. Die Scheidung ist nicht das Problem.«
Die Therapeutin wirkte verwundert, sammelte sich aber rasch.
»Nein?«
»Überhaupt nicht. Das Problem ist, dass ich angetrunken Auto gefahren und von Kollegen angehalten worden bin. Jetzt muss ich unfreiwillig eine Auszeit nehmen, während meine Vorgesetzten überlegen, ob ich meinen Job behalten darf oder nicht. Als Zeichen meines guten Willens habe ich meinen Chefs versprochen, zu Ihnen zu kommen.«
»Am liebsten würden Sie also gar nicht hier sein?«
Der Mund der Therapeutin kräuselte sich zu einem wissenden Lächeln.
»Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte Alkohol im Blut und bin Auto gefahren, das war blöd. Vor allem wegen meines Jobs. Mir ist schon klar, dass ich nicht einfach weiterarbeiten kann, als wäre nichts gewesen, denn dann würde mit unserem Rechtssystem irgendwas nicht stimmen.«
»Sie sind Polizistin?«
»Kriminalkommissarin. Gruppenführerin bei der Nova.«
»Verstehe. Wie lange waren Sie mit Ihrem Ex-Mann verheiratet … Wie heißt er eigentlich?«
»Svante. Zwölf Jahre.«
»Das ist eine lange Zeit. Haben Sie …«
»Kinder? Nein. Wir haben keine Kinder.«
Es entstand eine Pause. Vanessa konnte den Verkehr auf der Hornsgatan hören. Sie wollte nach draußen, in die Sonne. Weg von Ingrid Rabeus und ihrer Plastikblume.
»Wissen Sie, was mich stört?«, fragte Vanessa nach einer Weile.
»An der Scheidung?«
»Nein, an Therapien.«
Ingrid Rabeus setzte sich anders hin.
»Erzählen Sie.«
»Jeder sagt, psychische Erkrankungen seien ein Riesentabu. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Promis und Semipromis machen doch nichts anderes, als im Frühstücksfernsehen auf dem Sofa zu hocken und damit zu kokettieren, wie schlecht sie sich fühlen. Die reden dann davon, dass sie eine halbe Arbeitswoche im Monat vor jemandem wie Ihnen sitzen. Das können die ja auch locker machen, weil sie keinen richtigen Job haben. Es ist ja nicht so, dass Bindefeld oder wer auch immer die Kinopremieren organisiert, bei ihnen anruft und sie anschreit, weil sie nicht auftauchen. Aber ich habe einen richtigen Job. Im besten Fall hindere ich andere Menschen daran, Straftaten zu begehen. Im schlimmsten Fall sorge ich dafür, dass sie in den Knast wandern, wenn sie es doch tun. Und jede Sekunde, die ich hier sitze, werde ich davon abgehalten.«
Ingrid Rabeus machte den Mund auf, um etwas zu erwidern, schwieg dann aber doch.
»Sie sehen übrigens wie der Prototyp einer Therapeutin aus«, bemerkte Vanessa.
»Tue ich das?«
»Ja.«
»Inwiefern?«
»Nehmen Sie’s mir nicht übel. Aber ich glaube, es ist die Brille … und diese Tunika.«
»Okay.«
Ingrid Rabeus schürzte die Lippen, wodurch die Haut zwischen Nase und Oberlippe ihre Raucherfältchen offenbarte.
»Ich bin eine ziemlich gute Menschenkennerin«, sagte Vanessa.
»Wirklich?«
»Lassen Sie mich raten. Sie sind in einer afrikanischen Tanzgruppe?«
»Das ist richtig«, sagte sie. »Aber lassen Sie uns weiter über Sie sprechen.«
Vanessa schielte auf die Uhr. Gerade mal zehn Minuten. Sie konnte nicht fassen, dass sie noch ganze fünfunddreißig Minuten hier sitzen musste.
»Sie sind also angetrunken Auto gefahren?«
»Ja, aber ich habe kein Alkoholproblem, auch wenn ich weiß, dass alle Alkoholiker das von sich behaupten.«
Ingrid Rabeus’ verständnisvolles Lächeln wurde etwas angespannter.
»Haben Sie im Zusammenhang mit der Scheidung angefangen, mehr zu trinken? Oder davor?«
»Nein, wegen Svante habe ich nicht angefangen zu trinken. Aber ich habe mehr getrunken, nachdem ich mit Alkohol am Steuer erwischt worden bin. Mir ist schon klar, dass die meisten normalen Menschen nach einem solchen Vorfall ihren Alkoholkonsum zurückschrauben würden, aber ich nicht. Ich habe noch zugelegt.«
»Sie haben zugelegt?«
»Ja. Ich sitze tagsüber zu Hause rum, anstatt zu arbeiten. Und weil ich nicht einsam sterben will, habe ich mir Tinder besorgt, diese Dating-App, falls die Ihnen was sagt?«
»Ich habe davon gelesen.«
»Zwei, manchmal drei Abende die Woche sitze ich glatzköpfigen Männern zwischen vierzig und fünfzig gegenüber und höre mir an, was sie über ihr ödes Leben erzählen, während sie darauf hoffen, dass ich sie für einen Mitleidsfick mit zu mir nach Hause nehme. Und das langweilt mich dermaßen, dass ich ein Glas nach dem anderen runterkippe, nur um mich zu betäuben.«
Die Therapeutin beugte sich vor, rückte ihre Brille zurecht und blinzelte ein paar Mal.
»Warum haben Sie und Svante sich getrennt?«
»Unsere Beziehung hat sich leer angefühlt.«
»Hat er jemanden kennengelernt?«
»Got me, doctor. Eine junge Schauspielerin, Johanna heißt sie. Sie bekommen ein Kind. Svante ist Regisseur. Oder Dramatiker, wie er sagen würde. Ich freue mich für ihn, auch wenn ich weiß, dass sie schon ein Jahr miteinander geschlafen haben, bevor ich ihn rausgeworfen habe.«
»Also hat er Sie betrogen?«
»Ja, er hat fremdgevögelt, wie man so sagt. In solchen Momenten greifen die Leute normalerweise danach, oder?« Vanessa zeigte auf die Taschentücher. Sie nahm eins, entfernte den Snus-Portionsbeutel aus ihrem Mund, wickelte ihn in das Papier und legte es auf den Tisch. »Sie wollen, dass hier geweint wird, oder? Aber ich sage Ihnen was. Seit ich erwachsen bin, habe ich genau einmal geweint. Wollen Sie wissen, wann?«
»Ja.«
Vanessa beugte sich vor und senkte die Stimme.
»Sage ich Ihnen aber nicht«, flüsterte sie.
»Nein?«, entgegnete Ingrid Rabeus und runzelte die Stirn.
»Nein. Es ist bestimmt erleichternd und hat was Reinigendes. Die Leute sitzen hier vor Ihnen und weinen Krokodilstränen, und das tut ihnen vermutlich gut. Und wenn Sie dann abends nach Hause gehen, bilden Sie sich ein, dass Sie bis in ihre Psychen vorgedrungen sind. Dass Sie einen guten Job gemacht haben. Noch eine Seele gerettet haben. Und das haben Sie wahrscheinlich sogar, Sie sind sicher nett und klug und haben irgendeine tolle Uni besucht. Aber eins verspreche ich Ihnen, Sie werden mich niemals weinen sehen. Ich weine nicht.«
Eineinhalb Stunden nach dem Termin bei Ingrid Rabeus saß Vanessa auf einem Barhocker in Luigis Espressobar in der Roslagsgatan und blätterte in der Dagens Nyheter. Alle zwanzig Sekunden richtete sie ihren Blick auf den Eingang des Solariums Solkungen. Ihr Informant Reza Jalfradi musste jeden Moment auftauchen.
Sie war der einzige Gast in dem kleinen Café.
Der Barista, den Schlips in das weiße Hemd gesteckt, räusperte sich.
»Mehr Kaffee, signora?«, fragte er mit schonischem Einschlag.
Sie drehte den Hocker herum und hielt ihm das leere Glas hin. Er schenkte nach, während sie überlegte, was sie am meisten störte: Der eingesteckte Schlips oder dass er sie signora genannt hatte. Der Kerl war blond. Mit derart blasser Haut, dass sie vermutlich rote Flecken bekam, wenn man sie nur mit der Taschenlampe anleuchtete.
»Danke.«
Vanessa schlug das Feuilleton auf und starrte ihrem Ex-Mann ins Gesicht. In dem Artikel ging es um Svantes neues Stück Der Fluch der Liebe, das am Dramaten uraufgeführt werden würde.
Ein Interview mit Svante und der weiblichen Hauptrolle, sprich seiner neuen Freundin Johanna Ek. Auf dem Foto saßen sie nebeneinander auf einem braunen Ledersofa. Hinter ihnen hing ein Bild von einem Segelboot.
Svante sagte dem Journalisten, er sei davon überzeugt, das Stück bringe Johannas großen Durchbruch, er nannte sie die »nächste Greta Garbo«.
Vanessa schüttelte lachend den Kopf und warf erneut einen Blick auf die Straße, wo Reza Jalfradi gerade in den Solkungen verschwand.
Sie legte die Zeitung weg und nahm noch einen Schluck Kaffee.
Zwölf Jahre hatten Vanessa und Svante zusammengelebt.
Sie hatten sich bewusst dafür entschieden, sich auf ihre Karrieren zu fokussieren und keine Kinder in die Welt zu setzen. Vanessa als Kriminalkommissarin in der Gruppe, die nach der Umstrukturierung der Behörde Ermittlungseinheit mit den Fahndungsgruppen 5 und 6 hieß, aber von jedem Beamten nur Nova genannt wurde. Die Aufgabe dieser Sondereinheit bestand darin, sich im Großraum Stockholm an Einzelpersonen dranzuhängen, die eine Verbindung zur organisierten Kriminalität hatten. In den letzten Jahren war die Gruppe rasant angewachsen.
Für Svante hatte die Arbeit als Theaterregisseur auch mehrere Kneipenbesuche pro Woche umfasst, sowie erotische Abenteuer mit Frauen, denen seine Berühmtheit imponierte. Für Vanessa war das vollkommen in Ordnung gewesen. Sie machte einen Unterschied zwischen Sex und Liebe.
Aber eines Morgens am Frühstückstisch hatte Svante eine MMS bekommen. Vanessa hatte in dem Glauben, es sei ihres, nach dem Mobiltelefon gegriffen, und auf dem Display war ein kleines alienhaftes Wesen erschienen. Noch am selben Nachmittag hatte sie Svante rausgeworfen. Seitdem wohnte er in Johanna Eks Zweizimmerwohnung in Södermalm.
Vanessa verscheuchte die Erinnerungen, erhob sich und trat an den Tresen.
»Ich möchte zahlen.«
»Selbstverständlich, signora.«
Sie schob ihre American-Express-Karte in das Lesegerät und gab den Code ein.
»Mille grazie«, sagte der Schone und lächelte.
Reza Jalfradi hatte den Blick auf sein Mobiltelefon geheftet, als Vanessa die Tür zu Solarium Nr. 2 aufschob. Ohne wortreiche Begrüßungsfloskeln setzte sie sich neben ihn.
Er war ein achtundvierzigjähriger ehemaliger Krimineller, der Geldtransporte überfallen, dann aber auf Kneipier umgeschult hatte. Reza nahm keine Drogen, war also zuverlässig, und kannte jeden. Vanessa machte sich keine Illusionen, dass er die Welt zu einem besseren Ort machen wollte, sie wusste, dass die Informationen, mit denen er sie versorgte, gründlich abgewogen waren und stets in irgendeiner Weise seinen eigenen Zwecken dienten.
»Schön, dass es endlich geklappt hat«, sagte sie sarkastisch.
»Ich bin ein gefragter Mann mit prall gefülltem Terminkalender, aber meine Sekretärin konnte noch was freimachen«, gab Reza im gleichen Tonfall zurück.
»Ja, ich habe gehört, deine Pizzeria wird auch dieses Jahr wieder das Nobel-Bankett ausrichten. Der König schätzt anscheinend ganz besonders deine Quattro Stagioni. Liegt das am Analogschinken?«
Er lachte.
»Erinnere mich daran, dich anzurufen, wenn ich bei der nächsten Feier einen Komiker brauche.«
Vanessa fischte eine Snusdose aus ihrer Gesäßtasche und hielt sie Reza unter die Nase. Der schüttelte den Kopf.
»Ich habe nicht viel Zeit«, sagte sie. »Was ist los?«
»Jede Menge. Ein Banker ist gekidnappt worden.«
»Davon weiß ich gar nichts. Wann?«
»Vor zwei Wochen. Er wurde nach ein paar Tagen aber wieder freigelassen.«
»Und wer steckt dahinter?«
»Keine Ahnung.«
»Komm schon.«
»Im Ernst. Ich weiß es nicht.«
Sie musterte ihn und entschied für sich, dass er die Wahrheit sagte.
»Und wie heißt der Banker?«
»Weiß nicht. Aber ich kann’s rausfinden.«
»Entführungen von Bankern sind nicht gerade alltäglich, jedenfalls nicht in Schweden. Könnte die Legion dahinterstecken?«
Reza schüttelte den Kopf.
Seit einem Jahr war die Legion ein neuer Machtfaktor in Stockholms Unterwelt. Die beiden Köpfe der Gang, Joseph Boulaich und Mikael Ståhl, waren beim Militär gewesen. Nachdem sie in Afghanistan im Einsatz gewesen waren, hatten sie in den privaten Sektor gewechselt und für amerikanische Sicherheitsfirmen im Irak gearbeitet. In Kopenhagen dominierten schon seit Jahren aus Irak- und Afghanistanveteranen bestehende Gangs die Bandenkriminalität. In Schweden war dieses Phänomen dagegen neu. Und, wie sich herausgestellt hatte, nur schwer in den Griff zu bekommen.
Die Organisation der Legion funktionierte. Auf allen Ebenen herrschte absolute Diskretion, wodurch sie von den Abendzeitungen gar nicht wahrgenommen wurde.
Soweit bekannt war, versorgte die Legion Stockholm, Göteborg und Malmö mit erstklassigem Kokain. Anfangs hatten die anderen Gangs noch versucht, ihre Anteile am Drogengeschäft mit Gewalt zurückzugewinnen. Doch die Legion hatte mit militärischer Taktik und Präzision zum Gegenschlag ausgeholt und das ganze Land mit Leichen übersät. Allein acht davon in Stockholm. Keinen der Toten hatte man der Legion zuschreiben können. Und kein einziger Täter war gefasst worden.
Seit ein paar Monaten hatte sich die Situation beruhigt. Aber jeder Versuch, der Legion einen Schlag zu versetzen, hatte für die Polizei in einem Fiasko geendet. Die Gang war ihr stets einen Schritt voraus. Vanessa konnte sich das nur so erklären, dass es im Präsidium einen Maulwurf gab.
»Dann wäre das nie rausgekommen. Von denen quatscht keiner«, sagte Reza.
Vanessa trat ans Waschbecken und wusch sich die Hände. Zog ein Papiertuch aus dem Spender und trocknete sie ab.
»Noch was?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich muss dir was sagen«, begann Vanessa.
Reza hob überrascht die Augenbrauen.
»Ich bin suspendiert. Wahrscheinlich habe ich meinen Job noch, aber solange die Untersuchungen laufen, bin ich suspendiert.«
»Was ist denn passiert?«
»Spielt keine Rolle. Wenn du lieber wen anders treffen willst, kann ich mit meinen Kollegen reden.«
»Vergiss es. Ich rede nur mit dir.«
»Gut. Wir brauchen wieder eine neue E-Mail-Adresse.«
»Diesmal suche aber ich den Namen aus.«
»Ja, ja.«
Vanessa gab den Code in ihr Mobiltelefon ein und reichte es Reza, der den Browser öffnete, um eine neue Mailadresse anzumelden. Sie musterte sein Gesicht im Wandspiegel. Plötzlich brach er in Gelächter aus.
»Was ist das denn?«
Es dauerte einen Moment, dann begriff sie – sie hatte vergessen, den Suchverlauf zu löschen.
»Lauter lesbisches Zeug«, frotzelte Reza. »Ich hab’s ja gewusst, du stehst auf Mädels.«
»Halt die Klappe.«
Reza hob abwehrend die Hände.
»Ich urteile nicht. Ist doch cool, dass wir gemeinsame Interessen haben. Nächstes Mal gehen wir auf Kneipentour, Bräute abchecken.«
»Lass gut sein.«
»Dann wollen wir doch mal sehen«, murmelte Reza nach einer Weile. »Was hältst du von unserer neuen Mailadresse für die nächsten drei Monate?« Er zeigte ihr das Display.
Dort stand: [email protected].
»Das gleiche Passwort wie immer«, sagte Reza.
Zwei Nicolas Paredes brachte noch eine Handvoll Besteck in der Spülmaschine unter, schloss die Klappe und drückte den grünen Startknopf. Trat zwei Schritte zur Seite, umfasste den Griff der Maschine daneben und öffnete sie. Eine heiße Wasserdampfwolke schlug ihm entgegen.
Er wischte sich die Hände an seinem schwarzen T-Shirt ab und ließ die Klappe offen, damit das Geschirr trocknen konnte.
»Shit. Was ist daran denn so schwer?«
An dem langen Arbeitstisch saß Oleg, sein Kollege für diesen Abend, auf einem wackligen Hocker und blickte unglücklich auf sein Mobiltelefon. In der Spüle rechts neben ihm dümpelten ein paar große Töpfe in schmutzigem Wasser.
»Was ist denn?«, fragte Nicolas auf Englisch.
»Meine Schwester und meine Mutter sind gerade mit dem Boot angekommen. Ich versuche, ihnen zu erklären, wie sie zu meiner Wohnung in Hallunda kommen.«
Nicolas griff nach einem Topf und begann, ihn mit der Bürste zu bearbeiten. Olegs Telefon klingelte. Während Oleg zuhörte, führte er seinen linken Zeigefinger an die Schläfe und verdrehte die Augen. Im nächsten Moment entfuhr ihm eine Suada auf Lettisch.
»Ich gehe mal kurz Luft schnappen«, sagte Nicolas und stellte den Topf ab.
Er setzte sich auf den Treppenabsatz vor dem Eingang zur Küche und ließ seinen Blick über die Nybrogatan schweifen.
Die Tür hinter ihm ging auf und Josephine Stiller, eine der Kellnerinnen, trat auf ihn zu.
»Hast du eine Zigarette, Paredes?«, fragte sie.
Er schüttelte den Kopf.
»Dann komm mit zum Seven Eleven.«
Sie gingen die Straße Richtung Nybroviken hinunter. Nicolas wartete draußen, und als Josephine wiederkam, hielt sie ihm eine Schachtel Marlboro Gold entgegen.
»Schon gut, danke.«
Josephine zuckte mit den Schultern, schob sich eine Zigarette zwischen die Lippen und schlug den Rückweg ein.
»Wir beide müssen heute dableiben, bis sie schließen. Wie findest du das?«, wollte sie wissen.
Nicolas fuhr sich mit der Hand durch seine dunklen Haare.
»Wie soll ich das schon finden?«
Josephine ging nun langsamer und kam ihm so nah, dass er ihren feuchten Atem am Ohr spürte.
»Ich finde, du solltest mich noch mal so vögeln wie beim letzten Mal«, flüsterte sie. Nicolas sah sie an. Wenn er die Zunge rausstrecken würde, könnte er ihre Lippen berühren, so nah waren sie sich. »Oder du lässt es halt bleiben. Das liegt ganz bei dir. Ich will nur ein bisschen Spaß haben.«
Josephine steckte sich die Zigarette an und blies den Rauch aus. Er schien für einen Moment in der Luft zu schweben, dann verflüchtigte er sich.
Schon bei der ersten gemeinsamen Schicht hatte sie ihm deutlich zu verstehen gegeben, was sie von ihm wollte. Nach monatelanger ausgiebiger Flirterei hatte er schließlich nicht länger widerstehen können.
Wenn Josephine nicht gerade bei Benicio bediente, studierte sie Jura an der Universität Stockholm. Aufgewachsen war sie in Östermalm, und in vielerlei Hinsicht war sie ein typisches Mädchen der Oberschicht: hübsch und voller Selbstvertrauen. Nicolas unterhielt sich gern mit ihr, denn im Gegensatz zu vielen anderen, die mit solcher Schönheit gesegnet waren, hatte Josephine Humor und Verstand. Vielen, die so aussahen wie sie, mangelte es Nicolas’ Erfahrung nach an Charakter. Sie waren langweilig, weil sie nie soziale Fähigkeiten hatten entwickeln müssen, denn sie bekamen ohnehin immer, was sie wollten.
»Du willst doch nur deinen Vater auf die Palme bringen, indem du einen tätowierten Vorstadttypen anschleppst«, sagte er mit einem Lächeln.
»Kann sein.« Sie nahm einen tiefen Zug. »Aber ich kapier’s trotzdem nicht. Sonst muss ich eigentlich nie wirklich betteln und bitten.«
»Ich mag dich, Josephine. Aber es geht nicht. Du bist zu jung.«
»Ich bin zwanzig. Und entspann dich, Opa, ich mach dir ja keinen Antrag. Außerdem steh ich drauf, dass du’s mir nicht so leicht machst. Du bist nicht so berechenbar wie alle anderen in dieser notgeilen Stadt.«
»Ein andermal vielleicht«, entgegnete Nicolas.
Sie setzten sich auf die Treppe vor der Küche.
»Was machst du nachher noch?«
»Maria treffen.«
Josephine riss Augen und Mund auf, aber er kam ihr zuvor.
»Das ist meine Schwester.«
»Ich hätte kein Problem damit, die Zweitfrau zu sein. Aber gut, dann muss ich wohl irgendeinen reichen Loser in einer Bar aufgabeln.«
Sie stand auf, schnippte die Zigarette weg und drückte ihm einen Kuss auf die Wange.
Die Tür schlug zu. Die Zigarette glimmte noch. Es war schön gewesen beim letzten Mal. Am Morgen danach hatte sie eines seiner T-Shirts angezogen und Frühstück gemacht. Den Rest des Tages hatten sie im Bett verbracht und waren nur aufgestanden, um unten am Gullmarsplan Pizza zu holen.
Josephine brachte ihn zum Lachen. Er wollte sie anständig behandeln. Und es gab gewisse Umstände in seinem Leben, die ein Verhältnis mit ihr völlig undenkbar machten.
Vor allem wegen Maria. Sie war die wichtigste Person in seinem Leben.
Er stand auf, gab den Code ein und trat wieder in die Küche.
Oleg kämpfte mit der Klappe der Spülmaschine, und als er sie endlich aufbekam, drehte er sich weg, um der Dampfwolke auszuweichen. Das gelang ihm nur leidlich, seine runden Brillengläser beschlugen.
»Wie ist es gelaufen?«
Oleg putzte seine Brille mit seinem T-Shirt und blinzelte zu Nicolas hinüber.
»Nicht so toll.«
Das Telefon klingelte. Oleg legte es frustriert auf den Hocker.
»Wie lange bleiben sie?«, erkundigte sich Nicolas.
»Bis Samstag.«
»Ich komme hier schon klar. Fahr zu ihnen.«
Oleg schüttelte den Kopf.
»Ich kann dich mit diesem Chaos nicht alleinlassen. Und ich brauche das Geld.«
Nicolas wusste, dass Oleg seit Monaten Geld auf die Seite gelegt hatte, damit seine Mutter und seine Schwester ihn besuchen kommen konnten. Neben dem Job als Spüler bei Benicio arbeitete der Lette auch noch auf einer Baustelle in Märsta. Und in manchen Nächten sammelte er mit verarmten Rentnern und osteuropäischen Roma Pfandflaschen um die Wette.
Nicolas gab ihm einen leichten Schubser, stellte sich an seinen Arbeitsplatz und begann, die Teller aus dem Geschirrspüler zu räumen.
»Ich regle das. Das bleibt zwischen uns. Ich kapiere zwar nicht, warum jemand über die Ostsee fährt, nur um dich zu treffen. Aber ich werde ja schließlich fürstlich dafür bezahlt.«
»Ja, das ist die reinste Goldgrube hier«, meinte Oleg und verzog den Mund. Er setzte seine Brille wieder auf. »Danke, wirklich. Das vergess ich dir nie.«
Ein paar Stunden später stieg Nicolas am Östermalmstorg in die U-Bahn. Die Türen schlossen sich, und er musste daran denken, dass er einmal irgendwo gelesen hatte, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Einwohner von Danderyd, wo die rote U-Bahn-Linie begann, dreiundachtzig Jahre betrug. In Vårberg, nach wenigen Minuten Fahrt, wurden die Einwohner im Schnitt nur noch neunundsiebzig.
Er hatte keinen Grund zu glauben, dass sich daran etwas geändert hatte, seit er den Artikel gelesen hatte.
Die Situation in den Stockholmer Vororten war verheerender denn je. Brennende Autos, fliegende Steine und Schusswechsel waren zum Alltag geworden. Es wurde ganz offen mit Drogen gedealt. Die Gang hatte überall das Sagen, und ihre halbwüchsigen Mitglieder, die immer jünger wurden, vertrieben sich mit Diebstählen und Misshandlungen die Zeit.
Andere Gangmitglieder wurden erschossen in Autos aufgefunden oder auf offener Straße hingerichtet. Die übrigen Einwohner der Vororte waren die Verlierer, sie wollten nur ihr Leben leben und ihre Kinder aufwachsen sehen, hatten aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, um woanders hinzuziehen.
Menschen wie Maria.
Er musste seine Schwester heute Abend sehen, während der nächsten Tage würde er keine Zeit dazu haben. Außerdem vermisste er sie. Sie war ein Jahr älter als Nicolas, und sie war Autistin. Sie wohnte noch immer in dem Wohnheim, in das sie gezogen war, als sie volljährig geworden war.
Seit Nicolas’ Rückkehr nach Stockholm war sie bereits zweimal ausgeraubt worden. Aber den Tätern ging es dabei nicht nur um Geld. Maria litt seit ihrer Geburt an einem Hüftfehler und zog das rechte Bein etwas nach, was sie in ihrer gesamten Kindheit in Sollentuna zu einem ebenso leichten wie offensichtlichen Mobbingopfer gemacht hatte.
In Vårberg bewarfen Kinder und Teenies sie mit Steinen, wenn sie auf die Straße ging.
Nicolas hatte sie zu überreden versucht, in seine Wohnung am Gullmarsplan zu ziehen, doch das wollte sie nicht. Sie verabscheute Veränderungen. Wollte niemandem zur Last fallen. Doch sobald Nicolas genug Geld beisammen hätte, würde er mit ihr weggehen aus Vårberg, weit weg.
Das schlechte Gewissen, dass er sie so lange allein gelassen hatte, plagte ihn unaufhörlich. In seiner Zeit als Soldat, während der er sich oft im Ausland aufgehalten hatte, hatte er sie nur ein-, zweimal gesehen. Und immer hatte sie vorgegeben, alles sei in Ordnung, damit er sich keine Sorgen machte.
Nie wieder, dachte er.
Vier Reisende hasteten über den Bahnsteig von Vårberg. Der Zug ächzte, beschleunigte und verschwand in südlicher Richtung. Hinter dem menschenleeren Zentrum bog Nicolas rechts ab, überquerte die Rasenfläche und ging über den Parkplatz. Er nahm den Schlüssel, den er von ihr bekommen hatte, und betrat das Wohnheim.
An der Anmeldung saß niemand.
Nicolas ging zu den schmalen Fahrstühlen und fuhr in den zweiten Stock.
Essensdunst hing im Korridor, irgendwo lief ein Fernseher, ein Kind weinte, Stimmengewirr. Er blieb vor Marias Tür stehen und drückte auf die Klingel. Dann hörte er die schlurfenden Schritte seiner Schwester.
Die Tür glitt langsam auf. Die Diele hinter Maria lag im Dunkeln. Aber als sie ihn ansah, bemerkte er sofort das angetrocknete Blut in ihren Haaren. Ihr rechtes Auge zierte ein grüngelbes Veilchen. Sie trat zurück, um ihn hereinzulassen.
»Verflucht«, murmelte er.
Drei In jenem Teil der Welt, den der Entdecker Ferdinand Magellan Feuerland getauft hatte, herrschte komplette Dunkelheit. Die Wellen des Pazifik donnerten gegen die Klippen und zerschellten zu weißem Schaum. Der Wind zerrte und riss an der Vegetation und seinen Kleidern.
In den wolkenfreien Nächten in Südchile schien der Mond so hell, dass man Zeitung lesen konnte, doch jetzt versteckten sich Mond und Sterne hinter einer dichten Wolkenbank.
Eine Seemeile weiter draußen lag der Frachter M/S Iberica im Meer. Wären die Positionslichter des Schiffs nicht da, man wüsste nicht, in welchem Jahrhundert man sich befindet, dachte Carlos Schillinger. In der Natur spielte Zeit keine Rolle. Deswegen mochte er sie. Die schmutzigen Städte hingegen, in denen sich die Menschen wie Vieh drängten, hasste er.
Er zog den Mantel enger um seinen Körper und blickte auf das Wasser. Auch wenn er das Motorboot nicht sehen konnte, wusste er, dass es sich auf die kleine Bucht unterhalb von ihm zubewegte.
Der Teil der Ladung, den die M/S Iberica von den Philippinen mit sich führte, war nirgendwo registriert. So sollte es auch bleiben. Mit dem bereitstehenden Lastwagen sollte die lebende Ware über tausend Kilometer weitertransportiert und dann versteckt werden.
Er hörte Schritte hinter sich. Ohne sich umzudrehen wusste Carlos, dass der junge Mann, der nun neben ihm auftauchte, sein Adoptivsohn Marcos war.
»Sie sind fast da«, sagte er.
»Gut«, gab Carlos zurück.
Marcos blies seinen Atem in die hohlen Hände, um sie zu wärmen.
»Und wann kommt die nächste Lieferung?«, fragte er. Seine Stimme klang dumpf und fremd durch die Hände.
»Das hier ist die letzte von den Philippinen.«
»Keine neue Quelle?«
»Nein, bis jetzt nicht.«
Auf dem Wasser, etwa fünfzig Meter entfernt, leuchtete eine Taschenlampe auf. Eine Sekunde später war die M/S Iberica wieder die einzige Lichtquelle.
»Es ist so weit«, sagte Carlos.
Sie stiegen die Klippen hinunter. Marcos leuchtete ihnen mit seinem Mobiltelefon. In der Ferne schrie ein Seevogel.
Dieselschwaden stachen ihm in die Nase, auf dem Wasser gingen die Positionslichter des Motorboots an und es glitt langsam Richtung Ufer. Als der Rumpf auf den Sand aufsetzte, wurden die Scheinwerfer des Lasters eingeschaltet. Sofort war die Dunkelheit von Stimmen und Schatten erfüllt.
Ein Kind begann zu weinen. Jemand brachte es mit ein paar Ohrfeigen zum Schweigen, und die Schluchzer des Mädchens wurden von der Brandung, dem Motor des Lastwagens und den gehetzten Stimmen der Männer erstickt. Starke Arme führten die Kinder über den Strand und auf die Ladefläche des Lkw.
Ein älterer Junge riss sich los und rannte auf ein Gebüsch zu. Zwei Männer setzten ihm nach. Die anderen machten ihre Taschenlampen an und leuchteten in die Richtung, in die der Junge verschwunden war. Die beiden Männer kamen zurück, den Jungen zwischen sich. Er ließ den Kopf hängen und stemmte seine Beine in den Boden. Flehte und bettelte. Sie warfen ihn auf die Ladefläche, schlossen die Klappe und klopften zweimal gegen die Seite als Zeichen, dass alle Kinder verladen waren.
Als Laster und Begleitfahrzeug verschwunden waren, wurde es wieder ruhig am Strand.
Carlos ging zu seinem Wagen. Sein Chauffeur Jean rauchte in der Hocke, den Rücken gegen die Tür gelehnt.
»Können wir fahren, jefe?«, fragte er, als er Carlos entdeckte, stand auf und schnippte die Zigarette weg.
»Sí.«
Die Zigarette glimmte noch, Carlos trat sie aus, hob sie auf und reichte sie Jean.
»Wirf sie zu Hause weg.«
»Natürlich. Tut mir leid.«
Sie fuhren die ganze Nacht, bis Carlos das Tor erblickte, das die Colonia Rhein vom Rest der Welt trennte. Es glitt lautlos auf. Die dreizehntausend Hektar Land der Kolonie bestanden zum Großteil aus Wald, etwa ein Viertel waren Äcker und Viehweiden. Die Wohnhäuser der hundertfünfzig Bewohner verteilten sich auf den umliegenden Hügeln. In der Mitte lag ein kleines Dorf mit Geschäften und Fabriken, dazu gab es eine Schule, eine Bäckerei und eine protestantische Kirche.
»Nach Hause?«, fragte Jean und gähnte.
Hinter den Anden war die Sonne aufgegangen. Gleich machte die Bäckerei unten im Dorf auf. Carlos wusste, dass er sowieso nicht schlafen konnte. Er brauchte Kaffee. Wollte allein sein, nachdenken. Er ließ seinen Blick über die dunklen Felder schweifen, über denen dichter weißer Nebel hing.
Rechts neben dem Wagen ragte das Krankenhaus der Colonia Rhein empor, die Clínica Bavaria. Es war das modernste Gebäude der Kolonie und hatte mehrere Stockwerke. Aus der ganzen Welt kamen Patienten hierher, vor allem Geschäftsmänner aus Asien. Die Klinik hatte nicht nur eine Behandlung auf Weltklasseniveau und fortschrittlichste Stammzellenforschung an abgetriebenen Föten im Angebot, sondern verfügte außerdem über eine Organbank. Manche Patienten zahlten Millionen, um die Wartelisten für ein Spenderorgan in ihren Heimatländern zu umgehen. Einige Transplantationen wurden sogar rein prophylaktisch vorgenommen, die Reichsten ließen ihre Organe nur austauschen, um den Alterungsprozess zu verlangsamen und ihr Leben zu verlängern.
Seit Anfang der Neunzigerjahre wurde die Organbank durch Straßenkinder bestückt, die von den Philippinen nach Chile gebracht worden waren. Aber seit der neue Präsident Duterte im Amt war und den Drogenkartellen den Krieg erklärt hatte, hatten Carlos’ philippinische Geschäftspartner immer größere Lieferschwierigkeiten.
Deshalb war die Fracht der M/S Iberica die letzte von dort. Wollte das Krankenhaus überleben, musste Carlos eine neue Quelle auftun, durch die er die Klinik mit Organen versorgen konnte.
»Nein, fahr mich ins Dorf runter und leg dich dann zu Hause aufs Ohr.«
»Wie Sie wünschen, patrón.«
Jean blieb vor der weiß gestrichenen Kirche stehen. Carlos stieg aus, und der Mercedes entfernte sich. Der Duft von frisch gebackenem Brot in der klammen Morgenluft machte ihn hungrig.
Carlos grüßte señora Gisela, die die Bäckerei betrieb, und bat um Nusskuchen und Kaffee.
»Sehr gern, don Carlos. Nehmen Sie doch Platz, ich bringe es Ihnen sofort.«
Neben der altmodischen Kasse lag ein Stapel deutscher Zeitschriften. Carlos nahm sich den Spiegel und setzte sich draußen an einen Tisch.
Er schlug die vier Tage alte Zeitschrift auf, während ihm señora Gisela Nusskuchen und Kaffee servierte.
Carlos bedankte sich und kostete.
»Delicioso, wie immer.«
Sie nahm einen Lappen, wischte die leeren Tische ab und spähte hinüber zu den Feldern, während Carlos in seine Lektüre versank. Er überflog den Leitartikel und blätterte anschließend ziellos durch das Magazin, bis eine Überschrift sein Interesse weckte.
Fünfhundert Flüchtlingskinder verschwinden in Schweden – jedes Jahr.
In dem Artikel ging es darum, dass Schweden ein Problem damit hatte, die zahlreichen minderjährigen Einwanderer zu überblicken, die sich im Land aufhielten. Menschenrechtsaktivisten beschuldigten die Polizei und die Behörden, einfach wegzusehen, wenn sie spurlos verschwanden. Giselas Stimme schreckte ihn aus seiner Lektüre auf.
»Da kommt don Dieter«, sagte sie und ging wieder in die Bäckerei.
Eine schlaksige Gestalt kam unsicher die Straße hinauf und stützte sich dabei auf einen Stock.
»Guten Morgen«, grüßte Dieter Schück auf Deutsch, ließ sich mit einem leisen Seufzer am Nebentisch nieder und lehnte den Stock an den Stuhl.
Hinter ihnen ging die Tür auf, und señora Gisela brachte Kaffee und ein Plunderstück.
»Welche Zeitung wünscht don Dieter heute?«, fragte sie auf Spanisch.
»Die«, sagte Dieter, zeigte auf Carlos und brach in polterndes Gelächter aus, das in einen Hustenanfall überging. Obwohl Dieter seit Mitte der Vierziger in Chile lebte, hatte er noch immer einen unüberhörbaren Akzent. Jetzt schwenkte er auf Deutsch um. »Was liest du da?«, presste er zwischen den Hustern hervor.
»Was über Schweden«, sagte Carlos knapp. Er mochte und respektierte Dieter, aber er hasste es, wenn er beim Lesen gestört wurde.
»Ah, deine dritte Heimat. Du kannst doch Schwedisch, oder?«
Dieter schlug sich auf die Brust, und der Husten verstummte.
»Ja«, gab Carlos zurück. »Auch wenn mein Vater nie viel für Schweden übrig hatte. Er sah sich als Deutscher, und wie du weißt, hat er bei der Heirat den deutschen Namen meiner Mutter angenommen.«
Dieter führte zitternd das Gebäck zum Mund und biss hinein. Krümel rieselten über sein Hemd und auf seinen Schoß.
Im Krieg war Dieter Untersturmführer der Waffen-SS gewesen. Er hatte an der Ostfront gekämpft und war bis Stalingrad gekommen, war dann aber von der Roten Armee nach Deutschland zurückgedrängt worden. Hatte Berlin bis zum Ende verteidigt. War verwundet worden und wieder genesen. War anschließend nach Südamerika geflohen und hatte gemeinsam mit anderen SS-Familien die Colonia Rhein aufgebaut.
Ein neuerlicher Hustenanfall kündigte sich an. Dieter schlug sich die Faust vor die Brust und räusperte sich.
»Keiner hat Berlin mit solcher Verbissenheit und Hingabe verteidigt wie dein Vater«, sagte er und tupfte sich die Mundwinkel ab. »Wie lange ist er jetzt tot?«
»Siebenundzwanzig Jahre.«
»Siebenundzwanzig Jahre … Ja, er ist zum richtigen Zeitpunkt gestorben.«
Sie schwiegen, während die Sonne den Himmel erklomm.
In der Bäckerei ging Porzellan zu Bruch, und señora Gisela verfluchte lautstark irgendeinen Heiligen, von dem Carlos noch nie gehört hatte.
Er hängte seine Jacke über die Stuhllehne und legte die Zeitschrift aus der Hand. Ein kleiner Punkt auf einem der Hügel brachte ihn dazu, den Kopf zur Seite zu drehen. Der schwarze Chevrolet Pick-up seines Adoptivsohns tauchte am Fuß des Hangs auf.
»Willst du?«, fragte Carlos und reichte Dieter den Spiegel.
Der alte Mann entgegnete nichts und starrte mit halb offenem Mund ins Leere.
Als Marcos sein Auto abgestellt hatte, setzte er sich zu Carlos an den Tisch.
»Guck dir das mal an«, sagte Carlos und zeigte auf die Meldung über die Flüchtlingskinder. Carlos musterte Marcos, während der mit zusammengekniffenen Augen las.
Sein Adoptivsohn war in einem kleinen Dorf in der Nähe von Valdivia auf die Welt gekommen. Damals wie heute wurden die Menschen dort in den Sommermonaten von verheerenden Waldbränden heimgesucht, die alles zu Asche machten, was ihnen in den Weg kam. Das Haus von Marcos’ biologischen Eltern war zwischen zwei Flammenwände geraten. Die letzte Handlung seiner Mutter hatte darin bestanden, ihren neunjährigen Sohn in den Brunnen abzuseilen. Danach waren sie und ihr Mann bei lebendigem Leib verbrannt.
Eine Woche später fanden Rettungskräfte den Jungen, er war völlig erschöpft, aber unverletzt. Er hatte das Brunnenwasser getrunken und Ratten gegessen, die ebenfalls dort Schutz gesucht hatten. Marcos’ Geschichte verbreitete sich in ganz Chile, die Zeitungen schrieben ellenlange Artikel über den Wunderjungen von Valdivia, und Carlos war sofort von seinem Schicksal angetan. Er rief in dem Kinderheim an, in dem Marcos untergekommen war, einigte sich mit der Leiterin darauf, ihn zu adoptieren, und bezahlte sie für ihr Schweigen. Dokumente wurden keine unterschrieben, und zwei Tage später saß der Junge auf Carlos’ Beifahrersitz und fuhr mit ihm nach Süden. In die Colonia Rhein.
Carlos hatte Marcos vom ersten Augenblick an wie einen Sohn geliebt. Und Marcos hatte sich dem Leben in der Kolonie angepasst, die Sprache gelernt und Freunde gefunden, obwohl er schüchtern und wortkarg war. Unter den Gleichaltrigen war er immer der Schmächtigste gewesen, aber er war am schnellsten gelaufen, am höchsten gesprungen und hatte die härtesten Schläge ausgeteilt. Carlos war nie einem anderen Menschen mit Marcos physischer Konstitution begegnet. Jede seiner Bewegungen war von einer rohen, geradezu animalischen Kraft.
Vielleicht kommt das gar nicht so überraschend, hatte Carlos gedacht, als er seinen Adoptivsohn aufwachsen sah. Schließlich waren Marcos’ biologische Eltern Mapuche – Indianer jenes Stammes, den weder die Inka noch die Spanier sich jemals untertan machen konnten.
Marcos hatte die Meldung zu Ende gelesen, schob die Zeitschrift weg und steckte sich ein Stück Nusskuchen in den Mund.
»Kennst du irgendwelche Schweden, die uns da behilflich sein könnten?«, fragte Carlos.
Marcos kaute, dann nickte er langsam.
»Ja, in meinem Verband in Kolumbien gab es einen, der hat für Blackwater gearbeitet. Äußerst kompetent und seriös. Einer, dem man trauen kann.«
»Und dieser kompetente Mensch könnte uns dabei helfen, die Kinder zu beschaffen?«
»Ja.«
»Dann nimm Kontakt mit ihm auf und buch Flugtickets nach Schweden, für uns beide.«
»Wann?«
Carlos überlegte. Es war ihm zuwider, die Kolonie zu verlassen. Chile zu verlassen. Aber diesmal gab es keine andere Möglichkeit, wenn die Clínica Bavaria überleben sollte.
»So bald wie möglich«, sagte er und seufzte.
Vier Vanessa bat den Taxifahrer, an der Kreuzung Surbrunnsgatan-Birger Jarlsgatan zu halten. Nachdem das Auto weitergefahren war, bückte sie sich, berührte mit den Fingern den Asphalt und stellte fest, dass die Straße noch nass war.
Aus dem Monica-Zetterlunds-Park drang gedämpfter Gesang. Ein Mann hatte sich auf der Holzbank niedergelassen, die zum Gedenken an die Jazzsängerin aufgestellt worden war und rund um die Uhr ihre Lieder spielte.
Als Vanessa näher kam, sah sie, dass es sich bei dem Mann um Rufus Ahlgren handelte, einen der wenigen übrig gebliebenen Alkis des Viertels.
»Guten Abend, Sheriff«, rief er und hob zum Gruß die Flasche.
Sie blieb vor ihm stehen.
»Was trinkst du da, Rufus?«
»Gin. Das hält die Malariamücken fern in dieser Hitze. Willst du?«
»Wenn du die fernhalten willst, musst du den Gin mit Tonic mischen. Da ist Chinin drin.«
»Äh.«
Vanessa nahm die Flasche und wog sie in der Hand.
»Wieso setzt du dich eigentlich nie in eine Bar?«, fragte sie und musste an ihre Stammkneipe denken, das McLarens. Seit ihrer Trennung von Svante hatte sie dort keinen Fuß mehr hineingesetzt.
»Ich mag keine Bars.«
»Ein Alki wie du, der keine Bars mag. Das ist wie …« Vanessa führte die Flasche zum Mund, trank einen Schluck und schnitt eine Grimasse »… ein Löwe, der kein Fleisch mag.«
»Eher wie ein Löwe, der nicht gern im Zoo eingesperrt ist.« Rufus hob einen Finger. »Hör zu.«
Monica Zetterlund sang ihre Glanznummer Sakta vi gå genom stan. Rufus wiegte sich im Takt zur Musik, eine einzelne Träne rann seine Wange hinab. Als der Song verklungen war, wandte er sich wieder an Vanessa.
»Sie ist so verdammt einsam gestorben, das ist das Traurige an der ganzen Sache. Sie hat im Bett geraucht und aus Versehen die Laken in Brand gesteckt. Sie war invalide und hatte keine Chance. Die Wohnung da oben, da drin ist sie verbrannt.« Er deutete Richtung Birger Jarlsgatan und zündete sich eine verbogene Zigarette an. »Deswegen rauche ich nur noch draußen.«
»Das ist sehr weise. Ich rauche überhaupt nicht, aber ich werde trotzdem einsam sterben«, sagte Vanessa und wedelte den Rauch weg.
»Mieses Date?«
»Der Ärmste war so notgeil, dass er Mühe hatte, vollständige Sätze rauszubringen.«
»Oh verflucht.«
»Hast du Kinder, Rufus?«
»Einen Sohn. Und du, Constable?«
»Nein.«
»Weil du keine willst, oder weil dein überheblicher Mistkerl keine Kugeln im Lauf hat?«
Rufus hatte nie einen Hehl daraus gemacht, was er von Svante hielt.
»Ich bin nicht so der mütterliche Typ. Ich mag keine Kinder. Das hat der überhebliche Mistkerl genauso gesehen.«
»Habt ihr die Kerle geschnappt, die den Polizisten auf dem Gewissen haben?«
Eine Woche zuvor war Klas Hemäläinen in einem Industriegebiet in Sätra gefunden worden, erschossen. Klas war auch bei der Nova-Gruppe und bei den Kollegen sehr beliebt gewesen.
»Bisher noch nicht, leider.«
»Das ist ja das Letzte. Kanntest du ihn?«
»Er war ein netter Mann«, sagte Vanessa und verstummte. »Gute Nacht, Rufus«, sagte sie dann, »und bleib nicht mehr so lange.«
»Als Frau ohne Muttergefühle bist du manchmal ganz schön gluckenmäßig«, entgegnete Rufus und hob zum Abschied die Flasche.
Vanessa gab den Sicherheitscode der Roslagsgatan 13 ein.
Auf dem Teppich in der Diele lag der Flyer eines Immobilienmaklers, der sich in knappen Worten erbot, ihre Wohnung zu begutachten. Die Erkerwohnung mit vier Zimmern war ohnehin zu groß, war schon zu groß gewesen, als sie mit Svante hier eingezogen war. Aber sie mochte Sibirien, so hieß ihr Viertel in Vasastan, auch wenn es sich gerade im Wandel befand. Die alten Kneipen und Trödelläden wichen Saftbars und Hamburgerlokalen.
In den Neunzigern hatte Vanessas Wohnung einem Mann gehört, der von den Abendzeitungen als Pornokönig tituliert worden war. Der Mann, der zwei Stripclubs in der Innenstadt besessen hatte, hatte in der Jugendstilwohnung fast jede Wand entfernen und vor den Panoramafenstern im Wohnzimmer eine Badewanne einbauen lassen. Eine der beiden Terrassen hatte er verglasen lassen und Loungemöbel sowie eine kleine Bar hineingestellt. Danach hatte ein Internet-Millionär die Wohnung gekauft und die ganzen Kameras abmontiert, die der Pornokönig angebracht hatte, um seine legendären Partys zu verewigen. Nur die am Eingang hatte er behalten.
Als Svante gelesen hatte, dass die fast dreihundert Quadratmeter große Wohnung zum Verkauf stand, war er mit Vanessa zum Besichtigungstermin gegangen. Im Schlafzimmer, dem master bedroom, wie der lispelnde Makler es andächtig genannt hatte, stand ein nostalgischer Kachelofen, und die Decke war aus Spiegelglas. Als würde man in einem ottomanischen Palast schlafen, hatte der Makler gewispert und zur Decke gedeutet. Oder in einem drittklassigen Bordell, hatte Vanessa gedacht und ein Gebot abgegeben.
Seit Svante ausgezogen war, benutzte Vanessa im Grunde nur das Wohnzimmer. Das Bett im Schlafzimmer war gemacht und unberührt. Sie schlief stattdessen vor dem Fernseher. Ihre Fernsehgewohnheiten variierten, je nach Stimmung schaute sie Sendungen auf National Geographic oder dem History Channel oder Wiederholungen von Paradise Hotel auf TV 6.
Zuvor hatte sie fast jeden Abend im McLarens gegessen, aber seit der Trennung tat sie das nicht mehr. Sie konnte die Blicke der anderen Gäste und ihre Fragen nach Svante nicht ertragen und hatte in letzter Zeit lieber Kebab vom Falafelkungen gegessen. Zu ihrer großen Belustigung hatte Vanessa festgestellt, dass sie wegen der katholischen Gebetskette, die ihre Schwester Monica ihr von einer Zentralamerikareise mitgebracht hatte, von den koptischen Christen an der Kasse fünf Prozent Rabatt bekam. Und obwohl Vanessa überzeugte Atheistin war, wollte sie die jungen Männer nicht enttäuschen und fing plötzlich an, ihnen lebhaft von ihren regelmäßigen Pilgerreisen nach Santiago de Compostela zu erzählen, während sie darauf wartete, dass das Essen fertig war.
Vanessa zündete ein paar Holzscheite im Kachelofen an, ging ins Bad, putzte sich die Zähne und wusch sich das Gesicht. Sie öffnete die Terrassentür, schloss die Augen und lauschte auf die Geräusche der Stadt: die Autos auf der Birger Jarlsgatan, ein beschwipstes Lachen, eine lautstarke Diskussion, ein Paar, das Sex hatte, ein Alarm.
Sie trat an den Globus, der als Barschrank fungierte, öffnete ihn am Äquator, nahm eine Whiskyflasche heraus und schenkte sich zwei Fingerbreit in ein Glas. Danach zog sie sich aus, legte sich aufs Sofa, deckte sich zu und schaltete den Fernseher ein. Paradise Hotel. Ein sonnengebräunter Kerl mit nacktem Oberkörper und roter Kappe verbreitete seine Lebensweisheiten.
»Befolge nie den Rat eines fetten Personal Trainers«, erklärte er.
Vanessa zappte weiter. Discovery Channel. Zebras liefen durch eine ostafrikanische Steppe. Ihre Lider wurden immer schwerer, und sie nickte ein. Irgendwo im Grenzland zwischen Schlaf und Wachsein summte ihr Mobiltelefon. Sie tastete schlaftrunken danach und öffnete den Posteingang des Mailaccounts, den sie mit Reza teilte.
Der Banker heißt Oscar Petersén.
Unter der kurzen Nachricht befand sich ein Bild von einem Mädchen, das mit leicht geöffneten Lippen direkt in die Kamera blickte. Vanessa schüttelte den Kopf, trank noch einen Schluck Whisky und schlief ein.
Fünf Mitten in der Nacht hatte Carlos genug davon, im Bett zu liegen und sich hin und her zu wälzen. Er schnappte sich eine Matratze aus einem der Gästezimmer und trug sie auf die Terrasse. Der Mond tauchte die Felder und den Wald am Fuße des Hügels in sein helles Licht. Carlos blickte in den Himmel und sah zwei Sternschnuppen. Er folgte der Bahn der Satelliten, erfreute sich an der Jagd der Fledermäuse, hörte im Tal die Hunde bellen und die Pferde wiehern. Die Außenbeleuchtung zog Insekten an, sie kamen aus allen Richtungen und surrten um die Lampen herum. Die nachtaktiven Tiere orientierten sich normalerweise am Mondschein, doch die künstlichen Lichtquellen irritierten ihr Nervensystem, sie hielten sie für zusätzliche Monde.
Mittlerweile war wieder die Sonne über Südchile und der Colonia Rhein aufgegangen. In der Küche klapperte die Haushälterin. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee stieg Carlos in die Nase und bewegte ihn zum Aufstehen. Er reckte und streckte sich, ging ins Haus und murmelte »Guten Morgen«. Marisol reichte ihm einen dampfenden Becher schwarzen Kaffee und fuhr fort, einen Teller mit dem Schwamm zu bearbeiten. Sie beharrte darauf, alles mit der Hand abzuwaschen, obwohl Carlos schon vor Jahren eine Spülmaschine angeschafft hatte. Und irgendwie gefiel es ihm, wenn Leute an ihren Gewohnheiten festhielten.
Er ließ sich auf das Wohnzimmersofa sinken, führte den Becher an die Lippen, verbrannte sich, verzog das Gesicht und stellte ihn ab.
Über dem offenen Kamin hing die Luger seines Vaters an der Wand. Die Mündung war vergoldet, den Griff schmückten Elfenbeinintarsien. Auf einer kleinen Messingplakette stand: Für meinen Freund Gustav Schillinger. General Augusto Pinochet. Februar 1974.
Die Colonia Rhein war eine der beiden deutschen Exklaven, in denen die chilenische Militärdiktatur Verhöre durchgeführt hatte. Die zweite, die Colonia Dignidad, lag rund eintausend Kilometer weiter nördlich. In diese beiden deutschen Kolonien waren die gefährlichsten Gefangenen gebracht worden, diejenigen, die über wichtige Informationen verfügten. Denn abgesehen von ihrem Wissen über Landwirtschaft, Gesundheitswesen und Industrie hatten die Deutschen auch Foltermethoden mitgebracht, die zu perfektionieren sie einen Weltkrieg lang Zeit gehabt hatten.
Auch schon vor dem Militärputsch von 1973 waren die Immigranten willkommen gewesen und hatten den Schutz von Politik, Polizei, Kirche und Wirtschaft genossen. Aber als dann General Pinochet an die Macht kam, nahm der Einfluss der Deutschen zu. In der Colonia Rhein und der Colonia Dignidad entstanden Folterzentren und Waffenfabriken, abgesegnet und finanziert durch die Diktatur. In den Labors wurde mit Chemiewaffen experimentiert, in der Colonia Rhein waren sogar noch heute irgendwo Behälter mit Sarin vergraben.
Während die Colonia Dignidad jedoch implodiert war, weil ihr Leiter des sexuellen Missbrauchs von chilenischen Kindern schuldig gesprochen worden war, hatte die Colonia Rhein überlebt und sich den neuen Zeiten angepasst.
Seit ihrer Glanzzeit hatte sich dennoch vieles verändert. Die jungen Leute zogen in die Städte oder verließen Südamerika, um nach Europa zurückzukehren. Die Colonia Rhein war nicht mehr so traditionell deutsch wie früher. Einflüsse von außen wurden zugelassen. Aber rein wirtschaftlich betrachtet, war es der Colonia Rhein nie besser gegangen. Über den Mutterkonzern Alemagne gehörten ihr Fabriken, Lachszuchtbetriebe und Äcker in ganz Südchile.
Auf diese Weise schufen die Deutschen Tausende Arbeitsplätze. Und deshalb ließen die Politiker sie gewähren, solange sie Steuern zahlten und dazu beitrugen, dass die Arbeitslosenzahlen im Rahmen blieben.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Clínica Bavaria war hingegen gesunken. Doch Carlos ging es beim Fortbestand des Krankenhauses nicht um Geld, die Clínica Bavaria war mehr als das, sie war das Lebenswerk seines Vaters. Abgesehen davon, dass die Klinik reiche Ausländer mit medizinischer Betreuung und Organen versorgte, behandelte sie seit fast sechzig Jahren arme Chilenen kostenlos. Durch die Clínica Bavaria und die Schule der Colonia Rhein, die den chilenischen Kindern aus der Umgebung eine Gratisausbildung ermöglichte, waren die Deutschen bei der lokalen Bevölkerung beliebt.
Auf dem Hof bellte Bruja. Carlos ging an den Rosensträuchern vorbei zum Zwinger. Die Hündin verstummte, drückte ihre Nase gegen den Hühnerdraht und wedelte mit dem Schwanz.
Nach seiner Ankunft in Chile 1948 hatte sein Vater damit experimentiert, eine neue Rasse zu züchten, indem er den Dobermann mit dem hiesigen Rottweiler kreuzte. Von jedem Wurf tötete sein Vater alle außer zwei, die fortan um ihr Futter kämpfen mussten, damit nur der Stärkere überlebte. Das Ergebnis war ein großer kurzhaariger Wachhund mit der Intelligenz und Kraft des Rottweilers und dem Mut und der Aggression des Dobermanns.
Während Bruja über den Hof jagte, ließ Carlos sich auf der Bank unter dem Avocadobaum nieder.
Als wenig später das Auto kam, stand Carlos auf, rief nach Bruja und zeigte auf den Zwinger. Die Hündin gehorchte sofort. Carlos griff nach einer PET-Flasche, die er mit seinem Urin gefüllt hatte, goss ein wenig davon in Brujas Wassernapf und schob den Riegel vor. Wissenschaftliche Belege gab es dafür zwar keine, aber er hatte diese Methode von seinem Vater gelernt. So verleibte die Hündin sich jedes Mal, wenn sie von dem Urin trank, ein Stück ihres Herren ein. Das schaffte Loyalität und untermauerte, wer das Sagen hatte.
Er grüßte Jean und nahm auf der Rückbank Platz.
»Nach Santa Clara?«
»Zuerst will ich mit Marcos reden, aber sein Mobiltelefon ist aus. Ist er beim Bunker?«
»Ich habe sein Auto in die Richtung fahren sehen, ja«, sagte Jean.
»Dann fahren wir dorthin.«
Sechs »Was ist passiert?«
Nicolas führte die Hand zum Schalter und knipste das Licht in der Diele an. Hinter dem blau angeschwollenen Gesicht seiner Schwester hing ein gerahmtes Poster von Gunde Svan. Mit Autogramm. Für die beste Maria der Welt, stand mit schwarzem Edding darauf geschrieben. Seine Schwester war schon seit Kindertagen wie besessen von dem Skilangläufer.
Vorsichtig strich Nicolas ihr eine verfilzte Haarsträhne aus dem Gesicht. Er zog Maria an sich. Sie ließ ihn gewähren.
»Ich … ich war hungrig und wollte nur etwas zu essen kaufen. Aber dann haben sie mich geschlagen und mir mein Geld weggenommen«, sagte sie an seinen Brustkorb gedrückt.
Nicolas mahlte mit den Kiefern.
»Wann war das?«
»Ich weiß nicht. Vor ein paar Tagen.«
»Hast du was gegessen?«
Sie schüttelte den Kopf.
Es war zwecklos, sie weiter mit Fragen zu löchern oder zu ermahnen. Wenn sie reden wollte, würde sie das von sich aus tun. Er spürte einen Stich in der Magengegend, als er daran dachte, wie es ihr in den Jahren seiner Abwesenheit ergangen sein musste. Maria war einsam und wehrlos gewesen.
Nicolas hatte der SOG angehört, der geheimsten und bestausgebildetsten Spezialeinheit der Schwedischen Streitkräfte. Und obwohl der schwedische Staat mehrere Millionen Kronen dafür ausgegeben hatte, um Nicolas in Tauchen, Fallschirmspringen und Nahkampf auszubilden, arbeitete er als Tellerwäscher im Restaurant Benicio, seit er vor neun Monaten nach Stockholm zurückgekehrt war.
Er vermisste seine Einheit, seine Kameraden. Dabei war es keineswegs von Anfang an klar gewesen war, dass er Soldat werden würde.
Sein Vater Eduardo Paredes war nach dem Militärputsch von 1973 aus seiner Heimat Chile geflohen. Die Abneigung und das Misstrauen gegen Soldaten hatten seinen Vater Zeit seines Lebens begleitet. Als Nicolas zu den Küstenjägern gegangen war und verkündet hatte, er wolle Berufssoldat werden, war sein Vater so enttäuscht gewesen, dass er nach Chile zurückgekehrt war. Das lag nun zehn Jahre zurück, und seitdem hatten Vater und Sohn kein Wort mehr miteinander gewechselt.
Über Marias Kopf hinweg warf er einen Blick in die Wohnung. Kleider, Zeitungen, Flaschen und Kartons lagen über den Linoleumboden verteilt.
»Warum ziehst du nicht zu mir?«, flüsterte er. »Da hättest du es gut, ich würde dir jeden Tag Pizza mitbringen.«
Maria löste sich aus seinen Armen.
»Weil du mal an dich denken musst. Ich weiß, du hast mich lieb, aber du wirst nächstes Jahr dreißig. Und ich bin deine große Schwester. Außerdem ist jeden Tag Pizza ungesund.«
Nicolas nahm die Tüte mit den Hamburgern, die er mitgebracht hatte, und folgte ihr ins Wohnzimmer. Er stellte das Essen ab und suchte in der Küche unter der Spüle nach einer Plastiktüte, um aufzuräumen.
Sie folgte ihm mit dem Blick, während sie aß.
»Weißt du, wann ich begriffen habe, dass ich nicht mehr deine große Schwester bin?«
»Nein.«
»Als die Jungs aus meiner Klasse mich in der Toilette eingesperrt haben und du dich auf sie gestürzt hast und zusammengeschlagen worden bist. Die waren natürlich älter als du. Und stärker.«
»Aber …«
»Gleich, das meine ich nicht. Aber als du mit blutigen Klamotten und blauen Flecken am ganzen Körper nach Hause gekommen bist und Papa wütend geworden ist und dich gefragt hat, was passiert ist. Da hast du gesagt, dass du verprügelt worden bist, aber du hast nicht gesagt, warum. Du hast irgendeine Geschichte erfunden, du hast dich auf dem Pausenhof gestritten, hast du gesagt. Weil du wusstest, dass ich mich vor Mama und Papa schäme, und das wolltest du nicht.«
»Du hast gewusst, dass das deinetwegen war?«
»Ja, klar.«
»Das habe ich nicht gewusst.«
»Nein, ich habe mich ja auch vor dir geschämt. Weil du sieben warst und mein kleiner Bruder und derjenige, der mich verteidigt hat. Und ich wusste, dass du nicht wolltest, dass ich mich vor dir schäme.«
Nicolas bückte sich und legte eine leere Coladose in die Tüte. Maria schob sich eine Pommes in den Mund.
Er ging ins Schlafzimmer und bezog ihr Bett neu.
Es hatte Zeiten gegeben in seiner Kindheit, in denen ihm Maria peinlich gewesen war. Nicht in der Grundschule, aber später. Da war er sogar extra einen Umweg gegangen, um nicht mitansehen zu müssen, wie sie durch die Schule humpelte und die anderen Schüler grölten, Grimassen schnitten, sie nachmachten, schubsten und boxten.
Wäre er da in der Nähe gewesen, hätte er eingegriffen. Dann hätte er nicht mehr an sich halten können. Aber damals, als er mit blutverschmierten zerrissenen Klamotten zu Hause aufgetaucht war, hatte er eine Standpauke bekommen. Sein Vater hatte ihn als streitsüchtig bezeichnet und damit gedroht, ihn in ein Internat für Schwererziehbare zu stecken. Als ob es nicht reicht, dass deine Mutter und ich uns um deine Schwester Sorgen machen müssen, musst du dich jetzt auch noch wie ein verdammter kleiner Terrorist aufführen




























