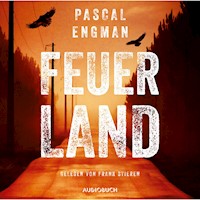Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Der Plot fühlt sich erschreckend real an... Ein unglaublich spannender Thriller.« Expressen Der Mord an einer Journalistin versetzt die schwedischen Nachrichtenredaktionen in Alarmbereitschaft. Massive Drohungen gegen Vertreter der sogenannten »Lügenpresse« sind längst an der Tagesordnung, doch nun macht ein rechtsextremer Serienkiller ernst und hinterlässt in den Zeitungsredaktionen seine blutige Spur. Bis sich ihm August Novak entgegenstellt - ein hochgefährlicher Gegenspieler, der zum Äußersten entschlossen ist. In Stockholms Zeitungsredaktionen regiert die Angst. Drohungen gehören zum Alltag, populistische Meinungsmacher verschärfen die aufgeheizte Stimmung noch. Als eine junge Journalistin, die strikt für Meinungsfreiheit eingetreten ist, kaltblütig ermordet wird, werden die schlimmsten Befürchtungen plötzlich real. Nur Madeleine Winther, eine junge aufstrebende Nachrichtenredakteurin, bleibt davon merkwürdig unberührt und plant stattdessen ihre nächsten Schritte auf der Karriereleiter. Doch auch sie muss sich der Realität stellen, denn es bleibt nicht bei diesem einen Opfer. Der Täter, Carl Cederhielm, will Rache nehmen an allen, die dazu beitragen, dass seine Heimat Tag für Tag von Flüchtlingen überschwemmt wird. Sein Ziel sind die Medien, und gemeinsam mit zwei Gleichgesinnten eröffnet er die Jagd auf Journalisten. Es scheint, dass niemand die schwedischen Terroristen aufhalten kann. Doch dann taucht ein neuer Akteur auf der Bildfläche auf, der zum Äußersten entschlossen ist.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Aus dem Schwedischen von Nike Karen Müller
TROPEN
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Patrioterna«
bei Piratförlaget, Stockholm
© 2017 by Pascal Engman
Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden
Für die deutsche Ausgabe
© 2019, 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
Unter Verwendung einer Abbildung von FinePic®, München
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50478-1
E-Book: ISBN 978-3-608-11527-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
EPILOG
DANK
Autoreninfo
Für dich, Opa. Ich vermisse dich sehr.//Deine Knalltüte
Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen, und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land.
Hermann Göring, Interview mit Gustave M. Gilbert in der Gefängniszelle, 18. April 1946
PROLOG
Hannah Löwenström saß am Schreibtisch in ihrer Wohnung in Hägerstensåsen im Stockholmer Süden und las die Reaktionen auf den Artikel, den sie für das Sveriges Allehanda, die größte Morgenzeitung des Landes, geschrieben hatte.
Er sorgte für großes Aufsehen. Twitter brodelte. Ihr Posteingang quoll über vor zornigen Mails. Auf Facebook war der Ton noch schroffer. Die Leute machten sich über ihr Aussehen lustig, schrieben, sie sei eine fette Kuh, und wollten wissen, warum sie so gern Araberschwänze lutsche.
»Hure!!! Hoffentlich wirst du von den ganzen Sandnegern vergewaltigt«, schrieb ein Olof Jansson.
Sie besuchte sein Profil und sah sich seine Fotos an. Olof Jansson hatte Frau und zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter. Er wohnte in Bengtsfors, mochte Oldtimer und arbeitete in einem Lager.
Sie blätterte die Fotos von einem Urlaub auf Gran Canaria durch, von einem Grillfest, von Olof vor einem Auto. Unter die Bilder hatten Verwandte und Freunde witzige Kommentare geschrieben.
Olof Jansson war ein ganz gewöhnlicher Mann mit einem ganz gewöhnlichen Leben.
Hannah konnte es nicht begreifen: Woher kam dieser ganze Hass?
Die Drohungen – sie solle Schwänze lutschen, bis sie nicht mehr sprechen konnte, sie solle gewürgt, vergewaltigt und in jedes ihrer Löcher gebumst werden und danach solle man ihr mit einem Messer die Fotze aufschlitzen – nahmen kein Ende. Die Einfallsreichsten manipulierten Bilder von toten nackten Frauen und fügten ihren Kopf auf die Leichen. Andere fotografierten ihr Geschlechtsteil vor dem Bild in ihrer Verfasserzeile oder vor anderen Bildern von ihr, die sie im Netz fanden.
Eigentlich hatte sie aufgehört, sich darum zu scheren. Sie war nicht besonders ängstlich, außerdem waren diese Drohungen seit Jahren Teil ihres Alltags, Teil ihrer Arbeit als Kulturjournalistin. Und Hannah wusste, dass das für alle Frauen galt, die für Zeitungen und fürs Fernsehen arbeiteten.
Der aktuelle Artikel hatte ihr zweiundzwanzig regelrechte Todesdrohungen eingebracht. Sie verschob sie mechanisch in den Ordner mit der Bezeichnung Polizeilich erfassen. Viel mehr gab es da nicht zu tun.
Sie ging in die Küche, schenkte sich ein Glas Rotwein ein und nippte daran.
Hannah Löwenström vermisste ihren Sohn Albin, der diese Woche bei seinem Vater verbrachte. Am Montag würde sie ihn von der Vorschule abholen. In vier Tagen. Bis dahin würde sie zusehen, dass sie Ordnung in ihre Wohnung brachte, Umzugskartons auspackte und das Zimmer strich, das Albins werden sollte. Seit dem Umzug hatte er in ihrem Bett geschlafen.
Im Wohnzimmer begann ihr iPhone zu piepen – um kundzutun, dass die Wäsche fertig war.
Hannah seufzte, stellte das Weinglas auf dem Schreibtisch ab und sah sich nach dem Überfallalarm um, den sie stets bei sich trug, wenn sie die Wohnung verließ.
Andererseits hatte sie keine Kraft mehr, Angst zu haben, sie wollte sich von den Drohungen nicht kleinmachen lassen.
Und genau genommen gehe ich ja gar nicht nach draußen, sondern bleibe im Gebäude, dachte sie. Dennoch spähte sie wie immer vorsichtig durch den Spion, ehe sie ins Treppenhaus trat. Es war leer.
Sie öffnete die Tür und ging die Treppen hinunter, schloss die Metalltür auf, die in den Keller hinabführte, und betätigte den Lichtschalter.
Der Wäschetrockner lief noch. In einer Minute war das Programm beendet. Als Hannah sich auf einen wackligen Plastikstuhl setzte, um zu warten, glaubte sie zu hören, wie jemand die Türklinke runterdrückte. Sie hielt den Atem an und versuchte, das unverdrossene Brummen des Trockners zu überhören. Nichts. Vermutlich hatte sie sich das nur eingebildet.
Der Trockner verstummte. Die Luke klickte und sprang auf. Hannah sammelte die Wäsche zusammen und stopfte sie in die blaue Ikea-Tasche, reinigte den Filter und schaltete das Licht aus.
Sie atmete tief ein, als sie behutsam die Tür aufmachte und durch den Spalt lugte. Das Treppenhaus war leer. Sie schüttelte über sich selbst den Kopf und ging die zwei Stockwerke in ihre Wohnung hinauf.
Als sie die Wohnungstür aufschloss, hörte sie, wie jemand hinter ihr die Treppe hinaufkam. Sie drehte sich um und sah einen großen Mann mit braunen Haaren, dunklem Mantel, Jeans und schwarzen Handschuhen. Er grüßte lächelnd. Hannah grüßte zurück und machte die Tür auf. Als sie sie wieder schließen wollte, hielt der Mann die Tür fest. Hannah konnte nicht dagegenhalten. Sie floh in ihre Wohnung. Suchte panisch nach dem Überfallalarm. Rief um Hilfe.
Der Mann schloss die Tür. Plötzlich stand er vor ihr im Wohnzimmer. Er packte sie, legte ihr die Hand auf den Mund und schubste sie vor sich her Richtung Wand, die Linke an ihrer Gurgel. Mit der Rechten griff er in seine Manteltasche – das Messer bekam sie nicht mehr zu sehen.
Es drang in ihren Magen, durch die Muskulatur, in die Leber.
Er drehte es und stieß noch einmal zu. Dann trieb er es durch den Leib nach oben.
Sie versuchte zu schreien, brachte keinen Laut heraus, nur ein Röcheln.
Als das Messer auf ihr Brustbein traf, zog er es mit einem Ruck wieder heraus.
Hannah sackte zusammen, kippte auf die Seite, schlug sich im Fallen den Hinterkopf und blieb liegen. Sie presste die Hände auf den Bauch, befühlte mit den Fingern die Wunde.
Wenige Minuten später war Hannah Löwenström tot.
KAPITEL 1
»Stört dich das überhaupt nicht, wie die dich anschauen?«, fragte Valeria Guevara und sah ihn an. August Novak drehte sich verwundert nach einer Traube Schulkinder um, die an ihnen vorbeiging. Sie trugen die Uniformen des Colegio Ambrosio O’Higgins, der einzigen Privatschule in Vallenar.
Einige von ihnen drehten sich gleichzeitig um und musterten Valeria und August.
»Es sind ja nicht nur die Kinder«, fuhr Valeria fort. »Es ist die ganze Stadt. Alle starren dich an. Ich bin es gewohnt, dass die Männer mir ihre Blicke zuwerfen oder mir hinterherpfeifen. Aber wenn du neben mir gehst, bin ich praktisch Luft.«
August lächelte und drückte ihre Hand.
»Es gibt ja nicht so viele Europäer hier im Norden von Chile. Gerade mal fünf in ganz Vallenar. Ich bin exotisch. Findest du nicht, dass ich exotisch bin?«, fragte er.
Valeria blieb stehen, stellte sich auf die Zehen und gab ihm einen Kuss.
»Doch, du bist sehr exotisch, mi amor. Besonders, wenn du darauf bestehst, in der Sonne zu gehen. Schau uns an, wir sind fast die Einzigen auf dieser Seite der Straße.«
»Wir Schweden nutzen die Sonne eben bei jeder Gelegenheit.«
Die Ladenbesitzer waren dabei, ihre Läden zu schließen, es war Zeit für die Siesta. Auf der Avenida Prat, Vallenars Hauptstraße, wimmelte es vor Menschen, die auf dem Weg nach Hause waren, um zu Mittag zu essen und sich anschließend auszuruhen, ehe sie sich wieder ihren Tätigkeiten widmeten.
Die meisten Einwohner der Stadt gingen auf der anderen Straßenseite, um sich vor der grellen Sonne zu schützen. Die Temperatur betrug etwa dreißig Grad, es war ungewöhnlich warm für November. Schon jetzt hieß es, dass der kommende Sommer sämtliche Hitzerekorde übertreffen würde.
Sie bogen rechts in die Seitenstraße Avenida Faez, wo das Sportgeschäft lag, Deportes Orlando. Der Inhaber, Don Orlando, saß schon im Auto und wollte gerade den Motor anlassen, um nach Hause zu fahren und sein Geschäft später gegen fünf Uhr wieder aufzumachen. Als er Valeria und August kommen sah, stieg er aus und kam auf sie zu.
»Schön, dich zu sehen, Don Augusto. Und dich auch, Señorita. Wollt ihr zu mir?«
August schüttelte seine Hand.
»Ja, aber wenn du nach Hause willst, ist das in Ordnung. Wir können auch nach der Siesta wiederkommen.«
»Aber nein, ihr braucht doch nicht zu warten«, sagte er und suchte in seiner Hosentasche nach dem Schlüssel, um das Gitter aufzusperren. Zwei Straßenköter, die dort einen Schattenplatz gefunden hatten, trotteten davon. »Was braucht ihr denn?«
»Eine Yogamatte. Meine hat der Hund zerfetzt«, sagte Valeria.
»Schon wieder?« Don Orlando lachte.
»Diese gringos … August lässt die Hunde einfach immer ins Haus«, erklärte Valeria und machte eine ausholende Geste.
Sie betrat den Laden als Erste.
August blieb vor einer Vitrine stehen und sah sich die Angelutensilien an. Don Orlando gesellte sich zu ihm.
»Die ist neu«, sagte er und nickte in Richtung einer Harpune. »Ich habe sie letzte Woche reinbekommen, neun Meter Reichweite. Deine geht bis sechs Meter, wenn ich mich nicht täusche, stimmt’s?«
»Im Ernst? Neun Meter?«, fragte August skeptisch.
»Neun Meter, Don Augusto. Und sie hat einen Aalstecher mit fünf Zahnblättern. Aber der, den du zu Hause hast, passt natürlich auch. Und wenn nicht, dann feile ich ihn dir zurecht.«
August nickte.
»Ich nehme sie.«
Valeria stellte sich hinter die Männer. Sie hatte sich eine hellblaue Yogamatte unter den Arm geklemmt und schüttelte den Kopf, als Don Orlando die Vitrine aufschloss und die Harpune herausnahm.
»Frischer Fisch«, sagte August und nahm sie entgegen.
Sie fuhren an den farbigen Zelten der Roma am Stadtrand vorbei, ließen die Polizeidienststelle an der Autobahn hinter sich und fuhren weiter Richtung Küste. Zu ihrer Rechten fiel die Landschaft steil in ein grünes Tal ab, und hinter ihnen ragten die Berge empor.
»Ich muss wieder in der Stadt sein, wenn die Siesta vorbei ist«, sagte August.
»Kommt er heute zurück?«, fragte Valeria und seufzte.
»Ja, er landet heute Abend.«
»Wir hatten eine gute Woche, während er weg war«, meinte Valeria. »Ich wünschte, es wäre immer so.«
»Bald ist es ja so weit. In fünf Jahren«, erwiderte August.
»In fünf Jahren. Dann bin ich dreißig und du sechsunddreißig. Können wir nicht doch schon früher nach Europa gehen?«
»Du weißt doch, dass das unmöglich ist.«
In Maitencillo, dem kleinen Ort, der zwei Kilometer von ihrem Haus entfernt lag, drosselte er das Tempo. Danach bogen sie auf einen Schotterweg, der ins Tal hinabführte und von Avocadoplantagen gesäumt wurde. Sie überquerten die Bahnschienen und fuhren durch das Tor.
Señora Maria, ihre Haushälterin, war im Hof, um sie zu begrüßen. Aus den Olivenhainen kamen die Rottweiler Salvador und Aragon angerannt.
Sie aßen vor der weißen Villa auf der Terrasse mit Blick auf das Tal und die Berge zu Mittag. Einige Wildpferde hatten unten am Fluss einen Weg durch den Zaun gefunden und grasten zwischen den Olivenbäumen. Don Julio, der Gärtner, hatte gerade den Pool gereinigt und kam nun auf sie zugeschlendert.
Er war fünfundsiebzig Jahre alt und bewohnte allein ein kleines Haus in der Nähe. Heute wirkte er ausnahmsweise einigermaßen nüchtern. Als er ihnen gegenüberstand, nahm er den Hut ab, trocknete sich den Schweiß auf der Stirn und setzte sich neben Valeria.
Sie erhob sich, um ein Glas für ihn zu holen.
»Ich habe eben mit Manuel, meinem Neffen, gesprochen«, sagte Don Julio. »Es sieht ganz danach aus, dass es diese Woche noch Ärger geben wird.«
»Wegen der Fabrik?«
Don Julio nickte.
»Das Problem ist, dass wir mittendrin hocken«, sagte er. »Die Straßensperren werden sie wahrscheinlich in Maitencillo aufstellen. Und sie werden keinen durchlassen.«
»Nicht mal uns Anwohner?«, wollte August wissen.
»Sie haben lauter Abschaum aus Südchile hergeholt. Kommunisten und Krawallmacher aus Valdivia. Die von hier kennen Sie, aber die anderen sind Extremisten. Ihr Anführer ist Alfonso Paredes, haben Sie von ihm gehört?«
Valeria kam mit einem Glas zurück, woraufhin August nach der Limonade griff und Don Julio einschenkte.
»Ich gehe an den Pool«, sagte sie dann.
August nickte und wandte sich an Don Julio.
»Ich weiß, wer das ist. Ich habe über die Besetzung des Hotels in Pucón gelesen.«
»Er ist ein hijo de puta, der so tut, als stünde er auf der Seite der Armen, in Wirklichkeit will er aber nur Streit anzetteln. Und die jungen Leute, auch mein Neffe Manuel, glauben den Mist, den er erzählt, und das ist das Problem.«
»Vladimir kommt diese Woche wieder zurück, das heißt, ich bin dann recht viel unterwegs. Denkst du, du kannst hierbleiben, damit Valeria nicht allein ist?«
»Ja, klar, machen Sie sich keine Sorgen. Die Señorita ist bei mir in Sicherheit.«
»Danke. Du kannst das Gästezimmer nehmen, wie immer. Was macht denn dein Bein? Was hat der Arzt gesagt?«
»Ich soll mich schonen.«
»Dann mach das doch auch.«
»Vierzehn Hektar Land bewirtschaften sich nicht von selbst«, stellte Don Julio fest und deutete mit dem Kinn Richtung Tal.
»Du kannst doch mehr Personal einstellen, jedenfalls, bis es deinem Bein wieder besser geht. Das ist gar kein Problem, das weißt du doch.«
»Wie Sie wollen, Señor.«
Don Julio erhob sich und ging ins Haus.
August schüttelte lachend den Kopf. Der alte Mann war Alkoholiker, und an manchen Tagen tauchte er überhaupt nicht auf. Die meisten waren der Meinung, August sollte ihn entlassen, aber er ließ auf Don Julio nichts kommen.
Er blieb sitzen und ließ den Blick über die Olivenhaine schweifen.
Noch fünf Jahre, grübelte August. Das ist noch einmal die Hälfte der Zeit, die ich schon fort bin. Aber danach habe ich genügend Geld, um mit Valeria in Schweden ein neues Leben anzufangen.
Als Señora Maria den Tisch abdeckte, ging er ins Haus und nahm die Treppe nach oben ins Schlafzimmer.
Oben auf dem Kleiderschrank lag seine Képi blanc von der Fremdenlegion. Das weiße Käppi erhielt man nach vier Monaten als Rekrut, nachdem man einen Test bestanden hatte in Form einer dreitägigen Wanderung durch die Pyrenäen. Es war fast zehn Jahre her, dass er sie bekommen hatte.
Das Käppi war das Einzige, was August von fünf Jahren Fremdenlegion geblieben war. Er machte den Schrank auf und nahm seinen Revolver heraus, einen schwarzen Smith & Wesson Combat, kontrollierte gewohnheitsmäßig, ob er geladen war, und streifte sein Schulterholster und ein dunkelblaues Sakko über. Er begutachtete sein Spiegelbild.
Die letzten Monate hatte er seine braunen Haare wachsen lassen. Bald waren sie wieder genauso lang wie damals, als er Schweden verlassen hatte.
Er dachte an Valerias Bemerkung, dass die Leute ihn anstarrten, wenn sie ihm auf der Straße begegneten. Das taten sie allerdings nicht nur, weil er Ausländer war, helle Augen hatte und ein Meter neunundachtzig groß war. Sondern eigentlich, weil die meisten Angst vor ihm hatten. Denn sie wussten, dass er für Vladimir Ivanov als Leibwächter arbeitete.
Alle in der kleinen Stadt dachten zudem, August sei ein gringo, ein Amerikaner.
Das sagte er, wenn er gefragt wurde, und das stand auch in dem gefälschten Pass, den er seit einigen Jahren verwendete. Dem Pass zufolge war er in Iowa geboren und hieß Michael Johnson.
Valeria lag in einem Liegestuhl und hörte über Kopfhörer Musik.
»Ich fahre jetzt«, sagte August.
Sie nahm die Kopfhörer ab.
»Das sieht aber sehr warm aus«, bemerkte sie.
August legte vielsagend eine Hand auf das Sakko, das den Revolver verbarg.
»Ach, stimmt ja. Und wann kommst du zurück?«
»Nicht so spät. Don Julio bleibt hier, bis ich wieder da bin.«
»Kann ich nicht mit dir mitfahren, Liebling? Ich kann in der Stadt auf dich warten, die Geschäfte haben bis zehn auf.«
»Ja, gut. Dann musst du dich aber beeilen, ich bin schon spät dran.«
Als sie durch den Ort fuhren, waren mehr Leute auf den Beinen als sonst. Ein Dutzend Männer war dabei, trockene Bäume zu fällen und auf die Straße zu bugsieren. August ging vom Gas, um zu sehen, was los war.
»Glaubst du, sie fangen schon heute Abend mit den Protesten an?«, fragte Valeria.
»Vielleicht. Es ist bestimmt besser, dass du mitgekommen bist«, sagte er und beschleunigte wieder.
»Warum wollen sie hier eigentlich keine Fabrik haben? In dieser Region gibt es die Jobs ja nicht gerade wie Sand am Meer.«
»Das Unternehmen hat Peruaner eingestellt, weil sie für die Hälfte des Lohns arbeiten. Es geht um einhundertfünfzig Arbeitsplätze.«
»Dann verstehe ich ihre Wut«, meinte Valeria.
»Ich auch«, sagte August.
Die Fahrt nach Vallenar dauerte rund zwanzig Minuten, auf den Straßen war es ruhig. Die meisten Autos, die ihnen begegneten, waren rote Pick-ups, die den ausländischen Bergwerksbetreibern gehörten. August setzte Valeria am Marktplatz ab und bog in die Avenida Prat. An einem Tisch im El Minero wartete Ilja Fjodorowitsch. Der Club sah wie eine ganz gewöhnliche Bar aus, aber alle in Vallenar wussten, dass er ein Bordell war, das Augusts Chef gehörte.
Ilja trug ein türkisfarbenes Hawaiihemd und weiße Shorts. Seine Füße steckten in Adidas-Sneakers. Seit ihrem letzten Treffen vor einer Woche trug er die dunkelblonden Haare kürzer, und er hatte auf die Rasur verzichtet.
Sie begrüßten sich, und August ließ sich am Tisch nieder.
Die Bedienung brachte ihm ein Bier.
»Die Ferien sind jetzt erst mal vorbei«, sagte Ilja und hob sein Cristal in Augusts Richtung, der zurückprostete.
»Wann landet Vladimir?«, fragte August.
»Heute Abend um acht. Er will sich morgen früh mit uns treffen.«
»Klingt gut«, sagte August tonlos und nahm die Sonnenbrille ab. »Was weißt du über den Käufer, den wir treffen sollen?«
»Er nennt sich Charlie. Er bekommt Ware aus unseren syrischen Waffenlagern. Nichts Außergewöhnliches, fünf Kalaschnikows und ein paar Makarovs. Wir geben ihm nur Zeit und Ort durch.«
»Wohin geht die Lieferung?«
»Tallinn. Am Hafen. Das gleiche Prozedere wie immer.«
»Wo kommt der denn her, dieser Charlie?«
Ilja schüttelte den Kopf.
»Keine Ahnung.«
»Organisation?«
Der Russe machte eine unwissende Geste.
»Du weißt doch, dass Vladimir nur das Allernötigste erzählt. Wenn du mehr wissen willst, frag den Typen nach einem Date.«
Zehn Minuten später gesellte sich der Mann, der sich Charlie nannte, zu ihnen. Er war in den Vierzigern, groß, trug Jeans und ein grünes T-Shirt. Die hellen Haare waren raspelkurz. Sein Gesicht war pockennarbig und rot von der Sonne. August überfiel so eine Ahnung, dass er Schwede war, und das machte ihn aus irgendeinem Grund nervös. Er hatte seit Jahren kein Schwedisch mehr gesprochen und würde es auch jetzt nicht tun. Der Typ durfte, wenn er denn Schwede war, auf keinen Fall Verdacht schöpfen, dass der Mann, der ihm gegenübersaß, Schwede sein könnte.
Sie gaben sich die Hand, und Ilja begann, die praktische Abwicklung des Geschäfts zu erläutern. August musterte Charlie schweigend. Als er ihn Englisch reden hörte, waren alle Zweifel beseitigt – der Mann war Schwede. Aber wozu brauchte ein Schwede solche Waffen?
Es war ungewöhnlich, dass Vladimir Ivanov mit Europäern Geschäfte machte. Die Europapipeline des Russen, die vom Mittleren Osten über die Türkei verlief, kam immer seltener zur Anwendung. Der Waffenschmuggel wurde mittlerweile hauptsächlich über Frachter für den lateinamerikanischen Markt abgewickelt, wo russische Waffen von den Straßengangs in dem ständigen Kampf darum, Kokain unters Volk zu bringen, sehr gefragt waren. Könnte Charlie in einem Motorradclub sein? Nein, die schwedischen Motorradclubs hatten ihre eigenen Händler. Und ein schwedischer Polizeibeamter, der in einen Einsatz gegen russische Gangster in Südamerika involviert war – das war vollkommen ausgeschlossen. Vermutlich sogar illegal. Je länger August darüber nachdachte, desto verwirrter wurde er.
Ilja schob einen Zettel über den Tisch.
»Datum und Autokennzeichen. Das Personal im Hafen von Tallinn regelt alles. Sie können also jede beliebige Fähre nehmen, in Stockholm, Helsinki oder Riga, egal, Ihnen stellt keiner Fragen.«
Charlie nickte, faltete den Zettel und schob ihn in seine Jeanstasche.
»Tja, dann«, sagte er und lehnte sich zurück.
»Wo sind Sie denn abgestiegen in der Stadt?«, erkundigte sich Ilja.
»Im Hotel Atacama, gleich um die Ecke«, antwortete Charlie. »Komische Unterkunft übrigens. Die sind offenbar keine Ausländer gewohnt. Die starren mich an, als wären sie im Zoo.«
Ilja lachte auf.
»Dabei war der Gründer der Stadt sogar ein Europäer, Ambrosio O’Higgins, ein Ire. Er hat sie nach seiner Heimatstadt in Irland benannt, Ballynary.«
»Daraus ist dann über die Jahre Vallenar geworden«, warf August ein.
Es war das erste Mal während des Treffens, dass August den Mund aufmachte.
»Faszinierend. Sind Sie Amerikaner?«
»Yes, Sir. Und Sie?«, fragte August und versuchte, so beiläufig wie möglich zu klingen.
»Das tut nichts zur Sache«, antwortete Charlie.
Stattdessen stand er auf und verabschiedete sich mit Handschlag. Dann verließ er die Bar. Ilja und August blickten ihm schweigend hinterher.
»Das stinkt doch nach Bulle, riechst du das nicht?«, fragte August.
Ilja riss die Augen auf und schnaubte.
»Du spinnst. Einen Bullen riech ich auf zwei Kilometer Entfernung. Und Vladimir kann sogar den Cousin eines Bullen kilometerweit gegen den Wind riechen. Entspann dich. Komm, wir bestellen ein paar Drinks. Was macht deine bezaubernde puerto-ricanische Freundin, ist sie mit dir in die Stadt gefahren?«
»Ja.«
»Ruf sie an, dann trinken wir was zusammen.«
»Hier? Sie ist ohnehin schon nicht begeistert, dass wir uns in Vladimirs Hurentempel treffen. Ich weiß nicht, was sie sagen würde, wenn ich sie auch noch hierher einlade.«
Ilja lachte.
»Du hast recht. Sag ihr, wir treffen uns im El Club Social. Und wenn sie in Begleitung einer Freundin ist, soll sie die einfach mitbringen.«
»Abgemacht«, sagte August. »Aber für deine Gesellschaft musst du schon selbst sorgen.«
Es war kurz nach elf geworden, als August und Valeria sich ins Auto setzten, um nach Hause zurückzufahren. Bereits drei Kilometer vor Maitencillo bemerkten sie den Rauchgeruch. Als sie näher kamen, sahen sie, dass es in dem kleinen Ort auf der Straße brannte. Eine Gruppe Männer stand ein Stück von dem brennenden Unrat entfernt und hielt Wache.
Sie hatten Baumstämme als Sperren über beide Fahrspuren gelegt. Es war unmöglich, vorbeizufahren, ohne sie vorher zur Seite zu räumen. August ging vom Gas, griff nach seinem Revolver und legte ihn unauffällig neben Valerias Schenkel auf den Sitz.
Wortlos warf sie einen Blick darauf.
Ein Mann, der August fremd war, trat auf die Fahrbahn und bedeutete ihm, anzuhalten. Er bremste ab und stieg aus.
Seine Augen begannen vom Qualm sofort zu tränen. Es gab nach seiner Zeit als Soldat in Afghanistan und dem Irak nur wenige Dinge, die August so sehr mit dem Tod verband, wie Rauch. Die Luft stach in seiner Lunge. Als er auf den Mann zuging, kam auch in die anderen Männer Bewegung und sie traten näher. Einige von ihnen erkannte August, es waren Einwohner von Maitencillo.
Auch Don Julios Neffe, Manuel Contreras, war darunter.
»Was willst du, gringo?«, fragte einer der Fremden.
August grinste den Mann an, den er auf Anhieb von den Fotos in der Zeitung wiedererkannte. Alfonso Paredes aus Valdivia. Hinter dessen Rücken registrierte August, wie die Einwohner beunruhigt zu ihm herüberschielten.
Manuel steckte sich eine Zigarette an und stellte sich neben die Männer.
»Ich wohne hier unten, amigo. Ich und mein Mädchen waren in Vallenar auf ein paar Drinks. Und jetzt wollen wir wieder nach Hause.«
Alfonso Paredes hatte einen dunklen Bart und war fast genauso groß wie August, was ungewöhnlich war für einen Chilenen. Zwei weitere Männer stellten sich hinter ihn, ihre feindseligen Blicke auf August gerichtet.
»Ist das ein Lexus?«, fragte Alfonso und nickte Richtung Wagen.
»Hör zu, ich will keinen Stress. Ich will nach Hause und schlafen. Mein Mädchen ist müde, und ich bin es auch.«
»Und wieso sollte ich dich durchlassen, gringo? Die anderen müssen auch warten. Heute Abend kommt hier keiner durch. Wenn du glaubst, du bist was Besseres, weil du blaue Augen und ein schönes Auto hast, dann irrst du dich.«
August beschloss, die Kommentare, dass er Ausländer war, zu ignorieren.
»Ich finde es genauso schlimm, dass die Arbeitsplätze nicht an die Männer aus der Gegend vergeben wurden. Ich bin auf eurer Seite. Aber ich will auch nach Hause. Bitte sag deinen Männern, sie sollen die Sperren zur Seite räumen und mich durchlassen.«
»Für wen hältst du dich?«
August seufzte. Er wurde langsam ungeduldig.
»Die Männer hinter dir wissen, wer ich bin. Ich schlage vor, du fragst sie.«
Manuel tippte Alfonso Paredes auf die Schulter und räusperte sich zögerlich.
»Alfonso«, sagte er. »Das ist Augusto. Er wohnt wirklich hier unten, da können wir ihn doch vielleicht durchlassen? Er ist okay. Mein Onkel arbeitet mit ihm.«
»Hör auf, die Ausländer an den Eiern zu lecken«, knurrte Alfonso über die Schulter und wandte sich wieder an August. »Du kommst hier nicht durch, gringo. Dreh um und fahr nach Vallenar zurück oder sonst wohin, das ist mir scheißegal.«
August warf einen raschen Blick auf sein Auto. Valeria hatte die Scheibe heruntergelassen, um zu hören, worum es ging. Sie war ganz offensichtlich besorgt.
»Hör zu, ich weiß, dass du keinen Schimmer hast, wer hier vor dir steht. Du hast eine Riesenwut auf die Fabrik und musst deinen Leuten zeigen, dass du Mumm hast. Ich versteh schon, wie das läuft. Deswegen gebe ich dir noch eine Chance, mich durchzulassen.«
»Ist das so?«, lachte Alfonso Paredes. »Und was, wenn nicht, du widerwärtiger gringo?«
Er ließ die Hand vorschnellen und versetzte August eine Ohrfeige.
»Da musst du schon härter zuschlagen, wenn du bei deinen Revoluzzern Eindruck schinden willst«, sagte August genervt.
Paredes hatte ihn mit der linken Hand geohrfeigt, er war also höchstwahrscheinlich Linkshänder. Der erste Schlag würde folglich Augusts rechte Seite treffen.
Alfonso Paredes ballte die Faust und setzte seinen linken Fuß unauffällig zurück, um mit Schwung auszuholen.
Statt zurückzuweichen, wie Kampfsportler das tun, um anschließend kontern zu können, machte August einen langen Schritt auf Alfonso zu, als der Schlag kam, und hob die Ellenbogen als Schutzschild vor sein Gesicht. Der Schlag traf die Luft hinter ihm, gleichzeitig rannte August, die Ellenbogen voraus, mit voller Wucht in Paredes’ Gesicht und Brust.
Alfonso Paredes stolperte rückwärts.
August ging hinterher, befingerte Paredes’ Gesicht, bis er mit seinen Daumen die Augen fand, und drückte zu. Parades schrie auf vor Schmerz. August packte ihn am Nacken, drückte seinen Kopf nach unten und führte mit dem Knie die Gegenbewegung aus. Alfonso Paredes sackte zusammen und verlor das Bewusstsein, noch ehe er am Boden aufschlug.
Einer der anderen Männer kam angerannt, nahm August in den Schwitzkasten und hielt ihn auf Hüfthöhe umklammert.
August hieb ihm in den Schritt, und der Kerl ließ los.
Irgendwo hinter sich hörte August Valeria schreien.
Er schlug seinem Gegner ein zweites Mal in den Schritt, führte sein linkes Bein nach hinten, sodass er sich nun schräg hinter dem Mann befand, legte ihm den linken Arm um den Hals und drückte unterhalb des Adamsapfels zu. Der Mann ließ sofort von ihm ab, griff sich an die Kehle und schnappte nach Luft.
Dann wankte er benebelt wieder auf August zu.
August deutete mit der Rechten einen Schlag an und trat stattdessen gegen das Knie des Mannes, spürte durch die Schuhspitze, wie Knorpel und Menisken knacksten, noch bevor das Bein einknickte und der Mann stürzte.
Die anderen Männer wichen zurück.
Außer Atem wandte August sich an Manuel Contreras.
»Manuel, kannst du dafür sorgen, dass das hier wegkommt und ich durchfahren kann?«
Manuel Contreras nickte, und zwei der Einwohner beeilten sich, mit ihm die Sperren zur Seite zu räumen. August lehnte sich ans Auto und klopfte sich Staub und Erde aus den Kleidern, während die Männer die Baumstämme aus dem Weg schoben. August hatte die Fahrertür geöffnet und wollte sich gerade hinter das Steuer setzen, als Alfonso Paredes aufstand und auf ihn zukam.
»Wenn wir uns wiedersehen«, rief er röchelnd, »wirst du dabei zusehen, wie ich deine Hure von Freundin in deinem eigenen Bett vergewaltige, gringo.«
August knallte die Fahrertür zu, öffnete die hintere, holte die Harpune heraus und montierte den Aalstecher. Mit der Harpune in der Hand ging er Alfonso Paredes entgegen, der beim Anblick der Waffe zurückwich.
Mit wenigen schnellen Tritten brachte August ihn zu Fall.
Die anderen Männer waren wie gelähmt. Keiner griff ein, als August Alfonso Paredes das Knie in den Rücken stemmte und seinen linken Arm auf den Boden drückte.
»Du hättest mich einfach nur durchlassen müssen, du sturer Bock«, raunte er.
Er setzte die Zahnblätter des Aalstechers auf Paredes’ behaarte Hand und drückte ab. Alfonso Paredes brüllte vor Schmerz.
Der Aalstecher hatte sich durch die Hand in den Schotter gebohrt, sie würden ihn vermutlich absägen müssen, um Paredes freizubekommen.
August machte kehrt und ging.
KAPITEL 2
Ibrahim Chamsai würde rund einen Monat später eine Bombe in seinem Taxi-Stockholm-Wagen deponieren, zweiunddreißig Schweden in die Luft sprengen und damit den bislang blutigsten Terroranschlag verüben. Doch davon hatte er keine Ahnung, als er vor dem McDonald’s im Sveavägen auf Fahrgäste wartete.
Untätige Einwandererjungs lungerten vor dem Eingang herum. Aus der Bar La Habana auf der anderen Straßenseite scholl Salsamusik. Ein paar Kubaner rauchten Zigaretten und unterhielten sich. Unweit von Ibrahims VW Passat strichen Bettler herum und durchwühlten die Mülleimer. Es war Freitagabend, aber das Geschäft lief zäh. In fünf Stunden hatte Ibrahim nur zwei Fahrgäste gehabt. Zuerst eine ältere Dame, die zum Flughafen Arlanda wollte, um nach Genf zu fliegen und dort ihre Tochter zu besuchen. Anschließend fuhr er eine Familie mit Kindern, die in Palma gewesen war, vom Flughafen zu ihrer Wohnung auf Södermalm.
Nette Menschen, allesamt. Das waren die meisten.
Ibrahim Chamsai las die Aftonposten und trank Kaffee. Fikapause, wie die Schweden das nannten. Ein schöner Brauch. Er legte die Zeitung auf den Beifahrersitz, als sein Mobiltelefon klingelte. Seine Frau Fatima rief an.
»Hej, mein Herz«, sagte er auf Arabisch.
»Ich rufe nur an, um dir Gute Nacht zu sagen. Was machst du gerade?«
Ibrahim warf einen Blick auf die Uhr im Armaturenbrett.
»Bis jetzt ist alles ruhig. Ich trinke Kaffee.«
»Welchen Kaffee? Ich habe gesehen, dass du die Thermoskanne zu Hause vergessen hast.«
Ibrahim lachte.
»Ja, ich war spät dran und habe mir dann bei McDonald’s einen gekauft. Schmeckt längst nicht so gut wie deiner.«
»Das dachte ich mir schon. Pass auf dich auf heute Nacht.«
»Das werde ich. Bis morgen.«
Er hatte noch neun Stunden seiner Schicht vor sich, er hatte keine Eile. Also konzentrierte er sich wieder auf den Zeitungsartikel. Die Sozialdemokraten waren übel dran, schrieb Anders Gustafsson von der Aftonposten. Mittlerweile waren die Schwedendemokraten die zweitgrößte Partei im Land. Nach der letzten Wahl hatten sie ihre Prozente fast verdoppelt. Nur noch einige wenige Prozentpunkte trennten sie von den Sozialdemokraten. Ibrahim tat Staatsminister Stefan Löfven leid. Der Bursche sieht immer so bedrückt aus, dachte Ibrahim, während er ein Foto von ihm betrachtete.
Schweden war ein großartiges Land, in dem ein Schweißer Staatsminister werden konnte. Ibrahim hatte immer die Sozialdemokraten gewählt. Schließlich waren Olof Palme und die Sozialdemokraten es gewesen, die ihn und seine Frau Fatima 1985 in Schweden willkommen geheißen hatten. Und ziemlich genau dreißig Jahre später tat Schweden das Gleiche für die Syrer, die vor dem Bürgerkrieg flohen. Aber weil seine Tochter Mitra sich seit ein paar Jahren in der Zentrumspartei engagierte, hatte Ibrahim bei der letzten Wahl dieser Partei seine Stimme gegeben.
Im Stillen hatte er dennoch gehofft, dass die Sozialdemokraten die Macht zurückeroberten. Aber eigentlich spielte es keine große Rolle, wer das Sagen hatte. Auf die Schweden war Verlass. Die Politiker arbeiteten für das Volk. Sie waren keine Diebe und Mörder, wie es in den meisten anderen Ländern auf der Welt der Fall war.
Viele Schweden wollten jedoch, dass die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge sank. Über die Hälfte der Befragten, laut der jüngsten Novus-Umfrage. Und Ibrahim konnte sie verstehen, er war selbst unschlüssig in Bezug auf diese Frage. Ja, die Syrer waren seine Landsleute, und er litt mit ihnen. Sie flohen sowohl vor dem IS als auch vor dem Schlächter Baschar al-Assad. Die Lage in Syrien war verheerender denn je.
Aber Schweden war ein kleines Land und es hatte seinen Beitrag geleistet. Mehr europäische Länder müssten helfen.
Außerdem hatte Ibrahim in der Zeitung gelesen, dass seine Landsleute so dieses und jenes einforderten, wenn sie in Schweden ankamen. Dass sie undankbar waren, sich wie verwöhnte Schweine benahmen. Sich weigerten, aus den Bussen auszusteigen, sich über die ihnen zugeteilten Unterkünfte beschwerten, nicht die Kleider anziehen wollten, die ihnen gegeben wurden. Begriffen sie denn nicht, dass die Schweden ihr Bestes taten?
Andererseits war auch er bei seiner Ankunft den schwedischen Behörden mit Misstrauen begegnet. War man daran gewöhnt, dass der Staat der Feind war, dass die Polizei Schlagstöcke zum Einsatz brachte, dass der Krankenhausdirektor sich bestechen ließ, damit die Ärzte die Familienangehörigen behandelten, ja, da war es nicht leicht zu verstehen, wie das alles in Schweden funktionierte.
Deutschland, die USA und Kanada sollten erst mal vor ihrer eigenen Tür kehren. Schweden gehörte zu den besten Ländern der Welt. Schweden hatte ihm die Staatsangehörigkeit zugesprochen, ihm Arbeit und Sicherheit gegeben. Hatte ihm stets Respekt entgegengebracht.
Als Ibrahims und Fatimas Sohn Muhammed im Sommer 1991 an Leukämie erkrankt war, hatten die Ärzte alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihn zu retten. Aber es war aussichtslos gewesen. Muhammed war im Alter von vier Jahren im Krankenhaus von Danderyd verstorben.
Ibrahim war am Boden zerstört gewesen, hatte seinen Tränen keinen Einhalt gebieten können.
Nachdem sie Muhammed beerdigt hatten, war Ibrahim klar gewesen, dass sie kinderlos sterben würden. Alt werden, ohne jemals das Getrappel von Kinderfüßen zu hören, die ihn morgens weckten. Nie Enkel haben. Er und Fatima würden kinderlos sterben, in einem Land, das meilenweit von ihrer Heimat entfernt war.
Sie hatten sogar erwogen, wieder nach Syrien zurückzugehen. Denn was spielte es noch für eine Rolle, wo sie wohnten, oder ob sie ums Leben kamen? Sie waren wegen Muhammed, wegen seiner Zukunft, nach Schweden gekommen.
Fatima war sechsunddreißig Jahre alt gewesen, als Muhammed zur Welt gekommen war. Eigentlich war es zu spät, um es noch mal zu versuchen.
Aber ein Jahr nach Muhammeds Tod war Fatima wieder schwanger gewesen, und mit einundvierzig hatte sie Mitra geboren. Ein Wunder. Ibrahim klappte seine Brieftasche auf und sah sich ihr Foto an: Mitra und Fatima, sein Leben, seine Engel.
Er hatte eine Fahrt. Norr Mälarstrand.
Bestimmt ein paar Teenies, die ausgehen und Spaß haben wollten.
Er drückte dem Foto einen Kuss auf, steckte es wieder in die Brieftasche zurück und fuhr pfeifend den Sveavägen hinunter.
KAPITEL 3
Madeleine Winther, Journalistin beim Nyhetsbladet, lehnte am offenen Fenster ihrer Wohnung, rauchte eine Zigarette und blickte auf die Hagagatan hinab.
Im Bett lag ihr Chef Markus Råhde, mit seinem Laptop auf dem Schoß.
»Alle Achtung, Anita Sandstedt bringt morgen Hannah Löwenströms Namen mitsamt Foto auf der ersten Seite. Man kann ja einiges über unsere Chefredakteurin sagen, aber feige ist sie nicht. Ich glaube nicht, dass die Kvällspressen oder die Aftonposten das machen.«
Madeleine gab keine Antwort.
Vermutlich wusste er, dass sie ihn ignorierte.
»Leider ist damit dein Interview mit dem Vorsitzenden der Moderaten weg von Seite eins. Das hier wird dann stattdessen die Schlagzeile werden.«
Madeleine nahm einen tiefen Zug und folgte zwei Männern auf der Straße mit ihrem Blick. Sie kaute am Daumennagel der Hand, die die Zigarette hielt, und hörte, wie Markus sich am Bauch kratzte. Sie stellte sich vor, wie sich Hautschuppen unter seinen Nägeln sammelten. Sie verabscheute dieses Geräusch.
Konnte er nicht einfach verschwinden? Er hatte schließlich erledigt, weswegen er gekommen war, warum musste er dann noch in ihrem Bett ein mobiles Redaktionsbüro installieren und haarklein auseinanderdividieren, was morgen in der Zeitung stehen würde?
Wenn sie ehrlich zu sich war, kannte sie die Antwort.
Aus unerfindlichen Gründen, dachte sie, glauben Männer, Frauen gefällt es, wenn sie arbeiten. Sie glauben, sie können so zeigen, was für großartige Familienversorger sie sind. Diese These, auf die sie sich seit ihrer Zeit am Enskilda-Gymnasium berief, wurde kürzlich von einer Studie untermauert, die von der Boston University erhoben worden war.
Einunddreißig Prozent der Männer, die an der Studie teilgenommen hatten, allesamt aus der Finanzbranche, arbeiteten in Wahrheit dreißig Stunden weniger pro Woche, als sie vorgaben. Daran störte Madeleine besonders, dass die Männer, indem sie systematisch über ihr Arbeitspensum logen, die Meinung vertraten, dass es unmöglich war, im Beruf Karriere zu machen, wenn man neben der Arbeit auch noch ein Privatleben haben wollte.
Gerade das aber wollten viele Menschen, vor allem Frauen.
Auf diese Weise schützten sie bewusst oder unbewusst ihre Arbeitsplätze.
Madeleine lächelte in sich hinein, schnippte die Zigarette aus dem Fenster und hüpfte am Fußende auf das Bett. Dann kam sie langsam auf Markus zugekrochen.
»Du siehst verdammt heißt aus, wenn du arbeitest, weißt du das?«, sagte sie und sah ihn mit ihren großen blauen Augen an.
Er runzelte die Stirn.
»Das ist so … sexy«, fuhr sie fort. »Ich weiß wirklich nicht, wie du das schaffst. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du eigentlich?«
»Da kommt schon was zusammen. Sechzehn, siebzehn Stunden vielleicht. Manchmal mehr. Es hängt nicht gerade wenig von mir ab, wir wollen schließlich jeden Tag eine Zeitung drucken.«
Sie kicherte, und er sah sie fragend an.
»Was denn? Wieso lachst du?«
Sie ließ sich vom Bett gleiten und ging ins Bad, machte die Tür zu, stellte sich vor den Spiegel und begann, Markus stumm nachzuäffen.
»Es hängt nicht gerade wenig von mir ab …«
Madeleine musste laut loslachen. Sie hielt sich den Mund zu, damit er sie nicht hörte.
Seit einem guten halben Jahr hatten sie nun schon ein Verhältnis. Sicher, anfangs war sie ein bisschen verliebt in ihn gewesen, hatte sich amüsiert, wie zerstreut und verlegen der um fast dreißig Jahre ältere Nachrichtenchef wurde, sobald sie sich in seiner Nähe aufhielt. Von seiner Miene gar nicht zu reden, als er sie zum ersten Mal nackt gesehen hatte. Vor allem aber war es spannend gewesen, der absoluten Oberliga der Zeitung so nahe zu kommen, an redaktionellen Beschlüssen teilzuhaben, die sonst weit über ihr gefasst wurden. Zu verstehen, wie jene dachten, die das Sagen hatten, zu lernen, welche die Mechanismen waren, die hinter den Kulissen die drittgrößte Abendzeitung Schwedens lenkten.
Das Nyhetsbladet war ein Emporkömmling, der vor fünf Jahren den Kampf mit den beiden schwedischen Boulevardzeitungen Kvällspressen und Aftonposten aufgenommen hatte. Die beiden anderen verkauften mehr gedruckte Exemplare, aber an den digitalen Lesern gemessen, war das Nyhetsbladet genauso groß wie die Kvällspressen. Viereinhalb Millionen Schweden besuchten jede Woche die Seiten dieser beiden Zeitungen. Die Aftonposten war mit ihren sechs Millionen Lesern nach wie vor die unangefochtene Nummer eins.
Madeleine hatte sich innerhalb von zwei Jahren einen Namen in der Branche gemacht. Es war nicht gerade an der Tagesordnung, dass Vierundzwanzigjährige derartige Prestigeaufträge bekamen, die nunmehr zu ihrem täglichen Brot gehörten. Das beruhte natürlich in erster Linie darauf, dass sie eine kompetente und geschickte Journalistin war. Ihr Foto in der Verfasserzeile war ungewöhnlich groß, auch schon, bevor sie angefangen hatte, mit Markus ins Bett zu gehen.
Madeleine war eine anerkannte Stilistin. Aber ihr größtes Talent bestand darin, dass sie die Menschen zu packen wusste. In Interviews gab sie ihnen das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, als wäre ihre Geschichte einzigartig auf der Welt.
Vor allem Männer sprangen darauf an. Mit Markus war es im Grunde genau das Gleiche. Sie hatte ihn wie einen Gesprächspartner in einem ihrer Interviews behandelt, ihm das Gefühl gegeben, er wäre interessant und würde von ihr wahrgenommen.
Ihre Beziehung mit Markus hatte ihrer Karriere Auftrieb gegeben. Sie wollte weiterkommen, sie hatte keine Zeit, dazusitzen, Wettermeldungen zu schreiben und darauf zu warten, bis jemand ihr Talent entdeckte. Dabei war es nicht so, dass Markus ihr bewusst eine Sonderbehandlung zuteilwerden ließ, dafür war er zu idealistisch. Man konnte über ihn sagen, was man wollte, er war aufgeblasen, ein wenig verrückt und selbstgefällig, wie fast alle männlichen Journalisten, aber er war auch von der alten Schule. Er war konsequent, kompromisslos, glaubte an die Wirkung des Journalismus und seine Bedeutung für die Gesellschaft.
Madeleine hatte sich ihrerseits für den Journalismus entschieden, weil sie wusste, dass sie rasch Erfolg haben würde. Auch wenn sie das ihren Kollegen gegenüber nicht zugeben konnte.
Denn in ihrer zwei Jahre währenden Karriere war Madeleine kein einziger Journalist begegnet, der nicht von sich behauptet hätte, Idealist zu sein. Sie hatte sogar gehört, wie ihre Kollegen ernsthaft behaupteten, nicht sie hätten den Journalismus gewählt, sondern der Journalismus hätte sie ausersehen.
»Was machst du morgen Vormittag noch mal?«, rief Markus.
Sie seufzte, öffnete die Badezimmertür einen Spaltbreit und bürstete ihre blonden Haare.
»Ich muss zu diesem Königsding. Der König und Silvia besuchen eine Glashütte in Östergötland. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich um sie rumscharwenzeln und fragen, wie es um ihre Enkelkinder steht.«
»Warum macht Håkan das nicht?«
Håkan Järeskog war Hofreporter beim Nyhetsbladet.
»Weiß ich nicht. Vielleicht baut er Überstunden ab. Er ist mit denen doch den ganzen Herbst lang rumgefahren.«
»Fotograf?«
»Haben wir doch immer, wenn’s königlich wird. Hast du das nicht selber so entschieden?«
»Ach ja, stimmt. Wer ist es denn?«
»Dahlström. Er holt mich um acht ab.«
Madeleine hörte Markus im Schlafzimmer grummeln.
Dahlström war der ungekrönte Casanova der Zeitung. Es war eher die Regel denn die Ausnahme, dass Hampus mit den Journalistinnen ins Bett stieg, mit denen er gemeinsam auf Außenreportage war.
Markus war eifersüchtig, auch wenn er das niemals zugeben würde, und Madeleine genoss es. Sie kam aus dem Bad, machte die Deckenlampe aus, kroch unter die Bettdecke, knipste die Nachttischlampe an und reckte sich nach der Ulrike-Meinhof-Biografie, die sie sich in der Akademibokhandeln gekauft hatte. In letzter Zeit las sie nichts anderes und hatte nur noch ein Dutzend Seiten vor sich. Aber sie kam nur wenige Zeilen weit, bis sie seine Hand an der rechten Innenseite ihres Schenkels spürte.
»Es ist spät«, sagte sie, ohne den Blick von ihrem Buch abzuwenden.
Innerlich erbrach sie sich bei dem bloßen Gedanken daran, noch mal mit ihm zu schlafen.
»Ich weiß«, sagte er. »Ich gehe gleich.« Markus fuhr den Laptop herunter, drehte sich auf die Seite und schaute sie an. »Nächstes Wochenende …«
»Ja?«
»Wollen wir nicht zusammen wegfahren? Nach Mitteleuropa irgendwo? Es ist so anstrengend, sich die ganze Zeit zu verstecken. Ich habe die Nase voll von dieser Heimlichtuerei.«
»Das wäre wundervoll«, sagte sie tonlos.
Dabei konnte Madeleine sich nichts Tristeres vorstellen, als mit Markus Hand in Hand durch Prag oder Wien zu schlendern.
»Gut«, sagte er beschwingt. »Ich schau mal, was es gibt.«
Er zog die Decke weg, küsste ihren Bauch und begann, nach seiner Unterhose zu suchen. Als er angezogen war, stieg sie aus dem Bett und begleitete ihn nackt in die Diele. Ehe er ins Treppenhaus trat, musterte er sie lange.
»Ich fasse es nicht, wie man so aussehen kann wie du. Du hättest genauso gut Model werden können.«
»Gewöhn dich dran.«
»Ich versuch’s.«
»Und weißt du, was das Beste ist …«, wisperte sie, nahm seine Hand und führte sie an ihrem Körper hinab, »… das alles gehört dir.«
Er zog sie an sich und beugte sich vor, um sie zu küssen. Madeleine gab ihm einen flüchtigen Kuss auf den Mund und machte rasch die Tür zu. Sie holte ihr Buch, trat ans Fenster und zündete sich noch eine Zigarette an.
KAPITEL 4
Es hatte etwas Verlockendes, sich auszumalen, wie sein Leben in Biografien oder TV-Dokumentationen dargestellt werden würde.
In den letzten Wochen hatte Carl Cederhielm sich immer öfter bei solchen Träumereien ertappt. Wenn er nicht irrte, hatte er auch als Jugendlicher so eine Phase gehabt. Aber damals war es hauptsächlich darum gegangen, wie er für Schweden die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen würde. Er legte Serranoschinken in den roten Einkaufskorb, suchte den Käse, entschied sich für ein Stück Ziegenkäse und ging weiter.
Der ICA Esplanad im Karlavägen in Stockholm war voller Familien mit Kindern. Carl hielt inne und lächelte, als ein kleines Mädchen von ihrer Mutter hochgehoben wurde, damit sie sich die Chipstüte selbst aus dem Regal nehmen konnte.
Carl sehnte sich nach Kindern. Die Sehnsucht war so stark, dass sie physisch wehtat. Er fragte sich, ob das normal war bei achtundzwanzigjährigen Männern? Wohl eher nicht. Vater zu werden, darüber hatte er als Kind viel nachgedacht, fiel ihm ein. Er warf einen Blick auf den Zettel in seiner Hand. Schinken und Käse, das hatte er. Es fehlten noch Sesam, Frischkäse und Baguette. Wein hatte er zu Hause.
Immer wieder strich er sich über sein Jackett und die Pistole darunter, eine Glock 19, die er in einem Holster trug.
Carl entschied sich für die Schlange ganz rechts, neben den Zeitschriftenregalen. Das machte er immer, selbst wenn die Schlange dort länger war als die an den anderen Kassen – feste Abläufe und Disziplin waren die Dinge, die einen starken Menschen ausmachten. Eine Sekunde lang stellte er sich vor, wie es wäre, wenn er plötzlich seine Waffe ziehen und um sich schießen würde. Würde er es schaffen, alle umzulegen?
Vermutlich nicht, einige wenige würden sicher davonkommen.
Die Mutter hatte sich mit ihrer kleinen Tochter an derselben Schlange angestellt wie Carl. Das Mädchen hielt die Chipstüte fest umklammert.
»Du darfst sie aufmachen, wenn wir bezahlt haben«, sagte die Mutter zu ihr.
Das Mädchen streckte sich nach einer Schachtel mit Bonbons und sah die Mutter bettelnd an.
»Nein, die nicht auch noch. Du kannst wählen, Saga. Entweder die Chips oder die Bonbons.«
Das Mädchen legte die Schachtel wieder zurück.
Die Mutter wandte sich zu Carl um, lächelte und verdrehte die Augen. Er erwiderte das Lächeln. Es gefiel ihm, wenn Menschen nett zueinander waren.
Die Schlange kam nicht vorwärts. Ein älterer weißhaariger Mann im Tweedjackett seufzte. Carl reckte den Hals, um zu sehen, was da so lange dauerte. An der Kasse diskutierte ein fremdländischer Mann in den Fünfzigern mit der Kassiererin. Die Diskussion wurde immer lauter.
Plötzlich schlug der Mann mit der Faust auf die Plexiglasscheibe neben dem Kartenlesegerät. Das Mädchen mit der Chipstüte griff nach der Hand ihrer Mutter. Die Kassiererin sah ängstlich aus.
Carl stellte seinen Einkaufskorb ab und ging an den Wartenden vorbei bis zur Kasse. Der Mann begann, wild zu gestikulieren, aber unterbrach sich, als Carl ihm auf die Schulter tippte und fragte, was los sei.
Er musterte Carl überrascht. Dann drehte er sich wieder zur Kassiererin um und wetterte weiter drauflos. Sie sah den Kunden hilflos an. Auf dem Band zwischen ihnen lag ein Paket Hackfleisch. Carl nahm an, dass es die Ursache der Auseinandersetzung war.
»Beruhigen Sie sich, Sie können sich hier doch nicht so aufführen. Sie machen ihr Angst, und den anderen Kunden gegenüber sind Sie respektlos. Entweder Sie bezahlen Ihre Ware, oder Sie verschwinden von hier«, sagte Carl ruhig.
»Er will es zurückgeben, weil es gemischtes Hack ist, aber die Packung ist geöffnet, und ich versuche, ihm zu erklären, dass das nicht geht«, sagte die Kassiererin.
»Es steht eindeutig drauf, dass es gemischtes ist. Sie haben das Paket geöffnet und wollen es zurückgeben? Wer soll das denn noch essen? Verschwinden Sie jetzt«, sagte Carl, nun mit mehr Nachdruck.
Der Mann maß ihn mit Blicken. Dann sagte er etwas, das Carl für Arabisch hielt, drehte sich um und steuerte auf den Ausgang zu.
»Tausend Dank für Ihre Hilfe«, sagte die Kassiererin, legte das Fleisch beiseite und winkte den nächsten Kunden heran.
»Kein Problem«, entgegnete er und reihte sich wieder in die Schlange ein.
Die Mutter des Mädchens klopfte ihm auf die Schulter.
»Gut gemacht. Ich verstehe wirklich nicht, wie manche Menschen gepolt sind«, sagte sie.
Der ältere Mann im Tweedjackett drehte sich um und sagte: »Wir holen die rein in unser Land, kümmern uns um sie, zahlen für den ganzen Hokuspokus, und dann benehmen die sich so. Es ist richtig, dass junge Männer wie Sie den Mund aufmachen. Man selbst traut sich ja nicht mehr, die sind doch gemeingefährlich.«
Draußen war es dunkel. Der blaue Bus der Linie 1 fuhr die Haltestelle an, und Fahrgäste stiegen aus. Carl war keine zwanzig Meter weit gegangen, als er auf seinen Klassenkameraden aus der Östra Real stieß, Nils Hermelin. Er schüttelte seine ausgestreckte Hand. Nils war fast genauso groß wie Carl, trug einen dunklen Trenchcoat und Jeans.
»Cool, dich zu sehen, Calle. Gehst du heute Abend noch weg?«, erkundigte sich Nils.
Carl verabscheute es, wenn er Calle genannt wurde, aber er ließ es durchgehen.
»Das habe ich vor. Ein Kumpel vom Bund kommt nachher zum Abendessen vorbei«, sagte er und hielt die Supermarkttüten hoch. »Danach gehen wir vielleicht noch in die Stadt.«
»Wehrdienst. Ist auch schon wieder eine ganze Zeit her. Warst du nicht bei den Fallschirmjägern?«
Carl schüttelte den Kopf.
»Küstenjäger.«
»Klingt krass. Ich muss weiter, ich besuch Per … Per Nordmark. Kennst du den noch?«
»Klar«, gab Carl zurück. »Grüß ihn von mir. Wir sehen uns.«
Es war halb acht, als er in der Grevgatan 18 seine Wohnungstür aufschloss. Er hängte seinen beigefarbenen Burberrymantel auf, zog die Schuhe aus, blieb vor dem Flurspiegel stehen, schob die Schultern zurück und betrachtete seinen Körper. Er war top in Form. Seit einem halben Jahr lief er jede zweite Nacht acht Kilometer. Und wenn er nicht joggte, ging er ins Fitnessstudio, das hatte rund um die Uhr offen. Carl stemmte hundertdreißig Kilo beim Bankdrücken und würde demnächst weitere Scheiben auf die Stange schieben. Er zückte seine Pistole, hielt sie mit beiden Händen im Anschlag und zielte auf sein Spiegelbild.
»Mona Sahlin, du kleine Hure«, flüsterte er.
Er steckte die Waffe in ihr Holster zurück, streifte es ab und legte es in die oberste Kommodenschublade. Dann packte er seine Einkäufe aus, legte Käse und Schinken auf einen Teller, hackte Sellerie, holte Kekse und Chips, rührte in einer kleinen Schale Sesam und Frischkäse an, gab einen Schuss Sojasoße hinzu und trug alles ins Wohnzimmer.
Anschließend suchte er Streichhölzer und zündete die Kerzen auf dem Wohnzimmertisch an. Nun blieb er mitten im Zimmer stehen und betrachtete zufrieden sein Werk.
Als er sich umdrehte, um wieder in die Küche zu gehen, blieb sein Blick an dem Foto seines jüngeren Bruders Michael auf dem Kaminsims hängen.
Carl nahm zwei Kerzen vom Wohnzimmertisch und stellte sie zu beiden Seiten des gerahmten Bildes auf.
»Was meinst du, sieht das schön aus?«, sagte er zu dem Foto und ging in die Küche.
Um Punkt acht klingelte Emil Forsén. An der Tür gaben sie sich die Hand, und Carl führte Emil ins Wohnzimmer.
»Ich habe was für dich dabei«, sagte Emil und überreichte ihm eine Flasche Famous-Grouse-Whisky.
Carl bedankte sich und stellte sie auf das Lowboard neben den Samsung-Fernseher. Seit zwei Jahren mied er Hochprozentiges, aber das behielt er für sich. Er und Emil hatten sich vier Jahre lang nicht gesehen. Damals war Emil nach Lund gezogen, um Medizin zu studieren.
»Ist das eine Zweizimmerwohnung?«, fragte Emil und ließ seinen Blick durch das Wohnzimmer schweifen.
Carl nickte.
»Unsereiner wohnt auf achtzehn Quadratmetern … Was ist denn mit deinen Koteletten passiert? Und deine Haare sind ja fast so kurz wie damals zu unseren Musikerzeiten«, sagte Emil lachend, setzte sich aufs Sofa und nahm einen Keks. »Du siehst ein bisschen so aus wie Joel Kinnaman.«
Carl wusste nicht, wer Joel Kinnaman war, nahm wortlos Emil gegenüber Platz und schenkte Wein ein.
Emil war der Einzige aus dem Wehrdienst, mit dem er Kontakt hatte. Er hatte ihn immer gemocht, aber mit einem Mal fühlte er sich unwohl in seiner Gegenwart.
Carl ging auf, dass es keine gute Idee gewesen war, ihn einzuladen. Sie würden nur dasitzen und in Erinnerungen schwelgen, über die alten Zeiten in Berga reden, eine Kneipenrunde drehen und sich betrinken.
Im Grunde genommen war das kindisch und sinnlos. Und Carl hatte keine Zeit, kindisch zu sein.
Aber es war wichtiger denn je, eine korrekte Fassade aufrechtzuerhalten, sich nicht abzuschotten. Carl musste ein normales Leben führen, wenn sein Plan gelingen sollte.
Nach einer Weile Small Talk blieb Emils Blick an Michaels Foto hängen.
»Dein Bruder?«
Carl nickte. Emil stand auf und nahm den Rahmen vom Sims.
»Ihr seht euch verdammt ähnlich. Wie das war, als du den Anruf gekriegt hast, werde ich nie vergessen. In der letzten Woche draußen war das, stimmt’s?«
»In der vorletzten«, korrigierte Carl.
Er hatte nie jemanden das Foto betrachten sehen, geschweige denn über Michael reden hören, und er wusste nicht recht, was er davon halten sollte.
Es entstand eine Pause. Dann stellte Emil das Foto zurück.
»Wie alt war er denn?«, fragte er und ging wieder zum Sofa.
»Er wäre siebzehn geworden«, sagte Carl und musterte seine Hände.
»Heroin?«
»Im Hauptbahnhof, auf dem Klo«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Total sinnlos. Aber das ist schon lange so gegangen. Er war ziemlich schwierig, Michael.«
»Wie haben eure Eltern das verkraftet?«
»Nicht so gut. Meine Mutter hat einen anderen kennengelernt und ist nach Norwegen gezogen.«
»Und dein Vater?«
»Er wohnt zwei Stockwerke über mir, im vierten.«
Es wurde wieder still. Carl nahm einen Keks. Von seinem Bruder zu sprechen, hatte ihn nicht traurig gemacht, im Gegenteil. Es gab ihm Energie. Und mit der wollte er etwas Besseres anstellen, als in irgendein Lokal zu gehen.
»Du«, begann Carl. »Ich wollte es dir am Telefon nicht sagen, aber es geht mir nicht so gut. Ich glaube, ich kann heute Abend nicht weggehen.«
Emil stellte sein Weinglas ab und runzelte die Stirn.
»Was meinst du damit?«
»Ich bin ein bisschen angeschlagen.«
»Soll ich lieber wieder gehen?«
»Entschuldige, ich dachte, das legt sich wieder, aber mir ist irgendwie übel.«
Emil warf ihm einen skeptischen Blick zu.
»Dass ich nach deinem Bruder gefragt habe, tut mir leid.«
»Nein, nein, schon gut, mach dir keine Gedanken«, entgegnete Carl und rang sich ein Lächeln ab.
Er erhob sich, um seinen Gast zur Tür zu begleiten. Emil musterte ihn ratlos und stand auf.
»Pass auf dich auf. Wir hören uns«, sagte er und hielt Carl die Hand hin.
»Auf jeden Fall.«
Als die Tür ins Schloss gefallen war, ging Carl ins Wohnzimmer zurück, nahm sein Weinglas und holte seinen Laptop, der im Schlafzimmer auf dem Bett lag. Dann setzte er sich wieder aufs Sofa, den Rechner auf dem Schoß, und ging auf die Webseite des Nyhetsbladet. Die Zeitung hatte als Erste die Meldung gebracht, dass die schwedische Allehanda-Journalistin Hannah Löwenström tot in Hägerstensåsen aufgefunden worden war. Auf Facebook schrieben viele »Endlich« und freuten sich ungeniert über ihren Tod. Carl lächelte in sich hinein und nahm einen Käsewürfel.
Er ging die Artikel auf Entpixelt durch.
Milchbärte aus Afghanistan hatten aus einem Badehaus in Gävle Kleinholz gemacht. Zwei Asylanten hatten eine Frau in Örebro vergewaltigt. In einer Flüchtlingsunterkunft in Varberg hatte es eine Messerstecherei gegeben. Carl schüttelte den Kopf. Um solches Gesocks ins Land zu lassen, brachten Personen wie Hannah Löwenström ihren medialen Einfluss zum Einsatz. Begriffen diese Leute denn nicht, was sie Schweden damit antaten? Ein illegaler Einwanderer hatte auf der Drottninggatan Menschen überfahren – und trotzdem wollten sie noch mehr aufnehmen. Der Wahnsinn kannte keine Grenzen.
Zahlreiche Kommentare zu den Artikeln auf Entpixelt zeugten von einer gewissen Schadenfreude darüber, was die Einwanderer anstellten, und schrieben ironisch, das sei »das neue spannende Schweden«.
Carl war nicht fähig, etwas anderes als Bestürzung für das zu empfinden, was da passierte.
Er hatte Hannah Löwenström umgebracht, um sich im Spiegel endlich wieder in die Augen sehen zu können, um sich nicht länger als Opfer zu fühlen.
Vor ein paar Jahren hatte er sich eine Zeit lang mit dem Gedanken getragen, auszuwandern, sich geschlagen zu geben und den ganzen Wahnsinn einfach hinter sich zu lassen. Er kannte mehrere Leute, die das getan hatten. Einige waren in rein weiße Gebiete auf Åland gezogen. Andere waren nach Ost- und Mitteleuropa gegangen, wo sich das multikulturelle Gift noch nicht ausgebreitet hatte, weil die osteuropäischen Staatsoberhäupter sich dem beflissenen Bestreben der Kosmopoliten entgegenstellten, die Kultur der westlichen Welt zu vernichten.
Carl hatte sich umgehört, viel gelesen und war für einen Neuanfang gewappnet gewesen. Aber irgendetwas hatte ihn daran gehindert. Anfänglich hatte er gedacht, es wäre Feigheit. Das hatte ihn umgetrieben. Aber dann war ihm aufgegangen, was ihn hier hielt: die Liebe zu seinem Land und zu seinem Volk, zu der Nation, die seine Vorväter geschaffen hatten.
Carl war niemand, der leicht aufgab, er war kein Opfer. Diese Erkenntnis hatte ihn entschlossener werden lassen, ihn froh gestimmt. Statt sich an einen anderen Ort zu wünschen, hatte er beschlossen, sich zu verteidigen. Diejenigen zu rächen, die sich nicht mehr rächen konnten. Die Opfer der Drottninggatan, all die vergewaltigten Frauen und sein Bruder Michael waren nur wenige von Tausenden, die der Welle der Gewalt ausgesetzt waren, die die Masseneinwanderung mit sich brachte.
Und die Schuldigen, die Täter, waren immer noch da draußen, auf freiem Fuß.
Die Journalisten, Politiker und die anderen Kulturmarxisten konnten nachts gut schlafen, sie waren es ja nicht, die von der Gewalt beeinträchtigt wurden, der die Regierung die Bevölkerung aussetzte. Doch Carl war schwedischer Küstenjäger, er hatte geschworen, das Land vor Feinden zu beschützen. Und das schloss auch die Feinde im Inneren mit ein, ebenso wie die Verräter, die die Entscheidungen fällten. Er hatte angefangen, im Netz und in seiner Umgebung nach Gleichgesinnten zu suchen, hatte sich über terroristische Vereinigungen in der europäischen Geschichte informiert, über den Baader-Meinhof-Komplex, die IRA, die ETA.
Sein Leben hatte sich schlagartig und für immer verändert, in dem Moment, als er seine Fesseln gesprengt und aufgehört hatte, sich als Opfer zu sehen.
Würde die Polizei ihn jemals schnappen, würden sie ihn als Nazi, Psychopathen, Verrückten beschimpfen. Die Journalisten würden darum wetteifern, ihn zu vernichten. Sie würden ihn verfolgen mit allen Waffen, die ihnen zur Verfügung standen. Sie würden ihn dämonisieren, sich auf seine Familie stürzen und alles, was ihm lieb war. Seine Kindheit und Jugend zerpflücken. Aber das war ein Preis, den zu zahlen er bereit war.
Er scrollte die Kommentare auf Entpixelt durch. Er erkannte mehrere Benutzernamen wieder. Plötzlich hielt er inne und zog den Pfeil der Maus auf den Benutzernamen Wilddrude. Die Person hinter diesem Alias wetterte gegen die Schwedenfreunde, die ihren Unmut und ihre Besorgnis über die Entwicklung und Konsequenzen der Masseneinwanderung zum Ausdruck brachten. Wilddrude nannte sie spöttisch »ungebildete Assi-Rassisten«.
Vor zwei, drei Jahren hatte Carl einmal mit Wilddrude diskutiert, aber er hatte nur Hohn und Spott geerntet. Die Person, die sich hinter dem Pseudonym verbarg, war ein Aufwiegler und Besserwisser.
Der Mann war ganz offensichtlich ein Idiot, oder er glaubte die Lügen der Medien wirklich. Carl hatte wissen wollen, wie so ein Mensch aussah, unzählige Male hatte er erfolglos versucht, die wahre Identität des Wilddruden herauszufinden.
Ohne sich große Hoffnungen zu machen, kopierte er nun die E-Mail-Adresse, die zu dem Alias gehörte, in die Google-Suchmaske. Er keuchte auf und traute seinen Augen kaum, als er merkte, dass dieselbe Adresse mittlerweile auch auf familjeliv.se registriert war.
Und dort fand er den Namen: Sonny Lindell war sechsundvierzig Jahre alt, wohnte in Sätra und war Lehrer am Kärrtorpsgymnasium. Sein Facebook-Profil zeigte einen Mann mit braunen Haaren und runder Brille, der zurückgelehnt dasaß und Bassgitarre spielte.
Carl ballte triumphierend die Faust und stand auf.
»Du Ratte«, murmelte er.
Er sah sich suchend nach seinem Mobiltelefon um, fand es neben sich auf dem Sofa und rief Fredrik Nord an.
»Ich habe Wilddrude gefunden. Er ist Lehrer und wohnt in Sätra«, berichtete Carl aufgeregt.
»Wie das?«, fragte Fredrik.
Carl begann, in der Wohnung auf und ab zu gehen.
»Vor einer Woche hat er sich auf familjeliv.se registriert, mit derselben E-Mail-Adresse, die er auch auf Entpixelt verwendet«, sagte er.
»Was für ein Idiot«, entgegnete Fredrik. »Aber nur Journalisten. Keine Zivilisten, keine Politiker, keine Muslime. Sonst bringen wir die Bevölkerung gegen uns auf. Das hast du selbst gesagt.«
»Ich weiß«, sagte Carl seufzend. »Aber dieses Aas ist Lehrer. Er verbreitet seinen Dreck unter seinen Schülern. Lass uns darüber reden, wenn wir uns morgen treffen.«
Sie beendeten das Gespräch, und Carl setzte sich zurück aufs Sofa.
Er öffnete die Datei, die in einem verschlüsselten Ordner auf der Festplatte seines Rechners lag. Die Datei bestand aus einer Liste, die er vor vier Jahren zu erstellen begonnen hatte und die persönliche Daten über nahezu fünfhundert Menschen enthielt, die in irgendeiner Form Schuld daran hatten, dass Schweden im Begriff stand unterzugehen.