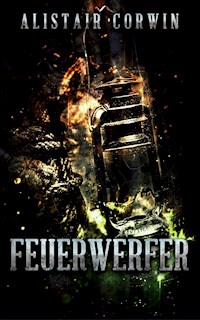
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fantasy trifft Steampunk. In einer Welt, in der Technik von Magie angetrieben wird, ist Arros Leben nicht besonders aufregend: Er entzündet Lampen. An diesem Abend jedoch stürzt ihm ein Fremder quasi vor die Füße und ändert dadurch alles. Einen Mord später findet er sich in der Gesellschaft tätowierter Soldaten, zwielichtiger Schauspieler und der mächtigsten Personen des Reiches wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Feuerwerfer
Die Dreizehnte Kompanie
Band 1
Ein Magie und Degenpunk Roman
Von Alistair Corwin
Copyright © 2017 Alistair Corwin
Cover von BetiBup33
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Erstveröffentlichung Juni 2017
Dritte überarbeitete Auflage September 2019
Copyright 2017 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Alistair Corwin.
Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN: 9783750408685
Weitere Bücher von Alistair Corwin
Demnächst:
Frostwerfer: Die Dreizehnte Kompanie – Band 2
als Johannes Reinecke:
Eine Nacht ohne Sterne:
Band 1 – Das Tal der Sonne, ISBN 9783744852050
Band 2 – Die Stadt des Feuers, ISBN 9783743160019
Das Lächeln in den Augen eines Gottes
Demnächst:
Der Trost im Schoße einer Göttin
Karte (Erstellt mit AutoREALM)
Inhaltsverzeichnis
1. Die Straßen von Lutissia - Erde
2. Die Bretter, die die Welt bedeuten - Luft
3. Die Insel der tätowierten Männer - Wasser
4. In den Hallen von Macht und Gold - Feuer
5. Nachwort
1. Die Straßen von Lutissia - Erde
Tief atme ich die feuchte Luft ein und konzentriere mich. Angesichts der Tatsache, dass dies mein Beruf ist, sollte es eigentlich Routine sein. Nein, ich spreche nicht vom Atmen.
Sollte.
Ist es aber nicht!
Ich spüre, wie die Wärme unaufhaltsam von den Füßen her in mir aufsteigt. Meine Finger krampfen sich immer fester um das Eisen des Zündstabs, dann lasse ich der Energie schlagartig ihren Lauf.
Es wird warm. Sehr warm!
Mein eigener Schrei reißt mich aus meiner angespannten Konzentration und ich schaue zu Boden. Feine Dampfschwaden steigen von meinen Stiefeln auf. Schnell hüpfe ich im Schnee hin und her.
„Heiß! Heiß! Heiß!“, rufe ich gequält.
Es schmerzt zum Glück nicht lange. Wenigstens scheine ich mich nicht ernsthaft verbrannt zu haben. Es hat also auch Vorteile, wenn Schuhe Löcher haben.
Ich blinzele zur gläsernen Fangkugel hinauf. Der kleine Feuerball darin hat etwas zu viel Kraft mitbekommen, wird die Lampe aber wohl hoffentlich nicht beschädigen. Wenn doch, ist es mir auch egal. Der Elementar dreht darin momentan fröhlich seine Runden und erhellt die schwefelgelben Nachtnebelschwaden mit seinem warmen Licht.
Wie schön, nur interessiert es niemanden.
Sehen ist gleich riechen. Kurz werde ich mir des üblen Gestanks um mich herum gewahr. Die Chemikalien der Gerber und Färber. Die knöcheltiefe, glitschige Mischung aus Fäkalien und Müll, die hier als Straße dient. Der faulige Dunst, der sich vom Fluss aus hoch quält wie ein sterbendes Tier, ist heute besonders dicht und aufdringlich.
Gemeinsam erzeugen sie eine Mischung, welche die Nase auf jegliche denkbare Weise beleidigt.
Der Preis des Fortschritts.
Die ersten Brandblasen an Händen und Füßen und dabei hat meine Schicht gerade erst begonnen.
„Na, das wird ja eine ganz heiße Nacht“, murmele ich vor mich hin und ärgere mich, dass wieder keiner da ist, um meinen Witz zu würdigen. Da ist man mal witzig ..
Ich tauche meine schmerzenden Hände in eine der kühlen Pfützen aus Schmutzwasser und schüttele sie trocken.
Ich seufze, schiebe die klobige Schutzbrille mit den nahezu stumpfen Gläsern vor meine Augen und das dichte Tuch vor meinen Mund. Eigentlich sollen wir Zünder sie die ganze Zeit aufbehalten. Macht aber keiner, denn darunter kann man kaum sehen oder atmen. Viel angenehmer ist es ohne natürlich auch nicht, aber an das Brennen in Augen und Kehle hat man sich irgendwann gewöhnt.
Ich hänge mir den kleinen verbeulten Gaskanister über die Schulter, klaube die Zündstange auf und mache mich wieder auf den Weg.
Die Fangkugel der nächsten Lampe sieht heile aus. Schmutzig, aber unbeschädigt.
Dann beginnt die übliche Prozedur. Schlauch anhängen. Kanister befestigen. Zündstange in den Stutzen einführen.
„Blödes Ding. Hör auf dich zu wehren!“, grunze ich, als es nicht sofort klappt.
Der Stutzen – als der Klügere – gibt schließlich nach.
Gas einlassen. Nur nicht zu viel, sonst fliegt mir alles um die Ohren. Die hohe Kunst ist es, sich nicht selbst hochzujagen, was leider viel zu oft geschieht. Dann lieber zu wenig. Wenn die Lampe nicht die ganze Nacht durchhält, ist es mir auch egal.
Kanister lösen.
Augen schließen.
Konzentrieren und Energien bündeln.
Atmen.
Und los.
Ich sammele die Hitze in mir und lasse sie sich in der Lampe mit dem Gas verbinden und es entzünden.
Dieses Mal läuft es erfolgreicher. Keine Verbrennungen und zudem ein ausreichendes Licht.
„Na, geht doch.“
Stange raus, alles eingepackt und weiter geht es. Nein, interessant ist solch ein Arbeitsalltag nicht.
Ich drehe meine Runde. Mache mir bei der einen oder anderen Fangkugel eine geistige Notiz: Sollte mal repariert werden. Austauschen. Dringend austauschen! Nicht, dass mich irgendwer fragt. Ich werde es weitergeben und alle werden es ignorieren.
Die Nacht ist ruhig, auch wenn in vielen Gebäuden noch gearbeitet wird. Das ist ja einer der Gründe, warum in diesem abgewrackten Teil Lutissias nachts die Lampen überhaupt brennen sollen.
In den runtergekommenen Hallen wird rund um die Uhr produziert, besonders seitdem der Platz in der Stadt immer knapper wird.
Nur gelegentlich kommt mir ein abgerissener Tagelöhner entgegen, den Blick fest auf die matschigen Schuhe gerichtet.
Einmal weiche ich in eine Nische aus und lasse eine lärmende Gruppe zwielichtiger Gestalten passieren, bevor ich weitergehe.
Ärger meide ich lieber. Eigentlich wissen die Leute, dass bei uns Zündern nichts zu holen ist, aber besser ist besser.
Zu der durch die Löcher in meinen Stiefeln eindringenden Feuchtigkeit von unten gesellt sich dann auch noch ein beständiger Nieselregen, sodass ich gen Mitte meiner Runde schön gleichmäßig durchnässt bin.
Wasser tropft mir in den Nacken. Ich klappe den Kragen meiner Jacke hoch und ziehe die Rübe ein.
Als es dann auch noch kalt wird und sich der Regen langsam in Schnee verwandelt, ist meine Laune endgültig im Eimer.
Eine weitere Lampe brennt und ich schlurfe mit schmatzenden Schritten über die große Kreuzung Ecke 'Kaisers Glorie' und 'Blutige Furt'.
An einer der Lampen lehnt eine Gestalt. Als ich noch überlege, ob der Typ besoffen, krank oder irgendwie gefährlich ist, winkt er mir zu.
„Hey Arros“, stöhnt er.
„Talvin“, rufe ich erstaunt und renne zu ihm.
Ich habe Talvin an meinem ersten Tag hier in Lutissia kennengelernt. Kaum angekommen hatte ich mich auch schon im Gassenlabyrinth verlaufen. Ein kleiner dummer Junge vom Lande ist hier ein gefundenes Fressen für den Abschaum der Straße.
Nun, um es kurz zu machen, ein paar von diesen Bastarden schnappten sich mich, raubten mich aus und hätten mich möglicherweise auch umgebracht, wenn Talvin einem von ihnen nicht die Zündstange übergebraten, den Rest vertrieben und mir damit den Hintern gerettet hätte.
Die folgenden Tage päppelte er mich auf, ließ mich bei sich wohnen und besorgte mir sogar meine Stelle als Zünder.
Eigentlich wollte ich ja zur Armee. Nein, nicht zu den normalen armen Schweinen. Zu den Energisten. Dachte, mit meinem Talent würde ich dort sofort unterkommen und eine steile Karriere beginnen.
Reichtum, Abenteuer und Frauen! Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass es nicht ganz so gelaufen ist.
Vorstellig geworden, Fragen beantwortet und wieder weggeschickt worden. Bislang wurde ich noch nicht einmal vorgeladen. Aber ich gebe nicht auf, auch wenn ich so langsam die Hoffnung verliere. Bestimmt wäre es besser gewesen, daheim in Werrenbruk zu bleiben. Dort stinkt es zwar auch, aber nicht ganz so schlimm wie hier.
Talvin ist einige Jahre älter als ich, kleiner und kräftiger. Sein Lederschurz, von denen jeder von uns einen zum Schutz trägt, ist frisch angesengt.
Auch sein langes dunkles Haar ist an mehreren Stellen verkohlt und an Ärmeln und Beinen seiner Sachen kann ich ebenfalls Brandspuren entdecken.
„Rückkopplung?“, frage ich überflüssigerweise.
Er nickt schwach.
„Alles in Ordnung“, frage ich. „Ich meine, so halbwegs?“
„Jaja“, keucht er, „aber so ein heftiges Ding habe ich noch nie erlebt.“ Ich reiche ihm meine Hand und ziehe ihn auf die Beine. Er zittert und schwankt, bleibt mit der Lampe im Rücken aber stehen. Mit etwas Schneewasser wische ich ihm Ruß von Stirn und Wangen.
Seine Lider sind offen, aber so richtig scheint er mich nicht sehen zu können, wenigstens huschen seine Pupillen wild hin und her.
Neben den Haaren haben auch seine Augenbrauen etwas abbekommen, oder um es anders zu sagen: Sie sind nicht mehr da. Weggebrannt. Da hat jemand seine Schutzbrille ebenfalls nicht getragen.
„Ist heute keine gute Nacht“, sage ich, „hat mich vorhin auch getroffen. Liegt vielleicht an all dem Zeug in der Luft.“
Ich muss ihn stützen, damit er nicht wieder in sich zusammensackt.
„Danke“, krächzt er schließlich, „ich muss weiter.“
Er will losgehen, prallt aber sofort gegen die nächste Wand. Ich fange ihn auf, hake ihn unter und führe ihn die Straße hinunter.
„Ich übernehme das“, sage ich, „für dich ist heute Schluss.“
Er protestiert noch ein paar Schritte schwach, verstummt dann aber, als er einsieht, wie hart es ihn getroffen hat.
„Ich schulde dir was.“
„Ach quatsch“, sage ich und meine es auch so.
Ich helfe ihm zurück zu unserem Quartier – nicht mehr als ein kleines Zimmer, wo wir unsere Sachen lagern können - und lege ihn auf einer wurmstichigen Holzbank ab.
„Danke“, murmelt er, „ich schulde dir was.“
Ich grinse. Da braucht jemand echt Ruhe.
„Schon fertig, ihr zwei?“, kreischt jemand hinter uns.
Ich schlucke schwer und fahre herum: „Noch nicht, Parik.“
Unser geliebter 'Vorarbeiter'. Als ob die verdammten Beamten jemals arbeiten würden.
Empört zieht er seine Brauen hoch: „Verzeiht, Meister Parik“, schiebe ich eilig nach.
Du verdammter Trottel, füge ich gedanklich hinzu.
Parik ist so gemein, wie er klein ist. Und er ist nahezu winzig. Mit seinem spitzen Kinn und der winzigen Brille mit den runden Gläsern erinnert er mich immer an eine Mischung aus Maus und Maulwurf. Wenn ein Arsch ein Gesicht hätte, dann wäre es seines.
„Was ist mit ihm?“, quiekt Parik so hoch, dass ein Kastrat neidisch würde.
„Er kann nicht mehr“, murmele ich, „eine schwere Rückkopplung. Die Luft ist heute ziemlich aufgeladen.“
„Ihr seid alle Versager. Versager. Versager!“, schreit er, bis sich seine Stimme zu überschlagen droht und fuchtelt mit seinen geballten Fäustchen.
„Ich mache seine Runde fertig“, unterbreche ich seinen Wutanfall.
Parik verstummt. Seine Glubscher werden zu kleinen schwarzen Nadeln und er beginnt debil zu grinsen.
„Ach ja, ist das so? “, fragt er selbstgefällig. „Hoffentlich weißt du auch, dass Talvin heute zusätzlich die Sondertour durch die Schlachthäuser machen muss.“
„Mist“, entfährt es meinem Freund leise, „verzeih, das habe ich vergessen.“
Ich kriege Kopfschmerzen.
Und wieder dieses süffisante Grinsen.
„Kein Problem, Meister Parik. Ich bin sofort unterwegs.“
„Das wäre wohl besser. Und wenn bis Mitternacht nicht jede einzelne Lampe brennt, behalte ich euren Lohn ein. Der ist ohnehin viel zu hoch.“
„Das könnt Ihr doch nicht machen“, hole ich aus.
„Bis Mitternacht!“, quietscht er und schlägt mit den Händen nach unsichtbaren Fliegen.
Ich gebe Talvin noch einen Klaps auf die Schulter.
„Ich schaffe das schon“, sage ich zuversichtlich und laufe los.
***
„Verdammt! Verflucht! Verflixt!“, ist mein Mantra für den Weg. Ausgerechnet die Schlachthäuser. Und ausgerechnet heute. Und ausgerechnet ich!
Die Schlachthäuser sind eben genau das: Eine Ansammlung von Schlachthäusern, die sich zu beiden Seiten eines Kanals aufreihen.
Der Blutkanal. Ja, die Leute der Gegend sind nicht gerade für ihre originellen Namen bekannt.
Heute stehen viele der kleineren Häuser leer oder dienen einem anderen Zweck. Absteigen. Kneipen. Hurenhäuser. In den Seitengassen treibt sich allerlei lichtscheues Gesindel herum. Verzweifelt. Hungrig.
Warum wir dort jeden Abend die Lampen entzünden müssen, entgeht meinem Verstand. Talvin sagte mir mal, er habe gehört, dass das auf einem Erlass aus der Zeit vor dem letzten Krieg stamme. Damals sei in dem Viertel Nahrung für die Truppen produziert worden. Tag und Nacht. Nachdem der Krieg vorbei war, verwaiste die Gegend, der Erlass aber blieb bestehen.
Jemand anders hat mir mal erzählt, dass die Obrigkeit Angst habe, dass die Leute dort im Dunkeln völlig austicken würden.
Eine Erklärung ist so einleuchtend wie die andere. Jedenfalls ist es unsere Aufgabe den Blutkanal jeden Abend – oder zumindest an jedem Abend, an dem Parik jemanden dazu einteilt - zu erleuchten und dabei möglichst nicht getötet zu werden. Wobei Letzteres Parik ziemlich egal ist und dies somit zur Straftour wird, wenn jemand unserem geliebten Herrn dumm kommt oder er sonst aus einem Grund einen schlechten Tag gehabt hat.
Ich fluche noch eine Weile vor mich hin, dann habe ich immerhin meine eigene Tour beendet und stehe am Blutkanal.
„Verdammt! Verflucht! Verflixt!“, murmele ich vor mich hin.
Ich lausche.
Alles ist ruhig.
Irgendwo quiekt etwas.
Oder jemand?
Im Schatten der Häuser schleiche ich zur ersten Lampe.
Stange in Stutzen einführen.
Konzentrieren.
Eventuell bin ich abgelenkt. Vielleicht liegt tatsächlich etwas in der Luft. Jedenfalls verdampft die Feuchtigkeit aus meiner Kleidung, als sich der Elementar seinen Pfad durch meine Eingeweide bahnt.
„Verdammt! Verflucht! Verflixt!“
Heute Nacht wird das nichts mit zügig.
Ich nehme mir ein paar Minuten, um wieder zu mir zu kommen, dann haste ich umso schneller weiter.
Die nächsten Lampen brennen ohne Probleme. Soeben fange ich an, daran zu glauben, dass der Abend vielleicht doch noch so halbwegs reibungslos über die Bühne geht, da fegt eine der kleinen Ein-Personen-Flugscheiben aus dem Nichts kommend nur wenige Zentimeter über mich hinweg.
Ich werfe mich mit dem Gesicht voran in den Dreck. Freilich viel zu spät. Das Ding hätte mir den Schädel abgesäbelt, ohne dass ich etwas dagegen hätte unternehmen können.
Ich hebe den Kopf und wische mir den eisigen Dreck von Kinn und Mund. Soeben überlege ich, ob es sicher ist dem Arsch hinterherzubrüllen – besser nicht, wer so ein Ding fliegt, kann es sich in der Regel leisten, ist reich, adelig oder sonst irgendwie wichtig – da folgt eine zweite Scheibe dicht auf.
Mit einem schrillen Pfeifen verschwinden beide Flugscheiben hinter den gewaltigen Schornsteinen der Fabriken. Fluchend erhebe ich mich aus dem Matsch, der sich wunderbarerweise einen Weg in die Ärmelaufschläge gebahnt hat und nun langsam bis zu den Ellenbogen rinnt.
Die Lederschürze hat das Schlimmste abgehalten, meine Hose nicht; die spielt nur Schwamm.
Mein Mantra wird also heute Abend noch benötigt.
Eine Weile wische ich bis ich einsehen muss: Besser wird es dadurch nicht.
Ich schnappe mir die Zündstange, da kehrt erst das eine, dann auch das zweite Fluggerät zurück.
Die Flieger umtanzen einen der hohen Schlote. Wer auch immer auf den Scheiben steht, hat Ahnung vom Fliegen. Todesmutig steigen sie auf, stürzen wieder hinab und versuchen einander zu rammen. Immer wieder kann ich das Metall von Klingen blitzen sehen.
Wie lange ich schon mit offenem Mund dagestanden habe, kann ich nicht sagen, da krachen die Scheiben ineinander.
Trudelnd und kreischend gehen sie tiefer. Die Piloten klammern sich an ihren Fluggeräten fest. Ich sehe, wie einer mit baumelnden Beinen in der Luft hängt und sich gerade noch so am Rand festhält.
Mit strampelnden Beinen versucht er vergeblich, sich hochzuwuchten. Gerade noch rechtzeitig zieht er die Beine ein, sonst hätte es ihn gegen einen Schornstein geknallt.
Der andere Kerl nutzt die Gelegenheit, geht auf die Knie und schlägt zu. Sein Gegner schwingt seine Beine hoch und springt auf die Scheibe seines Kontrahenten, die unter dem gemeinsamen Gewicht sofort ausbricht.
Die beiden Gestalten haben einander umschlungen und versuchen sich gegenseitig von dem Gefährt zu befördern.
Die Scheibe dreht einen nahezu perfekten Kreis um mich und geht dabei ständig tiefer, bis sie schließlich ein Dach streift und dem Flug damit ein unsanftes Ende bereitet wird.
In einem chaotischen Knäuel rollen sie alle gemeinsam hinab, schlagen Ziegel los und verschwinden aus meinem Sichtfeld. Etwas kracht lautstark, dann wird es still.
Am besten ich beende die Tour und verschwinde.
„Ach Mist“, seufze ich und mache mich auf die Suche nach der Absturzstelle. Ob ich jemandem helfen möchte oder doch nur die Leichen plündere, muss sich erst noch herausstellen.
Zu meinem großen Erstaunen sind beide Piloten jedoch noch äußerst lebendig.
Ein großer Typ steht mit dem Rücken zu mir und schlägt mit einem Knüppel nach dem am Boden liegenden anderen Kerl.
„Oh“, ist mein cleverer Kommentar, was jedoch ausreicht, damit sich der Große zu mir umdreht.
„Hey, ich bin schon wieder weg. Hab auch nichts gesehen“, murmele ich, als mir klar wird, dass in seiner Hand kein Knüppel, sondern ein riesiger fieser Säbel ist. Manchmal bin ich so verflucht tapfer.
Der Kerl hat seine Überraschung überwunden und beschließt, mir seine Waffe in den Bauch zu bohren. Irgendwie schaffe ich es, die Zündstange hochzureißen und die Klinge abzulenken. Metall fährt kreischend über Metall.
Während ich eines ums andere Mal der Klinge ausweiche, versuche ich ihn mit „Bleib ruhig“, „Warte mal“ und ähnlichen Bemerkungen von seinem Vorhaben abzubringen.
Das ich noch nicht getroffen wurde, ist ein Wunder. Der Kerl ist schnell.
Warum hilft der andere nicht mal?, fluche ich in mich hinein. Das Reden habe ich mittlerweile aufgegeben und verwende meinen Atem lieber dazu am Leben zu bleiben.
Wieder einmal weiche ich aus, bleibe irgendwo hängen und falle, mein Mantra laut in die Nacht hinaus brüllend.
Der Kerl steht über mir und grinst mich böse an. Wenn ich unter der Kapuze etwas anderes als Schwärze sehen könnte, würden seine Augen bestimmt dämonisch funkeln.
Ich habe schon mit meinem Leben abgeschlossen, da kracht ein greller Blitz in seinen Rücken und zaubert eine schöne Silhouette in die Nacht.
Die Luft wird mir aus den Lungen gepresst, als er auf mich fällt, aber die Waffe verfehlt.
Sein Gesicht ist dicht vor dem meinem. Pockennarben und ein sauber gestutzter Vollbart. Eine hässliche Narbe zieht sich quer über Stirn und das linke Auge – die beide eigentlich ganz normal aussehen. Nicht teuflisch funkeln, sondern eher verdutzt dreinblicken.
Seine Hände packen mich am Hals, dann merkt er aber wohl, dass sein Rücken schwelt. Narbengesicht rollt sich von mir runter und wirft seinen rauchenden Umhang fort.
Ein weiterer Blitz fegt durch die Gasse, verfehlt aber und sprengt nur einige größere Splitter aus der Wand. Der Kerl ist trotzdem so eingeschüchtert, dass er sich seine Waffe schnappt und sich davonmacht.
„Ja, lauf nur!“, rufe ich.
Derweil sich das Hallen seiner Schritte entfernt, liege ich einfach nur da, starre in die grünen Schwaden und versuche mir darüber klar zu werden, ob ich nicht doch irgendwo blute.
„Bursche!“, brummt eine tiefe Stimme, „was hältst du davon, wenn du aufstehst und mir hilfst.“
Es klingt mehr nach einem Befehl als nach einer Bitte.
Ich überlege, ob ich den Kerl nicht schlicht ignorieren soll.
Ach was soll es, so schön ist es hier am Boden auch nicht. Ich drücke mich aus der Matsch- und Müllschicht hoch.
Meine Beine sind noch ein bisschen wackelig und mein Hintern tut da weh, wo er nicht von Kälte taub ist. Ansonsten scheine ich unverletzt.
Jedenfalls körperlich. Mein Stolz und meine Selbstachtung hingegen, nun ja, reden wir nicht drüber.
Zum ersten Mal fährt mein Blick über den liegenden Mann. Zwei Faustwerfer liegen noch qualmend vor ihm. Er selbst wirkt gedrungen und kräftig. Das bärtige Gesicht macht es schwer sein Alter zu erraten, aber ich schätze ihn auf etwa fünfzig.
Kleidung und der funkelnde Degen, den er soeben wieder in die Scheide zurück schiebt, deuten auf Geld hin.
Um seinen Hals baumelt eine schicke Schutzbrille. Er muss in Eile gewesen sein. Keine Ahnung, warum er sie sonst nicht trägt.
Ich habe auch so schon genug Schwierigkeiten. Wahrscheinlich wäre es das Beste, gleich zu verschwinden.
„Bursche. Mein Name ist Durad und ich brauche deine Hilfe. Wie heißt du?“
Seine Stimme hat etwas Beruhigendes an sich. Mist!
„Arros“, antworte ich, ohne nachzudenken und schlage innerlich die Hände vor dem Kopf zusammen. Das war es endgültig mit dem Weglaufen. Ich werde ihm helfen müssen.
„In Ordnung, Arros. Ich bin verletzt. Du musst mir helfen. Okay?“
So ein bisschen klingt er, als würde er mit einem Schwachsinnigen reden.
Endlich löse ich mich aus meiner Erstarrung. Dort aus dem Haufen Müll und Schutt ragen die beiden Flugscheiben hervor. Knapp ein Schritt Durchmesser. Ein Wirrwarr aus Eichenstreben, Eisenplatten und Kupferröhren. Ein Wunder, das so etwas überhaupt fliegen kann.
„Die sind hinüber“, sage ich nach einer kurzen Untersuchung, „die Fangbehälter sind offen.“
Er mustert mich eingehend.
„Du bist ein Zünder. Du verstehst also ein wenig davon.“
Ich nicke, auch wenn 'ein wenig' deutlich übertrieben ist.
„Ja. Ohne einen geschickten Mechaniker fliegen die nicht mehr.“
Eine Weile schweigt er. Schiebt sich nur die Pistolen wieder in den Gürtel. Ich klopfe Dreck von meiner Kleidung.
Erst jetzt bemerke ich sein Schmerz verzerrtes Gesicht und die seltsame Haltung seines linken Beines.
Er nickt mir zu: „Dann muss es so gehen.“
„Das Bein. Gebrochen?“
Wieder nickt er.
Ich wühle in dem Haufen und finde eine Holzkiste, aus der ich zwei Bretter herausbreche.
Mit einem Messer aus seinem Gürtel – wie viele Waffen trägt der Kerl eigentlich bei sich? - zerschneide ich meine lederne Funkenfangschürze.
„Das wird wehtun“, sage ich überflüssigerweise, bevor ich sein Bein an meine improvisierten Schiene binde.
Er stöhnt zwischen zusammen gebissenen Zähnen auf. Seine Hände ballen sich zu Fäusten.
„Gib mir ein paar Sekunden“, ächzt er schwer atmend und wischt sich zitternd Schweiß von der Stirn.
Während Durad wieder zu sich kommt, mache ich Anstalten ich aus dem Müll eine Krücke zusammenzuzimmern, muss mich aber dann damit begnügen, ihm die Zündstange in die Hand zu drücken.
Mit Mühe ziehe ich ihn auf die Beine und lege mir seinen Arm über die Schulter. Er ist schwer. Einen guten Kopf kleiner, aber mit breiten Schultern.
„Wohin nun?“, frage ich.
„Zunächst einmal fort von hier. Nicht, dass noch jemand kommt, um nach dem Lärm zu schauen.“
Er klingt beunruhigt.
„Unwahrscheinlich“, meine ich, „hier in der Gegend kümmern sich die Leute normalerweise nur um ihren eigenen Kram.“
„Und du bereust es schon oder?“, lacht er.
„Noch nicht, aber wenn mich Meister Parik in die Finger bekommt, wird sich das ratzfatz ändern.“
Er lenkt mich um mehrere Ecken, wobei wir uns immer wieder umsehen. Vielleicht möchte er sich aber auch immer nur mal ausruhen. Dass sein Bein höllisch schmerzen muss, kann ich mir jedenfalls lebhaft vorstellen.
„Wer war der Kerl überhaupt und warum wolltet ihr euch gegenseitig umbringen?“, nutze ich schließlich eine Pause.
Er hockt auf einer niedrigen Mauer und sieht fast ein wenig weggetreten aus. Deutlich kann ich das Rasseln seines Atems hören.
„Zumindest die erste Frage kann ich nur mit einem: ‚Ich habe keine Ahnung‘ beantworten“, sagt er.
„Und die andere?“
Er sieht mich durchdringend an.
„Glaube mir, es ist besser, wenn du nichts darüber weist.“
„Und wer sagt mir, dass du .. Ihr nicht einer von den Bösen seid?“
Die Frage brennt mir schon lange auf der Zunge.
Er kramt an seinem Gürtel herum und wirft mir etwas zu. Ein Ring.
„Kein Antrag“, sagt er, als er meinen verwirrten Ausdruck bemerkt. „Was siehst du?“
Das schlechte Licht macht es nicht leicht. Ich drehe das Schmuckstück hin und her. Da reißt die Wolkendecke auf und im Mondlicht kann ich ein Kreuz erkennen – nein, kein Kreuz, ein X – das von drei parallelen 'I' gekreuzt wird.
„Scheiße. Ist das Ding geklaut oder seid Ihr beim Dreizehnten?“, frage ich ehrfürchtig und gebe ihm den Ring hastig wieder zurück.
„Du kennst also die Dreizehnte Kompanie? Dann kannst du dir ja ausmalen, was sie mit jemanden machen würden, der einem der Ihren den Ring klaut.“
Er lässt mir etwas Zeit dabei, die Sache zu verdauen. Damit ist die 'Guter oder Böser Sache' zwar noch immer nicht geklärt, aber ein Straßenräuber ist er jedenfalls nicht. Zumindest kein gewöhnlicher!
„Wenn du mir hilfst, dann wird es sicherlich nicht zu deinem Schaden sein. Die Angelegenheit ist kompliziert, deswegen kann ich dir nicht viel darüber sagen. Ganz davon ab, auch mir sind noch nicht alle Zusammenhänge klar.“
Wieder nicke ich.
„In Ordnung. Wo soll ich dich .. Euch .. hinbringen“, stammele ich.
„Ruhig, Kleiner. Bleib locker, dann kannst du Morgen schon deinen Freunden davon erzählen, wie du den Männern des Kaisers geholfen hast.“
Die Alternative, nämlich einem Mitglied des Dreizehnten nicht zu helfen, ist in diesem Moment keine Alternative, also ziehe ich ihn hoch und wir wanken Arm in Arm – wie ein Liebespaar oder eher wie Betrunkene – durch die Nacht.
An der nächsten Ecke braucht Durad wieder eine Pause. Nur wenige Schritt weiter wieder eine.
Eine Weile mustere ich ihn. Seine Brust hebt und senkt sich stoßweise. Der Atem pfeift. Das Gesicht ist schmerzverzerrt.
„Wo auch immer wir hin wollen“, sage ich, „es sollte besser nicht mehr weit sein.“
Er sieht mich böse an, seufzt dann aber: „Vielleicht hast du recht. Sieh dich mal um, ob du eine Kutsche“, er zögert, als er sich der Umgebung gewahr wird, „oder einen Karren findest. Und besorge gleich noch etwas Hochprozentiges.“
Aus den Weiten seines Umhangs zieht er einen Geldbeutel hervor und wirft ihn mir zu.
„Na los“, sagt er, als ich zögere, „und beeile dich. Ich hau schon nicht ab.“
Hinter der nächsten Ecke schaue ich in den Beutel. Voll mit funkelnden Goldmünzen.
Das ist mehr, als ich in einem ganzen Jahr verdiene. Für einen winzigen Moment rast der wilde Stier der Gier durch meinen Kopf. Der Gedanke 'Man bestiehlt kein Mitglied des Dreizehnten und bleibt am Leben' holt mich dann aber schnell wieder runter.
Eine Weile irre ich durch die verwinkelten engen Gassen. So richtig kenne ich mich hier nicht aus. Trotzdem finde ich irgendwann eine Kneipe. Mit zittrigen Fingern ziehe ich eine Handvoll Kupfergroschen aus dem Beutel und verstaue den Rest.
Das Innere des Ladens dient als Festung für den Bodensatz der Stadt. Heruntergekommene Tagelöhner trinken sich auf morschen Bänken um die kümmerlichen Reste ihres Verstandes und ihrer Barschaft.
Mit Geduld und Vorsicht schaffe ich es, an der Theke eine Flasche Fusel zu erstehen, ohne aufgeschlitzt zu werden.
Auch beim Verlassen versucht keiner der abgerissenen Gestalten mich umzubringen. Der Beginn einer Glückssträhne?
Draußen angekommen tausche ich den Geruch von Körperausdünstungen gegen Schwefel und Fäulnis. Wie angenehm! Hinter der nächsten Ecke nehme ich mir die Zeit, mein Zittern unter Kontrolle zu bekommen, bevor ich mich auf die Suche nach einem Transportmittel mache.
Zwischen zwei Lagerhäusern finde ich tatsächlich einen primitiven Handkarren, beladen mit einem Haufen Müll.
Zwar sehe ich keinen Besitzer, lasse aber trotzdem einige Münzen dafür da und so bin ich dann wenige Minuten später wieder bei Durad.
Er hat die Lider geschlossen. Ich denke schon, dass er tot ist, da hört er mich wohl kommen und schlägt die Augen auf. Sein Lächeln wirkt gespielt.
„Ich habe alles“, sage ich und reiche ihm die Schnapsflasche.
Er nimmt einen tiefen Zug und seufzt.
„Schon besser“, sagt er und nimmt einen zweiten.
Unter nicht unerheblichen Schwierigkeiten schaffe ich es, ihn auf den Karren zu heben. Er dirigiert mich weiter durch die Stadt. Bei jeder noch so kleinen Unebenheit hüpft und quietscht der Wagen lautstark, und damit auch Durad. Er versucht sein Bein stillzuhalten, leidet aber die ganze Zeit sichtlich.
So langsam nähern wir uns den besseren Gegenden. Der Dreck auf dem Boden ist nicht mehr ganz so tief und der Karren lässt sich deutlich einfacher schieben.
Dafür sorgt das Kopfsteinpflaster aber dafür, dass mein Fahrgast noch mehr hin- und hergeworfen wird.
Die mittlerweile beinahe leere Flasche macht die Reise aber halbwegs erträglich, wenigstens leidet er still.
„Halt hier“, befiehlt Durad schließlich, „den Rest gehen wir zu Fuß. Ich möchte nicht, dass uns das halbe Viertel hört.“
„Also das ganze Achtel?“, sage ich, doch mein Humor stößt auf taube Ohren.
Gemeinsam leeren wir den Rest der Flasche. Das Zeug schmeckt abstoßend, was Durad jedoch nicht zu stören scheint. Trotz des nur schwachen Lichts der Lampen sehe ich wie seine Wangen rot glühen. Er verzieht noch immer bei jeder Belastung seines Beines das Gesicht, aber der Alkohol hat seine Schmerz tötende Wirkung ausreichend entfaltet.
„Dann wollen wir mal“, grinst er und stützt sich auf meine Schultern. Wir humpeln und taumeln durch schmale Gassen, die zur Abwechslung mal nicht bis zum Anschlag mit Müll und Gerümpel voll sind, und irgendwelche halb verfaulten Kadaver liegen hier auch nicht. Das Leben scheint nicht gar so schlecht zu sein, wenn man reich ist. Erstaunlich, wie sauber Dinge sein können.
Allerdings fällt mir schon auf, dass wir die breiten Straßen meiden. Was ist, wenn Durad doch einer von den Bösen ist? Das Hauptquartier des Dreizehnten ist jedenfalls nicht hier.
„Wohin sind wir unterwegs?“, wage ich daher zu fragen.
„Keine Panik, Kleiner“, antwortet Durad schlicht und deutet auf eine Tür, nur wenige Schritt vor uns.
Der Dienstboteneingang des Hauses. Die hohen Damen und Herren wollen selbstverständlich nicht, dass der Pöbel ihre schicken Teppiche verschmutzt oder ihnen vor die Nase tritt, wenn sie es nicht wünschen. Wir sollen nur ihre Arbeit erledigen und nicht gesehen werden.
Mein Begleiter zieht einen Schlüssel hervor und öffnet die schwere Holztür, die ohne ein Murren aufschwingt.
Der Gang dahinter ist leer und wird von einer kleinen Elemantiklampe erhellt.
„Ich warte dann wohl hier“, murmele ich.
Durad sieht mich nur schief an: „Unsinn, Bursche. Du musst mich weiterhin stützen. Sonst ist niemand hier. Die Diener haben Ausgang.“
Mist, so einfach komme ich aus der Sache vermutlich nicht mehr raus!
Wir gehen durch eine Küche, in die allein mein Zimmer mehrfach hineinpassen würde.
Dahinter betreten wir die gewaltige Eingangshalle. Der Teppich ist so dick, dass ich fürchte, darin zu versinken. Statuen nackter Männer und Frauen säumen die Wände, an denen zahllose Bilder von Landschaften und Schlachten hängen. Von den silbernen Kerzenleuchtern, Kelchen, kleinen Figuren, Uhren und all dem Zeug, das die niedrigen Schränke bedeckt, könnte ich mich wahrscheinlich bis zu meinem Tod mühelos ernähren.
Eine Weile stehe ich reglos mit offenem Munde da, bis mich Durad ungeduldig zum Weitergehen bewegt.
Wir humpeln die breite bogenförmige Treppe hinauf. Auch hier ist alles voll von kostbarem Zeug, inklusive eines monströsen Kronleuchters aus Kristall, in dem hunderte winzige Lichter glimmen.
„Hoffentlich hält den die Decke aus“, murmele ich.
Durad lächelt nur, ob zustimmend oder genervt, ist schwer zu sagen.
„Wirsberg?“, ruft er plötzlich, „Eure Exzellenz? Seid Ihr da?“
Nach einer Pause angestrengten Lauschens: „Ich bin es, Durad.“
Er deutet auf eine der kunstvoll verzierten Türen, klopft und ruft noch einmal. Noch immer keine Antwort.
Wir drücken die Tür auf. Der Raum dahinter ist noch einmal eine Steigerung an Überfluss. Regale voller Bücher bedecken jede Wand. Im Lichte dutzender sauber brennender Lampen glitzern Gold und Edelsteine. Der Teppich ist noch dicker. Die Sessel in der Mitte des Raumes würden auch dem wohlbeleibtesten Menschen Platz bieten. Es riecht nach Leder und Blumen.
Da wir niemanden sehen, zieht mich Durad zu der doppelflügeligen Tür zu unserer Linken. Er klopft, dann schieben wir sie auf und treten aus der Ordnung des Lesezimmers in ein totales Chaos.
***
Um einen Schreibtisch herum, der in anderen Häusern als Esstafel für die ganze Familie gedient hätte, liegt ein Teppich aus Papier. Unterlagen, die jemand hastig durchsucht und beiseite geworfen hat. Zwei massive Stühle mit hohen Lehnen liegen umgestürzt gleich vor uns. Schreibfedern, ein Tintenfass und kleinere Büsten sind darum verteilt.
Noch immer in inniger Umarmung wanken wir hinter den Schreibtisch.
„Wirsberg“, entfährt es Durad, als er die Person auf dem Teppich liegen sieht.
Ich setze Durad vorsichtig ab, den Rücken gegen den Schreibtisch gelehnt, dann drehe ich den grauhaarigen Mann um.
Seine Kehle ist aufgeschlitzt. Viel Blut ist nicht zu sehen, da der feucht glitzernde Teppich unter ihm alle Flüssigkeit aufgesaugt hat.
„Nein“, murmelt Durad mehrfach und schüttelt sichtlich bestürzt den Kopf.
„Das war kein Einbruch, der schiefgegangen ist“, sage ich und deute auf all die kostbaren Dinge im Raum. Auch Kette und Ringe haben sie ihm nicht abgenommen.
„Bestimmt nicht“, sagt Durad, „das war gezielter Mord. Die haben was gesucht.“
Er deutet mit dem Daumen auf die Blätter hinter sich.
In der Ferne kracht etwas mehrfach.
Dann hämmert auch schon jemand mit der Faust an die Eingangstür.
„Was zum...? Sieh nach“, sagt Durad und zeigt auf das Fenster.
Ich schiebe die schweren dunkelgrünen Seidengardinen beiseite und hoffe einen Blick auf die Straße zu erhaschen. Mindestens ein Dutzend Soldaten haben einen Halbkreis vor dem Eingang gebildet.
„Im Namen des Kaisers. Ergebt euch und kommt heraus!“
Das Krachen wird lauter. Jemand wirft sich gegen das Portal.
„Wir müssen weg“, rufe ich.
Durad nickt grübelnd.
„Rauf. Wir müssen nach oben“, sagt er schließlich.
Ich ziehe ihn hoch. Er stöhnt auf, als sein Bein belastet wird.
Wir stolpern zu den Treppen und schleppen uns Stufe um Stufe hinauf. Uns gegenüber taucht eine Glastür auf, die auf einen Balkon führt.
Unten splittert etwas. Die Tür wird nicht mehr lange halten.
„Ich warte hier und halte sie auf“, stöhnt Durad als wir oben ankommen, „geh und suche eine Flugscheibe. Ich weiß, dass Wirsberg hier mindestens eine aufbewahrt.“
„Los geh“, brüllt er mich an, als ich nicht sofort reagiere.
Aus den Augenwinkeln sehe ich noch, wie er seine Faustwerfer zieht, dann laufe ich in den Flur zu meiner Linken.
Erster Durchgang. Ein Schlafzimmer.
Wo würde ich eine Flugscheibe aufbewahren? Wo würde ein Reicher eine Flugscheibe aufbewahren?
Hier jedenfalls nicht.
Eine Tür führt hinaus.
Ein Badezimmer. Was auch sonst. Die Badewanne bietet genug Platz für eine Handvoll Leute gleichzeitig.
Raus. Das Zimmer daneben ist voller Kleidung und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Ankleidezimmer. Viel zu viel für alles unter einer Hundertschaft.
Ich renne an Durad vorbei auf die andere Seite. Etwas summt und knistert, dann folgt ein lautes Krachen. Ich höre Schreie. Überraschung und Schmerz. Die Luft riecht nach Sommergewitter.
Eine verschlossene Tür. Ich werfe mich dagegen und pralle ab.
Drei Schritte Anlauf und ich stolpere unter dem Splittern der Tür in den Raum dahinter. Der Schwung reicht aus, um mich gegen irgendetwas stolpern zu lassen, das daraufhin zu Boden fällt.
Ich rappele mich auf. Es ist dunkel. Nur wenige schmale Linien aus Licht, die durch das Dachfenster dringen. Ich reiße es auf und sehe mich im fahlen Licht um.
Endlich ist mir das Glück hold. Auf einem Metallgestell steht eine Flugscheibe, die auch noch groß genug ist, um zwei Personen zu tragen.
Das ovale Ding ist reichlich schwer und lässt sich nicht besonders gut rollen, aber irgendwie schaffe ich es hinaus zur Treppe. Durad liegt in einer unbequem aussehenden Position am Geländer.
Sein Faustwerfer spuckt einen Blitz aus, der einem uniformierten Mann auf der Treppe in die Brust jagt und ihn stürzen lässt.
Ein zweiter Mann weicht aus und kommt mit erhobenem Säbel auf Durad zu.
Ich renne los und brülle. Der Mann schaut verdutzt auf. Ich pralle gegen ihn. Während der andere über das Geländer in die Tiefe fällt, lande ich neben Durad.
Ich hole die Flugscheibe zu uns hinüber.
„Leer“, sagt er, „ich lade sie auf. Du musst die Soldaten aufhalten.“
Er drückt mir die Faustwerfer in die Hände.
„Auch leer“, fügt er hinzu, „du musst die Fangbehälter laden.“
„Ich kann nicht“, stammele ich, „ich hab noch nie ..“
„Stell dir vor, es ist eine Lampe. Los!“
Er rollt sich beiseite und hat die Flugscheibe bereits in beiden Händen.
Meine panischen Blicke ignoriert er.
Ich nehme eine der erstaunlich schweren Waffen und konzentriere mich. Der Hitzeschwall rast durch mich hindurch.
Ob es geklappt hat?
Die zweite Waffe braucht länger. Die Geräusche am Fuße der Treppe lenken mich ab.
Dann taucht der erste Soldat in meinem Blickfeld auf.
Breitkrempiger Hut mit Pfauenfeder. Die Uniform in schönstem Dunkelblau.
Das ist sogar schlimmer, als ich gedacht habe.
Das ist einer vom Zweiten! Dem verdammten Zweiten Regiment! Der persönlichen Garde des Kanzlerkardinals! Was auch immer hier geschieht, wir stecken in echten Schwierigkeiten.
Der Kerl sieht mich, grinst breit und feuert.
Der Schuss geht dicht über meinem Kopf hinweg. Splitter und ein Schwall aus Rauch und Hitze fegen über meinen Rücken.
Er stürmt auf mich zu, dicht dahinter drei weitere Männer.
Ich hebe beide Faustwerfer und drücke ab.
Wenn ich nicht schon halb liegen würde, hätte es mich umgeworfen. Eine Feuerwolke hüllt alles um mich ein. Meine Augen tränen vor Rauch und Hitze. Sterne tanzen durch meinen Schädel. Meine Ohren klingeln.
Ich drehe mich auf die Seite und sehe zur Treppe. Einige Teppiche stehen teilweise in Flammen. Das Geländer schwelt. Eine Wache rollt sich brennend auf dem unteren Absatz. Ein anderer versucht ihn mit seinem Umhang zu löschen. Der Rest liegt in einem Knäuel daneben, versucht zu sich zu kommen und gleichzeitig zu entknoten.
Durad sagt etwas, das von dem Pfeifen in meinen Ohren verschluckt wird.
„Raus“, brüllt er und deutet zur Balkontür.
Ich drücke ihm die Waffen in die Hände und ziehe ihn auf der Scheibe liegend über die Bohlen.
Ich trete die Balkontür auf und drehe mich um, da richtet Durad soeben die Waffe auf eine gebeutelt aussehende Wache, die vorsichtig ihren Kopf hochreckt, und drückt ab.
Der Blitz verfehlt ihn knapp, zwingt ihn aber zum Rückzug.
Auf dem Balkon deutet Durad auf die Scheibe: „Du musst fliegen.“
„Aber ich hab noch nie ..“
„Stell dich in die beiden Vertiefungen und versuche das Gleichgewicht zu halten.“
Durad setzt sich mit dem Rücken zu mir, zieht seinen Gürtel durch eine der Metallschlaufen im hinteren Teil und wickelt sich das andere Ende um das Handgelenk.
„Konzentriere dich auf die Scheibe.“
Ich tue wie mir geheißen.
Nichts passiert.
Etwas knistert und knallt und mein Haaransatz kribbelt.
„Los!“, brüllt Durad.
Doch tatsächlich spüre ich, wie sich etwas öffnet. Ähnlich wie beim Entzünden einer Straßenlampe; nur ganz anders.
Kein Brennen auf der Haut. Nicht das Gefühl, als steige eine Fieberwelle durch den Körper.
Ein kühler Schwall, der in alle Richtungen gleichzeitig fliehen möchte. Tatsächlich schaffe ich es, den Druck an den Seiten einzusperren.
Die Scheibe hüpft einige Male, dann hebt sie tatsächlich ab.
„Richtig so. Mach weiter.“
Wir taumeln hin und her. Ein Blitz rast an uns vorbei und sprengt einen Teil des gegenüberliegenden Hauses. Ein Regen aus Schindelsplittern ergießt sich in die Tiefe.
Wir steigen weiter auf. Beinahe bleibt die Scheibe am Geländer hängen, dann schweben wir über der Straße.
Wieder schießt etwas an uns vorbei.
Ich beschleunige und fliege über das schon beschädigte Dach hinweg.
Soeben glaube ich, das Ding unter Kontrolle zu haben, da stürzt es in die Tiefe. Ich fange uns ab, bevor wir auf dem Pflaster aufschlagen, dann hüpfen wir wie ein Stein den man auf dem Wasser springen lässt dahin, nur sind wir der Stein und das Wasser ist Stein. Kein schöner Ritt, aber immerhin werden die Rufe leiser.
„Bring uns weg. Die Ladung wird nicht mehr lange halten.“
„Toll, was denkt Ihr, was ich hier mache!“
Volle Konzentration.
Die Vorderkante pflügt einmal durch den Straßendreck, dann ziehe ich unser Fluggerät hoch.
Ich kriege Kopfschmerzen.
Wieder kracht es. Rechts von uns trudelt eine näherkommende Scheibe durch die Luft. Durad streckt seinen Arm in mein Sichtfeld.
„Stillhalten“, brüllt er.
Ein zischender Blitz rast davon und trifft den Angreifer. Für einen kurzen Moment steht die Flugscheibe still, von einer bläulichen Aura eingehüllt, dann fällt sie mit ihrem Piloten in die Tiefe.
Wir haben eine Chance, denke ich gerade, da fegt ein weiterer Flieger nur knapp an uns vorbei. Ich spüre einen scharfen Schmerz an der linken Schulter. Blut läuft aus einem fiesen Schnitt.
Wir fallen mehrere Schritt bevor ich die Scheibe wieder unter Kontrolle habe.
Ich gehe tiefer, bis wir knapp über dem Pflaster hängen. Es fällt mir immer schwerer, uns in der Luft zu halten.
Der Angreifer dreht über uns einen Bogen, dann rast er von schräg vorne heran. Die Knöpfe der Uniformjacke funkeln im ersten Licht des Morgens, als er eine der Schwefelwolken durchpflügt. Er kommt näher, den schweren Säbel locker in der Hand. Die Zeit scheint sich zu verlangsamen.
„Er hat uns gleich“, wimmere ich, da schiebt mir Durad eine Waffe vor die Nase. Ohne großartig nachzudenken, nehme ich sie, lege an und schieße.
Der Kerl versucht noch auszuweichen, aber er ist nur wenige Schritt von uns entfernt. Der Blitz trifft ihn voll und wirbelt ihn von seinem Gefährt. Beide verschwinden aus meinem Gesichtsfeld.
Danach schlängeln wir uns immer langsamer werdend durch winzige Seitenstraßen, bis letztlich die gesamte Energie verbraucht ist und sich die Scheibe kein Stück mehr bewegt.
„Ich bin zu ausgebrannt“, meint Durad kopfschüttelnd, „wir müssen wohl laufen. Nur fort.“
Nur weil ich auch schon ganz schön fertig bin, sage ich: „Meine Wohnung ist nicht weit von hier.“
Keine gute Idee!, schreit eine kleine Stimme in meinem Kopf.
***
Für den Katzensprung zu meiner winzigen Unterkunft nahe der 'Gasse der stolzierenden Huren' – ja, so heißt sie wirklich – brauchen wir gefühlt Stunden.
Um so glücklicher bin ich, als ich Durad – meine nicht unerhebliche Last - auf dem Gequietsche ablegen kann, das ich als mein Bett nutze.
Kein Vergleich zu Wirsbergs 'Palast'. Ein Zimmer. Wurmstichiger Möbelersatz. Halb mit Holzlatten verrammelte Fenster. Die wenigen Glasteile sind so schmutzig, dass kaum noch Licht hindurchfällt.
„Hast du Alkohol da?“, fragt Durad mich keuchend.
Tatsächlich finde ich in einer Ecke noch eine halbe Flasche Wein oder etwas, das gerade noch so dafür durchgehen könnte.
Durad nimmt einen Schluck und verzieht angewidert den Mund.
„Damit kann man sich nicht mal waschen“, grummelt er, greift an seinen Gürtel und wirft mir einen weiteren klimpernden Beutel zu. Gehorsamer Diener, der ich bin – das der Kerl vom Dreizehnten kommt, macht mir noch immer Angst – besorge ich ihm in einer der kleinen Kaschemmen an der Ecke ein halbes Dutzend Flaschen billigen Weins.
Zurück im Zimmer leert Durad die Flaschen zügig, wobei immer mehr auch die Obstkiste durchtränkt wird, die mir als Tisch dient.
„Wie wäre es, wenn Ihr mir mal erklärt, was da draußen gerade passiert ist?“, nehme ich all meinen Mut zusammen.
Durad schaut mich eine Weile aus leicht glasigen Augen an, dann seufzt er: „Du hast recht, Kleiner.“





























