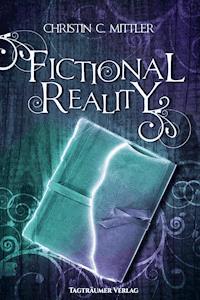
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tagträumer Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wenn ein Anderer deine Geschichte schreibt, was wärst du bereit zu tun, um sie zu ändern? Der Unfalltod ihrer Familie reißt Alexandra in ein tiefes Loch. Als habe sie nicht genug mit ihrem Verlust zu kämpfen, passieren zudem immer häufiger unerklärliche Dinge. In ihr keimt ein schrecklicher Verdacht. Etwas, das alles, woran sie glaubt, auf den Kopf stellt. Doch kann es ihr womöglich auch das wiederbringen, wonach sie sich am meisten sehnt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jessica StrangStapenhorststraße 1533615 Bielefeld
www.tagträ[email protected]
Buchsatz: André Ferreira
www.andre-ferreira.de
Lektorat / Korrektorat: Sabine Wagner
www.bookloververlag.lima-city.de
Umschlaggestaltung: Designs and Cover -
Linda Woods; www.designs-und-cover.de
Bildmaterial: © Depositphotos.com
ISBN: 978-3-946843-03-0
Alle Rechte vorbehalten
© Tagträumer Verlag 2017
CHRISTIN C. MITTLER
FICTIONAL REALITY
Für all die, die schon einmal das Gefühl hatten, dass ihre Figuren ein Eigenleben entwickeln.
Meine Mutter hatte zu lange einen ihrer Kitschromane gelesen und daraufhin verschlafen. Fluchend hetzte sie zwischen Badezimmer und Küche hin und her. Dabei hatte sie eine Zahnbürste im Mund, ein Handtuch einem Turban gleich um den Kopf gewickelt, unternahm gleichzeitig den verzweifelten Versuch, ihre Löckchen zu bändigen, und zog ihr Oberteil falsch herum an. Als sie schließlich das Frühstücksmüsli geistesabwesend in die Toilette schüttete, griff ich ein.
Obwohl ich genau dieses Verhalten früher regelmäßig verflucht hatte, liebte ich es. Weil es mir sagte, dass sich nichts veränderte. »Mum, wenn du dich schon schminkst, solltest du dich auch um beide Augen kümmern«, bemerkte ich, während ich mich im Badezimmer an ihr vorbeischob. Für gewöhnlich schminkte sie sich nur zu besonderen Anlässen wie Familienfeiern oder wichtigen Besprechungen – so wie heute.
Sie lag uns seit Tagen mit dieser Präsentation in den Ohren. Mindestens fünf Mal hatte sie uns erklärt, weshalb sie sie halten musste und was genau das Thema war. Aber ich würde es wohl auch beim hundertsten Mal nicht verstehen. Meine Mutter arbeitete in der Nahrungsmittelbranche. Sie entwickelte die tollen Produkte, die letztendlich kein Mensch brauchte: Zuckerfrei, fettreduziert, light und was die Weight Watchers-Gruppen sonst noch gierig entgegennahmen, ohne es zu hinterfragen.
Doch sie versuchte, wirklich zu helfen, weshalb sie, wann immer die Zeit dazu da war, an Möglichkeiten arbeitete, den Hunger der Welt zu stoppen. Letztes Jahr war sie sogar nach Afrika geflogen, um sich persönlich einen Eindruck von der Lage machen zu können. Aber ihre Chefs waren nun einmal darauf aus, Gewinne zu machen – das stand im Vordergrund. Also ging ihre Genialität im Labor im Grunde unter. Stattdessen entlud sie sich in dem kreativen Chaos, das sie unser Haus nannte.
Man sollte meinen, jemand der mit Stoffen herumexperimentierte und aufpassen musste, niemanden zu vergiften, sei ein wenig organisierter. Und das war eines der faszinierendsten Dinge, die ich bisher bei einem anderen Menschen miterlebt hatte. Als habe sie zwei verschiedene Persönlichkeiten.
»Besser?«, fragte sie und drehte sich zu mir um. Ich hob den Daumen nach oben und nahm ihr die Wimperntusche ab, um mich selbst zu schminken. Ich hatte mehr Übung darin als die Frau, der man auch ohne Make-up nicht ansah, dass sie 25 Jahre älter war als ich. Wenn ich später so aussah, würde ich glücklich sterben können. Nebenan hörte ich, wie sie inzwischen eine meiner zwei Schwestern aus dem Bett nötigte.
Das Exemplar, dessen nölige Proteste gekonnt ignoriert wurden, war Emily. Die mir trotz ihrer dreizehn Jahre auf den Kopf spucken konnte. Ich gehörte nicht zu den größten, sie hingegen war für ihr Alter riesig. Und sie war ein Papakind. Es grenzte an ein Wunder, dass sie sich überhaupt von jemand anderem wecken ließ. Wenn auch nur unter Gewaltandrohung, so wie sich das anhörte. Ich steckte den Kopf in ihren rosa Albtraum eines Zimmers. Dafür, dass sie behauptete, erwachsen zu werden, waren die vier Wände ein Traum für Disneyprinzessinnen.
Über ihrem Dornröschen-Schreibtischstuhl hing sogar ein Kleid, das ich aus einem Zeichentrickfilm kannte. Ich konnte mir das Grinsen kaum verkneifen, während ich zusah, wie meine Mutter den Kleiderschrank aufriss und Sachen herausschleuderte, als packe sie für eine Flucht. Kaum entdeckte Emily mich in der Tür streckte sie mir die Zunge heraus. Als ich keine Anstalten machte, ihr aus dem Weg zu gehen, spuckte sie mich an.
Der schwesterliche Teil wollte es ihr gleichtun. Er wollte mich dazu bringen, über den Pickel auf ihrer Stirn zu lästern, der »breiter als dein Hintern« war. Doch dann warf ich einen Blick auf die kitschige Barbie-Uhr. Die Zeiger verrieten mir den Grund, weshalb die Hektik meiner Mutter inzwischen zur Panik geworden war: Es war bereits zwanzig vor acht. Bei der Geschwindigkeit, mit der Em sich fertigmachte, müsste jemand das Beamen oder eine Zeitmaschine erfinden, damit sie pünktlich kam. »Soll ich Mellie in den Kindergarten fahren?«, fragte ich an den Türrahmen gelehnt, während Emily in einen Rollkragenpullover gezwängt wurde, der einmal mir gehört hatte. Das blaue Stück mit der großen Schneeflocke darauf stand ihr besser als mir. Mir hatte er fast bis zu den Knien gereicht, ihr lag er locker auf den Hüften.
»Es ist glatt draußen«, bedachte sie zögernd. »Es ist doch gestreut. Wenn nicht, könnten wir direkt den Notstand ausrufen. Die paar Kilometer werden uns schon nicht umbringen«, erwiderte ich schulterzuckend. Sie zweifelte weiterhin. Dann jedoch sah auch sie noch einmal auf die Uhr. Viertel vor acht.
Mellies Kindergarten lag in entgegengesetzter Richtung zur Schule und ihrer Arbeit. Ganz zu schweigen von den Minuten, die das Winterwetter und das dementsprechend langsame Fahren kosten würden. Schließlich nickte sie, ohne ein erleichtertes Lächeln verbergen zu können.
Ich wandte mich ab und ging zum dritten der fünf Räume im oberen Stockwerk. Die Tür war nur angelehnt – eine Seltenheit. Als wir noch jünger waren, hätten Em und ich sie nicht nur verschlossen, sondern am liebsten eine Matratze daran festgenagelt. So hätten wir ein bisschen mehr Ruhe vor den nächtlichen Babyweinkrämpfen gehabt.
»Hey Mellie«, sagte ich mit einer Stimme, die eine Spur höher war als üblich. Ich begab mich auf die Höhe meiner Schwester, die auf ihrem Teppich mit Labyrinthmotiv saß und mit einer Puppe spielte. Ein Exemplar, das sprechen, lachen und weinen konnte. Der linke Arm hing ausgekugelt herunter, seit Emily in einem Wutanfall das brabbelnde Stück gegen die Wand geworfen hatte. Es war mir ein Rätsel, wie sie das machte, aber Melanie wachte jeden Morgen um Punkt sieben Uhr auf. Unabhängig von unseren Eltern, einem Wecker oder einem Weltuntergang vor der Tür. Sie wurde wach und blieb es auch mindestens bis zum Mittagsschlaf - und selbst den verweigerte sie immer häufiger. Wenn Emily vor neun Uhr aufstehen musste, schlief sie spätestens in der ersten Unterrichtsstunde wieder ein. Meine Eltern führten regelmäßig Unterhaltungen mit ihren Lehrern darüber, dass sie die Bücher als Kissen benutzte. Mellie legte den Kopf schief und lächelte mich mit ihrem Milchzahnlächeln an, das ich so liebte. Ich war vernarrt in sie. Absolut vernarrt.
»Was hat Mum dir denn da angezogen?«, fragte ich sie mit einem Lachen und blickte auf das orangefarbene Ungetüm, das jemand als Pullover verkauft hatte. Er war ihr mindestens eine Nummer zu groß und ließ ihre Ärmchen aussehen wie die eines Kraken. Dazu eine tannengrüne Strumpfhose mit Löchern. Eine Hose fehlte gänzlich. Ich wusste nicht, ob ich belustigt oder genervt sein sollte. »Du siehst aus wie Maggie bei den Simpsons, wenn sie diese komische Sternenjacke anhat«, kommentierte ich und nahm sie auf meinen Arm. Sie wurde immer größer, wurde mir bewusst. Und schwerer. Die Vorstellung, dass sie schon bald nicht mehr das kleine Mädchen sein würde, stimmte mich einen Augenblick wehmütig.
Mit ihrer tatkräftigen Unterstützung, die sich in »Jaaaaa!«, begeistertem Wackeln oder lautstarker Ablehnung ausdrückte, suchte ich ihr etwas Akzeptables zum Anziehen heraus. Ich packte ihre dünnen Beinchen in eine neue Strumpfhose, die sich kaum über ihre Windel ziehen ließ. Sie hatte erst vor Kurzem begonnen, das Töpfchen zu benutzen und den Dreh noch nicht ganz heraus. Dann packte ich eine Latzhose aus Jeansstoff darüber. Dazu ein roter Pulli, in dem sie nicht wie ein überdimensionaler Stressball aussah.
»Soll ich dir die Haare flechten?«, fragte ich sie. Ein weiterer Blick auf die Uhr. Acht Uhr. In spätestens einer halben Stunde musste ich sie abgegeben haben. Meine Mutter hingegen brach vermutlich gerade einige Verkehrsregeln, um halbwegs pünktlich zu sein. Ich flocht ihr die langen Haare zu zwei Zöpfen, die mich an die Gretelzeichnung aus meinem alten Märchenbuch erinnerten, bevor ich sie Huckepack nahm und mit flugzeugähnlichen Geräuschen hinunter in die Küche brachte.
Sie liebte es. Besonders wenn ich oder unser Vater das taten. Wir gaben uns die größte Mühe. Meine Mutter verzichtete darauf, seit sie sich dabei einmal einen Nerv eingeklemmt hatte und Emily hatte keine Zeit für solchen ‚Kinderkram’. Mein Dad war bereits aus dem Haus. Auf dem runden Küchentisch lagen noch die Zeitung und eine Tasse mit den schwarzen Resten von etwas, das er Kaffee nannte. Viel zu stark. Eklig.
Ich ließ Melanie auf einen der Stühle sinken. Obwohl sie durchaus in der Lage war, selbst zu gehen, protestierte sie lautstark und streckte die kurzen Ärmchen nach mir aus. Ich widerstand der Versuchung, ihrem kleinen Schmollmund nachzugeben und suchte die Kaffeekanne, um von dem braunen Wunder zu retten, was noch zu retten war.
Zur selben Zeit versuchte ich, meiner Schwester eine Schale Haferschleim schmackhaft zu machen. Ich hätte einen Oscar für diese Glanzleistung verdient, denn das Zeug bereitete mir selbst Brechreiz.
Ich fand die Kaffeekanne schließlich auf der Gästetoilette, was einen neuen Rekord im Chaoshaushalt darstellte. Wie hatten sie das hinbekommen? Nachdem ich gefühlt einen Liter Milch und ein halbes Kilo Zucker dazugetan hatte, suchte ich nach einem Thermobecher. Der fast schon zwanghafte Blick auf die Uhr sagte mir, dass auch meine Zeit abgelaufen war.
Ich steckte meine Schwester in eine Jacke, die sie wieder wie Maggie Simpson aussehen ließ, und kämpfte mich in Schneeschuhen und Mantel zu meinem Auto.
Winter is coming war nicht nur das Motto der Starks, sondern auch das meiner Heimatstadt. Der Schnee vom Wochenende war allerdings schon wieder geschmolzen. Mit Ausnahme des Schneemanns Olaf – in Anlehnung an Disney so getauft. Ich sollte recht behalten, was die Straßenverhältnisse betraf.
Ich konnte nahezu normal fahren. Wir würden den Kindergarten sogar überpünktlich erreichen. Da mein Wagen jedoch immerhin halb so alt war wie ich, fuhr ich deutlich vorsichtiger als sonst. Und wann immer ich es mir erlauben konnte, warf ich einen Blick nach hinten, wo Mellie begeistert zu einem Kinderlied klatschte. Glücklicherweise hatte ich ihre Lieblingskassette.
Mein Wagen gehörte zu den wenigen, die noch kein CD-Laufwerk besaßen. Zehn Minuten später gab ich meine Schwester in die Arme einer hundert Kilo schweren Dame mit Schneewittchenfrisur.
Passenderweise erinnerte sie mich daran, dass sie morgen einen Prinzessinnentag planten. Damit wir daran dachten, sie zu verkleiden. Als ob Mellie uns damit nicht schon seit einer Woche in den Ohren lag.
Ich behielt die Frage, was sie an solchen Motto-Tagen mit den Jungs machten, für mich. Wurden auch sie in Kleider gesteckt? Eine Alternative wäre Mulan, aber selbst dann würden sie vermutlich eines Tages viel Geld für Therapiestunden bezahlen dürfen.
Da die Grippewelle vor Lehrern nicht zurückschreckte, fielen meine Kurse in der Schule aus. Deshalb vergeudete ich meine Zeit zu Hause mit Netflix. Fünf Stunden Hanibal ließen mich an der Menschheit zweifeln und weckten den Wunsch, es doch mit Vegetarismus zu versuchen. Die halbe Stunde auf unserem Crosstrainer gab mir kein besseres Gefühl, da mein Aufwand durch eine anschließende Schokoladenfressorgie vernichtet wurde.
Später fragte ich mich, ob ich etwas anders gemacht hätte, wenn ich die Zukunft gekannt hätte. Anfangs bejahte ich das, ohne groß darüber nachzudenken. Dann wurde mir klar, dass das kaum möglich gewesen wäre. So oder so war ich alleine zu Hause an diesem Vormittag, Mittag und Nachmittag. Um mein schlechtes Gewissen wegen der Schokolade zu unterdrücken, räumte ich das Wohnzimmer auf. Wobei ich den klassischsten aller Fehler beging und auf einen dieser leicht übersehbaren Legosteine trat. Ich schrie, als versuchte jemand, mir ohne Narkose den Fuß zu amputieren und ich schwor, dass es in Wahrheit nicht schmerzhafter sein konnte.
Nachdem sich Mrs. Finnigan von nebenan versichert hatte, dass ich nicht von einem Serienkiller gefoltert wurde, beschloss ich humpelnd, das Abendessen zu kochen. Ich war keine berauschende Köchin, aber meine Lasagne war legendär. Auch wenn Em aus Prinzip jedes Mal das Gegenteil behauptete und dann doch so viel aß, bis sie Bauchschmerzen bekam.
Ich wedelte wie ein Idiot mit den Händen, um meine beschlagenen Brillengläser wieder gebrauchen zu können, als aus dem Wohnzimmer der Refrain von Nothing Else Matters erklang. Metallica war die Lieblingsband meines Vaters. Obwohl ich ihn mir nie auf einem Konzert vorstellen konnte. Nicht ohne Bierdusche, weil ich ihn im Anzug vor mir sah. Selbst an den Wochenenden trug er zumindest Hemden.
»Hey Dad«, begrüßte ich ihn und quetschte mein Handy zwischen Ohr und Schulter, damit ich nicht mit dreckigen Fingern auf dem Display herumtatschen musste. »Wehe, du willst mir sagen, dass du heute später kommst. Ich koche.«
»Nein, nein, keine Panik. Ich wollte dir nur sagen, dass du Mellie nicht abholen brauchst. Ich mache früher Schluss und sammle dann deine Mutter und deine Schwestern ein. Wir sind in spätestens 45 Minuten da.«
Ich runzelte die Stirn, während ich den Ofen vorheizte. »Stimmt was mit Mums Wagen nicht? Der hat letzte Woche schon so komische Geräusche gemacht, als ich den Motor starten wollte. Ich war’s nicht«, fügte ich aus Gewohnheit hinzu. Er lachte kurz. »Nein, nein«, wiederholte er dann. »Aber hast du in den letzten Stunden mal aus dem Fenster gesehen?«
Ich rannte zu dem kleinen, quadratischen Küchenfenster. Die Wolkendecke vom Morgen war tief grau geworden und ließ eine pampige Mischung aus Regen und Schnee hinab. Obwohl es nicht einmal vier Uhr war, konnte ich kaum bis ans Ende der Straße sehen.
»Ich möchte nicht, dass sie bei diesem Wetter fährt. Sie hat seit Tagen zu wenig geschlafen. Ich will auch nicht, dass du noch irgendwo hinfährst.« Ich nickte. »In Ordnung. Wollte ich sowieso nicht. Ich warte dann hier auf euch mit einer hoffentlich nicht verbrannten Lasagne. Fahr vorsichtig«, fügte ich hinzu.
Das waren die letzten Worte, die ich zu meinem Vater sagte. Es hätte schlimmer sein können. Trotzdem dachte ich später oft daran, welche Grausamkeit in diesem Scherz des Universums lag. Als ich nach einer Stunde noch immer alleine war, dachte ich mir nichts dabei. Auch nicht nach fast anderthalb Stunden. Das schlechte Wetter, dazu die Dunkelheit. Sie mussten jeden
Moment durch die Haustür kommen – über die Kälte meckernd und mit knurrenden Mägen.
Ich deckte den Tisch und drehte das Radio auf, um Geräusche um mich herum zu haben. Ich hasste Stille. Ich konnte mich besser konzentrieren, wenn irgendwo Musik oder der Fernseher lief. Dann waren auch schon zwei Stunden vergangen. Allmählich machte ich mir doch Sorgen. Vielleicht standen sie im Stau?
Auf der Landstraße, die zur Firma meiner Mutter führte, gab es häufiger Zwischenfälle. Raser, Lkws, die zu spät merkten, dass sie zu groß und zu schwer für die Brücken waren… Aber dann hätten sie angerufen. Irgendwann, als ich die Lasagne fast zu einem Viertel aufgegessen hatte und meinen vollen Magen verfluchte, versuchte ich, sie zum dritten Mal anzurufen.
Doch weder meine Mum noch mein Dad oder meine Schwester gingen an ihr Handy.
»Hey, Em, ich bin’s. Vermutlich hast du deinen Akku mal wieder leergezockt – dachte eigentlich, dazu hättest du deinen Nintendo-schlag-mich-tot. Wenn nicht, sag Dad mal, er soll sich bei mir melden. Ihr macht mir langsam echt Angst.«
Nach drei Minuten klingelte mein Handy endlich. Aber es war niemand aus meiner Familie, sondern die Polizei. Sie war es auch, die kurze Zeit später vor der Haustür stand. Nicht weit vom Kindergarten entfernt waren zwei Wagen von der Straße abgekommen – niemand trug Schuld daran, zumindest würde das später im Unfallbericht stehen. Ein Smart hatte an einer roten Ampel nicht halten können, hatte den Wagen meines Vaters erfasst und von der Straße geschleudert. Ich hätte nie erwartet, dass so ein kleiner Wagen so viel Schaden anrichten konnte.
Die Fahrt beider Autos stoppte an einer Straßenlaterne.
Der Smartfahrer überlebte. Mit einigen Rippenbrüchen und einer Kopfverletzung hatte er sofort operiert werden müssen. Doch bereits am nächsten Morgen war er außer Lebensgefahr. Nicht dass ich darüber wirklich hätte nachdenken können; man sagte es mir einfach. Mellie war sofort tot.
Der Aufprall hatte die Halterung ihres Kindersitzes gelöst. Sie war durch den Wagen geschleudert worden. Ein Detail, das in jedem meiner Albträume erscheinen sollte. Meine Mutter schaffte es noch, Emilys Gurt zu lösen. An manchen Tagen versuchte ich mich damit zu trösten, dass sie in dem Glauben gestorben war, wenigstens sie retten zu können. Augenzeugen zufolge war Emily noch aus dem Wagen geklettert, während Mum gegen das Metallstück, das aus ihrer Brust ragte, nicht länger hatte ankämpfen können.
Mein Vater wurde von der Feuerwehr aus dem Wagen geschweißt. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus an inneren Blutungen. Aus denselben Gründen starb schließlich auch Emily, als man im OP versuchte, sie zu retten.
Diese Details erfuhr ich erst später - von einem untersetzten, rothaarigen Polizisten, der höchstens zehn Jahre älter als ich sein konnte. Ich konnte ihm ansehen, dass der Unfall auch an ihm nicht spurlos vorbeiging. Er war freundlich und versuchte, mich so schonend wie möglich zu behandeln. Er stammelte, fuhr sich ständig durch die Haare und wechselte von einem Bein aufs andere. Ich erinnerte mich erst später an sein Verhalten. Als er und sein Vorgesetzter mir gegenübersaßen, sah ich nur Schwärze und Sternchen vor mir.
Kaum hatten sie zu Ende gesprochen, brach ich zusammen. Es benötigte die Polizisten, einen Arzt und Medikamente, um mich ruhigzustellen. Sie schickten mich ins Krankenhaus, um mich über Nacht beobachten zu können.
Einen Monat später lag ich auf meinem Bett. Das war das erste Mal, dass ich misstrauisch wurde. Ich lag einfach dort. Genau genommen hatte ich, seit ich im Krankenhaus gelandet war, nichts mehr getan. Ich trauerte. Ich trauerte so sehr, wie es sich vermutlich nur wenige vorstellen konnten.
Ich hatte an einem einzigen Abend meine gesamte Familie verloren. Mein ganzes Leben. Ich schlug die Augen auf und lag mit einem Mal hier, ohne zu wissen, wie ich hierhergekommen war oder dass ich hätte gehen können. Ich fühlte mich, als hätte ich geschlafen, doch auch daran konnte ich mich nicht erinnern. Woher ich wusste, dass ein Monat vergangen war?
Die Uhr auf meinem Nachttisch verriet es mir. Es war, als hätte sich alles um mich herum bewegt – nur ich nicht. Wieso war ich hier? Wo ich doch glaubte, das Krankenhaus nicht einmal verlassen zu haben. War es nicht gestern erst gewesen, dass jemand an meiner Tür geklingelt hatte?
Ich wollte die Arme ausstrecken, um nach dem Wecker zu greifen. Womöglich war die Batterie leer, weshalb die Anzeige verrücktspielte. Aber meine Finger bewegten sich nicht.
Nicht einmal ein Stück. Und dann fiel mir ein, dass das quadratische Ding auf meinem Nachttisch über Strom betrieben wurde.
Vielleicht hatte es einen Stromausfall gegeben? Dann brauchte er schon mal ein paar Minuten, bis er wieder richtig lief. Dass ich auch davon nichts mitbekommen hatte, hatte offensichtlich nichts zu bedeuten. Ich wartete und wartete. Fünf Minuten. Zehn Minuten. Nichts veränderte sich. Ein Monat? Wie war das möglich? Mit einem Mal glaubte ich, etwas auf meinem Rücken zu spüren.
Als drücke jemand gegen mich, richtete ich mich mit einem Mal auf. Ich war überraschend wacklig auf den Beinen und musste mich an meinem Schreibtischstuhl festhalten, um nicht umzukippen. Aus den Augenwinkeln sah ich, was sich vor meinem Fenster tat: Ein Vogel baute sein Nest in dem Baum, dessen Äste mir ständig die Sicht auf die Straße versperrten.
Aber es war doch Winter. Tiefster Winter. Die Straßen waren glatt gewesen… Nichts davon war zu sehen. Kein Eis, kein Schnee, nicht einmal Regen. Die Sonne schien genau in den Raum und wärmte mich augenblicklich. Sogar zu sehr. Denn ich trug noch immer meinen dicken Pullover. Ich verließ den Raum und, kaum trat ich über die Türschwelle, geschah das, was ich befürchtet hatte. Der Schmerz drohte mich zu überwältigen.
Als sei mein Zimmer eine Art Schutzraum gewesen, die Tür, die mich vom Rest trennte, eine Mauer, hinter der ich mich hatte verstecken können. Ich ging durch den engen Flur und hörte nichts, mit Ausnahme des knarrenden Holzes unter meinen Füßen. Da war dieses eine Stück kurz vor der Treppe, das Dad schon vor Wochen hatte austauschen wollen. Meine Mutter hatte immer befürchtet, eine von uns – insbesondere Mellie – könne sich daran verletzen.
Sie hatte nicht gewusst, dass Em es hingegen geliebt und als Versteck genutzt hatte. Hatte. Denn nun konnte sie es nicht mehr tun. Tränen brannten in meinen Augen, während ich hinunterging. In meinem Kopf glaubte ich zu hören, wie meine Schwester lachte. Alles in mir fühlte sich schwer an. Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte. Wie auch? Es war ja niemand hier, mit dem ich sprechen könnte.
Die Küche sah nicht anders aus als an diesem Abend. Selbst die Reste der Lasagne standen noch dort. Aber sie sah frisch aus. Das alles ergab doch überhaupt keinen Sinn. Wie konnte ein Monat vergangen sein und gleichzeitig knüpfte alles an diesen furchtbaren Abend an? Und wieso war ich überhaupt in der Lage, an etwas Anderes zu denken?
Ich wollte aufräumen, um all das nicht mehr sehen zu müssen. Dass ich den Abend auf dem Sofa verbracht und Serien geguckt hatte, als sie… Ich musste meine Hände beschäftigen. Aber ich tat es nicht, sondern ging ins Wohnzimmer. Auch hier war alles wie am Vorabend. Wie an DEM Abend, korrigierte ich mich wie von selbst. Doch ich hatte den Raum noch nicht einmal vollständig überblickt, als es an der Tür klingelte. Ich hatte die Melodie – irgendein altes Volkslied – nie gemocht, weil sie mir zu lang war. Eine halbe Minute Klingeln, selbst wenn man die Tür nach fünf Sekunden öffnete. Es war der beste Garant, kleine Kinder zu wecken, die gerade erst nach langem Kampf eingeschlafen waren.
Jetzt gab es ja niemanden mehr im Haus mit leichtem Schlaf. Also war diese Melodie nur noch Hohn. Einen Augenblick überlegte ich, es zu ignorieren. Die dreißig Sekunden abzuwarten, bis es aufhörte. Dann weitere, die derjenige vor der Tür vermutlich klopfen, rufen oder einfach schweigen würde – je nachdem, wer mit welchem Grund gekommen war. Womöglich gab es noch einmal dreißig Sekunden mit Greensleeves – genau, das war es gewesen! – aber nach spätestens zwei Minuten wäre ich wieder alleine. Ich wusste nicht, ob ich das wollte. Dementsprechend schienen sich meine Füße wie von selbst zu bewegen, als ich zur Haustür ging. Vor der Tür standen drei Männer. Der eine war mein Onkel Rupert, ein untersetzter Mann mit zu vielen Haaren im Gesicht, der meist nur Weihnachten hierherkam. Seit unserer letzten Begegnung war sein Schnauzer noch mehr gewachsen und verdeckte vollständig die kleine Fläche zwischen der breiten Nase und den spröden Lippen. Seine Lederjacke spannte sich eng über seinen Bierbauch. Über der Brusttasche war noch immer der Fleck zu sehen, den er Em zu verdanken hatte. Sie hatte kurz zuvor erfahren, aus was Leder hergestellt wurde und war mit jeder greifbaren Soße auf ihn losgegangen.
Während unsere Eltern wenig begeistert waren, hatte ich mir vor Lachen beinahe in die Hosen gemacht. Der zweite Mann kam mir vage bekannt vor. Erst nach einigen Momenten erinnerte ich mich, dass er im Krankenhaus gewesen war. Nur hatte er kein Wort mit mir gesprochen. Der Dritte war mir so fremd wie ihm offensichtlich Haare. Seine Glatze schien im schwachen Sonnenlicht zu glänzen.
»Ja?«, fragte ich, statt sie zu begrüßen. Ich musste mindestens so schlimm aussehen, wie ich mich fühlte. Sie sahen mich an wie einen Obdachlosen auf der Straße. Pikiert und verunsichert, bevor die Fluchtgedanken dominierten. Aber abgesehen davon, dass ich mich fragte, ob ich stank, kümmerte es mich nicht sonderlich.
»Alexandra?« Ich verstand nicht, weshalb mein Onkel fragte. Er sollte seine Familie kennen – zumal davon nun nicht mehr viel übrig war. Wir waren nicht mehr viele. Wir waren niemand mehr - außer mir. Wer sollte also sonst die Tür aufmachen? Ich nickte. »Können wir reinkommen?« Ich zuckte mit den Schultern, trat jedoch einen Schritt beiseite. Die drei Männer folgten mir ins Wohnzimmer. Mir fiel dabei auf, dass auch sie sich verstohlen umsahen. Ich fragte mich, was sie dachten. Ob ihnen dasselbe durch den Kopf ging wie mir? Suchten sie einfach nach etwas, dass sie statt mir ansehen konnten? Oder fiel ihnen die Unordnung auf, das Sonderbare, das mich am Rande beschäftigte?
Vermutlich hielten sie es für normal. Normal? Was war hier noch normal? Wir setzten uns auf das Sofa, das noch von meinem Netflixmarathon gezeichnet war. Mein Handy lag auch noch auf dem Tisch. Es blinkte, aber zum ersten Mal wollte ich nicht sofort danach greifen und nachsehen. Die Begleiter meines Onkels stellten sich als Mitarbeiter des Jugendamtes vor.
Einer von ihnen war Psychologe, der andere Sozialarbeiter oder aus der Verwaltung, ich warf es durcheinander. Der Glatzkopf mit dem Trenchcoat und dem penetranten Zigarettengeruch erinnerte an einen pensionierten Polizisten, der nun auf eigene Faust arbeitete. Es war schwer, ihn anders zu sehen oder ihn so ernst zu nehmen. Aber seine mitleidige Miene schien ernst gemeint. Ich wollte sie nur nicht sehen.
Bei dem anderen hatte ich richtiggelegen. Er war im Krankenhaus gewesen, um nach mir zu sehen. Ein vom Staat vorgeschriebener Besuch, weil ich jetzt Vollwaise war. Das Wort hallte in meinen Ohren nach und bereitete mir Kopfschmerzen.
»Möchte jemand etwas trinken?«, fragte ich der Höflichkeit halber, dabei wusste ich nicht einmal, was wir noch im Haus hatten. Wie war das noch gewesen? Wasser, Wasser besaß jeder. Milch und Orangensaft, Emily und Melanie inhalierten beides förmlich. Hatten inhaliert. Der Kaffee war sicherlich leer. Er war immer alle, weil meine Eltern gefühlt mehr davon getrunken, als Nahrung zu sich genommen hatten.
Hatte, hatte, hatte. Ich hasste dieses Wort. Ich ging noch einiges an Getränkemöglichkeiten durch, bis mir auffiel, dass ich mich damit nur ablenken wollte. Sie schüttelten alle den Kopf, sodass sie mir keine Möglichkeit boten, ihnen zu entkommen. Mit einem Mal verspürte ich ein unheimliches Verlangen. Ich fürchtete mich vor dem, was nun kam.
Dennoch beschloss ich, nicht länger um den heißen Brei herumzureden: »Was gibt es denn?« Ich ging mir durchs Haar. Ein Fehler, denn es war vollkommen verknotet. Als wüsste ich nicht, wie man eine Bürste benutzt. Mir wurde erst im Nachhinein bewusst, wie lange ich auf eine Antwort wartete. In dem Moment selber bemerkte ich kaum, dass ich mit dem Chaos auf meinem Kopf kämpfte, während mein Blick an meinem Onkel hing. Schließlich räusperte er sich verlegen. Er mied meinen Blick, fixierte einen Punkt hinter mir. Vermutlich das hässliche Gemälde, das meine Mutter einmal von einer Geschäftsreise mitgebracht hatte. Ein Geschenk von irgendeinem Herrn aus Kapstadt. Trotz Fotos stellte ich ihn mir wie einen Schamanen mit Tierknochen um den Hals aus dem primitivsten Dorf vor. Das Bild hätte man dort auch malen können.
Ein Durcheinander aus Erdtönen und Grashalmen, von dem wir stets behauptet hatten, dass selbst Mellie das hinbekommen würde.
»Es geht um das Haus«, sagte Rupert schließlich mit dieser kratzigen Stimme, als sei er erkältet. »Ich denke… wir denken… es ist ein sehr großes Haus und du lebst hier…«
»… alleine«, führte ich den Satz zu Ende. Es war leichter, es selbst zu sagen. Etwas sagte mir, dass die Worte aus seinem Mund zu hören, mich krampfen lassen würde. Ich konnte es nicht. Wie auf Kommando nickten meine Gegenüber.
Mit einem Mal schien alles in mir taub zu werden. Ich befürchtete, meine Zunge würde mir nicht mehr gehorchen. »Ihr wollt mich aus dem Haus schmeißen«, brachte ich dennoch hervor. Meine Stimme klang fremd, geradezu ausdruckslos.
»Das ist alles, was euch beschäftigt?«
»Nein, nein.« Beschwichtigend hob er die Hände. An seinem rechten Ringfinger glänzte die Stelle, an der bis vor Kurzem noch ein Ehering gewesen war. Vor wenigen Wochen hatte seine Frau seine Koffer gepackt und sie ihm vor die Tür gestellt. Über die Gründe gab es einige Theorien, aber die Wahrheit kannte niemand außer ihnen.
»Du magst dich mit deiner Lage abgefunden haben«, bemerkte ich, während meine Augen die blasse Stelle nicht loslassen konnten.
»Aber das hier ist mein Zuhause. Ich lass es mir nicht wegnehmen.«
»Das möchten wir auch nicht. Niemand möchte das, Alexandra.« Er beugte sich auf dem Sofa vor, sodass sich seine Jacke gefährlich spannte.
»Wir alle haben in den letzten Wochen viel durchgemacht. Dein Vater war mein einziger Bruder. Ich habe ihn geliebt, wie ich auch seine Familie liebe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es dir geht. Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, dass du hierbleibst…«
»Ich kann mich um alles kümmern«, flüsterte ich. »Wenn es darum geht. Das tue ich häufiger. Das Chaos in der Küche ist nicht normal für mich. Daran kann man mich nicht festmachen, ich hatte seit dem Krankenhaus noch keine Gelegenheit, das muss man doch …« Ich stockte, als ich sah, wie sich etwas im Gesicht des Glatzkopfs veränderte. Seine hellen Augen – ein Blauton, der beinahe ins Graue überging – weiteten sich.
Die Pupillen rutschten hin und her. Seine Finger zuckten, als wolle er sich etwas aufschreiben. »Wovon sprichst du?«, fragte er bemüht ruhig. Seine Stimme hatte einen einladenden Ton, der bei Psychologen zur Jobausschreibung gehören musste.
Niemand wollte mit jemandem sprechen, der wie die singende Fette Dame in Harry Potter klang.
»Wann warst du im Krankenhaus?«
»Nach dem Unfall natürlich. Sie waren doch dort«, wandte ich mich an den, der bisher geschwiegen hatte.
»Sie wollten mich nicht gehen lassen, nachdem sie mir… nachdem ich erfuhr, dass…«
»Alexandra.« Ich hasste die Art, wie mein Onkel meinen Namen aussprach. Der Ton war ähnlich wie bei meinem Vater. Ein strenger, aber bemüht nicht zu strenger Klang, der Ärger vorhersagte.
»Du weißt, dass der Unfall bereits vor einem Monat war, oder?« »Natürlich«, erwiderte ich, bevor ich genauer darüber nachdenken konnte. Ich spürte, dass eine andere Antwort mir nur noch mehr Probleme bereitet hätte. Ich sah es in ihren Augen, in den kleinen Falten auf ihrer Stirn, die nichts mit ihrem teils fortgeschrittenen Alter zu tun hatten. Aber wenn wirklich ein Monat vergangen war, wie war es dann möglich, dass hier unten alles gleichgeblieben war?
Ich konnte nicht einen Monat vergessen oder gar in meinem Bett verbracht haben. Es konnte nicht so lange her sein. Es fühlte sich nicht danach an. Sie konnten nicht schon so lange weg sein. Und was war mit der Beerdigung? Wieso erinnerte ich mich nicht daran? Wer würde so grausam sein und mich davon ausschließen? Es war die letzte Möglichkeit, mich zu verabschieden… Von allem, was ich gekannt und geliebt hatte. Von meiner Familie… Ich spürte die Übelkeit in mir aufsteigen, Galle schien mir einen Moment den Hals zuzukleben, doch ich kämpfte dagegen an. Aus demselben Grund, weshalb ich nichts von all den Dingen, die ich wissen musste, meinen Onkel fragte.
Sie würden mich für verrückt erklären und noch schneller von hier fortbringen, als es ohnehin ihr Plan zu sein schien. Das war der einzige Gedanke, an den ich mich noch klammerte. Ich konnte und durfte nicht auch noch das Haus verlieren. Es war mein Haus, unser Haus. Ich hatte nie woanders gewohnt. »Ich kann mich um das Haus kümmern«, wiederholte ich leise und nun war ich es, die Blickkontakt vermied.
»Ich muss hierbleiben. Bitte.« Der Fremde schüttelte den Kopf. »Wir sind alles durchgegangen, es geht nicht.«
»Aber niemand hat mit mir gesprochen.« Es war das Einzige, dessen ich mir noch sicher war. Ich hätte nicht einmal sagen können, weshalb. Aber ich wusste es einfach. Und niemand widersprach mir in diesem Punkt. »Du bist erst siebzehn.« »Beinahe volljährig. Ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert.« Ich wollte niemanden. Mit Ausnahme meiner Eltern. Wieso verstand keiner, was in mir vorging? Weshalb taten sie so, als ginge es darum, ein neues Bett zu kaufen?
»Das solltest du aber.« Es war das erste Mal, dass der Mann aus dem Krankenhaus sprach.
»Dein Onkel hat mir erzählt, dass du dich seit… besagter Nacht vollkommen zurückgezogen hast. Du hast das Haus nicht verlassen, mit niemandem geredet. Das ist verständlich, doch halte ich es allmählich für nötig, dass sich das ändert. Es gibt nur sehr wenige, die nachvollziehen können, was dir passiert ist. Eben weil es so unbegreiflich schrecklich ist, solltest du dich jemandem anvertrauen.«
»Und dazu soll ich ausziehen? Mir wird der Zusammenhang nicht klar«, versuchte ich bemüht vernünftig zu sagen. Ich war mir nicht sicher, wie erfolgreich ich damit war. Angesichts der Tatsache, wie ich aussah, vermutlich nicht sonderlich.
Tränen schwammen in meinen Augen. Und ich brauchte eine Dusche, um den Schmutz und vielleicht sogar das hohle Gefühl in mir abwaschen zu können. Es wäre ein Anfang. Ein sehr kleiner Anfang. War es lächerlich, dass ich mich fragte, ob ich überhaupt dazu bereit war? Zu einer Dusche?
»Nicht zwangsläufig, nein. Aber dennoch sehe ich einen Zusammenhang. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir ebenso guttun würde, umzuziehen. Du kannst dieses Haus ohnehin nicht halten. Du gehst noch zur Schule. Selbst wenn nicht, findest du in den nächsten Wochen wohl kaum einen Job, der all die Rechnungen bezahlt.«
»Und wo soll ich sonst hin? In ein Waisenhaus?« »Karen hat vorgeschlagen, dass du bei ihr einziehst. Dort wärst du nicht alleine und in einem familiären Umfeld. Sie, wir, könnten uns um dich kümmern«, meldete sich mein Onkel abermals zu Wort. Familie. Mit einem Mal stellte ich mir vor, wie geschrumpft die Feier zum nächsten Geburtstag sein würde. Leere Stühle oder direkt ein kleinerer Tisch. Kein Mandarinenkuchen, weil nur Emily ihn gemocht hatte. Schweigen, weil Mellie nicht weinte oder mit dem Essen spielte, und niemand wusste, was man sagen konnte. Ich presste die Augen zusammen, um die Tränen zu verbergen.
Dieses Mal fiel es mir noch schwerer, mich nicht zu übergeben. Bei Karen zu wohnen, war vernünftig betrachtet vermutlich eine gute Idee. Aber sobald ich darüber nachdachte, sträubte sich etwas in mir. Wie konnte ich auch nur eine Sekunde aufhören, dafür zu kämpfen, hierzubleiben? Mein Vater hatte dieses Haus selbst gebaut. Oder zumindest die Leute herumgescheucht, die es gebaut hatten. Es entsprach den Wünschen meiner Eltern. Emily war in diesem Haus geboren worden, weil sie es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft hatten.
»Dann würde Tante Karen, die mich vielleicht ein Dutzend Mal gesehen hat, die Vormundschaft übernehmen, oder? Das steckt doch d hinter, wenn man zu jemandem zieht, bevor man volljährig wird.« Drei Monate. Nicht einmal.
Erst letzte Woche hatten meine Mom und ich zusammensitzen und über meine Geburtstagsparty reden wollen. Nein, in der Woche, bevor sie gestorben war, sagte ich mir. Es war nie dazu gekommen, die Arbeit hatte uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine dieser verpassten Gelegenheiten, von denen ich mir wünschte, ich könnte sie nachholen. Wenigstens eine…
»Nein. Bis du volljährig wirst, werde ich die Vormundschaft für dich übernehmen«, erwiderte mein Onkel, als hätte das nie zur Debatte gestanden. Ich wusste nicht, woher das Schnauben kam. Ich hatte nicht erwartet, dass ich an diesem Tag einen solchen Laut von mir geben konnte.
»Karen lässt dich nicht einmal auf das Grundstück, auf dem ich leben soll.« »Wir haben für diesen speziellen Fall eine Vereinbarung getroffen.« Die Bezeichnung ‚spezieller Fall’ verletzte mich. Wie lächerlich bei all dem, was geschah.
Sowohl mein Onkel als auch die Übrigen wiederholten noch einige Male in dieser bemüht zurückhaltenden und dennoch entschlossenen Art, dass ich ausziehen musste. Im Nachhinein war ich mir sicher, dass sie noch mehr Argumente brachten. Vielleicht begannen sie irgendwann sogar, über etwas Anderes zu sprechen. Ich hätte es nicht sagen können. Irgendwo zwischen der Vorstellung, in die Einliegerwohnung zu ziehen und dem peinlich berührten Gesicht meines Onkels driftete ich ab.
Ich sah ihre Münder, wie sie sich bewegten und all die Worte produzierten, die ich kaum ertrug zu hören. Ich blendete die tiefen Stimmen aus, die sich in meinen Kopf bohrten wie das hohe Schrillen von Sirenen. Je mehr ich über das nachdachte, was sie wollten, desto mehr schmerzte es. Es schien sich durch meine Haut in mein Inneres hineinzufressen und gesellte sich zu der Leere, die dort seit dem Anruf der Polizei herrschte. Zuerst dachte ich, sie würde die Angst vor dem Auszug verschlucken. Aber sie blieb. Beständig und voller Hunger, sich zu vergrößern. Doch das musste ich verhindern. Ich glaubte nicht, dass ich es überleben würde. Sie war bereits zu stark. Später konnte ich mich nicht genau erinnern, was in den vier Stunden danach geschah. Dunkel sah ich vor mir, wie man mich zwang, weitere administrative Dinge durchzugehen. Ein Termin beim Notar musste dabei gewesen sein. Ich war die Alleinerbin von allem, was meine Eltern besessen hatten. Offenbar mit Ausnahme des Hauses – zumindest, wenn es nach den Menschen um mich herum ging.
Alleinerbin… Allein… Mir schwebte vor, dass der Psychologe mich zu einer Sitzung mit ihm gedrängt hatte. Ich musste mir Tag und Uhrzeit irgendwo aufgeschrieben haben, denn mein Gehirn wollte es mir nicht verraten.
Erst, als mein Besuch verschwunden und ich zurück in meinem Zimmer war, glaubte ich, dass ich mich wieder halbwegs ordnen konnte. Doch sobald die letzten Geräusche der fortfahrenden Autos verstummt waren, legte sich eine unnatürlich Stille über das Haus. Ich irrte mich. Die Stille war noch schlimmer als das, was im Wohnzimmer geschehen war.
Ich war noch nicht bereit dafür, mich wieder meinem Leben zu stellen. Egal, wie viel Zeit vergangen oder auch nicht vergangen war. Nichts schien mehr so wie vorher. Dieses Zimmer war nicht der sichere Platz, an dem ich mich hatte verstecken können. Es wirkte nicht einmal mehr wie mein Zimmer.
Meine gesamte Umgebung erschien mir unwirklich. Alles schien anders. Ich bekam die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Von dem letzten Morgen, wie ich meine Mutter auf den Arm genommen und Mellie geholfen hatte. Aus dem Krankenhaus, als auch der letzte von ihnen gegangen war… Ohne dass ich sah, wohin ich mich bewegte, torkelte ich hinüber zu meinem Bett wie ein Betrunkener.
Ich sank auf die Matratze, rollte mich zusammen und weinte. Stunden um Stunden. Erst war es eine Erleichterung. Als könnte ich einen Teil all dessen, was sich in mir aufstaute, wenigstens für einen Augenblick gehen lassen. Nur einen kurzen Moment, in dem sich alles in mir darauf richtete. Dann konnte ich nicht mehr aufhören. Als ich aufwachte, war mir bewusst, dass nur eine Nacht vergangen war. Eine Erleichterung, über die ich mich jedoch nicht freuen konnte.
Mein Körper fühlte sich abermals taub an. Ich konnte aufstehen, ohne dafür mehrere Anläufe zu brauchen. Und als ich dieses Mal die Wände meines Zimmers betrachtete, hielt ich nicht inne. Plötzlich überkam mich ein Verlangen, das ich nie zuvor gespürt hatte. Noch in meinen Kleidern vom Vortag lief ich herunter und räumte all das auf, was von dem Abend des Unfalls noch übrig war. Mehr als einmal hielt ich inne. Nachdem ich die Backform von der Lasagne befreit hatte, schlang ich die Arme um mich selbst und beobachtete die summende Spülmaschine wie hypnotisiert. Um nicht zu weinen, dachte ich umso intensiver an den grauenvollen Geruch, der noch immer in der Luft hing. Angesichts dessen grenzte es an ein Wunder, dass das Essen nicht auch danach aussah. Auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie das möglich war.
Als ich mit dem Erdgeschoss fertig war, erlaubte ich mir ein paar Tränen. Andernfalls wäre mein Kopf angeschwollen wie ein Kugelfisch. Seit dem Morgen war etwas in mir, dass ich zuvor nie gekannt hatte – und das mir selbst ein wenig Angst einjagte. Ich schnappte mir Mülltüten, die ich über Hände und Füße zog und wagte mich auf unseren spinnenverseuchten Dachboden. Ich konnte dort oben nichts anfassen, ohne zusammenzuzucken.
Mit mehreren Anläufen holte ich alte Umzugskartons und unsere Koffer herunter. Dass sich zwischen ihnen Gäste eingenistet hatten, bemerkte ich erst, als ich sie beinahe zertrat. Dann begann ich, mein Zimmer auszumisten und packte die wenigen Dinge, die ich behalten würde, ein.
Es gab keinen Ausweg. Es gab keine Chance mehr, dass ich noch bleiben durfte. Sie gaben mir Zeit, um zu entscheiden, was ich mitnehmen wollte. Doch gab es genügend Zeit, um ein ganzes Leben einzupacken? Um mich zu verabschieden? Wenn dem schon so war, würde ich nicht zulassen, dass jemand anderes noch entschied, was ich behielt. Ich würde alles durchgesehen haben, bevor mein Onkel auch nur auf die Idee kam, mir zu helfen und mich dadurch zu beeinflussen. Es war die einzige Entscheidungsmöglichkeit, die mir noch geblieben war.
Sie gaben mir vier Tage Gnadenfrist. Dann wollte mein Onkel mit einigen Bekannten und einem kleinen Lastwagen zurückkehren. Vier Tage, um das Leben, das ich kannte, selbst wenn ich in der Stadt blieb, hinter mir zu lassen. Dennoch nahm meine Eile, die Räume zu durchsuchen, nicht ab. Viel mehr verfiel ich in einen Rausch, der erst abnahm, als ich erschöpft zusammenbrach, um den nötigen Schlaf nachzuholen.
Mein Zimmer durchzusehen war das Leichteste. Hatte ich mich früher noch geweigert, auch nur ein Kleidungsstück oder eine DVD wegzugeben, konnte ich es kaum erwarten, alles um mich herum loszuwerden. Ich behielt nur meine Möbel und persönliche Dinge, die ich in zwei Kisten zusammenpacken konnte. Mit Ausnahme meiner Bücher. Es war unmöglich, mich zwischen ihnen zu entscheiden. Ich brachte es nicht über mich, auch nur eines abzugeben. Weder die, die bei mir waren noch die meiner Eltern oder Emilys.
Wann immer mein Blick auf eines davon fiel, strich ich mit zitternden Fingern über den Einband. Sie gehörten zu mir. Mein Vater hatte mir beigebracht, welcher Zauber sich hinter den gedruckten Zeilen verbarg. Welche Schätze man in den Händen hielt, bevor man auch nur die erste Seite aufschlug. Wenn es etwas Materielles gab, ohne dass ich nicht leben konnte, dann waren es Bücher. Ich mochte die Neuerungen der letzten Jahre - Serien auf Netflix gucken oder ein E-Book-Reader, auf dem ich mehr speichern konnte, als im Haus Platz war. Aber nichts davon übertraf das Gefühl, eine gedruckte Geschichte in den Händen zu halten, in die man sich verliebte. Ein Buch in den Müll zu schmeißen, grenzte an körperliche Schmerzen.
Auch wenn diese im Augenblick nicht an das herangekommen wären, was mein Innerstes aufzufressen schien. Auffressen. Das Wort schien durch meinen Kopf zu schweben, als nahezu einziger, vollständiger Gedanke. Ich war erstaunt, wie gut es meine Gefühle beschrieb. Alles zwischen meiner Magengegend und meinem Herzen schmerzte abwechselnd, als bahne sich ein Monster mit Krallen und Zähnen einen Weg hindurch.
Es schien mich von innen heraus zu zerfetzen. Dann gab es Momente, in denen sich alles tot anfühlte. Als habe mein Körper kapituliert. Ich wusste nicht, welcher Zustand schlimmer war. Tief in mir wusste ich, weshalb ich mit meinem Zimmer anfing. Oder danach die Küche und das Wohnzimmer durchsah. Ich war mehrmals im Haus meiner Tante gewesen.
Der Keller war vollständig ausgebaut, eine eigenständige Wohnung, die seit ihrem Einzug niemand mehr als solche benutzt hatte. Ich brauchte mir keine Sorgen um den Herd oder eine Waschmaschine zu machen. Aber in diesen Räumen zu arbeiten, hielt mich davon ab, die Zimmer meiner Schwestern zu betreten. Bis es unvermeidlich wurde. Sie waren wie schwarze Löcher. Sobald ich den ersten Schritt über die Schwelle setzte, schienen sie mich zu verschlingen.
Ich musste innehalten. So sehr ich mich davor fürchtete, glaubte ich gleichzeitig, das Gefühl zu brauchen, als alles, was jemals zwischen diesen Wänden geschehen war, auf mich einschlug. Als zeige es mir, dass ich noch nicht innerlich tot war. Ich weinte beinahe ununterbrochen. Die meiste Zeit war meine Sicht verschwommen. Ich musste mir die Spielzeuge von Emily und Mellie so nah vors Gesicht halten, dass ich sie mit der Nase berührte.
Nicht zum ersten Mal dachte ich an den Morgen, als sie alle noch bei mir gewesen waren. Hätte ich gewusst, dass es der letzte sein würde, wäre ich früher aufgestanden. Um meinem Vater dabei zuzusehen, wie er derart müde aus dem Schlafzimmer kam, dass er beinahe gegen den Türrahmen lief. Um Mum nach ihrer Präsentation zu fragen und dieses Mal zuzuhören. Oder um einen Moment länger stehen zu bleiben, um Emily und Melanie zuzusehen. Ich mochte es, Menschen zu beobachten, sie zu erforschen, wie meine Mutter einmal scherzhaft gemeint hatte.
»Du kannst gar nicht ohne. Du brauchst immer jemanden um dich herum.« Bei dieser Erinnerung stiegen mir abermals die Tränen in die Augen. Ich stieß ein freudloses Lachen aus, das in Schluchzern unterging. Es wurde schlimmer, als ich mich schließlich, als eine der letzten Hürden, um Mellies Kuscheltiere kümmerte. Sie hatten vor ihr bereits Emily und mir gehört. Mit jedem einzelnen verband ich unendlich viele Geschichten. Sie bedeuteten mir mehr als… Es war so stark, dass mir kein Vergleich einfiel.
Ich strauchelte, als mir ein kleiner Stoffpapagei in die Hand fiel. Mehrere Minuten starrte ich ihn an, ohne ihn zuordnen zu können. Es nicht zu wissen, machte mich nervös. Als habe ich etwas Wichtiges aus ihrem Leben nicht gewusst. Ich versuchte mich zu beruhigen und mir zu sagen, dass das nicht zwangsläufig so sein musste. Womöglich war er ein Werbegeschenk gewesen. Mein Vater hatte vergangenes Weihnachten jede Menge davon mitgebracht, von denen die Hälfte unnütz war. Ich stand kurz davor, ihn auf den Wegwerfhaufen zu werfen, als sich meine Hand wie von selbst um das kleine Stück schloss.





























