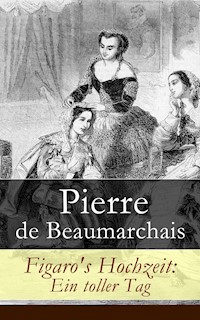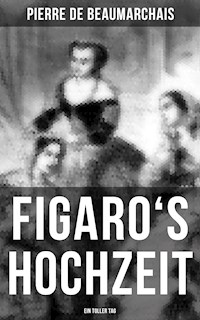
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Pierre de Beaumarchais' Werk 'Figaros Hochzeit: Ein toller Tag' ist ein Meisterwerk der dramatischen Komödie. Das Buch erzählt die Geschichte von Figaro, einem cleveren Diener, der in ein Netz aus Intrigen und Liebesverwirrungen verwickelt wird. Mit scharfem Witz und einer genauen Beobachtung der sozialen Hierarchie macht Beaumarchais subtile politische Kommentare und kritisiert die Ungerechtigkeiten seiner Zeit. Der autoritative und elegante Erzählstil des Autors verleiht dem Buch eine zeitlose Qualität, die auch heute noch fasziniert und unterhält. 'Figaros Hochzeit' fügt sich nahtlos in die Tradition des komplexen französischen Theaters ein und zeigt Beaumarchais' Talent als Meister des Dialogs und der Charakterentwicklung. Als einer der bedeutendsten französischen Dramatiker des 18. Jahrhunderts, war Beaumarchais selbst politisch aktiv und nutzte sein Schreiben, um soziale Missstände anzuprangern. Seine eigene Erfahrung als Hofbeamter und Unternehmer inspirierte ihn, ein scharfes Auge für die falsche Moral und Korruption der Gesellschaft zu haben. 'Figaros Hochzeit: Ein toller Tag' ist ein zeitloses Werk, das sowohl als unterhaltsame Komödie als auch als kritische Betrachtung der sozialen Strukturen des 18. Jahrhunderts gelesen werden kann. Leser, die literarische Meisterwerke schätzen, werden von Beaumarchais' scharfsinnigem Humor und seiner psychologischen Raffinesse begeistert sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Figaro's Hochzeit: Ein toller Tag
Books
Inhaltsverzeichnis
Einleitung.
Nachstehender Beitrag zur »Bibliothek ausländischer Klassiker« bedarf einer erklärenden Vorrede. Er bietet dem Leser nicht ein reines Kunstwerk, das sich selbst erklärt, auch nicht ein hohes Meisterwerk von der Formvollendung einer griechischen Tragödie oder der ursprünglichen, ewigen komischen Kraft einer Komödie Shakespeare's, Molière's; »Figaro's Hochzeit« ist vielmehr ein Zeit- und Sittengemälde, ein Stück Tendenzliteratur. Und doch gehört sie nothwendig in ein Panorama der Weltliteratur; denn sie hat Epoche gemacht, nicht blos auf der Bühne, sondern in der Kulturgeschichte, sie stellt sich, von heutigem Standpunkte betrachtet und beleuchtet, dar als ein, wenn auch unbewußtes, doch tiefbedeutungsvolles lustiges Vorspiel des größten Drama's der neuen Weltgeschichte. Sie gleicht dem vulkanischen Ausbruch, der dem Erdbeben im Völkerleben vorangeht, von ihm erzeugt und doch es ankündigend. Werk, Verfasser und Zeit erläutern und bedingen hier einander in so innigem Zusammenhang, daß sie, getrennt, nicht verstanden und nicht gewürdigt werden können. Fassen wir sie denn zusammen auf, in einem flüchtigen Ueberblick, so kurz wie möglich, und wie nach Raum und dem Plane der »Bibliothek« nöthig.1
Pierre Augustin Caron wurde am 24. Januar 1732 geboren, in der Straße St. Denis zu Paris, als Sohn eines Uhrmachers. Er lernte das Handwerk seines Vaters, vielleicht nicht ganz und gar aus Neigung, jedoch so gut und tüchtig, daß er es bis zum 24. Lebensjahr ausübte und es sogar zu einer verbessernden Erfindung darin brachte, die »Hemmung« betreffend, über welche Erfindung er in einen Zeitungs- und Rechtsstreit mit unbefugten Nachahmern gerieth, den ersten der zahlreichen Prozesse, die sein langes Leben ausfüllen. » Ma vis est un combat«; dies Wort Voltaires ist mit Recht der Gesamtausgabe von Beaumarchais' Schriften (Paris 1809) als Motto vorangesetzt.
Den jungen Uhrmacher, einen unruhigen und heißen Kopf, zog es aus dem Glaskasten der väterlichen Werkstatt unwiderstehlich hinaus in die Welt, aus dem Dunst des Kramerviertels von Paris in die Versailler Hofluft, die Moschus- und Verwesung duftende. Seine Kunstfertigkeit auf der Harfe, einem Instrument, das damals in Frankreich noch den Reiz der Neuheit hatte, bahnte ihm den Weg, vereinigt mit einer äußerst vorteilhaften, aber auch jeden Vortheil schlau wahrnehmenden und dreist verfolgenden Persönlichkeit. Er ward binnen Kurzem der Günstling der vier Töchter Ludwigs XV., Mesdames de France, spielte eine Figur in ihren vertrauten Zirkeln, sang, musicirte und dirigirte in den kleinen Familienkoncerten des Hofes. Doch genügte die Rolle eines David vor dem altgewordenen Saul weder dem Ehrgeiz, noch dem Thatendrang des strebsamen Adepten. Zu seinem Glücke gab es in das sonst überall verschlossene und jedem Profanen unzugängliche Allerheiligste und Allerhöchste gewisse Hinterthüren. Das absolute Königthum verkaufte, um festen Preis, oder auch an den Meistbietenden, kleine und große Titel, Hofämter, Chargen, welche sich, zum Theil unter den barocksten Bezeichnungen, in dem Almanach de Versailles als Reste einer vorsündfluthlichen Zeit erhalten haben: Beaumarchais wurde 1755 controleur clerc d'office de la maison du Roi, was nach heutigem Stil etwa in Hofküchenschreiber zu übersetzen sein wird. Die Rechte und Verpflichtungen dieser Stellung bestanden darin, bei Galatafeln »das Fleisch Seiner Majestät« zu serviren. Molière, der Dichter des Tartufe, als valet de chambre tapissier Ludwigs XIV., und Beaumarchais- Figaro, der feierlich, den Hofdegen an der Seite, vor dem Küchenpersonal einherschreitet und »la viande du Roi« auf die Tafel Ludwigs XV. setzt: das sind zwei von jenen unvergleichlichen, tiefironischen und hochkomischen Randzeichnungen, mit welchen der Humor des Weltgeistes seine ernsten Annalen spielend zu illustriren pflegt.
Der Hofinvalide, von welchem Beaumarchais sein Amt, wie heutzutage eine Realgerechtsame, erstanden hatte, erwies ihm den weiteren Dienst, bald darauf das Zeitliche zu segnen. Beaumarchais heirathete seine Wittwe und nahm, – angeblich von einer kleinen Besitzung derselben, in Wahrheit aber wohl aus eigener Erfindung und Wahl, – statt des kahlen, kurzen Namens Caron, der über dem Ladenschilde seines Vaters noch prangte, den längeren, volltönenderen an, welchen er später in einem der glänzendsten Stadtviertel von Paris (Boulevart Beaumarchais) und in der Literaturgeschichte verewigen sollte. Das kleine Vermögen seiner Frau bildete die Grundlage seiner mannigfachen, in das Höchste gehenden, zwischen Millionen und Null schwankenden Unternehmungen. Einer der Rothschilde oder Pereires jener Zeit, Paris du Verney, welchem Beaumarchais eine werthvolle Auszeichnung durch die Prinzessinnen, seine treuen Gönnerinnen, verschafft hatte, betheiligte ihn zum Dank bei gewinnreichen Unternehmungen und weihte ihn in die Geheimnisse der hohen Finanzkunst ein. So gewann Beaumarchais die Mittel emporzukommen, die sein Geist allein niemals gegeben haben würde. Im Jahr 1761 stieg er auf zu der Sinecure eines Secrétaire du Roi, um den billigen Preis von 85,000 Francs; er bezahlte damit zugleich ein Adelsdiplom. Die Absicht, im folgenden Jahre schon die erledigte Stelle eines grand-maître des eaux et forêts, deren es nur 18 in ganz Frankreich gab, um 500,000 Francs an sich zu bringen, mißlang durch den Widerstand seiner Kollegen; er mußte sich mit dem immerhin vornehmen Titel begnügen: Lieutenant-Général des chasses à la Capitainerie de la Varenne du Louvre, den er 1763 erlangte. In dieser Eigenschaft hat Beaumarchais, als Stellvertreter eines Herzogs, der Capitaine-Général war, geraume Zeit einem Forst-, Rug- und Hegegericht in Sachen königlicher Jagdprivilegien vorgesessen, das im Louvre abgehalten wurde. Nicht ein volles Menschenalter später war die Revolution mit ihrem blutigen Schwamm über alle diese Herrlichkeiten gefahren und hatte den glücklichen Besitzer derselben zurückgelassen als – Citoyen Beaumarchais.
Wir verzichten darauf, die auf- und absteigende Linie eines solchen Lebenslaufes, in welchem sich die ganze, unstäte, fieberhaft bewegte Zeit abspiegelt, durch alle Windungen und Wechsel zu begleiten. Nur erwähnen wollen wir die verschiedenartigen Felder menschlicher Thätigkeit, auf denen Beaumarchais theils gleichzeitig, theils nach einander gewirkt hat. Er war Geldspekulant, Bank- und Börsenmann, Papierfabrikant, Holzhändler en gros –Schiffsrheder, der eine Flottille von vierzig Kauffahrern, sammt einem eigenen Kriegsschiff von 52 Kanonen zur Deckung, den amerikanischen Freistaaten in dem Unabhängigkeitskampf gegen England, im Auftrag Spaniens und Frankreichs, zu Hülfe sandte, – geheimer Agent Ludwigs XV. und seines Nachfolgers, wie ihrer Minister, in allerlei Aufträgen, die man einer regelmäßigen Diplomatie nicht zuzumuthen pflegt, zum Beispiel Aufkauf von Pasquillen gegen die Pompadour und gegen Königin Marie Antoinette, Verhandlungen mit dem geheimnißvollen Chevalier d'Eon, – Verlagsbuchhändler, der für eine doppelte Gesamtausgabe Voltaire's in 20,000 Exemplaren Lettern aus England, Papier aus Holland kommen ließ und zur Ausführung des Geschäftes dem Markgrafen von Baden ein ganzes Schloß in Kehl abkaufte, – Lieferant für die französische Republik, welcher er 60,000 Stück Musketen über die holländische Grenze zu liefern wußte, – Stifter des jetzt über ganz Frankreich so fest und fruchtbar organisirten Vereins für Bühnenschriftsteller, – Unternehmer zahlreicher Bauwerke, worunter sein eigener, kostbarer Palast am Boulevart, – und nebenbei der populärste Dramatiker Frankreichs. Zu solchen Arbeiten rechne man eine Reihe von persönlichen Fährlichkeiten und Heimsuchungen: die spanische Reise in den Jahren 1764 und 1765, welche ihm, durch Goethe's »Clavigo«, eine andere Art Unsterblichkeit2 eintrug – dreimalige Verhaftungen in Paris, – eine kurze Staatsgefangenschaft in Wien, – sein Exil in Hamburg, verschärft durch die Achterklärung des Nationalkonvents, durch eigene bitterste Noth, Einkerkerung der Seinigen in Paris, Konfiskation seines Vermögens, – endlich eine ganze Reihe von Rechtshändeln der langwierigsten und schwierigsten Art, mit dem Grafen Lablache um eine Erbschaft, mit dem Parlamentsrath Götzmann und dessen intriguantem Weibe wegen Bestechung, mit dem Banquier Kornmann wegen Mitschuld an Ehebruch; lauter Streitsachen auf bürgerliches Leben oder Sterben, aus denen er zuweilen als Sieger hervorging, aber nicht ohne tiefe Wunden an seiner Ehre, zuweilen als Besiegter, der jedoch dann seinen Gegner mit der vollen Wucht seines Talents in den Schranken der öffentlichen Meinung niederwarf und eine Fluth von Flugschriften über ihn herabschüttete, welche klassisch in ihrer Art zu nennen sind.
Es liegt am Tage, daß einem so zerfahrenen, bewegten, in allen Farben schillernden Leben sowohl die innere Einheit, wie Klarheit, Festigkeit, Halt nach außen fehlen muß. Beaumarchais hat riesige Erfolge gehabt, aber auch riesige Täuschungen und Verluste, höchsten Ruhm neben tiefster Schmach und Demüthigung erfahren, alle Reize und alle Bitterkeiten gekostet, von denen ein Erdenwallen überhaupt ausgefüllt sein kann. Es giebt keine Verleumdung, keine Verfolgung und Feindseligkeit, die ihn nicht, von seinen ersten Schritten auf dem glatten Parket von Versailles bis zum Grabe und darüber hinaus, betroffen, der er nicht, die Pistole oder die Feder in der Hand, verzweifelten Widerstand geleistet hätte. Vor Gericht mußte er sich sogar von der Anklage der Vergiftung zweier, nach kurzer Ehe verstorbenen Gattinnen reinigen; bekanntlich lag Giftmordriecherei während des letzten Viertels des vorigen Jahrhunderts ebenso in der Luft, wie Demagogenriecherei im ersten des jetzigen. Und als er, nach dreijährigem Exil, den Siebzigen nahe, harthörig und körperlich hinfällig geworden, dabei aber immer ungebrochenen Geistes, beißenden Witzes voll, zu jedem guten und schlechten Wortspiel allzeit fertig, nach Paris zurückkehrte, um mit den Machthabern der Republik um die Trümmer seines Vermögens zu ringen, als er auf der Schwelle des neunzehnten Jahrhunderts, am 18. Mai 1799, über Nacht eines stillen und raschen Todes verblich, da wollte man ihm, dem ewigen Spötter und Spieler, selbst dieses ernste, ehrliche Ende nicht glauben: die Wärter flüsterten von Selbstmord durch Gift, wo nichts als ein natürlicher Schlagfluß vorlag. Er starb in demselben Hause am Boulevart, das er sich mit fürstlicher Pracht und Künstlerlaune gebaut, aus dessen Fenstern er am verhängnißvollen 14. Juli den Sturz der Bastille – in gewissem Sinne und zum Theil sein Werk – mit angesehen hatte, und wurde von den Seinigen in dem Garten dieses Hauses begraben. »Tandem quiesco« – Endlich Ruhe – hatte er selbst über seine Gruft schreiben lassen, um auch darin eine letzte Täuschung nach dem Tode zu erleben. Sein Garten und sein Grab sind jetzt eine Straße, nachdem seine Gebeine in der Erde irgend eines pariser Friedhofs vermoderten. Ihn überlebte seine dritte Gattin und eine einzige Tochter, die, an einen Herrn Delarue glücklich verheirathet und 1832 verstorben, das Geschlecht Beaumarchais', aber nicht seinen Namen, in zwei Enkeln und einer Enkelin bis zum heutigen Tage fortgesetzt hat.
Ein Leben wie das in vorstehenden Zügen skizzirte, ist kein »Dichterleben«, ist es weder äußerlich als Stillleben in Blättern und Büchern, noch innerlich in der Selbstbeschränkung, Sammlung und Vertiefung, welche jede Kunst von ihren geborenen und auserwählten Pflegern heischt. Der Geschäfts- und Weltmann bleibt in Beaumarchais dem Schriftsteller von Fach, der Journalist und Pamphletist dem Dichter überlegen. Er selbst sagt, daß er nur zur Erholung – »par délassement« – mit Literatur sich beschäftigt habe und hinter der geistigen Bewegung seiner Zeit zurückgeblieben sei, weil das Schriftstellerthum als Lebensberuf einen ganzen Mann erfordre. Das Wort mag mehr bescheiden als wahr, oder auch als ernst gemeint gewesen sein; denn in den wenigen Werken, welche Beaumarchais der Literatur gegeben hat, – sie füllen zwei Bände von sieben der Pariser Gesammtausgabe, – überflügelt er, und das nicht blos im Erfolge, sondern auch in Anlage und Zweck, alle Zeitgenossen. Zusammengehalten gewähren seine Stücke, sechs an der Zahl, allerdings nicht den Eindruck einer fortschreitenden, stätig entwickelten, künstlerisch gezüchteten Dichternatur, wie sie in den Werken Shakespeare's, Moliere's, Schiller's sich offenbart; aber in jedem einzelnen tritt um so schärfer ein kühner, origineller, überall neue Bahnen suchender und findender Geist auf, der sich in einem oder dem anderen Wurf einmal der Bühne zuwendet, wie sonst einem waghalsigen Experiment an der Börse, einer Spekulation zu Land oder Wasser, einer abenteuerlichen Unternehmung im öffentlichen Leben. Das Theater reizte und lockte durch seinen Glanz, seine Unruhe, seine rasche und laute Wirkung die ihm innerlich wahlverwandte Natur Beaumarchais'; Novellen und Romane hat er nie geschrieben, konnte er nicht schreiben, wie er auch keinen guten Vers zu machen im Stande war. Revolutionäre Geister wie er treten auf in ungebundener Rede: Rousseau that es, Lessing, Schiller in seiner ersten Theaterperiode.
Beaumarchais hat im Jahre 1767 auf dem Théâtre-français debütirt mit dem bürgerlichen Schauspiel »Eugenie«, einem Rührstück, das sich zunächst an Diderot's Arbeiten gleichen Stiles (le Père de Famille, le Fils naturel) anlehnt. Der erste Wurf gelang über Erwarten, machte Aufsehen; der nächstfolgende (»Die beiden Freunde oder der Lyoner Kaufmann«, 1770 gegeben), ebenfalls ein bürgerliches Schauspiel, dessen Handlung um einen Bankrott sich dreht, mißglückte entschieden. Mit einem kühnen Sprunge geht, fünf Jahre später, der Dichter aus dem empfindsamen Familiendrama in die lustigste Posse über, vom Schauspiel zur komischen Oper: im »Barbier von Sevilla«, – zuerst mit spanischen Volksweisen für die Oper geschrieben, später als Schauspiel umgearbeitet und in solcher Gestalt 1775 auf dem Théâtre-français erschienen, aber mit der unerhörten Neuerung gesungener Einlagen, – landet Beaumarchais auf seinem eigentlichen Gebiet, dessen Höhe er 1784 in »Figaro's Hochzeit« erreicht. Diesem seinem Meisterwerk, das später näher zu betrachten sein wird, folgt 1787 eine große Oper »Tarare«, von Salieri komponirt, der prophetische Vorläufer heutiger wahnwitziger Operntexte und Ausstattungsstücke mit Dekorationspomp und Ballet-Zugaben; endlich 1792 die Umkehr zum Familiendrama (»Ein zweiter Tartufe, oder die Schuld der Mutter«), worin Figaro, Almaviva, Rosine noch einmal, in veränderter Gestalt, an das Lampenlicht gezogen werden, ohne jedoch ihre früheren Erfolge einzuholen, wenngleich das Stück sich noch vor zehn Jahren dann und wann auf dem Repertoir blicken ließ.
»Figaro's Hochzeit« war um 1780 im Manuskript vollendet und 1781 von dem Théâtre-français zur Aufführung angenommen, gelangte zu dieser aber erst 1784. Drei Jahre hat, – wie Molière's Tartufe, in vieler Beziehung sein Gegenstück, – der gefährliche Barbier Quarantaine halten müssen, in fünf Censurbureaux hinter einander. Nur durch Hintertreppen, Vorzimmer und Modesalons, in denen der Dichter das Stück vorlas, ist dasselbe zur Bühne gekommen; Prinzen von Geblüt, Fürstinnen, Herzöge, Minister haben ihm den Weg gebahnt, ihm, dem gefährlichsten Feinde ihrer Standesinteressen. König Ludwig XVI., der es sich im Beisein der Königin hatte lesen lassen, erklärte es für abscheulich, für unaufführbar, – »détestable, injouable«. Sein Auge, von Natur kurzsichtig, erkannte mit tiefem Seherblick und mit dem angeborenen Instinkt, der die Souveräne vor ihren Feinden warnt, in Figaro's Scheermesser das erste, ferne Wetterleuchten der Guillotine. Des Königs Abneigung gewann dem Stück und dem Verfasser Freunde; der Graf von Provence, später Ludwig XVIII., protegirte es, Hofdamen warben um eine Vorlesung, der gesammte hohe Adel intriguirte für die Aufführung, die, mehrere Male angesetzt, immer wieder verboten wurde, einmal kurz vor Beginn der Vorstellung, zu der die Wagen bereits in langer Reihe angefahren waren. Schlau und zäh, verstand Beaumarchais aus jedem Hinderniß eine Reklame für sein Werk zu machen und Schritt vor Schritt, gegen den höchstgebietenden Willen, dessen Weg zu forciren. Hatte er dabei, außer der nächsten Absicht, derjenigen einer endlichen Darstellung, höhere, politische, sociale, revolutionäre Zwecke? Diente diesen, unbewußt oder bewußt, derjenige Theil der französischen Gesellschaft, welcher so bald darauf der Erfüllung solcher Zwecke zum Opfer fallen sollte? Gewiß nicht, Beides nicht! Aus heutiger Ferne gesehen, ist allerdings das furchtbar ernste Lustspiel die Einleitung zu dem Schreckens- und Schauerdrama von 1789, ist dessen sociale, komische Introduktion, wie Chenier's »Karl der Neunte« (1789 erschienen) das politische, pathetische Vorspiel desselben. Beide Dramen sind die Herkulessäulen der Revolution: jenseits liegt ein stilles Binnenmeer, diesseits offene See, deren atlantischer Wellenschlag von der neuen zur alten Welt, und umgekehrt, braust und brandet, nach den tiefen Gesetzen geheimnißvoller Strömungen und Wechselwirkungen. Aber Beaumarchais wollte eine derartige Wirkung seines Stücks so wenig, wie die Gesellschaft wußte, was sie that, indem sie dasselbe förderte. Natürlich, nicht tendenziös zurechtgelegt, stellt das sonderbare Verhältniß folgender Maßen sich dar. Einerseits wollte Beaumarchais eine Komödie über alle Komödien, einen Ausbund von Spaß und Spott, etwas noch nicht Dagewesenes dem Publikum bieten. Andererseits wollte die vornehme Gesellschaft des damaligen Paris, diese sittlich verfaulte, nur den raffinirtesten Genüssen noch zugängliche, alles Glaubens bare Gesellschaft an einem solchen, noch nie dagewesenen Schauspiel sich frivol amüsiren, auf Kosten ihrer selbst, gegen ihres Königs souveränen Willen, der längst nicht mehr souverän war. Diese Gesellschaft ist so tief mit Blindheit geschlagen, daß sie nicht am Vorabend von 1789, geschweige denn fünf volle Jahre früher den Ausbruch des Vulkans ahnt, auf dem sie lebte, tanzte, liebte, spottete. Unsere Generation, welche in rascher Folge die Julitage, die Februartage, die Dezembertage erlebt hat, kann sich aus eigenster Anschauung einen Begriff von der, über alle Berechnung gehenden Plötzlichkeit der größten Katastrophen im Völkerleben machen. Gerade auf den Spitzen der Gesellschaft werden sie am wenigsten geahnt: die Gewitter ballen sich unter ihr, und wenn auf einmal die Blitze von unten nach oben fahren, bald eine Krone vom Haupte, bald ein Haupt vom Rumpfe schlagend, dann sind die meist Getroffenen, oft auch die meist Treffenden die meist Ueberraschten. Unmittelbar vor, ja mitten in der Revolution wußten ihre Führer nicht einmal, wie weit und wohin sie ging; schreibt doch, unter dem 9. Oktober 1787, Lafayette, der auf seinem welthistorischen Schimmel als Vorreiter dreier Revolutionen, diesseits und jenseits der großen Wasser, durch die Geschichte geht, an Washington die merkwürdigen Worte: »Allmählig, ohne große Erschütterung werden wir zu einer unabhängigen Volksvertretung und damit auch zu einer Minderung der königlichen Gewalt gelangen; aber das ist Sache der Zeit und wird um so langsamer vor sich gehen, als die Interessen mächtiger Personen Knüppel in den Weg werfen werden.« Fünf Jahre später war der Thron des heiligen Ludwig umgestürzt, sein Enkel auf dem Schaffot verblutet! Beweis genug, daß das Erdbeben von 1789 nicht blos seine Opfer über Nacht überfiel, wie es denn, als der erste Stoß, allen nachfolgenden an Größe und Schnelligkeit überlegen ist, denen von 1830, 1848, 1851, 18??...