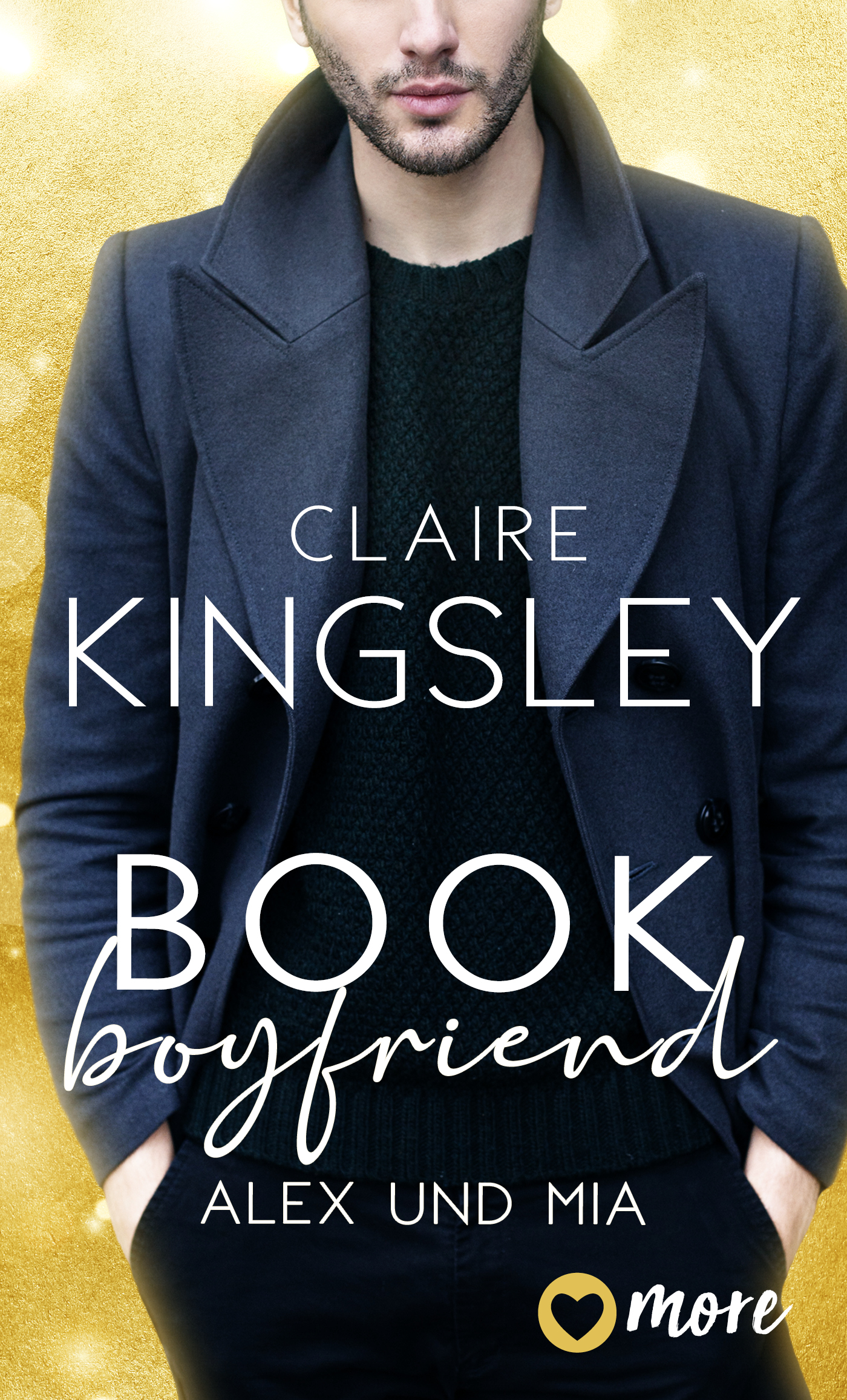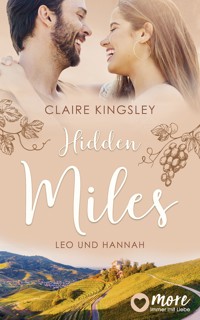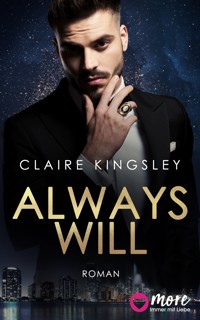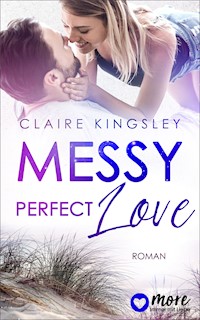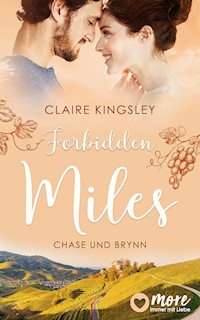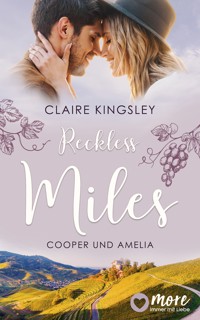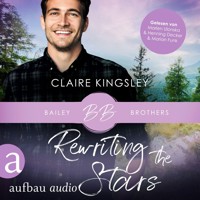9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bailey Brothers Serie
- Sprache: Deutsch
Wie lange würdest du auf die Liebe deines Lebens warten?
Asher ist nicht mehr derselbe Mann wie damals, als er Grace den Ring gab. Zuviel ist seitdem geschehen. Doch er hat sich nicht unterkriegen lassen und ist größer, härter und stärker geworden. Nun ist er zurück in Tilikum und für den ganzen Ort das einzige Gesprächsthema. Mit Klatsch und Tratsch hat Asher gerechnet, nicht aber damit, dass Grace immer noch seinen Ring trägt und all die Jahre auf ihn gewartet hat. Doch Asher fällt es schwer zu lieben, zu vertrauen und jemanden in sein Herz lassen. Für Grace war ihr Märchen nur unterbrochen und sie will ihn eines Besseren belehren.
Wird es Asher gelingen, die Dämonen in seinem Inneren zu bezwingen?
"Fighting for Us"- der zweite Teil der "Bailey Brothers" Reihe von Bestsellerautorin Claire Kingsley. Wir empfehlen die Titel in der richtigen Reihenfolge zu lesen, da Ashers und Grace Geschichte in diesem Buch fortgesetzt wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Wie lange würdest du auf die Liebe deines Lebens warten?
Ich bin nicht mehr derselbe Mann wie damals, als ich Grace den Ring gab. Zuviel ist seitdem passiert. Doch ich habe mich nicht unterkriegen lassen und die Dämonen in meinem Inneren gut weggeschlossen.
Jetzt bin ich zurück in Tilikum und für alle das einzige Gesprächsthema. Mit all dem Klatsch und Tratsch habe ich gerechnet. Womit ich nicht gerechnet habe ist, dass Grace immer noch meinen Ring trägt und all die Jahre auf mich gewartet hat.
Aber ich kann nicht mehr lieben, nicht mehr vertrauen und jemanden in mein Herz lassen. Niemals wieder …
»Fighting for Us«- der zweite Teil der »Bailye Brothers« Reihe von Bestsellerautorin Claire Kingsley. Wir empfehlen die Titel in der richtigen Reihenfolge zu lesen, da Ashers und Grace Geschichte in diesem Buch fortgesetzt wird.
Über Claire Kingsley
Claire Kingsley schreibt Liebesgeschichten mit starken, eigensinnigen Frauen, sexy Helden und großen Gefühlen. Ein Leben ohne Kaffee, E-Reader und neu erfundene Geschichten ist für sie nicht vorstellbar. Claire Kingsley lebt mit ihrer Familie im pazifischen Nordwesten der USA.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Claire Kingsley
Fighting for Us
Übersetzt von Nicole Hölsken aus dem amerikanischen Englisch
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Epilog
Impressum
Kapitel 1
Asher
Eine Faust traf auf mein Kinn, gefolgt von einem schnellen Schlag in meine Niere. Ein Stöhnen entfuhr mir, als ich gegen den Schmerz ankämpfte. Eine andere Möglichkeit blieb mir nicht. Der Schwächling, der meine Arme gepackt hielt, würde mich zwar nicht mehr lange festhalten können, aber solange ich mich nicht erfolgreich entwunden hatte, würden diese Arschlöcher weiter erbarmungslos auf mich eindreschen.
Ich knurrte den Scheißkerl, der vor mir stand, an. Keine Ahnung, wie er hieß, und es interessierte mich auch nicht die Bohne. Das blaue Auge, das ich ihm letzte Woche geschlagen hatte, klang langsam schon wieder ab. Diesmal würde ich ihm gleich zwei Veilchen verpassen.
Er lächelte und versetzte mir einen weiteren Hieb.
Fuck.
Wieder versuchte ich, mich aus dem Griff seines Kumpans zu befreien. Da der Kerl hinter mir stand, konnte ich nicht erkennen, wer es war. Doch ich spürte, wie seine Kräfte nachließen. Mein Gegenüber versetzte mir noch einen Schlag unter die Rippen, während ein weiterer sich von der anderen Seite auf mich stürzte und auf mich einprügelte.
Keiner der drei hätte es allein mit mir aufnehmen können, also hatten sie sich zusammengerottet, um mir gemeinsam in der Bibliothek aufzulauern. Ich hätte damit rechnen müssen. Eigentlich war ich immer vorbereitet und auf der Hut. Das musste ich. Nur so konnte man so lange im Gefängnis überleben. Aber jetzt waren sie mir zuvorgekommen, und ich war geliefert.
»Nun bist du nicht mehr ganz so großspurig, was?«, höhnte der erste und fletschte seine gelben Zähne.
Ich sah ihm grimmig in die Augen. Ich würde ihn vermöbeln. Und zwar heftig. Sobald einer dieser Wichser einen Fehler machte, würde ich mich auf ihn stürzen. Und es in vollen Zügen genießen.
Das Adrenalin brauste durch meine Adern, verbrannte alles andere zu Asche. Mein Herz pumpte wie wild, während ich weiter gegen den Mistkerl ankämpfte, der mich festhielt. Ohne den ersten aus den Augen zu lassen, verlagerte ich mein Körpergewicht. Doch die Arme, die mich fixierten, ließen nicht locker. Bewusst entspannte ich meine Muskeln, konzentrierte mich auf die Bewegungen meines Gegners, bereit, jede noch so kleine Schwäche zu meinen Gunsten zu nutzen. Bereit zum Gegenangriff.
Die Faust des ersten Mannes traf erneut auf mein Gesicht, flutete meinen Mund mit dem metallischen Geschmack nach Blut. Jetzt reichte es!
Ich warf mich ihm entgegen, gab gleichzeitig in den Knien nach und ließ den Oberkörper nach vorn kippen. Der Typ, der meine Arme festhielt, flog über meine Schulter. Mit wildem Gebrüll stürzte ich mich auf den ersten und rammte ihm die Faust in den Magen. Da sie immer noch in der Überzahl waren, würde es sicher nicht lange dauern, bis sie mich wieder überwältigten – oder die Wachen uns voneinander trennten. Also hatte ich nicht viel Zeit, um es ihnen zu zeigen.
Triumphierend versetzte ich dem ersten weitere Schläge. Der zweite sprang mir auf den Rücken, um mich niederzuringen, aber ich warf ihn ab. Mit einem Stöhnen kam er auf dem Boden auf.
Dann rammte mich jemand von der Seite und schlang mir die Arme um die Taille. Wir krachten in einen Tisch und stürzten zu Boden. Als er auf mir landete, blieb mir beinahe die Luft weg.
Ich keuchte. Anscheinend waren sie jetzt sogar zu viert. Gegen so viele hatte ich keine Chance. Ich hielt die Arme vors Gesicht, um es gegen seine Schläge zu schützen. Ground and Pound. Das kannte ich aus dem Ring. Doch dort pfiff nach einiger Zeit der Schiedsrichter ab.
Im Gefängnis war das anders.
»Hey!«
Ich hörte schnelle Schritte. Die Wachmänner schrien Befehle. Es hagelte weitere Schläge, bevor jemand meinen Angreifer von mir herunterzog.
Verdammt. Es tat höllisch weh.
Ein weiterer Wachmann zog mich grob auf die Füße, zerrte mir die Arme hinter den Rücken und legte mir Handschellen an. Ich leistete keinen Widerstand. Ich blinzelte lediglich, weil mir Blut ins Auge tropfte, und warf den Arschlöchern, die die Prügelei angezettelt hatten, tödliche Blicke zu, während die Wachleute sie an den Tischen überwältigten und ihnen ebenfalls Handschellen anlegten.
»Mitkommen!«, bellte der Wachmann und schob mich vor sich hinaus. »Raus hier!«
Ich machte mir gar nicht die Mühe, ihn darauf hinzuweisen, dass ich diesmal gar nicht angefangen hatte. Dass erst drei Typen und später vier sich einfach auf mich gestürzt hatten. Es spielte keine Rolle. Bestenfalls bekam ich eine Weile Zellenarrest. Schlimmstenfalls drohte mir Einzelhaft. Aber ich hätte es durch nichts ändern können.
Das Metall schnitt mir in die Handgelenke, und ich bebte vor Zorn. Auf diese Mistkerle, die mich angegriffen hatten. Auf den Wachmann, der mich wegführte. Auf den Beton und den Stacheldraht, die mich hier festhielten. Ich biss die Zähne aufeinander. Wut pulsierte durch meine Adern und brachte mein Blut zum Kochen.
Er führte mich nicht in meine Zelle zurück. Doch im Grunde war mir selbst das gleichgültig. Ich war ihnen nun mal ausgeliefert, so dass sie mir jede x-beliebige Strafe aufbrummen, mich sogar in eine Einzelzelle werfen konnten, um meinen Widerstand zu brechen. Die Einzelhaft war zwar brutal, machte aber für mich kaum noch einen Unterschied.
Ich war bereits ein gebrochener Mann.
Ich hoffte nur, dass diese anderen Arschlöcher schlimmer bestraft wurden als ich.
Der Wachmann führte mich einen Flur entlang, und plötzlich begann sich eine Andeutung von Furcht ihren Weg durch meinen Zorn hindurch an die Oberfläche zu bahnen. Ich hatte keine Ahnung, wo wir hingingen. Das Leben im Gefängnis folgte einer festen, monotonen Routine. Tagein, tagaus tat man die gleichen Dinge. Es war verdammt langweilig, aber zumindest wusste man immer, was einen erwartete.
Neues oder Unbekanntes verhieß nie etwas Gutes.
In höchster Alarmbereitschaft folgte ich dem Wachmann in einen kleinen Raum. Darin standen ein Metalltisch, der am Fußboden festgeschraubt war, und zwei Stühle. Wahrscheinlich für Anwälte, die sich mit einem der Gefängnisinsassen unterhalten wollten. Ich war noch nie in diesem Zimmer gewesen, denn mein Anwalt hatte mich hier nie aufgesucht. Dazu hatte es auch keinen Grund gegeben. Mein Urteilsspruch stand schließlich fest. Acht Jahre. Keine Bewährung, keine Chance, wegen guter Führung entlassen zu werden. So funktionierte es in diesem Bundesstaat nun mal. Ich konnte bloß abwarten, bis ich meine Zeit hier abgesessen und für mein Verbrechen bezahlt hatte.
Noch dreihundertzweiundfünfzig Tage.
Ich zermalmte den Gedanken im Staub, bevor er Wurzeln schlagen konnte. Über meine Entlassung durfte ich nicht nachdenken. Nicht jetzt. Nur einmal am Tag, kurz nach dem Aufwachen, gönnte ich mir den Gedanken ans Ende. Dann ließ ich all meine Trauer zu und dachte eine Minute lang an draußen. An meine Familie. Gram. Meine Brüder. Sogar an sie, obwohl ich mich gerade vor dieser Erinnerung hüten musste.
Wenn diese Minute vorbei war, blendete ich sämtliche Überlegungen und Gefühle wieder aus. Das musste ich tun. Alles andere hätte mich geschwächt, und hier drin durfte man sich nicht die geringste Schwäche erlauben. Ich musste kalt und hart wie Stahl sein. Sonst wäre ich schon vor Jahren in Stücke gerissen worden.
Ich hielt still, während der Wachmann meine Handschellen aufschloss, und meine Verwirrung wuchs. Was hatte ich hier zu suchen? Besucher konnten nicht der Grund sein. Sie wurden üblicherweise angekündigt, damit die Gefangenen entscheiden konnten, ob sie sie empfangen wollten oder nicht. Deshalb hatte ich bereits seit Jahren keinen Besuch mehr gehabt, denn ich hatte ihn immer abgelehnt. Ich wollte niemanden sehen. Daher hatten sie alle den Versuch schon vor langer Zeit aufgegeben.
Ohne jede weitere Erklärung bedeutete mir der Wachmann, mich hinzusetzen, und fixierte mich mit den Handschellen am Tisch.
Was zum Teufel sollte das?
Im Eingang tauchte nun der leitende Justizvollzugsbeamte auf. Er hatte einen langen grauen Schnurrbart und buschige Augenbrauen. Seine breite Brust sprengte beinahe sein T-Shirt, und die Falten in seinem Gesicht zeugten von einem jahrelangen harten Leben. Der Kerl hatte einiges hinter sich, das sah man ihm an.
»Mein Gott«, murmelte er mit heiserer Stimme. »Warum blutet er, verdammt nochmal?«
»Es gab eine Prügelei in der Bibliothek«, erklärte der Wachmann.
»Holen Sie Verbandszeug.« Der Wachmann entfernte sich, und der leitende Justizvollzugsbeamte runzelte die Stirn, legte den Kopf schief und musterte mein Gesicht. »Haben Sie noch andere Verletzungen?«
»Nein.«
»Gut.« Er nahm mir gegenüber Platz und legte einen Aktenordner auf den Tisch. »Ich habe Neuigkeiten.«
Ich erstarrte und sah ihm in die Augen. Furcht durchzuckte mich wie ein Stromstoß, und mir wurde übel. Sicher war irgendetwas Schreckliches passiert.
Fuck. Bitte nicht Gram.
»Ist jemandem aus meiner Familie was passiert?«
»Nein. Nichts Schlimmes. Im Gegenteil: Es gibt eine gute Nachricht, völlig unerwartet.«
Ich runzelte die Stirn. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach.
»Sie dürfen nach Hause, Bailey. Gerade habe ich Anweisung für Ihre sofortige Entlassung erhalten.«
Kapitel 2
Asher
Unverwandt sah ich zu Boden, spürte aber den Blick des Justizvollzugsbeamten auf mir. Ich saß auf einem harten Metallstuhl im Haftraum, die Handgelenke in Handschellen, die Hände im Schoß. Ich ließ die Handgelenke kreisen, wollte das schmerzhafte Metall an der Haut spüren, wie um mir selbst zu beweisen, dass das hier real war.
Die Platzwunde an meiner Stirn pochte, und meine Knöchel waren durch die Prügelei heute Morgen ziemlich ramponiert. Etwas abwesend fragte ich mich, ob meine Hände tatsächlich irgendwann wieder abheilen oder ob sie für immer grün und blau bleiben würden. Normalerweise war ich jedes Mal, wenn die Blutergüsse nachgelassen hatten, erneut zusammengeschlagen worden.
Ich öffnete und schloss die Fäuste ein paar Mal. Der dumpfe Schmerz wollte nicht nachlassen. Also war die ganze Situation definitiv kein Traum.
Wieder betrat ein Wachmann den Raum, und die beiden wechselten ein paar leise Worte miteinander. Dann nickte der erste mir zu. »Jetzt ist es so weit.«
In den letzten paar Stunden hatte ich nur untätig herumgesessen. Gewartet. Nach dem Treffen mit dem leitenden Justizvollzugsbeamten hatte man mich zu meiner Zelle geleitet, um dort sauber zu machen. Dann hatte ich einen Telefonanruf erledigen dürfen und war anschließend hergebracht worden.
Die anderen Häftlinge blickten mir erstaunt hinterher. Die ungewöhnlichen Umstände machten sie unruhig. Herrgott, mir ging’s ja nicht anders! Während ich mit gesenktem Kopf die Anweisungen des Wachpersonals befolgte, ließ mich die Frage nicht los, ob sich jemand einen kranken Scherz mit mir erlaubte.
Ich folgte dem Wachmann zu einer hinter einer Absperrung befindlichen Theke. Er bedeutete mir, die Hände zu heben, um meine Handschellen aufzuschließen. Mit einem dumpfen Klirren landeten sie auf der Oberfläche.
»Asher Bailey«, sagte der Mann hinter der Theke. Er schob einen Umschlag mit meiner Brieftasche durch die Öffnung. Dann reichte er mir eine rechteckige braune Schachtel. Sie war nichtssagend, etwa sechzig Zentimeter lang und dreißig breit. Das Tape am Deckel klebte gar nicht mehr richtig, war aber zumindest besser als nichts.
Ich nahm beides an mich ‑ mehr besaß ich nicht mehr ‑ und folgte dem Wachmann durch eine weitere Tür.
»Ihr Wagen wartet auf dem Besucherparkplatz«, erklärte er.
»Okay.« Ich war selbst überrascht, dass meine Stimme so normal klang. So ruhig. Innerlich zitterte ich vor Aufregung.
Ich würde heimkehren.
Eigentlich hätte ich mich darüber freuen sollen, denn so blieb mir ein ganzes weiteres Jahr hinter Gittern erspart. Ein Brief vom Gouverneur hatte aus heiterem Himmel alles verändert, so dass ich aus diesem Drecksloch entlassen wurde. Doch im Grunde war ich dazu noch gar nicht bereit. Jeden Tag war ich einer strengen Routine gefolgt, nur darauf konzentriert, durchzuhalten. Dieser feste zeitliche Ablauf würde nun nicht mehr nötig sein, und das brachte mich total aus dem Konzept.
Als wir die nächste Tür erreichten, wäre ich beinahe stehen geblieben, um mich bei dem Wachmann zu erkundigen, ob er wirklich sicher war. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass man mir eine Falle stellte ‑ dass ich, kaum dass ich einen Schritt nach draußen gemacht hatte, wieder gepackt und in Handschellen zurückgebracht würde. Mein Misstrauen galt keineswegs diesem speziellen Wachmann, sondern der ganzen Welt. Ich traute niemandem.
Er öffnete die Tür, und ich blinzelte in das helle Sonnenlicht. Es war Anfang Mai, und kein einziges Wölkchen trübte den strahlend blauen Himmel. Ich überquerte die Schwelle, ohne dass irgendetwas geschah. Zwar befand ich mich immer noch innerhalb der Mauern, trotzdem war dieses Terrain für die Gefängnisinsassen tabu. Noch vor wenigen Stunden hätte ich mich hier nicht aufhalten dürfen.
Aber es wurde kein Alarm ausgelöst. Kein einziger Wachmann zeigte sich.
Der Justizvollzugsbeamte und ich überquerten den Asphalt und gingen auf den hohen, von Stacheldraht gesäumten Zaun zu. Mein Herz pochte wie wild, und mein Mund war ganz trocken. Mein Begleiter gab ein Zeichen, und wenige Sekunden später setzte sich das Tor in Bewegung.
Mit einem metallischen Scharren öffnete es sich, und vor mir lag die Außenwelt ‑ oder besser gesagt das, was ich von hier aus davon erkennen konnte, also ein Parkplatz. Doch in der Ferne erhoben sich die Berge, deren Gipfel nach wie vor schneebedeckt waren.
Diese Berge waren mein Zuhause.
Ich holte tief Luft und schritt durch das Tor nach draußen. Immer noch keine Sirenen. Sofort schloss es sich wieder rumpelnd hinter mir. Sie ließen mich tatsächlich gehen.
Die Türen eines dunkelblauen SUV flogen auf, und vier Männer stiegen aus. Ich starrte sie an und war sprachlos. Ich hatte erwartet, dass einer von ihnen mich abholen würde, nicht alle vier.
Die Erleichterung war so überwältigend, dass mir beinahe die Luft wegblieb. Sie umringten mich, und jemand nahm mir meine Sachen aus den Händen.
Meine Brüder. Sie waren hier. Wie lange ich sie nicht mehr gesehen hatte!
Gavin drängte sich nach vorn, stürzte sich auf mich und umarmte mich wie ein Bär. Seine Arme waren überraschend muskulös.
»Hey, du!«, rief er und drückte mich an sich.
Ich erwiderte die Umarmung. Wie konnte er verdammt nochmal nur so stark geworden sein?
»Platz da, Bruderherz! Jetzt sind wir dran.« Logan zog sich schwungvoll seine Pilotenbrille vom Gesicht und grinste mich an. Auch er hatte sich verändert. Sein Kinn war kantiger, und sein Bartschatten ließ ihn älter wirken.
Natürlich, denn er war ja schließlich auch älter. Als ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, war er ein neunzehnjähriger Bengel gewesen.
Gavin ließ mich los, und Logan breitete seine Arme aus.
»Ash, es ist so verdammt lang her.«
»Was du nicht sagst.« Ich umarmte ihn, und er schlug mir ein paar Mal auf den Rücken.
Evan überragte uns Brüder immer noch. Seine Hände waren ölverschmiert wie die eines Mechanikers, und er hatte ein paar Tattoos, an die ich mich nicht erinnern konnte. »Schön, dich zu sehen, Mann.«
»Find ich auch.«
Nun umarmte ich auch Evan. Levi wartete in einiger Entfernung und beobachtete mich unsicher, als wisse er nicht so genau, was er von mir halten solle. Er wirkte älter, genau wie sein Zwillingsbruder, und füllte sein Tilikum Fire Department-Shirt ganz anders aus als früher.
Sieben Jahre waren halt eine lange Zeit.
Schließlich umarmte mich auch Levi. »Schön, dass du wieder da bist.«
»Danke.«
»Du hast uns nicht verarscht«, meinte Logan. »Sie lassen dich wirklich frei?«
»Ich habe dir doch gesagt, dass das kein Scherz war«, meinte Levi.
Ich runzelte die Stirn. »Ihr habt allen Ernstes geglaubt, dass ich euch einen Streich spiele, als ich anrief, um euch zu sagen, dass ich vorzeitig entlassen werde?«
Logan zuckte mit den Schultern. »Hätte ja sein können, dass du im Gefängnis einen ziemlich schwarzen Humor entwickelt hast.«
Gavin gluckste vor sich hin und versetzte Logan einen Schlag auf den Arm. »Wäre doch ein ziemlich guter Streich gewesen, oder?«
»Ihr habt ’nen Knall«, meinte Levi.
»Bei diesem Anblick läuft es mir kalt den Rücken runter.« Logan warf einen Blick auf den Gefängniskomplex. »Bist du so weit? Können wir uns vom Acker machen?«
»Ja, ich bin ein freier Mann.«
»Mehr hast du nicht dabei?« Evan legte den Umschlag und die Schachtel in den Kofferraum des SUV.
»Das ist alles. Meine Wechselklamotten habe ich dagelassen. Und die hier werde ich wohl verbrennen.« Ich zupfte an dem alten T-Shirt und der schwarzen Jogginghose herum, die ich trug. Im Gefängnis hatten wir unsere eigenen Anziehsachen tragen dürfen ‑ Sträflingskleidung wurde nur denjenigen zur Verfügung gestellt, die keine hatten ‑, aber diese Scheißklamotten wollte ich nie wieder sehen.
»Toll. Für ein kleines Feuer bin ich immer zu haben«, sagte Gavin. »Und mit ,kleinem Feuer‹ meine ich ein großes.«
»Schon paradox, wenn man bedenkt, dass du Chief Stanley dazu bringen willst, dich einzustellen«, meinte Levi.
»Ja, ich verstehe eben was von Feuer und bin perfekt für den Job.«
»Kommt endlich!«, brummte Evan. »Lasst uns verdammt nochmal von hier verschwinden!«
»Ich sitz vorne!«, rief Gavin.
Levi funkelte ihn wütend an. »Nein.«
»Ich habe es aber zuerst gesagt!«
»Lass Asher vorn sitzen.«
»Stimmt, hast recht.« Gavin machte eine Verbeugung und deutete auf die immer noch offene Beifahrertür. »Nach dir, großer Bruder.«
»Schön, dass du in den letzten sieben Jahren ein bisschen erwachsener geworden bist«, sagte ich.
Er grinste nur.
Mir fiel es schwer, diesen Mann mit dem Jungen aus meiner Erinnerung in Einklang zu bringen, aber das erwähnte ich nicht. Als ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, war er ein magerer Teenager gewesen, dem das Haar über die Augen fiel. Jetzt war er so groß und stark, dass ich ihn kaum wiedererkannt hätte.
Wir drängten uns ins Auto. Anscheinend gehörte der SUV Levi, denn er nahm am Steuer Platz. Gavin protestierte, weil er letztlich ganz allein in der dritten Reihe sitzen musste, aber nachdem Evan ihn noch einmal kurz angeschnauzt hatte, hielt er den Mund.
Manche Dinge änderten sich eben nie.
Levi verließ den Parkplatz und blieb an der Schranke stehen. Dann hob sie sich, und wir fuhren hindurch. Und einfach so war ich auf dem Highway und sah die Justizvollzugsanstalt im Seitenspiegel verschwinden.
Ich war auf dem Weg nach Hause.
»Also, können wir jetzt endlich mal darüber reden?«, erkundigte sich Logan.
Ich sah mich um und deutete auf das Pflaster, das auf der Platzwunde an meiner Stirn klebte. »Worüber? Meinst du etwa das hier?«
»Eigentlich ist dein Gesicht im Großen und Ganzen doch durchaus noch intakt, aber ja, wenn du willst, können wir auch darüber reden.«
»Das ist gar nichts. Entpuppte sich ja auch als Abschiedsgeschenk.«
Levi warf einen Blick auf meine Knöchel, sagte allerdings nichts. Dafür war ich ihm dankbar.
»Warum seid ihr denn zu viert hergekommen?«, wollte ich das Thema wechseln, bevor sie mir noch mehr Fragen wegen meines Gesichts stellten. »Ich hätte gedacht, dass Gram nur einen von euch schicken würde.«
»Machst du Witze?«, fragte Gavin. »Asher Bailey kommt aus dem Gefängnis, und du hast tatsächlich geglaubt, wir wären nicht alle da? Außerdem hatten wir uns darüber in der Wolle, wer dich abholen sollte, und Gram meinte, wenn wir nicht auf der Stelle alle ins Auto stiegen und uns in Bewegung setzten, würde sie ihre Hühner auf uns hetzen.«
Ich warf einen Blick über die Schulter. »Ihre was?«
»Du hast schon richtig gehört. Gram hat jetzt Hühner«, meinte Levi.
Meine Mundwinkel verzogen sich zur Andeutung eines Grinsens. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal gelächelt hatte. »Klingt ganz nach Gram.«
»Also, erzählst du uns nun, was passiert ist, oder müssen wir raten?«, fragte Logan. »Wir dachten, du müsstest noch ein ganzes Jahr absitzen.«
Ich stieß den Atem aus. Irgendwie stand ich nach wie vor unter Schock, weshalb ich noch nicht klar denken konnte. Mein jetziger Zustand erinnerte mich an die ersten paar Tage nach meiner Festnahme, als ich beim Sheriff in Untersuchungshaft gesessen hatte. Damals war mir alles wie ein Albtraum vorgekommen. Auch der heutige Tag hatte etwas Unwirkliches.
»Der Gouverneur hat sich eingeschaltet und mich begnadigt«, antwortete ich.
»Seit wann kennst du den Gouverneur?«, fragte Logan.
»Tu ich gar nicht. Anscheinend hat derselbe Typ auch die Nichte des Gouverneurs belästigt, etwa ein halbes Jahr bevor …« Ich verstummte. Sie wussten, wovon ich sprach. »Ich weiß nichts Genaueres, doch ich glaube, sie hat nie Anzeige erstattet. Irgendwie kam die Sache aber trotzdem heraus, und man erfuhr auch von mir. In dem Brief stand, dass die bislang abgeleistete Haftstrafe unter den gegebenen Umständen ausreichend gewesen sei und ich mit sofortiger Wirkung entlassen werden solle.«
»Das ist ja nicht zu fassen!«, meinte Logan.
»Zu blöd, dass er das nicht vor sieben Jahren getan hat«, murmelte Levi.
»Ich glaube, damals war er noch nicht Gouverneur«, wandte Evan ein.
»Könnten wir uns jetzt mal auf das Positive konzentrieren?«, warf Logan ein. »Asher ist wieder draußen. Wir fahren den kleinen Scheißer nach Hause.«
Nach Hause. Diese Formulierung traf mich direkt in die Magengrube. Obwohl wir den Highway zu unserer Kleinstadt in den Cascade Range Mountains hinabfuhren, konnte ich es kaum glauben.
Ich war noch nicht bereit. Ich hatte mich nicht vorbereitet.
Fuck.
Wie sollte ich damit nur klarkommen? Ich hatte so gut wie keine Ahnung, wie das Leben zu Hause in den vergangenen sieben Jahren gelaufen war. Einige der Sträflinge lebten geradezu für den Kontakt mit der Außenwelt ‑ Besuche, Briefe, Updates. Aber ich war anders gewesen. Ich hatte schnell erkannt, dass es bloß einen Weg gab, wie ich meine Haftstrafe überleben konnte: Ich musste hart bleiben. Kalt. Stark.
Ich hatte buchstäblich alles Gute in meinem Leben verloren ‑ alles, wofür es sich zu leben lohnte. Erinnerungen an zu Hause waren wie eine tiefe Wunde, gaben mir das Gefühl, barfuß auf Glasscherben herumzulaufen. Hätte ich mich dem täglich ausgesetzt, ich wäre innerlich verblutet.
Also hatte ich den Kontakt zur Außenwelt auf ein Minimum reduziert. Mir war klar gewesen, dass ich später dafür würde bezahlen müssen, aber je länger ich im Gefängnis war, umso entschlossener war ich gewesen. Denn ich schützte nicht nur mich selbst ‑ tat, was ich musste, um zu überleben. Ich schützte auch meine Lieben. Ich wollte nicht, dass sie sahen, was aus mir geworden war.
Doch nun sauste ich ohne jede Vorbereitungszeit über den Highway meinem Zuhause entgegen. Ohne mich auch nur einen Augenblick an den Gedanken gewöhnen zu können, wieder in die normale Welt zurückzukehren.
Eine Welt, die sich verändert hatte, ohne dass ich etwas davon wusste.
Ein merkwürdiges Gefühl von Panik breitete sich in meiner Brust aus, und ich ballte die Hände zu Fäusten. Ich hatte keinerlei Routine. Keinen Plan. Ich war ein freier Mann. Immerhin musste ich ab sofort auch nicht mehr befürchten, dass mich diese drei Arschlöcher aus dem Nichts überfielen und vermöbelten. Das war schon mal eine Verbesserung. Trotzdem ging mir das alles viel zu schnell. Ich hatte das Gefühl, zu ersticken.
»Alles okay, Mann?«, fragte Levi.
»Ja. Ich muss bloß jede Menge verarbeiten. Es ist so lange her.«
Ich schwieg einen Augenblick und sah aus dem Fenster. Worüber sich keiner meiner Brüder zu sprechen traute, war nicht mein zerschundenes Gesicht. Es war die Kluft aus ganzen sieben Jahren, die mich von den anderen Jungs trennte. Während meines Gefängnisaufenthalts hatte ich hin und wieder von Gram gehört. Sonst hatte ich mit niemandem Kontakt gehabt, nicht mal mit meinen Geschwistern.
»Ich weiß, dass ihr seit meiner Verhaftung nichts mehr von mir gehört habt.«
»Kein Stress, Mann, wir haben das schon verstanden«, meinte Logan.
»Echt?«
»Erst war ich ziemlich sauer, als Gram uns ausrichtete, dass wir dich nicht besuchen durften. Aber ich werde nie vergessen, was sie sagte. Erinnert ihr euch auch noch dran?«
Levi nickte. »Sie meinte, wenn ein Mann in den Krieg zieht, muss er sich manchmal zwingen, die Menschen zu vergessen, die er zurücklässt. Nur so kann aus ihm der Soldat werden, der er sein muss, um zu überleben.«
Verdammt. Damit hatte Gram wie immer ins Schwarze getroffen.
»Ja. Genau so ist es.«
»Die gute Nachricht ist allerdings, dass du die Waffen niederlegen kannst«, fügte Logan hinzu. »Der Krieg ist vorbei.«
Ich sah auf meine ramponierten Hände herab. Die Waffen niederlegen. Keine Ahnung, wie ich das machen sollte.
»Hat irgendjemand bereits Grace erreicht?«, fragte Gavin.
Ich wirbelte herum und knurrte ihn buchstäblich an. »Nicht.«
»Was?«
»Rede verdammt nochmal nicht von ihr. Sprich nicht mal ihren Namen aus.«
Gavin riss die Augen auf und hielt begütigend die Handflächen hoch. »Sorry.«
Der Blick, den Evan und Logan einander zuwarfen, entging mir keineswegs, aber ich ignorierte sie.
Ich war auf vieles noch nicht vorbereitet, doch am schlimmsten war die Sache mit ihr. Irgendwann würde ich mich der Wahrheit stellen müssen, aber noch nicht heute. Ich kam mir ohnehin schon vor wie eine tickende Zeitbombe, und allein der Klang ihres Namens konnte mich zum Explodieren bringen.
Ich konnte nicht. Noch nicht.
Ich hatte meine Freiheit verloren, meinen Beruf, meine Zeit, sogar meine Würde. Doch das alles war nichts im Vergleich zu dem Schmerz darüber, sie verloren zu haben. Nicht einmal annähernd.
Ich hatte sie von ganzem Herzen geliebt und für immer verloren.
In jenen kurzen allmorgendlichen Augenblicken, in denen ich mir gestattet hatte, über mein Zuhause nachzudenken, hatte ich auch den ein oder anderen vorsichtigen Gedanken an sie zugelassen. Ich hatte mich gefragt, was sie wohl tat. Mit wem sie zusammen war, wo sie lebte. Was sie mit ihrem Leben angefangen hatte, seit ich fort war. Und im Stillen hatte ich Gott oder das Universum oder wen auch immer darum gebeten, sie zu beschützen und dafür zu sorgen, dass es ihr gut ging und sie in Sicherheit war.
Aber noch war ich einfach nicht bereit, mehr über ihr momentanes Leben zu erfahren. Ich wünschte mir mehr als alles andere, dass sie glücklich war, aber mit dem damit bestimmt einhergehenden Schmerz kam ich noch nicht klar. Ich brauchte Zeit, um mich für den Kummer zu wappnen.
Kapitel 3
Grace
Frische Bergluft wehte durch mein Haar, während wir in Caras blauem Cabrio die scharfen Kurven nahmen. Es war Kaiserwetter ‑ die Sonne schien, nicht ein Wölkchen trübte den Himmel. Wir waren auf dem Rückweg von einem Tag im Wellness-Spa. Nach einem köstlichen Brunch gefolgt von einer Massage und einer Gesichtsbehandlung war ich bestens gelaunt und vollkommen relaxt.
»Noch mal danke«, sagte ich und sah sie an. »Das war genial.«
Caras rotes Haar peitschte um ihr Gesicht, und sie lächelte, wobei sie ihre perfekten Zähne blitzen ließ. »War mir ein Vergnügen.«
Ich hatte Cara am Tilikum College kennengelernt, an dem ich nach Ashers Inhaftierung mein Studium wieder aufgenommen hatte. Wir hatten beide die Uni gewechselt und passten nicht zu den anderen Studenten. Obwohl wir erst Anfang zwanzig waren, hatte uns das Leben ziemlich übel mitgespielt, so dass wir etwas bodenständiger waren als alle anderen. Ein bisschen weniger unbeschwert und naiv.
So ging es einem, wenn man mit einem Mann verlobt war, der im Gefängnis saß.
Ich schob meine Sonnenbrille die Nase hinauf. »Mir war gar nicht klar, wie sehr ich eine Pause brauchte. Und die Massage.«
»Gut. Dann lässt du dich ab jetzt vielleicht häufiger von mir verwöhnen.«
Ich verdrehte die Augen. Cara entstammte einer reichen Hollywood-Familie und schwamm förmlich im Geld. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen bestand darin, es für mich auszugeben, wahrscheinlich vornehmlich, um mich zu ärgern.
»Ich finde es ja toll, dass du mich so verwöhnst, aber nicht dass du mir deshalb auf weitere dumme Gedanken kommst.«
»Nein, Süße, denn jetzt weiß ich ja, worauf du stehst. Nächstes Mal verbringen wir ein Wochenende in einem Spa in Napa. Oder vielleicht sogar in Paris.«
»Stopp. Auf Paris lasse ich mich definitiv nicht ein.«
»Du unterschätzt meine Sturheit.«
»Und du meine.«
Sie sah kurz zu mir hinüber. »Glaub ich nicht. Mittlerweile bin ich deinem Eigensinn gewachsen.«
»Keine Ahnung, was du meinst.«
Nach der nächsten Kurve nahm sie die Ausfahrt nach Tilikum. Manchmal fragte ich mich, warum sie in unserem kleinen Ort hängen geblieben war. Sie war in L.A. aufgewachsen, unter reichen Menschen und Promis. Hatte elegante Brunchs und exklusive Clubs besucht. Ursprünglich hatte sie sich aus reiner Rebellion gegen ihre Mutter für ein kleines College in einem total abgelegenen Städtchen entschieden. Und es hatte funktioniert: Ihre Mom war fuchsteufelswild geworden. Aber aus irgendeinem Grund hatte Cara Tilikum auch nach ihrem Abschluss nicht den Rücken gekehrt.
Dafür war ich unendlich dankbar.
»Und? Hast du Lust, heute Abend auszugehen?«, fragte sie.
»Klar. Woran hast du gedacht?«
»Egal, Hauptsache, ich kann mir ein paar nuttige Klamotten anziehen und muss hinterher nicht allein nach Hause gehen.«
»Ja, na ja, dann viel Spaß dabei.«
Schmollend schob sie die Unterlippe vor. »Komm schon, Grace. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Sex mehr gehabt. Ein hübscher Schwanz käme mir jetzt gerade recht.«
»Na gut. Wir können zusammen ausgehen, und du darfst dich nuttig anziehen und dir einen hübschen Schwanz organisieren.«
»Und was ist mit dir?«
»Was meinst du?«
»Wenn du jetzt schon glaubst, entspannt zu sein, würdest du dich wundern, was so ein hübscher Schwanz noch alles bewirken könnte.«
Als wir in die Stadt einbogen, verlangsamten wir unser Tempo, und ich strich mir das Haar glatt. »Ich passe, aber trotzdem danke.«
Sie stöhnte. »Dann zieh dich wenigstens genauso nuttig an wie ich. Ich werde zwar weiter dran arbeiten, dir irgendwann mal wieder guten Sex zu verschaffen, weiß allerdings, dass ich noch nicht allzu viel erwarten kann.«
»Ja, ist auch besser so.«
»Warum bist du diesbezüglich dermaßen stur?«
»Du weißt warum.«
Sie trat auf die Bremse und hielt mitten auf der Straße an ‑ ohne Stoppschild, ohne Kreuzung. Es war zwar niemand hinter uns, aber trotzdem.
»Was machst du denn da?« Ich sah über die Schulter. »Kannst du vielleicht wenigstens an den Rand fahren?«
Sie drehte sich zu mir um und schob die Sonnenbrille hinunter, um mich darüber hinweg anzusehen. »Nimm ihn ab. Wenigstens heute Abend.«
»Was soll ich abnehmen?«
Sie richtete den Blick demonstrativ auf meine Hand. »Den da.«
Mir blieb der Mund offen stehen, und einen Augenblick lang war ich sprachlos. Ich war daran gewöhnt, dass sie mich wegen meines fehlenden Sexlebens aufzog; das machte sie eigentlich dauernd. Aber meinen Ring abzunehmen? »Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Nein, das tue ich ganz sicher nicht.«
»Süße, du weißt, dass ich dich mehr als alles auf der Welt liebe, aber wie lange willst du damit noch weitermachen?«
»Womit weitermachen? Ich bin verlobt.«
»Ob er sich auch noch daran erinnert?«
Ich wandte den Blick ab. »Es ist kompliziert, das weißt du doch.«
Sie schwieg kurz, dann legte sie die Hand auf meine. »Tut mir leid. Du hast recht, es ist kompliziert. Wenn du ihn nicht abnehmen willst, dann solltest du ihn anbehalten.«
»Ich weiß, dass du das nicht nachvollziehen kannst«, sagte ich mit leiser Stimme. »Das erwarte ich auch gar nicht. Du hast ihn nie kennengelernt. Du hast uns nie zusammen erlebt.«
»Ich will dich ja verstehen. Du bist meine beste Freundin, und wenn du etwas haben willst, dann mache ich es mir zur Lebensaufgabe, es dir zu beschaffen. Es ist nur … du hast schon so lange nichts mehr von ihm gehört.«
»Ich weiß.«
Cara hatte recht. Doch ich war nicht die Einzige, bei der er sich nicht gemeldet hatte. Asher hatte den Kontakt zur Außenwelt vollkommen abgebrochen. Er weigerte sich, Besuche zu empfangen, und abgesehen von gelegentlichen kurzen Nachrichten an Gram, in denen er ihr mitteilte, dass alles in Ordnung war, gab es keinerlei Lebenszeichen von ihm.
Seit sieben Jahren hatte ich ihn weder gesehen noch von ihm gehört.
»Glaub mir, ich weiß, dass man mich entweder für dumm oder für verrückt hält, weil ich an der Verlobung festhalte.« Ich hielt die Hand in die Höhe. Normalerweise trug ich immer mehrere Ringe an verschiedenen Fingern, die ich genauso häufig wechselte wie meine Outfits. Nur Ashers Ring nahm ich nie ab. »Aber mir ist es egal, was die Leute von mir halten. Es geht niemanden was an. Asher hat mich gefragt, ob ich ihn heirate, und die Tatsache, dass er ins Gefängnis musste ‑ weil er mich gerettet hat, falls dir das entfallen sein sollte ‑, bedeutet noch lange nicht, dass es vorbei ist.«
»Ich habe nicht vergessen, dass er dich gerettet hat, und du kannst Gift darauf nehmen, dass ich ihm dafür einen dicken Kuss gebe, wenn ich ihn endlich kennenlerne.«
Hinter uns hupte ein Auto. Cara drehte sich um und funkelte den Fahrer böse an.
»Los, Cara, nun fahr schon zur Seite!«
Sie löste den Fuß von der Bremse und bewegte sich wieder vorwärts. »In dieser Stadt gibt es so gut wie keinen Verkehr. Er hätte mich problemlos umrunden können. Und ich halte dich weder für dumm noch für verrückt. Okay, vielleicht bist du doch ein wenig verrückt. Aber wer ist das nicht?«
»Warum schlägst du dann vor, dass ich meinen Ring abnehme und mich in Nuttenklamotten mit dir auf die Pirsch begebe? Was hast du für Hintergedanken?«
»Je näher das Datum seiner Entlassung rückt, umso mehr frage ich mich, ob das nicht eine Riesenenttäuschung für dich wird und du danach total unglücklich bist.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust.
»Grace, meine Sorge ist keineswegs unbegründet. Bei eurem letzten Zusammentreffen hat er sich von dir getrennt.«
»Warum habe ich dir das nur jemals erzählt?«
»Weil ich dich vorher betrunken gemacht habe.«
Ich verdrehte die Augen. »Miststück.«
»Ich mache mir bloß Sorgen um dich. Du fantasierst dir da etwas zusammen. Was ist, wenn er entlassen wird und du feststellen musst, dass er das mit der Trennung ernst meinte?«
»Meinst du, darüber hätte ich nicht auch schon nachgedacht? Eigentlich denke ich an nichts anderes. Aber, Cara, ich kenne ihn. Ich kenne uns. Nach seiner Entlassung wird es schwer für uns. Richtig schwer. Er wird nicht mehr derselbe sein, und ich bin es auch nicht. Aber er und ich …«
»Ihr seid Seelenverwandte? Füreinander bestimmt? Leidensgenossen? Eure Liebe steht nur unter einem schlechten Stern?«
»Letzteres hoffentlich nicht. Hört sich an wie bei Romeo und Julia, oder? Und die waren am Ende beide tot.«
»Stimmt, aber genauso gut könnten auch Liebende gemeint sein, deren Sterne einfach nicht die gleiche Bahn ziehen. Und das trifft auf jeden Fall zu.«
»Was du nicht sagst.«
Am Postamt bog sie nach links ab und fuhr langsamer, so dass wir Harvey Johnston zuwinken konnten. Sein grauer Bart war ganz zottelig, und er trug staubige Arbeitsklamotten. Wegen seines ungepflegten Äußeren und seines verwirrten Verhaltens hielten ihn viele für einen Obdachlosen. Aber er wohnte in einer Hütte vor der Stadtgrenze und schien einigermaßen gut für sich selbst sorgen zu können. Er war eben bloß ein wenig merkwürdig.
Ich mochte ihn. »Hey, Harvey.«
Er winkte mit breitem Grinsen zurück.
»Asher liebt seine Familie«, fuhr ich fort. »Er hat sich nicht zurückgezogen, weil er sich ihr gegenüber beschissen verhalten will oder weil sie ihm egal ist. Er hat es gemacht, um zu überleben. Das ist der einzige Grund, warum er den Kontakt zu allen Menschen gekappt hat. Selbst Gram sagt das. Wahrscheinlich hat er einfach keine andere Wahl.«
»Und deshalb musste er sich auch gleich von dir trennen. Weil er das Gefühl hatte, keine andere Wahl zu haben.«
»Auch auf die Gefahr hin, dass du das ironisch meinst: Ja, genau das war der Grund, warum er mich freigegeben hat. Abgesehen davon war das damals gar keine richtige Trennung, sondern vielmehr ein Streit, den wir vor sieben Jahren begonnen haben und bislang noch nicht austragen konnten.«
Sie lachte.
Ich stieß sie mit dem Ellbogen an. »Warum lachst du mich aus? Sei nicht so gemein.«
»Bin ich nicht, versprochen. Ich habe mir nur gerade vorgestellt, wie er nach Hause kommt und du als Erstes Streit mit ihm anfängst.«
Das war gar nicht so abwegig. Auf jeden Fall hatte ich ein Hühnchen mit Asher zu rupfen.
Aber erst nachdem wir bis zum Umfallen miteinander gevögelt hatten.
Mein Gott, wie sehr ich ihn vermisste!
Vor meinem Haus wurde sie langsamer und hielt schließlich an. »Ich sage dazu Folgendes: Ich werde deine Loyalität immer bewundern.«
»Danke.«
»Tut mir leid, dass ich dir vorgeschlagen habe, den Ring abzunehmen. Ich will mich nicht mit dir streiten. Und solange du wütend auf mich bist, mag ich mich gar nicht verabschieden.«
»Du bist echt komisch.«
»Ich weiß. Ich kann nichts dafür. Schuld daran ist meine schreckliche Kindheit.«
Ich schnallte mich ab und beugte mich zu ihr herüber, um sie zu umarmen. »Ich bin nicht wütend auf dich.«
»Danke, Süße!«
»Sollen wir uns gegen acht im Caboose treffen?«
»Klingt gut.«
Ich schnappte mir meine Tasche und ging ins Haus.
Auf dem Boden meines Wohnzimmers lagen Muster für Arbeitsplatten und Schranktüren ausgebreitet. Ich hatte ganz vergessen, dass ich sie gestern Abend dort liegen gelassen hatte. Dieses Haus hatte ich vor etwa einem Jahr erstanden. Bis dahin hatte es jahrelang leer gestanden und war völlig unbewohnbar gewesen. Schon damals hatte ich allerdings erkannt, dass man nur etwas harte Arbeit reinstecken musste, um diese Bruchbude in ein Juwel zu verwandeln. Ich hatte immer noch einiges vor mir, doch das Wohn-, ein Bade- und ein Schlafzimmer waren von Grund auf renoviert worden. Die Küche konnte man zwar benutzen, allerdings gab es keine Türen an den Schränken, und der Linoleumboden war abscheulich. Aber alles funktionierte. Daher hatte ich vor ein paar Monaten hier einziehen können.
Das Leben auf so einer Baustelle war nicht einfach, doch das war mir egal. Und wenn ich mal eine Pause brauchte, konnte ich stets ein paar Tage lang bei Cara unterkommen.
Da ich zugesagt hatte, heute Abend mit ihr auszugehen ‑ was bedeutete, dass ich diesen Abend nicht im Pyjama mit einem Glas Wein auf meiner Couch verbringen würde ‑, duschte ich, frisierte mich und legte ein wenig Make-up auf. Anschließend ging ich in die Küche, um mir ein schnelles Abendessen zuzubereiten.
Leider herrschte in meinem Kühlschrank gähnende Leere. Verdammt. Ursprünglich hatte ich gestern zusammen mit Cara einkaufen gehen wollen, mit ihrer Spa-Überraschung hatte sie mir allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war zwar kein Grund zum Klagen, aber ein Besuch im Supermarkt war dennoch unerlässlich.
Also schnappte ich mir meine Schlüssel und die Handtasche und lief zur Tür hinaus. Ich beschloss, noch rasch bei meiner Mom vorbeizuschauen und meinen kleinen Bruder aufzugabeln. Wahrscheinlich würde es ihm gefallen, mal aus dem Haus zu kommen. Und falls er doch keine Lust hatte, würde ich ihn mit Süßigkeiten oder so was bestechen. Auch mürrische Elfjährige hatten schließlich noch etwas für Süßes übrig, oder?
Ich wohnte weniger als anderthalb Kilometer von meinem Elternhaus entfernt, so dass ich schon bald da war. Als der Wagen die private Zugangsstraße entlangholperte, konnte ich Moms Auto nirgends entdecken; nur Jacks Polizeifahrzeug parkte vor dem Haus. Vor ein paar Jahren hatte Mom Jack Cordero geheiratet, einen ehemaligen Cop aus Seattle, der jetzt im Bezirksbüro des Sheriffs als Chief Deputy arbeitete. Es hatte sich ein wenig seltsam angefühlt, mit Mitte zwanzig noch einen Stiefvater zu bekommen, zumal meine Mom vorher nie verheiratet gewesen war, nicht mal mit meinem eigenen Vater. Aber Jack war ein netter Kerl und liebte sie über alles.
Ich fand es toll, dass sie endlich glücklich war, dass sie jemanden gefunden hatte, der sie anständig behandelte, ganz im Gegensatz zu meinem Mistkerl von Vater, der ‑ Ironie des Schicksals ‑ ebenfalls im Gefängnis saß.
Jeder Außenstehende hätte sicher einen Vaterkomplex bei mir vermutet. Ich war verlobt mit einem Mann, der acht Jahre wegen Totschlags hinter Gittern saß, während mein Vater wegen Drogenschmuggels ebenfalls inhaftiert war. Ja, diese Grace Miles hatte ihr Leben auf jeden Fall im Griff.
Doch in Wirklichkeit hatte ich nie viel mit meinem Vater zu tun gehabt. In meiner Kindheit hatte es kurze Phasen gegeben, in denen er regelmäßig zu Besuch kam. Aber meistens war er nicht da gewesen. Vor etwa fünf Jahren hatte ich dann herausgefunden, wieso. Er war verheiratet und hatte noch vier weitere Kinder. Meine Mom hatte keine Ahnung davon gehabt, und erst nachdem ich ihm nachgespürt hatte, weil er keine Unterhaltszahlungen mehr für Elijah leistete, hatte seine Familie von uns erfahren.
Jetzt hatte ich drei Halbbrüder und eine Halbschwester, die allesamt bloß eine halbe Stunde mit dem Auto von mir entfernt lebten. Glücklicherweise kam keiner von ihnen nach dem Mann, der uns gezeugt hatte. Ich liebte meine neue Familie. Sie war fantastisch.
Manchmal nahm das Leben schon unerwartete Wendungen.
Ich parkte neben Jacks Auto, aber mein Blick schweifte zu Grams Haus hinüber. Ich fragte mich, ob sie vielleicht auch irgendetwas aus dem Supermarkt brauchte. Da ich sowieso hinfahren wollte, konnte ich sie auch gleich fragen, ob ich ihr etwas mitbringen sollte.
Ich überquerte die Wiese und ging die Stufen zur Veranda hinauf. Grams Haus schien sich in all den Jahren nie verändert zu haben. Dieselbe das gesamte Haus umspannende Veranda, die unter den Füßen quietschte. Die Eingangstür stets in fröhlichem Gelb gestrichen. Passende gelbe Fensterläden. Ihr Garten war legendär und brachte mehr Obst und Gemüse hervor als manche kleinen Bauernhöfe.
Dieses Haus war genauso sehr mein Zuhause wie Moms. Ich hatte unzählige Erinnerungen daran, wie ich mit den Jungs an Grams Küchentisch saß, die Beine baumeln ließ und Kekse oder Blaubeermuffins verspeiste. Gram besaß viele Morgen Land, und einen Großteil meiner Kindheit war ich mit Asher hier herumgestreunt. Wir hatten im Bach gespielt, Flöße gebaut, Geschichten erfunden. Es war ein schönes Leben gewesen.
Die Eingangstür war wie üblich nicht verschlossen, also betrat ich das Haus und hörte in der Küche Wasserrauschen.
»Hey, Gram!«, rief ich und wanderte den Flur hinab zum rückwärtigen Teil des Hauses. »Ich gehe einkaufen. Brauchst du irgendwas …« Ich schrie auf und blieb wie angewurzelt stehen.
Am Spülbecken stand ein Mann. Kurzes dunkles Haar und breite Schultern, deren Muskeln sich deutlich abzeichneten. Starke, tätowierte Arme.
Einige der Tattoos erkannte ich wieder. Das war doch nicht möglich.
Er drehte das Wasser ab, wandte sich um und sah mir in die Augen.
O mein Gott.
Mir stockte der Atem, und einen Augenblick lang brachte ich keinen Ton heraus.
Es war Asher.
Oder jemand, der früher einmal Asher gewesen war. Dieser Mann war breit und stählern, und auf seiner Stirn prangte ein Pflaster über einer frischen Platzwunde. Ich musterte ihn von Kopf bis Fuß. Er sah so anders aus.
Doch er war es. Er stand genau vor mir.
Er starrte mich an, und eine steile Falte bildete sich zwischen seinen Augenbrauen. Sein Blick wirkte beunruhigt. Warum sah er mich auf diese Weise an? Er öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen, aber dann schloss er ihn wieder.
Endlich bekam ich ein Wort heraus: »Asher?«
»Was tust du hier?« Seine Stimme klang heiser, beinahe monoton.
»Ich? Was tust du hier?«
»Ich wurde entlassen.«
Wieder zögerte ich, setzte mehrfach an, bevor meine Stimme mir gehorchte. »Du wurdest … Was? Warum hat mir denn niemand Bescheid gesagt? Wann bist du angekommen?«
Er gab keine Antwort. Starrte mich nur an, als könne er nicht glauben, dass ich hier war.
Diesen Moment hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Wenn er herauskam, hatte ich vor den Gefängnistoren auf ihn warten wollen, um mich sogleich in seine Arme zu werfen.
Stattdessen standen wir jetzt in Grams Küche und starrten einander an, als wüsste keiner von uns, was er tun solle.
»O mein Gott, was ist bloß los mit mir?« Ich machte einen Schritt auf ihn zu und wollte ihm die Arme um den Hals legen.
Aber er streckte die Hand aus, um mich daran zu hindern. »Nicht.«
Ich zuckte zurück wie nach einer Ohrfeige. »Was?«
»Ich kann nicht.«
»Was kannst du nicht?«
»Ich bin einfach noch nicht in der Lage dazu.«
»Wozu bist du nicht in der Lage? Ich verstehe nicht.«
»Fuck«, murmelte er. Er blickte zu Boden und umklammerte die Theke hinter sich, als müsse er sich festhalten, um nicht umzufallen. »Du musst gehen.«
»Das ist nicht dein Ernst. Asher …«
»Bitte«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Er schloss gequält die Augen. »Bitte geh.«
Die Erinnerung an unser letztes Zusammentreffen drohte mich zu überwältigen. Damals hatte er gesagt, es sei vorbei und ich müsse ihn loslassen.
Nun war er wieder zu Hause und wollte, dass ich ging?
Trauer und Zorn kämpften in meinem Inneren um die Vorherrschaft, so dass ich keinen Ton herausbrachte. Die Welt schien kopfzustehen. Dann wandte ich mich um und verließ das Haus.
Kapitel 4
Asher
Ich konnte mich einfach nicht beruhigen.
Die Holzdielen quietschten unter meinen Füßen, während ich in meinem alten Schlafzimmer auf und ab ging und meine Panik in den Griff zu kriegen versuchte. Mein Herz schlug zu schnell, und das Adrenalin schien mich von innen heraus zu verbrennen. Zitternd vor Erregung ballte ich die Hände zu Fäusten. Kurz davor, vollkommen auszurasten.
Am liebsten hätte ich auf irgendetwas eingeprügelt.
Warum war sie hergekommen? Wieso ausgerechnet heute?
Ich war erst seit wenigen Stunden da. Nach meiner Ankunft hatte Gram so getan, als wäre ich nur für ein verlängertes Wochenende weg gewesen, statt die letzten sieben Jahre hinter Gittern gesessen zu haben. Sie hatte gelächelt, mich fest in die Arme genommen und mir dann aufgetragen, meine Sachen in mein Zimmer zu bringen.
Meine Brüder hatten bleiben und feiern wollen. Das war allerdings das Letzte, was ich jetzt brauchte, aber Gram hatte mir die Mühe erspart, es ihnen zu erklären. Ihr war wohl klar, dass ich nicht einfach so tun konnte, als sei alles in Ordnung. Dass ich immer noch der Alte war und mühelos da mit meinem Leben weitermachen konnte, wo ich aufgehört hatte.
Ich kam quasi aus einer anderen Welt und war nun hier gestrandet ‑ mit nichts als den Kleidern, die ich am Leib trug.
Nachdem Gram meine Brüder hinausgejagt hatte, hatte die vertraute Umgebung dieses Hauses mir ein wenig Halt gegeben. Die Fensterläden und die Eingangstür waren nach wie vor gelb gestrichen. Die Böden quietschten genau wie früher an den gleichen Stellen. Und wie eh und je duftete es nach frisch gewaschener Wäsche und gebackenem Brot.
Nach zu Hause.
Ich hatte Gelegenheit zum Nachdenken gehabt. Mich zu beruhigen und wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Und ich hatte einen neuen Plan geschmiedet.
Mein ursprüngliches Vorhaben war durch meinen leitenden Justizvollzugsbeamten vereitelt worden. Jahrelang hatte ich mich abgeschottet und mich hinter meinem Panzer verschanzt, um zu überleben. Erst kurz vor Ende der Haftstrafe hatte ich meinen Schutzwall langsam abbauen wollen, zumindest weit genug, um vor meiner Heimkehr wieder eine Verbindung zu meiner Familie aufzubauen. Dann wollte ich sämtliche ihrer Briefe lesen, um mich über die Veränderungen in Tilikum zu informieren. Ich hätte mit meinen Brüdern telefoniert und meine letzten Wochen im Gefängnis genutzt, um mich auf das Leben draußen vorzubereiten.
Nie hätte ich damit gerechnet, vorzeitig entlassen zu werden.
Also musste ich einen neuen Plan fassen. Ich musste mich eine Weile hier zu Hause verbarrikadieren. Mir ein paar Tage Zeit geben, um mich wieder zurechtzufinden. In der sicheren Umgebung von Grams Haus auskundschaften, wie das Leben jetzt lief. Ich würde hier sämtliche Briefe lesen, Fragen stellen, Zeit mit meinen Brüdern verbringen. Und wenn ich bereit war, würde ich meine Kreise ausweiten. Mehr Neuigkeiten in Erfahrung bringen. Mich nach draußen wagen und mit eigenen Augen sehen, was sich verändert hatte. Den Menschen zeigen, dass ich wieder zu Hause war.
Aber dann war Grace hereingeplatzt und hatte diesen neuen Plan ebenfalls zunichtegemacht.
Ich war einfach noch nicht bereit, mit ihr zusammenzutreffen.
Ich ging weiter auf und ab, versuchte dem Drang zu widerstehen, meine Faust gegen die Wand zu rammen. Ich sehnte mich nach dem Schmerz ‑ wollte meine Knöchel spüren.
Hätte mich am liebsten geprügelt.
Dieses Bedürfnis steigerte meine Panik so sehr, dass ich glaubte, von ihr verschlungen zu werden. Ich war nicht mehr im Gefängnis. Ich konnte nicht einfach auf irgendetwas eindreschen ‑ oder auf jemanden. Jemandem meine Faust in den Magen zu rammen oder zu hören, wie ein Kinn unter meinem Hieb knirschte, hätte mir vielleicht kurzfristig Erleichterung verschafft. Aber hier war das verboten.
Auch wenn ich es mir eigentlich nicht eingestehen wollte, war mir klar, warum ich plötzlich das Gefühl hatte, dass mir der Boden unter den Füßen entzogen wurde. Sieben Jahre lang hatte ich in dem starren Korsett strenger Regularien funktioniert. Ich hatte eine Struktur gehabt. Und der plötzliche und unerwartete Verlust dieser Routine brachte mich aus dem Gleichgewicht.
Eigentlich hätte ich meine Freiheit genießen sollen, tatsächlich aber war ich völlig neben der Spur.
Warum hatte sie ausgerechnet heute hier auftauchen müssen? Während ich nach meiner Entlassung immer noch unter Schock stand?
Ich hörte auf, hin und her zu laufen, und stützte einen Arm gegen den Fensterrahmen. Schloss die Augen und holte ein paar Mal tief Luft, um meinen Körper zur Ruhe zu zwingen. Meinen rasenden Puls zu beruhigen. Doch als ich die Augen öffnete, fiel mein Blick als Erstes auf Grace’ altes Schlafzimmerfenster.
Verdammt.
Ich packte den Vorhang, um ihn zuzuziehen ‑ wobei ich ihn vermutlich heruntergerissen hätte ‑, als ich Grams Stimme hinter mir hörte.
»Hey, Bär.«
Langsam öffnete ich die Faust wieder und ließ den Vorhang los.
Seit ich denken konnte, trug sie ihr Haar zu einem langen Zopf geflochten, allerdings war er mittlerweile völlig ergraut. Ihr Gesicht war von tiefen Falten durchzogen, aber ihre dunkelbraunen Augen blickten nach wie vor klar drein.
»Was für ein Tag.« Sie setzte sich auf die Kante meines alten Doppelbettes und klopfte auf die Matratze neben sich. »Komm her.«
Ihre gelassene Stimme beruhigte den wütenden, verletzten kleinen Jungen in mir sofort. Ich gehorchte und nahm neben ihr Platz.
»Lass dir Zeit, Bär.«
Ich beugte mich vor, stützte die Unterarme auf die Schenkel und fuhr mir mit den Fingern durchs Haar. »Ja.«
»Ich meine es ernst. Entspann dich und atme erst mal durch.«
»Ich versuch es ja.«
Eine ganze Weile sagte sie nichts, aber ihre stumme Präsenz half trotzdem. Mein Herz beruhigte sich langsam, und die Panik ließ nach.
»Manchmal brauchen wir nur einen sicheren Ort, um unser inneres Chaos zu überwinden. Einen Ort, an dem wir uns getrost fallen lassen können, um uns hinterher wieder aufzurichten.« Sie tätschelte mein Bein. »Hier ist so ein sicherer Ort, Bär.«
Ich kniff die Augen zusammen und schluckte die überwältigenden Gefühle hinunter, die sich Bahn zu brechen drohten ‑ Gefühle, die ich so lange begraben hatte. Wut und Aggression waren meine ständigen Begleiter gewesen ‑ und Langeweile. Aber Empfindungen wie Liebe oder Dankbarkeit waren mir fremd geworden, so fremd, dass ich sie kaum wiedererkannte.
Gram schwieg, während ich mich mühsam zusammenriss, meine Gedanken sich überschlugen und mein Herz sich schmerzhaft zusammenzog. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht glücklich war. Machte mir Sorgen, dass ich nicht klarkommen würde. Und hatte Angst, dass ich mittlerweile viel zu verkorkst war, um hier wieder Fuß zu fassen.
Dass ich alle mit mir herunterziehen würde.
Nach und nach normalisierte sich meine Atmung. Ich öffnete die Augen wieder, richtete mich auf und wischte mir die Hände an der Hose ab.
Nun, da die Panik meinen Blick nicht länger vernebelte, erkannte ich, dass meine Seite des Raumes total vollgestopft war. In unserer Jugend hatte ich dieses Zimmer mit Evan geteilt. Aber seine Seite war nun leer. Auf dem Bett lag ein Quilt, allerdings war es nicht seiner. Die neue Decke und die dazu passenden Kissen ließen darauf schließen, dass es als Gästebett genutzt werden sollte. Seine Regale und sein Nachttisch waren leer. Keine riesigen Klamotten oder Schuhe Größe 47 auf dem Boden.
Auf meiner Seite wirkte das Zimmer beinahe bewohnt. Ich musterte den handgemachten blauen Quilt, der auf meinem Bett gelegen hatte, so lange ich zurückdenken konnte. Auf den Regalen türmten sich Sportpokale, die ich bei meinem Auszug hiergelassen hatte. Dann noch Lehrbücher aus dem College und alte Spiralblöcke. Meine Uniform für die freiwillige Feuerwehr hing im Schrank neben meiner alten Letterman-Jacke. Kisten mit der Aufschrift Asher stapelten sich an der Wand, und mein alter Wecker ‑ dieses grässlich laute Ding, das Gram mir im zweiten Studienjahr gekauft hatte, damit ich nicht mehr verschlief ‑ zierte den Nachttisch.
Daneben befand sich ein gerahmtes Foto von Grace und mir. Vorher hatte das in meiner Wohnung gestanden.
»Hast du all meine Sachen behalten?«
»Das meiste schon. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir nur ein paar Lebensmittel aus deinem Kühlschrank weggeworfen. Aber abgesehen davon ist das meiste hier gelandet.«
»Warum hast du nicht einfach alles weggeworfen? Oder es eingelagert oder so?«
»Ich fand es schön, die Sachen hierzuhaben.«
Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte. Anscheinend meinte sie es ernst.
»Grace auch.«
Beim Klang ihres Namens zuckte ich zusammen, aber ich konnte Gram wohl kaum verbieten, ihn auszusprechen. »Was?«
»Ich glaube, auch ihr gefiel es, deine Sachen hier zu wissen. Wenn sie ihre Mom besuchte, kam sie hin und wieder her und saß eine Weile in diesem Zimmer herum.«
Ich beugte mich wieder vor und rieb mir mit den Händen übers Gesicht. Ich brauchte noch etwas Zeit, um die Wahrheit über Grace zu erfahren. Zeit, um mich darauf einzustellen, wie sie jetzt lebte.
Sie war so verdammt schön. Allein ihr Anblick schmerzte.
Ich konnte einfach noch nicht über sie reden, und doch konnte ich mir die Frage einfach nicht verkneifen. »Warum wohl?«
»Wahrscheinlich fand sie es tröstlich, weil sie sich dir hier verbunden fühlte. Es war für uns alle nicht leicht.«
»Gram, es tut mir so leid …«
»Lass das!«, schnitt sie mir mit scharfer Stimme das Wort ab. »Du konntest nichts dafür, dass du ins Gefängnis musstest. Das war völlig ungerecht. Also hast du dir nichts vorzuwerfen.«
Sie irrte sich. Es gab jede Menge, wofür ich mich entschuldigen musste. Aber ich wollte nicht mit ihr streiten.
»Nur bei Grace musst du dich entschuldigen.«
Ich stöhnte auf. Na toll. Sie hatte Ohren wie ein Luchs und vermutlich alles mitbekommen.
»Hast du gehört?!«
»Gram, ich kann nicht.«
»Du kannst ihr nicht sagen, dass es dir leidtut, sie auf diese Weise abserviert zu haben? Natürlich kannst du das.«
»Nein, ich bringe es einfach noch nicht über mich, mit ihr zu reden.«
Erneut tätschelte sie mir das Bein. »So schlimm wird es schon nicht werden.«
Angesichts der Gefühle, die mich eben überwältigt hatten, als ich sie unten gesehen hatte, war ich da nicht so sicher. »Ich weiß nicht recht.«
»Na, ich schon. Aber lass dir trotzdem Zeit. Du hast jede Menge durchgemacht, und keiner wird dir einen Vorwurf machen, wenn es eine Weile dauert, bis du wieder festen Boden unter den Füßen hast. Aber das wird schon.«
Auch da war ich nicht sicher. »Danke. Und, Gram?«
»Ja?«
»Danke, dass ich hier wohnen darf.«
»Wie gesagt, jeder braucht irgendwann mal einen sicheren Ort. Und meine Jungs sind hier jederzeit willkommen.«
Kapitel 5
Grace
Na, wenn das kein verdammter Albtraum war! Total überrumpelt und etwas benommen verließ ich Grams Haus und fragte mich, was zum Teufel da gerade passiert war. Ich ignorierte das Klingeln meines Handys, denn bestimmt brachte ich sowieso keinen Ton heraus.
Noch bevor ich wieder daheim war, klingelte es erneut. Diesmal sah ich zumindest nach, wer es war. Levi. Der verpasste Anruf war von Evan gewesen. Wahrscheinlich wollten sie mir mitteilen, dass Asher wieder zu Hause war, aber ich hatte im Moment keine Lust, mit irgendeinem Mitglied der Familie Bailey zu sprechen. Wenn ich mich wieder beruhigt hatte, würde ich sie zurückrufen.
Ich stellte den Wagen in meiner Auffahrt ab, und als ich ausstieg, blitzte eine Erinnerung vor meinem geistigen Auge auf, so lebhaft, dass sie mir den Atem raubte. Ich, wie ich vor diesem Haus stand, nachdem Asher mir mitgeteilt hatte, dass er sich auf den Deal eingelassen hatte und ins Gefängnis gehen würde. Und dass ich ihn in Ruhe lassen sollte.
Ohne darüber nachzudenken, war ich hergefahren. Hatte vor dem damals verlassenen Haus geparkt und es mit Steinen, Stöcken und Kiefernzapfen beworfen, weil ich ein Ventil für meine Wut und meinen Schmerz brauchte.
Jetzt ging es mir ähnlich. Am liebsten hätte ich meinen Gefühlen freien Lauf gelassen und es genauso gemacht wie damals. Ich hob einen Kiefernzapfen auf und drehte ihn ein paar Mal in der Hand, während ich den Blick fest auf die Hauswand richtete.
Dann eine weitere Erinnerung. An den Abend, an dem Asher und ich einen gemeinsamen Spaziergang unternommen hatten. Er hatte meine Hand gehalten und mir gesagt, dass er mich liebte. Hatte mich genau vor diesem Haus zum ersten Mal geküsst. Wenn wir zusammenblieben, so hatten wir uns damals geschworen, würden wir es kaufen und instand setzen.
Es zu unserem Zuhause machen.
Ich hatte so viele Fragen, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Was war passiert? Wieso hatte mir niemand etwas gesagt? Und vor allem, warum stand ich nun ganz allein hier und fühlte mich beschissen, obwohl Asher keine zwei Kilometer von hier entfernt war?
Er hatte gesagt, dass er noch nicht dazu in der Lage sei. Wozu war er nicht in der Lage? Mich zu treffen? Warum?
Es fühlte sich falsch an, dass er zwar zu Hause war, ich ihn aber nicht in den Arm nehmen konnte. Normalerweise hätte ich mich an ihn geklammert und ihn gar nicht mehr losgelassen.
Mir war speiübel. Jahrelang hatte ich Angst vor Ashers Heimkehr gehabt. Und jetzt waren mir all meine Befürchtungen, die ich konsequent und stur zu verdrängen versucht hatte, um die Ohren gehauen worden.
Meine Sorge, dass er seine Worte von damals ernst gemeint hatte, dass es tatsächlich vorbei war und ich umsonst gewartet hatte.
Mein Handy pingte erneut. Stöhnend stand ich auf, um einen Blick darauf zu werfen.
Gram:Alles wird gut, Gracie-Bär. Er braucht nur Zeit. Warte weiter auf ihn.
Ich atmete tief aus, ließ mich erneut auf die Couch sinken und sah auf ihre Textnachricht herab. Ich hätte ihr so gern geglaubt. Gram sagte nichts, nur weil man es hören wollte. Manchmal hüllte sie die Wahrheit in Geschichten oder Metaphern, die man erst später verstand, aber sie schonte niemanden. Wenn sie sagte, dass alles gut werden würde, dann glaubte sie daran.
Dennoch war der Gedanke, dass ich womöglich sieben Jahre meines Lebens damit verschwendet hatte, auf einen Mann zu warten, der mich nicht mehr wollte, zu viel für mich. Irgendetwas musste ich mit der aufgestauten Energie und Nervosität anfangen. Erst schrieb ich Gram eine Textnachricht, in der ich ihr dankte, dann kramte ich meine Sicherheitsbrille und einen Vorschlaghammer hervor. Ich musste noch einen Teil der Schränke und der Arbeitsplatte herausschlagen.
Also tat ich, was ich immer tat, wenn mir alles zu viel wurde. Ich machte mich an die Arbeit.
***
Vor dem Caboose zögerte ich und fragte mich, ob es wirklich so eine gute Idee war, heute auszugehen.