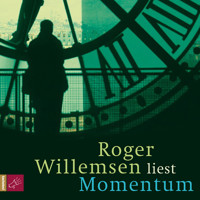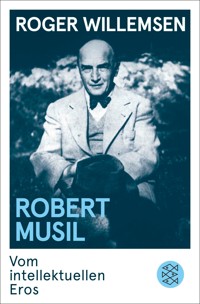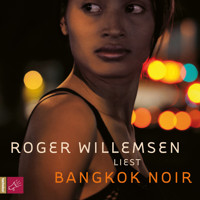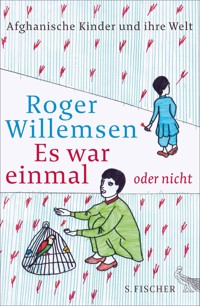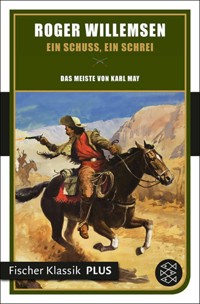16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1986 lebt Roger Willemsen in London, setzt sich an den Küchentisch und beginnt ein Experiment: Er beginnt zu schreiben und lässt uns zugleich in jedem Moment daran teilhaben. Und so werden wir zu atemlosen Zeugen, wie sich zufällige Beobachtungen, Gedanken und Erinnerungen – die »Figuren der Willkür« – zu einem Buch formen, das seine Geschichte selbst erzählt. Was Schreiben wirklich bedeutet, wird hier nicht beschrieben. Es wird gelebt und erlebbar gemacht. »Ich bin froh, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Es irrt sich oft, es hat sie nicht alle. Ich mag es sehr.« Roger Willemsen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mit einem Nachwort von Insa Wilke
Figuren der Willkür
Autobiographie eines Buches
Über dieses Buch
1986 lebt ein junger Mann, der Roger Willemsen sein könnte, in London, setzt sich an den Küchentisch und beginnt ein Experiment: Er beginnt zu schreiben und lässt uns zugleich in jedem Moment daran teilhaben. Und so werden wir zu heimlichen Zeugen, wie sich zufällige Beobachtungen, Gedanken und Erinnerungen – die »Figuren der Willkür« – zu einem Buch formen, das seine Geschichte selbst erzählt. Was Schreiben wirklich bedeutet, wird hier nicht beschrieben. Es wird gelebt und erlebbar gemacht.
»Ich bin froh, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Es irrt sich oft, es hat sie nicht alle. Ich mag es sehr.« Roger Willemsen
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Roger Willemsen, geboren 1955 in Bonn, gestorben 2016 in Wentorf bei Hamburg, war Autor und Literaturwissenschaftler. Darüber hinaus produzierte er Fernsehsendungen, drehte Dokumentarfilme und stand mit zahlreichen Programmen auf der Bühne. Willemsen war Honorarprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin und langjähriger Schirmherr des Afghanischen Frauenvereins. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Adolf-Grimme-Preis in Gold, dem Rinke- und dem Julius-Campe-Preis, dem Prix-Pantheon-Sonderpreis, dem Deutschen Hörbuchpreis und der Ehrengabe der Heinrich-Heine-Gesellschaft. Zu seinen Bestsellern gehören »Deutschlandreise«, »Der Knacks«, »Die Enden der Welt« und »Das Hohe Haus«, posthum erschienen »Wer wir waren«, »Musik! Über ein Lebensgefühl« und zuletzt »Liegen Sie bequem? Von Büchern und vom Lesen«. Über das Gesamtwerk informiert der Band »Der leidenschaftliche Zeitgenosse«, herausgegeben von Insa Wilke. Willemsens künstlerischer Nachlass liegt im Archiv der Künste in Berlin.
Impressum
Neuausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS – Büro für visuelle Kommunikation
Coverabbildung: Handschrift Roger Willemsen
ISBN 978-3-10-491579-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Vorspann
Der ABC-Schütze
Reden vor dem Spiegel
Ichsätze
Der Schreibtisch
Also wirklich
Außerhalb des Imperfekts
Inspiré
Ach
Jubilare sine vox
Der Obelisk
Autogramme und Initialen
Druckstellen
Impressio
Con brio
Die Verzierungen der Bundeslade
Die Literatur mit dem Buckel
Beschönigung
Abspann
Figuren der Wirklichkeit
Personenregister
Und manchmal dämmerte in mir dann eine Art von Bewusstsein, was ich durch die Worte ausdrücke »Ich sagte mir usw.« oder »Molloy, tue es nicht!«, oder »Ist das der Name Ihrer Mutter, sagte der Kommissar«, ich zitiere aus dem Gedächtnis. Oder ich drücke es aus, ohne dabei so tief zu sinken wie in der oratio recta, indem ich andere genauso lügnerische Redefiguren gebrauche, wie zum Beispiel »Es schien mir, dass usw.« oder »Ich hatte den Eindruck, dass usw.«, denn mir schien nicht das Geringste, und ich hatte keinerlei Eindruck irgendwelcher Art, sondern es hatte sich einfach irgendwo irgendetwas geändert, was bewirkte, dass ich mich auch ändern musste, oder dass die Welt sich auch ändern musste, damit nichts geändert würde.
Samuel Beckett
Vorspann
Das Buch über das Buch hinauszutreiben, also Dinge zu sagen, die in geschlossenen Abhandlungen nicht vorkommen, in der Literatur aber das Interesse auf sich ziehen: Eine solche Versuchung motiviert die Form dieses Buches. Es reagiert auf die Verminderung der Wirklichkeit in der gedruckten Rede, auf die Verbannung der Flüchtigkeit, auf Formen, in denen Bücher ihr Überleben sichern.
Die Arbeit am Buch ist immer wohlerwogen, die Anstrengung läuft darauf hinaus, es perfekt zu machen – eine Haltung, die dazu beiträgt, Bücher heute so fremd erscheinen zu lassen. Dabei existiert ein Buch wesentlich außerhalb des Buches, es existiert als Assoziation, auf einem Bahnsteig, als Einfall oder Erinnerung. Man muss von diesen Formen, also auch von der Gewinnung des Buches sprechen, von den Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass eine Seite so und so abgefasst wurde.
Der autobiographische Rahmen ist Ausdruck des Wunsches, bestimmte Gedanken zu denken, sie aber nicht ohne Beteiligung des Denkenden zu denken. Alltägliches hemmt oder treibt die Fortsetzung des Schreibens, deshalb ist es nicht grundsätzlich wichtiger, dass sich der Held eines Romans die Hose anzieht, als dass ein Autor eine neue Seite einspannt. Es ist ja auch wenig mehr als eine Konvention, dass sich der Autor in literarischen Texten jede Gestalt geben kann und in nicht-literarischen keine, nicht mal die eigene.
Wenn im Lauf der Überlegungen Politiker, Film- und Schlagerstars genannt, wenn Annoncen, Rezensionen, Briefe, Telefonate, Parolen zitiert, wenn gehörte, erinnerte, gefundene Rede und Tratsch benutzt werden, so geschieht es vor allem, weil dem Buch in diesen Formen die eigene Zeit oft am nächsten lag und weil nur eine Literaturbetrachtung ohne Gegenwart zu einer unangefochtenen Schrift gelangt, während Werbung, Schlager und Politiker auf ihre Weise signifikanter sprechen als die meisten Bücher, deren Schrift ihrerseits übermalt wird von der Leistung der anderen Medien und ihrer Sprachgesten.
Gewöhnlich werden die unterschiedlichen Sprecharten und Textsorten isoliert gewürdigt: Es gibt ein Verhalten zur Werbung, eines zum Liebesbrief, eines zum Distichon. In diesem Verständnis verschwinden die Beziehungen der Texte untereinander, und ihr Ausdruck wird blind. Manchmal ist aber die Werbung rührender als ein Naturgedicht und ein Sonett brutaler als ein Slogan. Durch eine Gleichordnung der unterschiedlichsten Textsorten kann man versuchen, zu einem konsequenteren Verhältnis zum Geschriebenen und Geredeten zu kommen. So ergibt sich ein notwendiges Durch- und Nebeneinander von alten und jungen Texten, langfristig wahren und flüchtigen. Es geht hier ja nicht primär um die Darstellung der Geschichte des Schreibens, sondern um die Charakteristik der literarischen Arbeit an der Wirklichkeit.
Deshalb bildet dies Buch die Koexistenz der unterschiedlichsten Schriften im Bewusstsein des Schreibenden ab, deshalb überlädt es sich mit Schrift und gibt doch gleichzeitig zu erkennen, wie sehr es von einem Widerwillen gegen repräsentative Literaturvorstellungen geleitet wird. Es bietet seine Überlegungen nicht wie einen Besitz an, eher wie eine Vermutung, die es dem imaginären Leser zum Weiterschreiben überlässt: kein Bericht, keine Theorie, keine Erzählung, kein Sachbuch …
Schließlich hat dieses Buch »leichte« und »schwierige« Passagen. Die leichten erscheinen manchmal nur leicht, weil das Gefühl spontan alles zu verstehen meint, was dem analytischen Verstand vielleicht schwierig vorkäme; die schwierigen wirken manchmal nur schwierig, weil sie auf nichts zurückgreifen, was sich der Leser und der Autor immer schon gedacht hatten. Jedes echte Reproduzieren aber vollzieht eine Wiederholung der Schwierigkeiten, die es gemacht hat, einen Gedanken zu denken, ihn darzustellen und in der Festlegung seiner Grenzen auch die des Schreibenden zu erfahren. Möglicherweise leistet ein Buch manchmal auch Verzicht auf das Verstandenwerden, möglicherweise hat es an manchen Stellen einfach andere Probleme als der Leser, zum Beispiel in dem Versuch, ein Buch und kein Buch zu sein.
Der ABC-Schütze
Gegen Abend schoben sich die Wolken zu einer Fläche zusammen, und ich ging zurück in die Welwyn Street. Imperfekt, nach den Gesetzen der Harmonielehre: ein Intervall von der dritten Person Plural zur ersten Person Singular.
Noch mal: Gegen Abend schoben sich die Wolken zu einer Fläche zusammen, und ich ging zurück in die Welwyn Street. Immer beginnen sie mit dem Wetter, dann maximal zwei, drei Akzente pro Satz und eine monochrome Schauseite.
Das Haus stand in einer Wolke aus Staub und Dämmerlicht, davor spielte ein Mann auf einem Dudelsack, der sich aus der Ferne anhörte wie ein schreiendes Kind in einem Insektenschwarm. Ich erinnere mich. Es ist 23 Uhr 15, das Buch beginnt.
Das Summen des Kühlschranks, die eilenden Schritte auf dem Pflaster, die verschliffenen mühsam auf der Treppe, ein in den Rahmen geschobenes Fenster, eine Uhr. Aus der Ferne nähert sich ein Überfallkommando mit seiner unsauberen Quinte, minutenlang bleibt es vor dem Fenster stehen. »Gott sei Dank, endlich Wirklichkeit!«
Die Tage gehen unscheinbar dahin. Mittags überquert man mit einem Brot in der Hand die Straße, fährt U-Bahn, führt ein paar ungründliche Reden, bleibt vor einem Fenster stehen. Später sieht man in den fallenden Regen, Freunde kommen, man spricht über Politik oder Filme oder abwesende Freunde oder sonst was. Man fährt in die Stadt, geht ins Kino, wenn es sonst nichts gibt, und fährt wieder mit der Bahn, wieder nach Hause. Vor dem Schlafengehen werden ein paar Zeitungen durchgesehen, die Fotos wenigstens, etwas zum Anstreichen oder Rausreißen. Später wird man sich an nichts erinnern.
All das lässt sich nicht beliebig, nicht belanglos genug erzählen, diese Lebensführung, die in ihrem unkonzentrierten Ablauf noch am ehesten einer Folge von musikalischen Figuren ähnelt, einem Singsang. Diese so heruntergeleierten Jahre haben jedenfalls nicht die Struktur eines Satzes mit handelnden und leitenden Elementen, mit wahren Indikativen und echten Konjunktiven, mit einem fühlbaren Nach- und Nebeneinander, einer Ordnung-in-sich und einer Einfügung in alle Ordnung – dieses Leben liegt, vom Satz aus gesehen, wie unsichtbar da.
»Bad? Worse?«, antwortete vor zwei Tagen der Tourist aus Teheran. Es habe keinen Sinn, solche Worte zu benutzen, sie machten es nur schlimmer … als ob man jetzt, nachdem man sie ausgesprochen hat, etwas wirklich bezeichnet hätte …: »Was bei uns geschieht, geht weiter als Worte … hat mit Worten nichts zu tun … literature, of course … das ist: eine Beziehung herstellen zwischen schönen Dingen, natürlich dem Gesicht der Frau und, sagen wir: der Landschaft … of course … worse: Nicht die Sprache kann das sagen, die Wirklichkeit sagt es, handelt es … überraschend jedes Mal … wir dürfen keine Musik hören, um acht Uhr abends wird der Strom abgeschaltet, damit wir ins Bett gehen … im Dunkeln machen die Kinder mit dem Mund die Trompete nach, andere tanzen …«
Wenn ein Gedanke ausgesprochen wird, schrickt die Wirklichkeit zusammen. Sie nimmt die Gestalt der Ordnung an, erscheint und verschwindet. Der ordentliche Satz enthält eine Erinnerung an einen Ernstfall. Man erinnert sich jetzt an eine Familie von ernsten Sätzen und Gedanken, Formen, an das Bestimmende zu denken, das hier und anderswo die Wirklichkeit formt. Plötzlich hat man das tonlose Leben überschritten. In der Katastrophe des ernsten Satzes erkennt man das unscheinbare Leben selbst als Katastrophe, jetzt eine Angst vor der Berührung mit dem Satz: Nicht das jetzt … nicht!
Im Widerstand gegen den ernsthaften Satz erinnert man sich an das Entsetzen vor der allgemeinen Ordnung. Versuchsweise beginnt man zu sprechen, man gibt der Sprache das Gesicht der Katastrophe, und sie spricht … in einem Ausbruch … von Besonderung. Ähnlich wie das minutenlange Verweilen des Überfallkommandos vor der Tür, das die Wirklichkeit wie eine Erinnerung fühlbar machte.
Trotzdem treibt man sich in diese begriffliche Anstrengung immer tiefer hinein, Sie auch, Leser, benebelt von einem Ausdrucksbedürfnis, das durch die Stimmigkeit von Sätzen spricht, denn Konstruktion, Satz, Periode, Prosa, Aufbau, Komposition sind vor allem Formbegriffe für den Versuch, selbst logisch, kontinuierlich, unangreifbar, stimmig, vernünftig, eingeweiht und all das ganz und gar zu sein, und während mich doch keinen Augenblick das Gefühl verlässt, ein Buch zu schreiben, ein Buch über Bücher, ein Buch und kein Buch, es hier gerade zu beginnen, mit Sätzen, die sich unablässig selber und durch mehr legitimieren müssen als bloß durch den Wunsch, etwas Weitläufiges, Zusammenhängendes und unendlich Beruhigendes zu errichten. Während sich dieses Gefühl neben der Schrift erhält und mich diese immer wieder verlieren lässt, organisiert sich mein ganzes Leben im labilen Gleichgewicht zwischen Gelingen und Misslingen, und ich weiß genau, wie sehr beide mit eben den Momenten verbunden sind, in denen sich die Abwesenheit des ganzen Lebens verdichtet, so dass aus der Empfindung der Unzusammengehörigkeit von allem und der Beziehungslosigkeit zum Schreiben eine positive Vorstellung von dem entsteht, was ein Text ist. Als wäre es schön, textartig zu sein und ein Buch zu werden, ein Ebenbild!
Ich sehe wieder auf die Straße hinunter; indem ich auf die Frau warte (stellen Sie sich irgendetwas vor), warte ich auf das Buch, das auch misslingen muss, wenn es gelingen soll. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch bleibt, bis sie in den Flur tritt … das Geräusch des Schlüssels, der abgesetzten Tasche, der Klotür, des fallen gelassenen Mantels, der umgefallenen Stiefel … was heißt das, nichts aus ihr zu machen, keine Ersatzgesellschaft, kein dialogisches Gegenüber, kein Alter Ego, kein Medium der Kritik, nichts als eine Instanz der Störung gegenüber diesem Text, der mich von ihr entfernt? Wie sehr hat sie abmagern müssen, um hier, so!, zu erscheinen! Auf welchen Wegen kommen überhaupt Menschen in Texte? Man könnte nur noch das entdecken wollen.
Gewiss verrät es Schwerfälligkeit, wenn man sich heute Dinge ausdenkt, die später ein Buch werden sollen, im Angesicht aller Bücher, oder wenn man an die Erfahrungen mit Büchern denkt, Schulbüchern, Gesetzbüchern oder allein an die Satzformen, mit denen man sich hier anstecken konnte: »Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was sein ist.« »Höre ich dieses Rindvieh schrein …«, »Friss die Hälfte!«
Es ist eine reiche Vorstellung, sich das erste Buch zu denken als die Gesamtheit des Alphabets und aller seiner Metastasen in dem Menschen, der noch nicht lesen kann. Dieses imaginäre Buch, das sich aus dem Zusammenschluss sämtlicher linguistischer Zeichen zu einer geschlossenen Welt ergab, war voller Suggestion und voller erahnbarer Leiden. Wie empfindlich dringt die Schrift ins Bewusstsein – als plastische Form der Ausgeschlossenheit, solange man sie nicht beherrscht, und als Form des Ausschließens, sobald man ihrer mächtig ist.
Einige wenige lernen Schreiben, und einige ganz wenige lernen Lesen und Schreiben. Hinter der Geschwindigkeit des Sprechens kann man die ganz andere Geschwindigkeit des Lesens und Schreibens schon erahnen, jenes Tempo, das vielleicht dem der Affekte und der Bilderreize in der Außenwelt viel kühner und feierlicher angepasst ist. Jetzt aber ist die Schrift noch ein Inbegriff für die Schönheit als aufgehobene Wahrheit, sie bewahrt eine von Lust aufgerührte Erwartung künftiger Möglichkeiten des Wissens.
Die Qualen des Alphabetismus beginnen mit dem ersten zusammenbuchstabierten, gelesenen und wieder und wieder nachgeschriebenen Satz: »Heiner ist im Auto.« Es kann nachträglich so aussehen, als habe einen die Enttäuschung über die erste Handhabung der geschriebenen Sprache nie ganz verlassen. Jeder bewusste Satz hat etwas vom Fluidum dieser Enttäuschung in sich aufgesogen, denn die Sprache, die so gesprochen wird, ist so opak, dass sie die Idee eines universalen Mediums der Mitteilung nur durchlässt, um sie zugleich mit jedem neuen Satz neu zu verdrängen, bis zum Blödsinn, bis zur sprachlosen Stumpfheit.
Was konnte es angesichts dieser von dem einen Satz um sich greifenden Enttäuschung bedeuten: die Verfügung über das Geschriebene zu erhalten, all dieser innere Aufwand, um schließlich den einen glanzlosen Satz aus allen Sätzen herauszuschälen, etwas so Abstraktes, ohne Anschauung, ohne Wirklichkeit und ohne den mindesten Reflex dieser neuen Macht des Benennens? »Lobet all das Handwerk, Groß und Klein«, selbst das ist mehr, selbst: »Mach dir nicht ins Hemd!« Mit einem solchen kommunikativen Hohlraum im Kopf aber findet man nichts wieder in der Wirklichkeit. Niemals erscheint sie der Erfahrung so, wie sie in der Phrase erscheint: »Heiner ist im Auto.« Schon der erste Satz war ein Abschied.
Auch die folgenden Sätze waren so, auch der erste Text, der erste abgeschlossene, in die Schrift gebrachte Ausschnitt aus der Wirklichkeit: ein unmöbliertes Zimmer, und niemand da, der den Reiz der Abwesenheit in jedem Satz erklären oder nur auf ihn hätte aufmerksam machen können. Erst ziemlich spät lässt sich im Lesen die Spur dessen nachvollziehen, was nicht ist, und manchmal löst sich eine groteske Komik aller Anstrengungen des Redens aus diesem Nichtsein der Wirklichkeit in der Sprache, greift auf den Text über und reißt ihn in den Unsinn. Auch »Wanderers Nachtlied« ist dann Unsinn, auch die »Manhattan Island Serenade«.
Immerhin. Es gibt andere Formen, sich auf das Abwesende in Texten zu konzentrieren. Zustände. Man beginnt zu lesen, wie man das erste Mal schwimmt, ohne Konzentration auf etwas anderes als die Fähigkeit zu schwimmen. Mit ständig erhöhter Geschwindigkeit schwimmt die Sprache vorbei, wird wie ein flüchtiger Aufenthaltsort zur Kenntnis genommen, und alle Bewusstheit verengt sich in der Beobachtung des eigenen Lesens: Ich schwimme! Ich schwimme!
Ebenso wird man schreiben. Ohne Fragen an die Dinge – »Heiner ist im Auto« – ohne an das »ist« in diesem Satz zu rühren, ohne etwas anderes auszubilden als die Fertigkeit, die Sprache vor den Dingen zu verschränken.
Anders als im imaginären Buch wird im Lesen- und Schreibenlernen die Sprache zum Material abgerichtet. Was sonst hatte ich zu lernen, als mich durch sie in die Gemeinschaft der schriftlich Kommunizierenden zu promovieren? Die Gesellschaft, die man in der Schrift gewinnt, bildet ein zeichenhaftes Arrangement ganz anderer Art, als man es je zuvor kannte. Seine Wirklichkeit zeigt kaum eine tragfähige Verbindung zu dem, was einen früher umgab, und erst dem allerselbstverständlichsten Schreiben gelingt es vielleicht, die Schrift so weit schwinden zu lassen, bis die vorschriftliche Welt wieder in Erscheinung tritt. »Ich schwimme, ich schwimme«, werde ich dann schreiben, und: »Heiner ist im Auto.« Solchen Unsinn, heimgekehrtes, unüberprüfbares, talentloses Geschwätz. Verstehen Sie? Ich versuche eine Vorstellung vom Trivialen zu ehren, ohne es identifizieren zu können. Ist es deshalb wertlos, sich dann und wann an die Möglichkeit eines so vollendet gelungenen Trivialen zu erinnern?
Sie sitzt inzwischen am selben Tisch und hat mit nervöser Geschwindigkeit begonnen, einen Text zu übersetzen. Sie hält kaum einmal inne, als wollte sie mit ihrer Tätigkeit gar nichts anderes, als das Bild des Schreibens aufrechterhalten. Mir zur Unterstützung. Das Bild einer Motorik, die sich bewusstlos an ein Nichts anlehnt. Und den Gedanken, schreibe ich ihn nicht in genau dieses Nichts? In dieser Pose also die Gemeinschaft?
Die Gemeinschaft der schriftlich Verbundenen bildet sich in der Selbstbehauptung der Einsamkeit aller Schreibenden erst richtig heraus. Deshalb ist die Einsamkeit in der Schrift noch größer als außerhalb ihrer. Im Laufe der Jahrhunderte hat das Schreiben einen Individualitätszwang produziert, der in mancher Hinsicht zur synthetischen Erschaffung des Menschen mehr beigetragen hat als zur Abbildung des normalen. Ja, selbst die Darstellung des Normalen ist von einer gänzlich unsolidarischen ästhetischen Verschrobenheit gekennzeichnet: Vermutlich ist das die Voraussetzung zur Aufnahme in jene Gesellschaft, in der die Menschen durch die literarische Verteidigung ihrer Besonderung miteinander verkehren.
Zunächst bildet die Literatur also die Literatur ab und die Menschen, die in ihr fehlen, sie bildet die von der Literaturgeschichte geweckte Phantasie ab, und dahinter bringt sie umständlich die Wirklichkeit zum Vorschein, mit ihrem von der Literatur durchkreuzten und mit Zeichen übersäten Gesicht.
Also folgt die kommunikative Erregung exakt jener undurchsichtigen Grenze, durch die sich die Realität der Erfahrung und die Realität der fixierten Erfahrung wechselseitig beschränken. Wenn man aber einerseits die Motive entschlüsseln könnte, die aus der ersten Erregung einen Text werden lassen, und wenn man andererseits zeigen könnte, wie die überlieferte Literatur in jedem Satz mitschreibt, so dass sich ein Text niemals ganz von allein und durch sich selbst begründen kann, dann hätte man die Sprache überschritten mit einer Aussicht auf das, was sie treibt und was sie als vereinzelte Stimme im Chor der durcheinander kommunizierenden Sprachen verständlich macht. Ob sich das aber lohnt?
Die Literatur wenigstens verdankt ihre Beruhigung der Fähigkeit, alle unmittelbaren Sprachen der Reize, Konsonanzen und Farben, der Gesten, Laute und Gerüche, der mimischen Äußerungen und der Erinnerungen zu begrenzen oder zu unterbrechen, um sie dem Leser, beherrscht durch dessen eigene Reproduktion, zurückzuerstatten.
»Lieber«, »verehrter«, »geschätzter«, »wohlmeinender«, »gütiger«, »geneigter Leser« durften vergangene Jahrhunderte den besonnenen Kopf anreden, der über ihren Zeilen hing. Sogleich nehmen sie die Liebe, die Verehrung, die Wertschätzung jener vorweg, die sich mit den Autoren in die Tröstungen der Bildung, der reduzierten und reduzierenden Sprache teilen. Schöne, ausdrückliche Konvention des Wohlwollens zwischen Autor und Leser … ein gemeinsamer Abschied aus der praktischen Welt. »Lieber müßiger Leser«, spricht Cervantes den Einsamen an, der sich auf den »Don Quichote« eingelassen hat, »Ohne dass ich es schwöre, kannst du mir glauben, dass ich von Herzen wünsche, dies Buch, das Kind meines Geistes, möge so schön, so herrlich und klug sein, wie man es sich nur immer denken kann. Aber wer kann wider die Natur?«
Der Leser ist ein Bild, in dem sich die Untätigkeit der Zeiten spiegelt, und der Autor kann nicht einmal versprechen, dieser Untätigkeit Sinn zu verleihen. Er kann nur den Glauben herausfordern, den Glauben an die Tröstungen der Schrift, an die beruhigende Zurücknahme der Erfahrung im Text, an die Schönheit von Entwicklung, Stimmigkeit, Folgerichtigkeit, Konsequenz, und wie die ethischen Werte des Geschriebenen alle benannt werden.
Man nimmt ein Buch heraus, schlägt eine beliebige Seite auf und beginnt zu lesen – bevor man noch versteht, ergreift die Harmonieidee dieses ganzen Zusammenhängens und -stimmens, dieses Sich-Bedingens und -Stützens vom Leser Besitz. Der Ausdruck eines geschlossenen Textes ist schön – gleich, was er sagt –, weil er plausibel ist, weil seine Teile miteinander zu tun haben, weil die Worte aufeinander wirken und auseinander entwickelt werden, weil sie verbunden sind in Sätzen, Gefügen, Absätzen und Seiten, weil schließlich all das eine gesellschaftliche Vorstellung weckt, so als sei nicht eigentlich vom Sprechen, sondern vom Wirken und Handeln die Rede. Dass alles zusammenhängt, wirkt unter den Gesetzen der erzählerischen Prosa betrachtet nicht entsetzlich, sondern beruhigend. Die »umfassendste Chiffre, an der die halbe Welt hängt, ist das ›et cetera‹«. Baltasar Gracián erkennt so im Zusammenhang des Textes zugleich ein Abbild der Welt und eine tröstliche Dummheit; der einfältigste Text wäre danach derjenige, der gar nichts ausspricht als dieses »et cetera«. Jeden Ansatz zur Intensivierung reißt er mit sich fort und löst ihn in Handlung auf, immer flüchtig, skizzenhaft. Schließlich gibt es sprachgeschichtlich die Möglichkeit, dass »Kitsch« von »sketch« abgeleitet wurde. Weiter. Die eine Betrachtung sieht nach, wie die Welt im Text gemacht wurde, und Adorno sagt: »Alles Machen der Kunst ist eine einzige Anstrengung zu sagen, was nicht das Gemachte selbst wäre.« Die andere Betrachtung erkennt in der Wirklichkeit des Textes lauter Abwehrhandlungen gegen die Störungen beim Schreiben. Natürlich stellt man sich im Dienst einer positiven und empirischen Literaturbetrachtung am liebsten einen Autor vor, der Gedanken und Sinneseindrücke souverän organisiert. Wenn einem am Text aber nun besonders die Arbeit des Schreibens auffällt, dann erkennt man allmählich, wie ganze Figuren, ganze Situationen und Szenen gegen einen möglichen Abbruch des Schreibens mobilisiert werden, gegen Problematisches, Pessimistisches, Haptisches, Motorisches, Weibliches, kurz, gegen jede Einmischung (Interference). Man kann nicht beweisen, dass eine Person oder ein Gefühl nur deshalb aufgetreten sind, um in einer Phase zerebraler Leistungsschwäche dem Ende des Schreibens vorzubeugen; trotzdem glaube ich, dass man quer durch die gesamte Literaturgeschichte bis hinein in die Programme und Manifeste die Spur dieser Angst vor dem plötzlichen Versagen verfolgen kann, deutlich immer wieder bei Dostojewski, deutlich immer wieder auch in der Geschichte der Gesinnungsschriftstellerei.
In diesem Bereich entsteht eine ganz veränderte Rangordnung der Motive des Lebens, Schreibens und Sich-Behauptens, und das Geschriebene wird hart von der Anstrengung, sich nicht aufzugeben, und nachlässig vor Sicherheit, wenn die Folge der Ideen unabweislich, geschmeidig vor dem Stift erscheint. Diese Schrift aber, die hier noch lange laufen muss, damit sie ein Buch wird, und die die Gedanken jetzt schon weiß, die sie erst hundert Seiten später aufblättern will, diese angefochtene Schrift ist nicht das Buch. Das Buch ist: Hier zu sitzen, zu einer anderen Zeit, »in einem anderen Land«, mit einem Muskelreiz, der beherrscht wird, bis der Satz fertig ist – wenn es gut geht – und einer quälenden Verhaftung an die Stützpfeiler des Alphabets und der Grammatik – wenn es nicht gut geht –, und mitten darin fällt einem manchmal, wie ein Verkehrsschild vorbeifliegt, das Gesicht des Lesers ein, Dein Gesicht, lieber verehrter gleichgültiger, warum nicht sogar missgünstiger Leser, und die Schrift wird ein bisschen unklar und allgemein, sie liegt da wie unsicher von Deinem Gesicht abgepauste Rede, und während man noch das Tröstliche der kulinarischen Lektüre während des Schreibens selbst vorausschmeckt, wird man auch von der Verdrängungsleistung dieses Schreibens mitgerissen: Alles soll verschwinden, alles, das nicht Schrift ist, soll getilgt werden, das Leben verringert und gewaltsam ausgeschlossen werden, damit die Schrift ihr Recht bekommt, damit sie nach allen Metamorphosen der Erregung zurückkehren kann zur Einfachheit einer literarischen Oktave, vom C zum eingestrichenen C: »Der Unfall mit dem Kinde vernichtete den Oheim ganz; der Aufenthalt im Vaterlande ward ihm unerträglich, er ging auf Reisen, nach Frankreich und England, soll aber …« (Mörike).
Die Sprache soll sich selbst erzeugen, der Autor soll verschwinden; er selbst betritt diesen Weg, sobald er sich für das Buch entscheidet. Gewiss, so hoch sind die Auflagen des Mediums.
Man entscheidet sich schließlich auch für eine Schrift ohne Individualität, der Buchdruck ist ja nicht das Medium, in dem einem die eigenen Ideen als die eigenen erscheinen. Er ist nicht einmal Schrift in dem Sinn, indem es die Handschrift ist, nämlich ein Gebilde, das in Unregelmäßigkeiten und provisorischen Zügen die Silhouette des Gedankens in der spontanen Form seiner Herstellung bewahrt. Ich finde nicht, dass man die Schäden dieser Übertragung geringschätzen sollte: Nicht nur, weil es zwischen Laurence Sterne und Arno Schmidt eine Geschichte des Haders mit dem Buchdruck zu entdecken gibt, sondern weil mancher handgeschriebene Text wahrer ist, als er es im Druck je wird sein können. Überall ist das so, wo ein Ausdruck sich besondert oder wo er gegen die gläubige Anerkennung des Buchdrucks aufsteht.
Die »bildenden« Künstler haben vom Bildcharakter der Schrift am tiefsten gewusst (schließlich hatten sie ja auch im Buch schon das Bild erkannt), um die Jahrhundertwende haben die Maler von Korin und anderen asiatischen Kalligraphen gelernt, die Schrift ins Bild zu setzen oder sogar das Bild in die Schrift, aber schon viel früher entwickelte auch mancher Schreibende eine besondere Sensibilität für die Graphik der Worte. Als Cellinis Bruder, »der Pfeifer«, starb, ließ ihm Benvenuto eine Grabinschrift meißeln, auf der alle Buchstaben, mit Ausnahme der ersten, gebrochen waren.
Einmal sind also die graphischen Variationsmöglichkeiten beim gedruckten Wort viel zu wenige und viel zu konventionell, als dass sie die Ausdrucksbewegungen des gedachten oder notierten Wortes nachvollziehen könnten, und dann stehen sich im Text, stehen sich im gedruckten Text die Sprachen der durchgestrichenen, abgewiesenen, im gedruckten Text die beiden Sprachen der durchgestrichenen, eliminierten und der geretteten, unzensierten Schrift nicht mehr wie zwei Sprachen gegenüber, sie illustrieren den, sie bilden die Entstehung, sie bilden den Geschichtsprozess ab, sie bilden den Prozess der geschichtlichen Entstehung des Textes ab; löscht man diesen aber aus, löscht man diesen aus, löscht man ihn, so verleiht man dem Geschriebenen, verleiht man dem Text, dem Geschriebenen, belastet man den Text mit einer Objektivität, die er für sich selbst gar nicht besitzt, selbst nicht besitzt, nicht in Anspruch nimmt. Nach Wochen: Verleiht man dem geschriebenen Text eine Objektivität, die er für sich selbst nicht in Anspruch nimmt.
Man korrigiert, um den Gedanken zu verbessern, um die Gestalt zu modifizieren oder die Sprache und um sich der eigenen Geschichte hinzugeben. Das war damals, bevor ich Albertus Magnus, Alexander von Humboldt und … nein, haben Sie zwei Märkte besuchen, Ente essen, schlafen, den Regen fallen hören müssen, Langweiler, um zwei Worte aus dem Gefüge zu reißen und zu ersetzen? Ist es das? Ist es wirklich die Biographie des Schreibenden, die sich in der Biographie des Satzes niederschlägt? Es ist immer richtig, »historisch« zu sagen. Aber folgt das treffende Wort der Ente, verdirbt das nächste vor dem Bild des Regens? Hängt es damit zusammen, dass man mit den Satzformen isst und schläft, trocken und mühsam wird, dass man nie etwas behaupten möchte, als die Satzform des Lebens in einem bestimmten Augenblick des Schreibens?
Nur Befehlsformen, Glaubenssätze, werbende und tragische Formeln kommen ohne Korrektur aus. Hände weg vom Mitschüler, der Mitschülerin. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Nie war er so wertvoll wie heute. Ich habe es nicht gewollt. Sie sprechen verbindlich für die Gemeinschaft der Abhängigen, der Gläubigen und der Opfer. Vorsicht Umsturzgefahr! Das Grabmal ist umgehend fachmännisch zu befestigen! Auch in Büchern ist das Unzweifelhafte brutal, eine Nötigung dem Verstehen gegenüber, eine Verdrängung gegenüber der Arbeit. Daraus kann man ein paar Folgerungen ziehen: Ähnlichkeit des Werkes mit dem Produkt, Korrektur als Verweis auf die Arbeit, Fehler und misslungene Partien verraten die Störbarkeit der Gestaltung, die Diskrepanz zwischen Person und Satz etc., das kann man schnell zu Ende denken.
Fra Angelico (erste Hälfte des 15. Jahrhunderts) lehnte Perspektivstudien, technische Kniffe und angeblich auch Korrekturen in seiner Malerei ab, sie war ihm Sakrament, unmittelbare Äußerung Gottes, und jede Korrektur wäre also eine Berichtigung Gottes gewesen. Ein ähnliches Programm beherrscht heute nur noch die Sprache des Politikers, der jeden Satz als unwiderrufliche Emanation des Rechtsgedankens ausspricht und keine Korrektur zulässt, weil in ihr sichtbar würde, dass das Recht und die Überzeugung gemacht, inszeniert und gebeugt werden. Am mutigsten hat sich die Malerei seit dem 19. Jahrhundert der Beliebigkeit ausgeliefert, permanent fordert sie zur Umgestaltung, zur Korrektur, zur Vollendung auf, kategorisch animos gegenüber der befehlsartigen Erscheinung unzweifelhafter Gestaltungsformen.
Sie haben es leicht, die politische Rede und die Ware, unfehlbar zu sein, denn schließlich kann man sie immer an ihrer Funktion messen. Die Arbeit am Text aber wird schlechter ausgeführt als am Produkt. Sie kann zuverlässig weder empirisch überprüft noch durch die Veränderung des Serientyps revidiert werden, denn sie entsteht auf dem Kreuzungspunkt aller möglichen Anstrengungen des Willens, der Begierde, des Fassungsvermögens und in einem grundsätzlich labilen Verhältnis zu den verschiedenen Geschichten: der Autobiographie, der Bewusstseins- und der Kulturgeschichte, die sich alle wechselseitig beargwöhnen und zur Aufhebung treiben.
Mit einigem Recht kann man also glücklicherweise das Misslingen als Form der Vollendung beschreiben und sich an den Indizien der Auslassungen, Vereinfachungen, gewaltsamen Durchführungen und an gewissen Symptomen der Feigheit vor den Anforderungen des Stoffs den Vorgang des Produzierens nachbuchstabieren, und dann endlich sieht man den Schreibenden auch erleichtert, sobald er über den Berg ist.
Der Schriftsteller kennt sie natürlich genau, die Familie der erreichbaren, synthetischen Sätze und Phantasien, die jeder mit ein wenig Schamlosigkeit Begabte jederzeit hervorbringen kann: oft der Schauspieler, der brillant ist von Berufs wegen, oder der Pfarrer oder der Reporter. Auf der anderen Seite, ausgestattet mit holographischem Lorbeer, die wahren Schriftsteller, für die ein Satz, wie Paul Valéry gesagt hat, keine gleichgültige Handlung ist wie das Atmen und Kauen. Sie verachten die bloß technische Hervorbringung von Sprache und gewinnen einen ethischen Wert aus der Mühe, sich auf die unerreichbaren Sätze zuzubewegen, die wirklich unbezahlbaren, die man nicht erfinden kann und die man mit einer förmlich animalischen Leistung des Totstellens vor der Sprache auf sich aufmerksam macht. Diese Sätze werden den langen Passagen routinierter Sprachausübung meist behutsam implantiert, in ihnen ändert sich das Zeitmaß, sie sprechen das Warten aus, das Warten auf Erfahrungen und das Warten auf die Sprache.
Und dann, dass man sich mit jedem Satz gegen etwas behaupten muss: Gegen andere Sätze, gegen einen Einfall, gegen das Gefühl, gegen das Denken, gegen einen Brechreiz des Gehirns, gegen Klarheit, gegen Dunkelheit, gegen Entscheidungen, gegen Bedürfnisse, schließlich gegen alles, was nicht schreibt, was nicht noch im selben Augenblick beginnt, sichtbar oder spirituell die Feder zu führen, sowie gegen das, was auch schreibt. Dass man sich gegen all das behauptet, und sei es nur durch den physischen Akt des Schreibens, des Schreibens und Weiterschreibens, des Sich-durch-das-Papier-Hungerns, mit einer militanten Verspannung der Rechten und einer unsäglichen Beharrlichkeit – wenn das nicht verstanden wird, wird nichts verstanden, nicht die Entschlossenheit, nicht die Energie, nicht die Enttäuschung von sich, von der Schrift und von allem. Großes Ritual, so sieht man in seiner Arbeit den Schriftsteller mit der Schrift kämpfen.
Eine Krise nach der anderen hat er für sich entschieden, eine Müdigkeit mit der Nächsten bezahlt und nichts hinterlassen als kleine Zerstörungen und spröde Stellen im Gewebe seiner Erzählung, und hinter all den Niederlagen, aus denen sich ein Text zusammensetzt, steht die Person auf, die sich halbwegs durchsetzen konnte und doch die Beherrschung für Zeilen und Seiten aufgeben musste, Seiten, die am innigsten die Unnachgiebigkeit der vorgenommenen Welt dokumentieren, dieses partout-nicht-Textartige an ihr, und der Autor steht dazwischen, glücklich gescheitert, mit einer zur Dummheit entschlossenen Individualität, die sich gegen die »Folterungen der Fantasie« (Redon) durchgesetzt hat, um in der »Schönheit des Scheiterns« die »Aufgabe der Dichtung« erkennen zu können, wie es Oscar Wilde für alle formuliert hat.
In dieser ganzen, unvollständig gesehenen und unbewältigten Wirklichkeit drückt sich die Spur der arbeitenden Individualität des Autors ab, und wer sich von nichts anderem erregen ließe als von dieser Anstrengung, durch den Text zu kommen und die Wirklichkeit fertig zu machen, der würde auch die Antipathie erkennen, mit der der Schreibende vor den Anforderungen seines Stoffes agiert, diese latente Zerstörungswut, mit der die »schöpferische Individualität« auf die Gleichgültigkeit der Wirklichkeit Ideen und Formen gegenüber reagiert. So ist die Signatur des Mangels und des Versagens allem aufgeprägt, was im Geschriebenen persönlich wirkt und was in allererster Linie nicht die Dinge, sondern vielmehr das verzweifelte, schriftlich erstarrte Bewusstsein zur Erscheinung bringt. Auch deshalb ist die korrigierte und überschriebene Schrift, die unleserliche, »private« Ausdrucksfläche, wahrer als die Buchseite, auch offener, auch flüchtiger.
Das Bewusstsein der Flüchtigkeit: Treuestes Kontinuum des Schreibenden, während er schreibt: Er tut es augenblicklich, ohne die Unterstützung der Körpergefühle und Reizungen der sogenannten »Schreibsituationen«, er verfolgt die eigene Schrift als seinen Ausdruck der Übertreibungen und Vernachlässigungen. Im Buch sieht er all das sub specie aeternitatis wieder: So habe ich es nicht gemeint, ruft der Autor vor den eigenen Sätzen, so habe ich mich nicht gemeint, oder, wie der Wilde vor der eigenen Imago: Das bin nicht ich! und auf der anderen Seite der Leser vor derselben Schrift: So isses, genau wie bei uns, genau wie bei mir. Der Autor, ratlos, inspiriert vom Bild des Komponisten, der am Flügel mit einer Hand in den Tasten und einem Bleistift in den Noten arbeitet, lächelt in die Kamera.
Jedes Buch, das sich der eigenen Hervorbringung ganz bewusst ist, jedes gefährdete Buch also, ist am wahrsten in der Form des Unikats. Man (Arno Schmidt: »Zettels Traum«, »Abend mit Goldrand«) kann das imitieren, so korrespondiert man mit der Form des imaginären und maßlosen Buches, das sich nur einer vorstellen kann ohne Bewusstsein vom Buchwesen, einer, der sich ein Buch im Kopf überdimensional ausdenkt, ohne Rücksicht auf Material, Umfang und Vervielfältigung. Das »Buch der Bücher«, das »Buch der Natur«, das »Buch für alle und keinen« … Von einem solchen konzessionslosen Buch aus betrachtet ist die Ware »Buch« eine gemeine Beschränkung, aber diese Beschränkung ist seine Existenz. »Aber«, sagt Tieck, »wenn wir etwas schaffen wollen, müssen wir unserem Tiefsinn eine willkürliche Grenze setzen; so entsteht alle Wirklichkeit, alle Schöpfung, dass die Liebe sich auch in der Liebe ein Ziel, einen Tod setzt: Die liebende Angst zieht sich plötzlich in sich zurück und übergibt ihr Liebstes der Gleichgültigkeit, der Existenz, sonst könnte nie etwas entstehen.«
So bleibt auch hinter der Gestalt des Buches die Idee des imaginären Buches erhalten, von der der Dramatiker Ibsen, von der Ibsen, der Phantast, in diesem Falle, sagt: »Meine bedeutsamsten Werke, die kennt weder Mann noch Weib. Kein Mensch – außer mir, weil sie nicht geschrieben sind. Und warum sollte ich auch meine eigenen Ideale profanieren, wenn ich sie in Reinheit und für mich allein genießen konnte?« Für sich allein genoss Ibsen eines Tages auch eine junge Spanierin, die im schönsten Augenblick ausrief: »Schau, schau, unser Dramatiker!«
(Aufhören. Diese quälende, vorgeschossene Idee des Gelingens zeigt sich, so attraktiv wie abstoßend sie eben ist, durch und durch von Angst bestimmt. Denn wenn noch manchmal in klaren Augenblicken die Idee dieses Buches, an dem ich hier ja tatsächlich sitze, das also noch nicht ist, wenn sie also auch manchmal ganz klar ist, so bleibt doch die Angst vor der Zerstörung – und alles Schreiben ist Zerstören – gleich daneben präsent, und je plausibler mir die Form wird, desto entschiedener fürchte ich ihr Zerbrechen, und immer deutlicher wird mir dann, was schließlich auch eine literarische Geschichte hat, dass ich das Buch, das ich schreiben will, nur andeuten kann, und das sind doch wirklich zwei verschiedene Formen: das Schreiben und das Andeuten.)
Mit dem Buch entscheidet man sich für eine Äußerungsform, die so weit verengt und verkleinert werden kann, dass sie in die Schrift passt. Man bezieht sich also auf eine Wirklichkeit, von der man meint, dass sie sich der Schrift anbietet, eine Wirklichkeit, die der Schrift ihre Schauseite zeigt und zugleich verspricht, bei der Schrift zu bleiben und nicht plötzlich zu erkennen zu geben, dass sie sich in eine Fotografie, einen Cluster oder einen Gestus verwandeln möchte. Jeder einzelne Satz muss die besondere Neigung der Wirklichkeit aufspüren, gerade im Wort manifest zu werden. Deshalb muss der Autor einmal zur Probe und weiter, als er eigentlich sehen kann, seinen Stoff durchfühlt haben.
Die Wirklichkeit nötigt dem Schreibenden Stoff, Mittel und Motive auf. Wenn Joyce der Realität von Mr. Bloom und Mr. Daedalus in Sphärensprüngen aus Geräuschen, Graphiken und Floskeln folgt, so erhält seine Willkür doch in jedem Augenblick ihre Grenzen von der Realität selbst, die ihn in solche Präzisierungen treibt. Jede geschlossene literarische Darstellung aber wird mit einer insistierenden Kraft, die von Satz zu Satz immer schroffer wird, weil sie sich immer monomanischer und immer hypnotischer darstellt, darauf bestehen, jedes neue Element sei wie das vorangegangene ganz adäquat in der Sprache ausdrückbar. Diese Situation muss einem Bewusstsein, das in Bilderverschmelzungen, Farb- und Klangkaskaden und gedanklich geruchlichen Überblendungen wahrnimmt, beinahe krankhaft eindimensional erscheinen. Natürlich gibt es Benennungen solcher Vorgänge auch in Texten, aber diese sind hier immer nur gleichsam beschriftet und nicht sie selbst. Also bildet der kontinuierlich fortlaufende Text, auch wo er sich noch so realistisch gibt, einen künstlichen Zustand des Bewusstseins ab. So eindimensional, kausallogisch, folgerichtig und darüber hinaus permanent konzentriert ähnelt das hier unterstellte Bewusstsein des Buches kaum mehr dem, das alltäglich zwölfstündig müde wird: Hier öffnet sich die Kluft zwischen dem vollendeten Buch und der endlosen Schrift. Außerdem liegt die Wirklichkeit der Vorstellung dem sprachlichen Vermögen des Autors manchmal näher, manchmal ferner. Deshalb ist ein Satz in einem Text ganz Sprache, wo er an der Sache selbst geboren wird, wo die Wirklichkeit dem Satz glücklich entgegenkommt. Andere Sätze bleiben dagegen weit weg von der Sprache in einem Bereich der Andeutung und Kapitulation. Es kommt deshalb für den Autor weniger darauf an, sich eine Sache richtig vorzustellen, sondern vielmehr darauf, an der Vorstellung die Seite freizulegen, die der sprachlichen Ordnung zugewandt ist, nicht der filmischen und nicht der pantomimischen. Was wie ein Nachlassen der sogenannten »Kräfte« des Autors aussieht, bedeutet vielleicht nichts anderes, als dass er auf der literarisch unanschaulichen Seite einer Sache besteht, während ihn seine Phantasie mit Bildern speist, die er nun unablässig nachbuchstabieren muss.
Laurence Sterne hatte den Roman, sein beharrliches Nacheinander, sein dramatisches Fädenziehen und Bogenschlagen, sein Figurenbilden und -verderben und all das schon satt, bevor der Roman aus den Kinderschuhen heraus war, zum Zeitpunkt, da seine monotonen Entwicklungsstufen allerdings schon absehbar wurden. Sterne hat sich mit einer Ironie, die das Genre blamiert, aus der Gattung wie aus der Geschlossenheit des sprachlichen Weltbilds herausbewegt und sich im Zuge dieser Bewegung für alle möglichen Störungen des Schreibens interessiert. Nicht umsonst erzählt er in seiner »Sentimental Journey« die folgende Episode: »Ich erinnere mich, dass der hoch- und wohlgelehrte Bevoriskius in seinem Kommentar über die Geschichte der Menschen von Adam an mitten in einer Note sehr natürlich abbricht, um der Welt Nachricht von einem Paar Sperlingen zu geben, welches sich draußen an seinen Fensterrahmen gesetzt und ihn immer in seinem Schreiben gestört und zuletzt von seiner Genealogie gänzlich abgebracht hätte. Es ist wunderbar! schreibt Bevoriskius; die Sache hat aber ihre Richtigkeit, denn ich bin so neugierig gewesen, jedes Mal einen Strich mit der Feder anzuzeichnen … Während der kurzen Zeit, da ich die andere Hälfte dieser Note hätte ausschreiben können, hat mich das Männchen wirklich dreiundzwanzig- und einhalb Mal durch seine wiederholten Liebkosungen gestört.«
Man kann auch die andere Seite zeigen, die Störung im Bereich der Sprache selbst. Am leichtesten in der Lyrik. Schließlich hat hier jede poetische Minimaleinheit die größte Belastung zu tragen. »Schlafend trägt man mich in mein Heimatland« beginnt Alfred Mombert ein Gedicht in dem Band »Der Glühende«. Der Inhalt der Vision ist sprachlich nicht ganz klar: Wer schläft? könnte man fragen, aber diese kleine Irritation wird kaum fühlbar oder allenfalls, als sei sie schon eine Folge des Wunderbaren, das in dem Bild hergezeigt wird: eine Vorstellung, die ganz im schmucklosen Satz aufgeht und mit ihm untergehen muss. Es gibt für dieses visionäre Epigramm keine sprachliche Folge, es kann nicht erweitert und nicht entwickelt werden; trotzdem fügt der Autor, gleichermaßen unter dem Bann der Vorstellung wie unter dem des sprachlichen Gelingens, einen Satz an, der sich deutlich auf die sprachabgewandte Seite des Bildes bezieht: »Ferne komme ich her, / Über Gipfel, über Schlünde, (…)«. Also: Die Phantasie hatte ein Bild erfasst und bis in den Satz getrieben; darüber hinaus aber verweigert das Bild alles Begriffsähnliche, jetzt hallt es nur noch leer und unbezwungen aus einem imaginativen Anhängsel nach, das sachlich ohne Interesse, sprachlich ohne Präzision ist, und in dem nichts spricht als der empörte erste Eindruck, der durch handwerkliche Zudringlichkeit gekränkt wird. In diesem zweiten Satz, so taub er ist, befindet man sich aber gerade auf dem Boden jener sprachlichen Verweigerung, die nach nichts klingt als nach der vollständigen Auflösung sprachlicher Bestimmtheiten. Man kann nicht behaupten, diese Zusammenhänge seien Mombert und anderen Autoren nicht deutlich gewesen, wahrscheinlich schätzten sie den Wert ihrer epigrammatischen Funde so richtig wie deren Kosten ein. Die Literatur ist ja nicht nur das Medium, in dem man das Besondere festhält, sondern auch das, in dem man es sucht. Vielleicht war für Mombert der Vers in jenem Augenblick ein Instrument, um die Erregung aufzuspüren, und weniger eines, diese Suche darzustellen.
Für die Prosaschreiber gilt das Gleiche: Für eine einzige ehrliche Wortkombination brauchen sie oft zwei Seiten unaufrichtiger Prosa, und der Rest bleibt Denkmal der Suche, des Versagens vor dem Intensitätsgebot, nichts weiter.
Reden vor dem Spiegel
Immerfort vor sich hin die Lippen zu bewegen und den Elan des Redens zu genießen als das Element, in dem man die Abwesenheit der Wirklichkeit feiert, ohne sie beleidigen zu müssen, das ist das Berufsbild von Schriftstellern, schreibenden und redenden. Ich will keine Gedanken im Kopf haben, sagt sich dieser in der Sprache Verlorene, ich will sie draußen haben, und unter einer hygienischen Anstrengung ohnegleichen verwahrt er sich gegen die zerebralen Auftritte von Ideen, die ihn in die Sprachlosigkeit treiben könnten.
Also korrespondiert das Schreiben mit einer Erregung, die es durch Situationen und Probleme treibt, ohne in der Schrift jemals die eigene Gestalt zu finden, das eigene Bild. Das will sich nicht, wie Tieck sagte, an ein Gleichgültiges, das kann sich nicht an die Existenz ausliefern. »Wenn ich beim Malen nicht zittere wie die Natter in der Faust«, hat Delacroix berichtet, »bin ich kalt.« »Ich bin ein ausgesprochen überhitzter Mensch«, äußert Sandra Paretti. Wer so schreibt, mit der Seligkeit des schamlosen Redens im Gesicht, tut es für die Gemeinschaft der unerhörten Schwätzer, die in ihrer allen sozialen Prüfungen entzogenen Rhetorik ein Überlebensgefühl konservieren. Reden – Reden – vor dieser Erregung ist nichts gut oder schlecht, nichts wahr oder unwahr, reden Sie nur, nun reden Sie doch, und manchmal ziehen sie sich hinter ihre Rede zurück, nur um in Ruhe nachdenken zu können.
Wenn man einmal auf positive Beweise verzichten will, dann könnte man in der Struktur von Texten, in ihren wiederkehrenden, gesetzmäßigen Ordnungen ihre eigentliche Antwort auf die Erregung des Redens erkennen, die immer gleichmäßig hin und her kratzende Hand. Schrecklich, lesen Sie eine Novelle von Kleist, es gibt darin eine Sicherheit und Gleichförmigkeit der Prosa, einen Sog der Beherrschung, einen Befehl, eine völlig unverwandte Geste, mit der der Text sich abschließt, er strauchelt nicht, er gibt nicht nach, er hält seine Impulse in der Faust, ein Wunder der Beherrschung und schrecklich zugleich, hier müsste man noch etwas anschließen, etwas, das vom Charakter der Jagd in diesem Schreiben spricht, vom Gewinnen, Siegen im Wort …
Die chronisch vor sich hin reden und die mit jedem Satz eine Hand auf die Wirklichkeit legen, sie existieren in idealer Gemeinschaft mit denen, die die Schrift pflegen als das Mittel, Recht zu behalten. Da erscheint zwischen den Zeilen eine verbissene Besserwisserei, jeder Gegenstand ist ihr recht um der monologischen Obsession nachzugeben, der nie zugehört wird und die deshalb im Gespräch mit sich selbst immer Recht behalten muss. In der Gesellschaft gibt es neben dem Schriftsteller viele Einzelne, die so reden: einsame Männer, die nachts in der Küche mit ihrem Unglück oder der Politik des Landes abrechnen, Mönche, die mit dem Fernsehen sprechen, Frauen, die sich für den Nachrichtensprecher hübsch machen, solche, die auf dem Bürgersteig stehen bleiben und in den Himmel gestikulieren, Ehefrauen, die alleine über der Salatschüssel mit ihrem Mann hadern, oder Alte, die um vier Uhr in der Nacht aufstehen, um nach einer Wanderung quer durch den Wald in einer Kirche zu beten und während ihres Rückwegs beten sie weiter und zu Hause immer noch den Rosenkranz. Ich habe sogar von einer glanzvoll verarmenden Familie gehört, die an festlichen Tagen zur Mahlzeit Tischreden vom Tonband abspielte. Über zehn Jahre war das her, dass diese Reden in dem Hause gehalten worden waren, natürlich kannte sie jeder auswendig, und man kaute sie so mit zum Essen, todernst und deprimiert. Tatsächlich gibt es das.
Es gibt diese Menschen genauso in der Literaturgeschichte. Manche haben sich entblößt und es vorgezeigt, dass sie so sind. Die sollte man betrachten, wenn man nach der Entstehung von Werken fragt. Die Schwätzerfiguren aus den Büchern sollte man daneben aufreihen. Für wen hat Gaspara Stampa ihre Sonette gefertigt, diese verlassenen, mit jeder Zeile neu verlassenen Verse, eine in sich geschlossene, expressive Liturgie – »vivere ardendo e non sentire il male«. Oder für wen hat Adèle Hugo geschrieben (ja, die Tochter), als sie wie besessen die Seiten füllte und ihre Verlassenheit ausschöpfte? Werbung? Fixe Idee? Hysterie? Man stellt sich die Erleichterung wie die Ermattung in diesem Schreiben vor, die Erleichterung in der förmlich fanatischen Entäußerung, in dem plötzlich erscheinenden, einen, geschrienen, »sitzenden« Wort, die Erschöpfung am Ende eines Tagewerks aus dieser Schrift, wenn diese Konzentration des Vergeblichen sich erschöpfte.
Man stelle sich vor, dass die Schrift für diese Menschen so fraglos ist wie die eigene Existenz, dass sie kein Organ haben wollen für die Ambiguität des Schreibens, und dass sie es selbst verstehen, die Schrift immer wieder zu glauben, unabhängig von allen Behauptungen und Verfolgungen, die in ihr stattfinden, einfach so ministrieren sie der einzigen Verlässlichkeit: der Ausübung des Redens und Schreibens, platonische Kugelmenschen: ideale Leser, ideale Autoren in einem.
Man kann sich ferner vorstellen, dass diese Schriften wenig mit den Büchern zu tun haben, die wir kennen. Es handelt sich hier nicht um formal bestimmte Bücher, um gewisse, dem Markt ein bisschen verfallene Druckerzeugnisse, und vielleicht braucht man auch gar keine bestimmten Bücher, solange sie nur aus Erregung bestehen, und was man ein Buch nannte, wird man vielleicht auch ersetzen können durch die bezifferbaren Protokolle einer bestimmten Intensität. Und was für ein Glück, wenn man Bücher bekommt, in die man alles hineinschreiben kann, offene, der Flüchtigkeit der Schrift ehrlich hingegebene Sprechformen ohne Argument gegen das Altern der Sätze, wie man es sonst verteidigt, indem man »die Wahrheit«, etwas »Neues, Innerliches«, etwas »Unerhörtes« hervorbringt.
Es bedarf (und ich bin jeder Lebenssituation dankbar, die mir die Möglichkeit gibt zu sagen »es bedarf« oder »es ziemt sich«) solchen Texten gegenüber einer gesteigerten Sensibilität für ihre Eigenart des Suchens. Schon der einzelne, der richtige Satz ist immer fern, beständig setzt sich im Schreiben das Gefühl durch, man müsse auf das richtige Buch unendlich zugehen, und so sehr jeder Satz dabei provisorisch formuliert wird, so sehr entfesselt doch jede zu Ende gedachte Äußerung eine Euphorie vor den ungesagten Sätzen, ich meine Sätze, die nichts Bestimmtes sind, nichts als Niederschläge des Produktiven in einem vom Stofflichen geläuterten, fast substanzlosen Zustand, wie das Geschriebene von Gaspara Stampa oder Adèle Hugo, aber ohne Anlass und ohne Bewusstsein von den Motiven.
Eben auf dem Wort »Bewusstsein«: Heftiger Widerstand gegen das Schreiben, hervorgerufen vom Zweifel an der Trennschärfe des Worts und der Wahl der mit ihm verbundenen Stilhöhe, plötzliche Wahrnehmung der Lüge, die mit der halb konzentrierten Entscheidung für das Wort verbunden schien, dann eine parallele Vergleichung der Lüge mit der möglichen Fortsetzung des Buches, zwei Gedanken, die sich wie zwei Stimmen auf dem Klavier nebeneinanderher bewegten und zum völligen Stillstehen des Vorhabens führten, dieses Buch zu Ende zu führen. Absetzen und gedankenloser Blick auf eine halbe Tasse kalten Kaffee, ein paar Zeitschriften (»Time Out«, »Spiegel«), einen Prospekt von Wyndhams Theatre, eine lose Pernod-Werbung, ein paar Bücher, einen Taschenkalender, Stifte, die mir nicht gehören. Blick aus dem Fenster, »No Ball Games Allowed in Yard«, unkonzentrierte Beobachtung eines rotgekleideten Arbeiters mit der Nummer 81 auf dem Rücken, er winkt einen Lastwagen aus der Parklücke, nichts mehr sonst. Rückkehr an den Schreibtisch und flüchtiger Blick über die Stichworte f Besitz, die ich nun abarbeiten will, neuerliche Ermüdung; ging hinaus auf den Flur und sah die Treppe hinunter in der Hoffnung, sie käme heim. Kein Mensch. Inzwischen hat ein unhörbarer Regen eingesetzt, sie wird also aus dem Bus aussteigen und in flachen offenen Schuhen eiligst heimlaufen, der Wind treibt die Tropfen fast waagerecht an der Scheibe vorbei. Lust, sich eine Gewalthandlung auszudenken.
In der Küche kein Obst gefunden, zum Schreibtisch zurückgekehrt, weit ab von der Tischkante provisorisch über dem Papier gehangen, keinen wirklichen Widerstand, weder gegen das Geschriebene noch gegen das Schreiben entdeckt, trotzdem lieber eine Ansichtskarte vom Boden aufgehoben, darauf den Satz »Really, Barcelona is magic« entziffert. Für einen Augenblick die gravitätische Vorbeißerphysiognomie von Juan Carlos König auf der Briefmarke studiert, Abschied davon, jetzt wirklich zum Text zurückgekehrt. Das Privileg ausschöpfen.
Also die Sache mit dem Besitz, die ich hier anfügen wollte, ist ganz klein. Ich wollte nur bemerken – inzwischen ist mir wieder etwas für später eingefallen, das auf einem Notizzettel festgehalten wird, das liest sich nicht leichter als es sich lebt –, also: Sätze, auch solche, die so verloren komponiert sind wie die von Gaspara und Adèle (die redet man einfach mit Vornamen an wie Marcel und Oscar, andere nur mit Nachnamen, wie Joyce, Tolstoi, Flaubert und andere Respektspersonen, die in ihrer intellektuellen Physiognomie ein bisschen robuster und unmenschlicher ausgefallen sind), auch solche Sätze also stellen in der Wirklichkeit der Sprache Eigentumsverhältnisse her. Solange sich die Realität im Zustand uneingeschränkter Zerstreuung befindet, existiert nichts im Bezug auf den Einzelnen. Es bleibt ihm nichts als die Verfügung über den Satz. Im Satz besitze ich meine Passform der Welt, so scheint es, etwas, das einer Gesinnung und einem wiederholbaren Standpunkt, einer immer wiederaufgenommenen Deutung ähnlich sieht, einer Welt-Anschauung, von der man schließlich auch sagt, man »besäße« sie.
Dass dem Bewusstsein die Wirklichkeit als Satz zustößt und dass sie in ihm nachher als einzigartige Konstellation reproduzierbar ist, das rückt den Satz in die Sphäre der Besitzgegenstände. Er ist urheberrechtlich geschützt, das heißt auch: Er ist am wahrsten im Munde dessen, der ihn zuerst zusammengesetzt hat. »Und ein geschminkter Tiger ist der Mensch«, man lacht vielleicht über den Menschen Grabbe, der diesen Satz in seinem Besitzstand führt. Man lacht nicht so sehr über das Bild wie über die Vorstellung der Besitznahme, den Augenblick, der das Bild heranbrachte, die Kraft, die es anzog, die Entschlossenheit, die es niederlegte, die Korrektur, die es duldete. Es spricht sich ein gespanntes Verhältnis zu allem in diesem Bereich schon Gesprochenen in dieser Prozedur aus, ein Standort im Grotesken, der das einzigartige Bild an sich zog.
In diesen Bereich der sprachlichen Verfügungsräume, der kleinen Parzellen, wo man Individuen auf ihrem Grund und Boden sprechen sieht, in diesen Bereich dringt die Kritik nicht ein, die den Satz an sozialen Übereinkünften misst. Wo der Satz nur seinen Sprecher in der Tätigkeit des Sprechens behaupten muss, dort bleibt der Normenkanon, den die Literatur durch ihr wertsetzendes Sprechen aufstellt, weitgehend außer Kraft. Von jeder guten Seite Prosa, einer Seite mit dem Sog der Evidenz und der Vollständigkeit, geht dieses Verbot aus: Nicht sprechen! Nicht weitersprechen! Das Verbot zeugt von der doppelten Moral des literarischen Satzes: einer Moral von der Gesellschaft, einer Moral von der Literatur. »Es gibt Verse in unserer neuen deutschen Literatur«, schreibt Hebbel, »die selbst dann noch nicht entschuldigt wären, wenn es in den zehn Geboten hieße: Du sollst Verse machen!«
So steckt in jedem erfüllten Satz, den man irgendwo aufliest, ebenso ein Zuwachs wie eine Enteignung, ein Gewinn an verfügbaren Einsichten und Bildern, eine Entmündigung im Hinblick auf die eigenen mühsam durchzusetzenden Sätze. In jüngerer Zeit hat man einen Ausweg darin gefunden, wenigstens den einzelnen Satz nicht mehr so zu belasten wie früher. So ist mit der Erscheinung der geredeten Bücher (Céline, Miller) eine Entlastung der Elementareinheiten eingetreten, und für eine Zeitlang wenigstens wurde das Inspirative geringer gehandelt.
Damit hat sich im Grunde vor allem die Idee der Herstellungs- und Gestaltungsdauer von Sätzen verändert. Die neuere Vorstellung näherte sich auch syntaktisch der Geschwindigkeit der Verkehrsformen und der Warenproduktion an. Das alte Bild des Dichters, das ist Jean Pauls Schulmeister oder der ziselierende Olympier, von dem Eckermann berichtet, das neue, das ist Henry Miller, der mit der Schreibmaschine durch Paris läuft, um der Geschwindigkeit der produktiven Schübe auch technisch gewachsen zu sein.
Mit der Verwandlung der alten Lesekultur in eine Kultur des Hörbildes ist wahrscheinlich eine zunehmende Sensibilisierung für das Buch als Bild, für den Schreibenden und Lesenden als Bildträger eingetreten. Wenn früher die Massenbewegung der Aufklärung durch das Buch arbeitete und mit seiner Hilfe konquistadorisch tätig wurde, so wird inzwischen im Lesen, im Vorzeigen von Büchern als Toilettenartikel der Innerlichkeit eine Ausdrucksgebärde kolportiert. Die kontemplative Pantomime des Lesens zitiert Bilder vom Schlage Vermeers oder Pieter de Hoochs; man kann sich doch nicht spröde dagegen machen, dass man in solche Bilder förmlich eintritt, wenn man zum Buch greift, es liegt etwas Altmodisch-Beschauliches oder etwas Seelisch-Attraktives auf dem Buch und etwas Reaktionäres auf dem Plädoyer. Man kann auf »dem« Lesen so abstrakt nicht mehr bestehen, seit man sich mit der Schrift nicht mehr gegen die heidnischen Gnaden des Analphabetismus durchzusetzen braucht. Aus der Indifferenz des Posthistoire tritt der Lesende vielmehr in der grotesken, entrückten Aufmachung, die sich Cyrano de Bergerac bereits im 17. Jahrhundert vorstellen konnte: »Das Phantom war von ungeheurem Wuchse, und der kleine Teil, der von seinen Augen sichtbar war, zeigte einen finsteren und rohen Blick. Ich wüsste trotzdem nicht zu sagen, ob es schön oder hässlich gewesen wäre; denn ein langes, aus Blättern eines Kirchengesangbuches zusammengestoppeltes Gewand bedeckte es bis auf die Zehen, und sein Gesicht war mit einem Papier bedeckt, worauf das ›In principio‹ geschrieben war.« (Johannes 1, 1: »In principio erat verbum.«)
Das Bild des Buches, einst Chiffre für den Versuch einer Entzifferung des Menschen, ist blass geworden, es verfolgt den Menschen nicht mehr mit philologischem Pathos bis in den Schlaf, wie es Hebbel geschah, der einmal notierte: »Über Nacht hatte ich den absurdesten aller Träume. Ich träumte nämlich, das 16. Jahrhundert läge neben mir im Bett, in Gestalt eines großen Bilderbuchs, und ich suchte es umsonst zu wecken.« Was für ein Traum: Im Schlaf wacht der Schlafende, und das Buch schläft. Gerade in dieser Position aber zitiert es die Hingabe, die mit erotischem Ernst darauf drängt, wirklich werden zu wollen.
In der berühmtesten aller Liebesgeschichten mit Büchern erklärt das Buch die Hingabe zur Natur und zur lässlichen Sünde. Paolo Malatesta, der ansehnliche Brautwerber seines elenden, gelähmten und verschrobenen Bruders, besucht im 13. Jahrhundert Francesca da Rimini, um mit ihr gemeinsam zu lesen. Sie befassen sich mit »Lanzelot«. Die Lektüre wird bedenklich. Die Maler, die in den kommenden Jahrhunderten die Szene für die Vorstellung festhalten, bezeichnen das stürzende Buch als das corpus delicti für die aus dem Text empfangene Verführung zur Unkeuschheit. Das Buch ist zum Vorbild geworden, der Text zur engen Pforte, die von der Kultur in die Sinnlichkeit führt. Schon bei Dante wird das Bild des lesenden Paars wie eine Position des Vorspiels beschworen, so als deute die Lektüre auf die schwindenden Sinne der Lust voraus, indem sie sich vollsaugt mit den Bildern der Verführung. In einer milden Ecke des Infernos stellt Francesca dem hinterweltlichen Wanderer die Vorgänge selbst dar:
Wir lasen eines Tags, zur Unterhaltung,
Von Lanzelot, wie Liebesnot ihn drängte;
Wir waren einsam und ohn’ allen Argwohn.
Zu mehren Malen trieb die Augen hoch uns
Jenes Gedicht und macht’ uns blass das Antlitz;
Doch eine Stelle war’s, die uns besiegte.
Als wir da lasen vom ersehnten Lächeln,
Wie es geküsst ward von so hehrem Liebsten,
Küsste hier der, den nichts mehr von mir fortreißt,
Mich auf den Mund, an allen Gliedern zitternd!
Galeotto ward das Buch und der’s verfasste –
An jenem Tage lasen wir nicht weiter …
Vom Mittelalter über Galilei bis hin zur Aufklärung ist der Vergleich von Welt und Buch sehr beliebt, verbreitet erscheint daneben die Vorstellung vom Buch als Kuppler. Hier nähert sich dem Liebenden die Welt der Kultur in Gestalt der Verführung und der Läuterung. Die Anwesenheit des Buches bürgt für die im höheren Sinne – nämlich vor der Kultur – gewährleistete Sittlichkeit der erotischen Unternehmung. Zugleich nimmt die literarische Welt die erotisch Beunruhigten in ihre Tradition auf: Gerade Autoren mit eher prüden Darstellungsvorlieben haben die Paare durch das Prisma der Literatur in die Leidenschaft sehen lassen. In Stifters »Nachsommer« zum Beispiel führt Shakespeares Lear die Liebenden erstmalig zusammen. So kommen die Geschlechter auf dem Umweg über das Buch zueinander, und dieses bleibt als zweckloser Zweck an der Stelle zurück, an der sich das Bild vom Vorbild emanzipiert.
In solchen Liebesgeschichten werden die Bücher immer überwunden; das Lesen zeugt von einer noch unentwickelten Geschicklichkeit im Umgang mit der erotischen Unmittelbarkeit. Sobald sich diese aber einstellt, wird der Literaturgeschichte eine neue Liebesgeschichte geschenkt, die ihre Originalität nun gerade durch die ausdrückliche Ferne von allem beweist, was in ihr an Bücher erinnern könnte. Demnach erscheint das kupplerische Bild des Buches immer auf der Schwelle zur Überwindung des Buches; es bleibt in jene Zone mittelbaren Lebens verbannt, in der die erotische Erfahrung schon begonnen hat, aber noch nicht erfüllt ist – so als stünde die gesamte Lesekultur im Zeichen solcher Vereitelungen und Ersatzbefriedigungen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist, aber weil auch ein nicht-literarisches Buch daraus besteht, dass man behauptet, die Dinge seien so, wie man sie arrangiert hat (mit der Ente im Bauch, mit dem Regen vor dem Fenster, mit einem Film quer durchs Bewusstsein), deshalb behaupte ich es so, nachdem ich alles reiflich erwogen habe.
»Jetzt gehen wir einen Schritt weiter« (Karl Kraus). Dass auch die Schrift ein Bild ist, fällt vielleicht am deutlichsten auf, wenn sie aus ihrem Funktionszusammenhang gelöst wird: Der Zeitungsfetzen im Wald wirkt als objet trouvé, wie der Buchstabe bei Klee, wie die Annonce bei Schwitters. Die Inschrift, die der Historiker entziffert, wird zur graphischen Form, in der das Leben archäologisch aufersteht, so wie auch heute schon manchmal gerade angesichts der Schrift der posthume Charakter des Gegenwärtigen deutlich werden kann. Das Bild der Sprache wird zur repräsentativen Form des Verfalls und der Auferstehung des Geschehenen außerhalb ihrer Bedeutung. In seiner optischen Gestalt ist der Schriftzug ein Ideologieträger. Konservative Parteien setzen auf ihren Plakaten das Wort »Sicherheit« in Sütterlin. Das ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Todesstrafe für Terroristen. Die »Freiheit«, die wir meinen, liest man zuerst an der Kalligraphie ab: Frankfurter Allgemeine Zeitung; Sommer, Sonne, Bayern, CSU; Gesamtschulen heute – Kaderschulen morgen?; Wohin geht Moskau? und so weiter.
Schließlich bleibt noch das Bild des Dichters, mit dessen Tradition sich der Schreibende belastet, ein Bild plus Nimbus, peinlicher als der von Pastoren und Homöopathen. Kein Berufsstand hat eine solche Geschichte professioneller Selbstzerstörung aufzuweisen wie der der Autoren. In seiner gesellschaftlich beglaubigten Zwecklosigkeit hat er immer wieder gegen die Ordnung der Literatur gewütet, weil eine größere nicht erreichbar war, und fatalerweise ist er durch sein Ungestüm dem Eindruck der produktiven Unvernunft – also dem Inbegriff dessen, was als Inspiration durchgeht – desto penibler gerecht geworden.
Die Literatur erzeugt ja nicht nur diffuse Vorstellungen von Landschaften und seelischen Zuständen, in denen sich speziell die literarische Öffentlichkeit nie bewegt hat, sie erzeugt gemeinsam mit diesen eine Vorstellung von der Erfindung