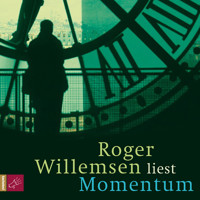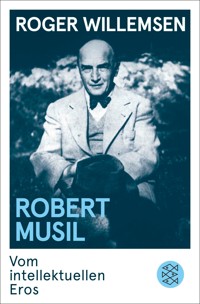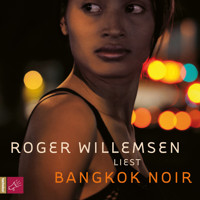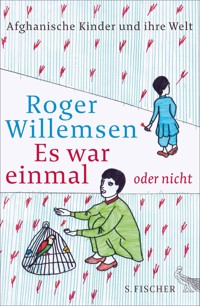9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Keine andere Kunst nahm Roger Willemsen so persönlich wie die Musik: Sie war von früh an Komplizin, als es darum ging, das Leben zu verdichten. Willemsens Liebeserklärungen an den Jazz, seine Verbeugungen vor den klassischen Komponisten, seine scharfe Verteidigung der künstlerischen Existenz, vor allem aber sein tiefes Verständnis für die Musiker und ihre Themen sind legendär. Seine einzigartigen Texte »über Musik« sind weit mehr als das: Sie sind Ausdruck eines Lebens »entlang jener Linie, an der man Dinge macht, die aus Freude bestehen oder aus Aufregung, aber nie aus Gleichgültigkeit«. Roger Willemsens Hommage an die Musik und ihre Heldinnen und Helden gibt einem das Gefühl, am Leben zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Roger Willemsen
Musik!
Über ein Lebensgefühl
Über dieses Buch
Keine andere Kunst nahm Roger Willemsen so persönlich wie die Musik: Sie war von früh an Komplizin, als es darum ging, das Leben zu verdichten. Willemsens Liebeserklärungen an den Jazz, seine Verbeugungen vor den klassischen Komponisten, seine scharfe Verteidigung der künstlerischen Existenz, vor allem aber sein tiefes Verständnis für die Musiker und ihre Themen sind legendär. Seine einzigartigen Texte »über Musik« sind weit mehr als das: Sie sind Ausdruck eines Lebens »entlang jener Linie, an der man Dinge macht, die aus Freude bestehen oder aus Aufregung, aber nie aus Gleichgültigkeit.« Roger Willemsens Hommage an die Musik und ihre Heldinnen und Helden gibt einem das Gefühl, am Leben zu sein.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Roger Willemsen, geboren 1955 in Bonn, gestorben 2016 in Wentorf bei Hamburg, war nicht nur Autor, Moderator und eine der führenden intellektuellen Stimmen Deutschlands, sondern auch ein leidenschaftlicher Musikhörer und Kenner. Mit »Willemsens Musikszene« hatte er zwei Jahre lang im ZDF seine eigene Musiksendung, mit »Willemsen legt auf« machte er im NDR eine 15-minütige Radiosendung, die es auf 279 Folgen brachte und zu der 26 große Publikumsabende gehörten. Er gestaltete eine Weltmusik-Reihe mit den Berliner Philharmonikern, ein Barock-Programm mit dem Geiger Daniel Hope, ein Klassik-Programm mit der NDR-Radiophilharmonie. Für die »Zeit« schrieb er eine eigene Musikkolumne, für arte und ZDF machte er einen Film über den Jazzpianisten Michel Petrucciani und zahlreiche weitere Musikerporträts.
Über Roger Willemsens umfangreiches Werk gibt Auskunft der Band ›Der leidenschaftliche Zeitgenosse‹, herausgegeben von Insa Wilke.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS, Büro für visuelle Kommunikation
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490885-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Stille
I An die Musik
An die Musik
Kiss and Run. Verliebte Männer
The Man I Love. Liebende Frauen
Peace Piece. Meditationen
Die vier Jahreszeiten
Schwere Abschiede
Das Unglück der Liebe
Sweet Dreams und schwere Träume
Happy Blues – Euphorien
Einsame Herzen
Die Farben des Herbstes
Nachtstimmungen
Der musikalische Gottesdienst
Grenzenlos
Memories of you
Heimweh
Ja!
Ganz schön albern
Trübe Tage
Unter Tränen
Sonnenuntergänge
Auf der Haut
Sonntagsstimmung
Unbeschränkt
Tagträume
Sehnsucht
In Gedanken an Dich
Versklavt
Vor Tagesanbruch
Crazy Girls
Die Nähe der Ferne
Kinderliebe
Die große Ruhe
Was kommt?
II Porträts
Die Reise ins Unerhörte
Nocturnes
For you
Das Beste aus den Siebzigern
In memoriam Michel Petrucciani
III Klassik und Jazz
Dave Brubeck/Dave Brubeck
Baldassare Galuppi/Ralph Burns
Heitor Villa-Lobos/Selaelo Selota
Louis Moreau Gottschalk/Duke Ellington
Mili Balakirew/Hampton Hawes
Carl Maria von Weber/Jutta Hipp
Igor Strawinsky/Sonny Rollins
Antonio Soler/Earl Hines
Sergei Prokofjew/Duke Ellington
Joseph Haydn/Thelonious Monk
Johann Paul von Westhoff/Stan Tracey
Ferdinand Ries/Django Bates
Georg Friedrich Händel/Connie Evingson
Henry Purcell/Paul Hanmer
Giovanni Battista Martini/Kay Starr
Igor Strawinsky/Gil Evans
Wolfgang Amadeus Mozart/Sidney Bechet
Ludwig van Beethoven/Omar Sosa
Antonio Salieri/Melody Gardot
Georg Philipp Telemann/Thierry Lang
Gioacchino Rossini/Hampton Hawes
Clara Schumann/Bill Evans
Richard Strauss/Toni Harper
Antonín Dvořák/Abdullah Ibrahim
Robert Schumann/Anita O’Day
Ottorino Respighi/Gil Evans
Johann Sebastian Bach/Bud Powell
Dmitri Kabalewski/Red Garland
Antonín Dvořák/Miles Davis
Muzio Clementi/Lennie Tristano
Anonym (»Greensleeves«)/John Coltrane
Niccolò Paganini/Arturo Sandoval
Ernesto Lecuona/Chucho Valdés
Georg Friedrich Händel/Quincy Jones, Mervyn Warren
Wolfgang Amadeus Mozart/Blossom Dearie
Alexandre Tansman/Charlie Haden, Hank Jones
Duke Ellington/Camille Saint-Saëns
Ferruccio Busoni/Tommy Flanagan
Claude Debussy/Jacky Terrasson
Johann Nepomuk Hummel/Michel Camilo
Claude Debussy / Basil »Manenberg« Coetzee
Wolfgang Amadeus Mozart/Jamie Cullum
Ludwig van Beethoven/Jimmy Giuffre
Stefan Wolpe/James Carter
Anton Webern/Teddy Charles
Muzio Clementi/Nat King Cole
Nikolai Rimski-Korsakow/Roy Eldridge
Domenico Scarlatti/Art Tatum
IV Unterwegs
Unterwegs I
Über äthiopische Musik
Über Musik aus Mali
Unterwegs II
Über afghanische Musik
Unterwegs III
Der Klang der Grenze
V B-Seite
Ehen der Volksmusik
Die zwei Soprane
Spott zum Gruß
Wir Helenisten
Pink Floyd
Do not disturb: Ein Popsong
Nachwort
Namensregister
Stille
Wo vom Wesen die Rede ist, so lehrt die Philosophie, ist vom Ursprung die Rede. Wenn von den stillen Momenten eines Lebens also gesagt wird, etwas Wesentliches trete in ihnen zutage, so ist auch gemeint, etwas Ursprüngliches zeige sich. Dies aber bezeichnet nicht die conditio humana allein – wir kommen aus der Stille und gehen wieder in sie ein –, es bezeichnet die Bedingungen jeder künstlerischen Hervorbringung: Die leere Leinwand schweigt, das weiße Blatt tut es, Ruhe tritt ein, bevor der erste Ton gespielt wird, und der letzte liefert sich ihr wieder aus.
Stille ist der Zustand, in dem Musik geboren wird. Was immer sie sagt, ist sie doch auch komponiertes Schweigen und zieht sich selbst auf immer neue und originelle Weise ins Unhörbare zurück, ja, der Musik kann es sogar gelingen, die Stille zu vertiefen durch ihr Sprechen. In keinem Werk aus den frühen Jahren der klassischen Musik ist das so fassbar wie in dem von Johann Sebastian Bach, dessen Sonaten und Partiten für Solo-Violine geradezu als Ergründungen einer Stille erfahrbar sind, die beides kennt: die Strenge der Architektur, die Zartheit der Schwärmerei. Musik berührt hier ihre Voraussetzungen, ihren Ursprung im Schweigen und ihre Neigung, in dieses heimzukehren.
Wenn alle lärmenden Bewegungen, alle Überlagerungen von Empfindungen, Wahrnehmungen, Impulsen durch Geräusche zurückweichen, tritt die Ruhe der Betrachtung ein. Die Natur wird häufig so erfahren, selten die Stadt. Die Waldesruhe, der Frieden über dem See, das Schweigen der Nacht, sie alle assoziieren Friede, den Fortfall des Hochtourigen, Geschäftigen, Flüchtigen, auch Belanglosen. Es tritt Kontemplation ein, reines Bei-sich-Sein.
Auch im sozialen Leben aber ereignet sich Stille nicht nur, sie besetzt eigene Funktionen: In der »Schweigeminute«, der stillen Trauer, der Denkpause, in der Betrachtung des Firmaments, in den Schweigeräumen der Kirchen, Krypten, Tempel, im Schweigegelübde der Kartäuser, der Eremiten, der tibetanischen Schweigemönche, in der »stillen Zeit« zwischen Weihnachten und Silvester.
Es gibt, wo Bescheidenheit oder selbst Demut einsetzen, ein Klein-Werden, das dem Leise-Werden entspricht und oft der Pietät, dem Glauben, der Selbstversenkung vorbehalten ist. Auch wohnt den stillen Augenblicken des alltäglichen Lebens oft eine eigene Magie inne, so der Stille vor dem Kuss, der Stille des Einvernehmens in einem Blick, der Stille des Gebets, der Stille im Umkreis des Sterbens und schließlich jener Stille, die im Auge des Orkans, im Zentrum der Katastrophe herrscht, wenn sich die Zeit dehnt und alle Abläufe zugleich verlangsamt und geräuschlos erscheinen. Manchmal ist deshalb auch die abgesenkte Stimme, die flüsternde sogar, besser geeignet, einen inneren Vorgang zu spiegeln, als die Sprechstimme, und manchmal ist gerade die Musik geeignet, geräuschlose Zustände zu verdichten.
Von den bleibenden Momenten eines Lebens wird oft gesagt, dass sie »atemlos« waren, dass alle Bewegung in ihnen zum Stillstand kam, dass sie sich in völligem Schweigen ereigneten. Was intensiv ist, sei es im Erleben des Glücks oder in der Katastrophe, tritt oft geräuschlos auf. Zugleich werden gerade die leisen Augenblicke leicht überhört und übersehen, sei es, weil das Brausen der Realität zu laut, der Kommunikationslärm zu dominant, die Bestrahlung aus akustischen Quellen bestimmend, wenn nicht gewaltsam ist.
Die Präsenz von künstlichen Sounds aber muss nicht nur auf Sehbehinderte und Blinde immer wieder als ein Angriff auf die Orientierung wirken und das individuelle Erleben beschädigen oder sogar vereiteln. Sie provoziert andererseits eine bewusstere Wahrnehmung von Stille, die es gegen die akustische Zerstreuung zu bewahren gilt, auch weil Selbstreflexion ohne solche Stille kaum denkbar ist. Diese Erfahrung erweist sich als unerlässlich für den Bau der Persönlichkeit, die Herausbildung von Individualität.
Es liegt in der Wahrnehmung der Stille zugleich oft etwas Nachzeitiges: Jetzt wird sie erlebt, später wird sie bewusst und erst im Rückblick hörbar. Es gibt viele Felder, auf denen sie sich unmerklich einstellt und ausdehnt: Da sind die leisen Prozesse, in denen sich ein Leben ändert, Prozesse der Ermüdung, des Nachlassens und Ausbleichens; da sind die Zeitdehnungen inmitten einer Katastrophe, in der der äußere Lärm ohrenbetäubend erscheinen kann, innen aber streckt sich ein atemloser Zustand, der sich ausdehnt als ein Vakuum, bevor es zum Aufprall, zum Kollaps kommt; da ist die Stille im Schrecken, vor dem Erhabenen, im Feierlichen. Man kann die Stille bereisen, wie man das Meer bereist oder in eine Landschaft eintritt – lauter Schweigezonen, in denen alle Bewegung zum Erliegen kommt und Lebensäußerungen nicht stillgestellt, aber unhörbar werden.
»Wer Klang wirklich in seinen ganzen Dimensionen aufnehmen will, muss Stille erfahren haben«, sagte Yehudi Menuhin, »Stille als wirkliche Substanz, nicht als Abwesenheit eines Geräuschs. Diese echte Stille ist Klarheit, aber nie Farblosigkeit, ist Rhythmus, ist Fundament allen Denkens, darauf wächst alles Schöpferische von Wert. Alles, was lebt und dauert, entsteht aus dem Schweigen. Wer diese Stille in sich trägt, kann den lauten Anforderungen von außen gelassen begegnen.«
So betrachtet, führt die Stille in eine Reglosigkeit der Bewegung, in ein Schweigen alles Sprechenden, in die beredte Pause zwischen den Mitteilungen, in den Transitraum von Zuständen abseits von Aktionen: Man öffnet eine Schublade zur Hälfte, nimmt aber nichts heraus. Man schlägt einen Nagel in die Wand und lässt das Bild trotzdem am Boden stehen. Man will die Hand zum Abschiedwinken heben, da bleibt sie, halbhoch, in der Luft. Die fragmentarischen Werke und Gesten, sie verweisen auf ein Moment der Nachzeitigkeit, der Teilung in zwei Zeiten, in Gegenwart und Vergegenwärtigung, in Existenz und Bild: Man wird aufgestanden sein, aber noch sitzt man und produziert den Impuls der kommenden Handlung. Man verzögert sich und ist in diesem Augenblick bei sich, festgehalten von einem Zustand vor der Tat, gebrochen in der Nicht-Identität mit dem eigenen Handeln und doch eingefroren in der Immunität des Moments.
Solche Dramen der Stille vernehmlich zu finden bezeichnet ihren musikalischen Aspekt. Die Rede verstummt, der Arm hebt sich, der Bogen schwebt über den Saiten, der Atem wird unhörbar: Gleich öffnet sich der Klangraum zur Erzählung, und sie wird in jedem Zögern, Aussetzen, Verweilen die Stille neuerlich zitieren, der sie sich zuletzt wieder ausliefert, ehe andere Geräusche, Klänge und Mitteilungen übernehmen.
IAn die Musik
»Musik höre ich wehrlos, deshalb stört sie mich in öffentlichen Räumen auch oft. Sie absorbiert mich. Ich kann neben ihr kaum einen Gedanken fassen. Für kaum etwas bin ich so dankbar wie für die Entdeckung neuer, unbekannter, sprechender Musik.«
ROGER WILLEMSEN, 2015
An die Musik
Ich höre ihn noch, wie er sich aus dem Unterdorf hocharbeitet, der Spielmannszug zur Kirmeszeit. Zuerst pochte nur das Lang-Lang-Kurz-Kurz-Kurz der Bauchtrommel, dann mischte sich das Schrillen der Piccoloflöten ein, der Schellenbaum, dann die Blechbläser, anschwellend. Vor jedem Haus blieb dieser Zug stehen, dann erschnorrte sich der Tambourmeister ein Tablett voller Schnapsgläser und führte die Hausfrau zum Tanz auf die Straße, während der Fahnenschwenker schwenkte und die längst besoffenen Bläser bliesen und niemand den Rhythmus halten konnte. Meine Mutter wurde in den Armen des Kapellmeisters von einer Straßenseite zur anderen gewalzt, und mein Bruder und ich standen hinter der Hecke und pissten uns in die Hose vor Lachen. Später sagte unser Musiklehrer immer: »Muzzick ist, wenn der Zoch kütt.« Muzzick, mit Betonung auf der ersten Silbe, also ist, wenn die Marching Band kommt.
Diese Musik war unzerstörbar, denn sie war die erste, so fröhlich wie banal und in der Drum-and-Bass-Line kaum anspruchsloser als ein Großteil des Mainstream-Rocks der Sechziger. Später las ich, dass Gustav Mahler sich auf den Jahrmärkten gerne zwischen die Musikquellen stellte und sich dem Verfließen der Stimmen auslieferte. Als ich es auch versuchte, hörte ich keine Kirmes mehr, nur noch Mahler. Und mehr als das: Architektur und Musik sind die einzigen Künste, die Räume erschaffen. Im Durcheinanderfließen der akustischen Quellen auf den Jahrmärkten und Rummelplätzen fand ich die erste moderne Klangarchitektur, simultan und eklektisch.
Zeitgleich überschwemmte eine andere, neuartig unscheinbare Musik den öffentlichen Raum, die dudelnde, berieselnde, dem Happy Sound verpflichtete Instrumentalmusik, die John Lennon abfällig »Muzak« taufte. Der Begriff von der »akustischen Umweltverschmutzung« wurde geboren, und es war gut zu wissen, was für ein Scheißdreck »Musik« heißen kann, eine auf synthetische Belanglosigkeit kalkulierte Klangmasse, die nichts hinterlässt als Vergessen.
Darf man das sagen? Wohl nicht. Denn die Musik ist ja eines der Rückzugsgebiete der Moral, das heißt, wer die falsche hört, ist für die einzig Wahren schon im Handumdrehen selbst vom Teufel. Andererseits gibt es nun einmal Allergien, manchmal schon allein gegen einen Sound oder eine fortgesetzte rhythmisch-harmonische Unterforderung, die aus der Musik Tapete macht. In die versenkt man sich schließlich auch nicht.
Die wahren Paradiese der Musik, fand ich, liegen außerhalb von »Muzzick« und »Muzak«, aber dem Soundtrack der Kindheit und der Pubertät ist man noch weitgehend wehrlos ausgeliefert, der Kindheit, weil andere die Musik auflegen, der Pubertät, weil sich die Musik glücklicherweise mit Erfahrungen mischt, die das musikalische Urteil außer Kraft setzen.
Der Jazz wählte viele Wege in mein Leben, und vielleicht war ja schon der Spielmannszug ein Trojanisches Pferd gewesen, in dessen Bauch die Swing Bands aus New Orleans schliefen. Jedenfalls weckte dieser dörfliche Schellenzug die Lust an der Havarie der Musik, an unwillentlich gegeneinanderlaufende Rhythmen, an Synkopen und Blue Notes.
Ein anderer Weg in die Musik des Jazz aber führte über Domenico Scarlatti. Dieser, ein barocker neapolitanischer Glücksspieler im spanisch-portugiesischen Exil, ließ immer wieder die Volksmusik seiner Heimat durch die Trillerketten klingen, und er brachte den Spaniern, als diese nach Italien und seiner Oper schielten, den Flamenco zurück, die missachtete Volksmusik der Zigeuner im eigenen Land. Er komponiert Fingerfertigkeiten von hoher Oberflächen-Brillanz, aber darunter tönte es wie die Musik des Heimwehs. Seine musikalischen Rituale sind die der Spieluhr, des Glockenspiels, mit Arpeggien, die sich in den immer selben Scharnieren drehen und trotzdem, im Melancholischen wie im Heiteren oder Bizarren, frei sein wollen. Dieser Drang in ein Klima der Freiheit, der Selbstbefreiung und Emanzipation vom autoritären Bann besitzt in jeder Musik etwas Hypnotisches und ist, was der Jazz auch ist: Musik im Zustand der Hervorbringung, Musik, in der sich die Produktivität selbst Bahn bricht.
Ein weiteres Einfallstor in mein Leben fand der Jazz durch das Radio. Von dort klangen Swing und Gospel wie aus weiter Ferne herangespülte Stimmungsbilder von Festen, aus Ballsälen und Gottesdiensten, es war Musik aus dem Sehnsuchtsraum, und der Melancholie der Kindheit antwortend, waren sie Sprache des Mangels und der Entbehrung, der Trauer, des Blues. Ich ging mit dieser Musik Schritt für Schritt, erregt vom Vibrato des Sidney Bechet, hypnotisiert vom Swing Lester Youngs, mitgerissen von der Spätromantik eines Oscar Peterson, oder – eingelassen in »das größte Duett aller Zeiten«, wie Duke Ellington es nannte: »ein liebender Mann und eine liebende Frau« –, ich lernte dem Sound zu folgen, der eine eigene Persönlichkeit besitzt wie der Stimmklang, und dem Geschwader dieser Ausdrucksformen folgte ich bis zum katatonischen Rasen eines Charles Mingus oder zur Selbstauflösung der Musik im Werk John Coltranes.
Als sie sich mir eröffnete, da hatte ich schon längst begriffen, dass der Jazz »falsche« Musik war, dass er nicht nur erlaubte, sondern forderte, was Thelonious Monk zu einem Drummer in den Sechzigern gesagt hatte: »Du weißt, wie man richtig spielt. Jetzt spiel falsch und mach das richtig.« Und hatte nicht Miles Davis von seinen Musikern verlangt, sie sollten öffentlich proben, vergessen, was sie beherrschten? Und wie hatte Wynton Marsalis’ Lehrer ausgerufen, als der junge Trompeter aus der großen Familie erstmals in der Jugendband gespielt hatte, und zwar so, dass dieser fand, »etwas Schieferes und Unzusammenhängenderes hatte ich nie gehört«? Dieser Danny Barker hatte gerufen: »Meine Herren, das ist Jazz!«
Man kann sagen, Jazz sei die klassische Musik des 20. Jahrhunderts. Man kann sagen, er sei Ausdruck der Emanzipation von Diskriminierung und politischer Unterdrückung. Man kann auch sagen, er enthalte die schönsten Formen existentieller Freiheit, er sei Klima, Atem, Luft von vorn, er synchronisiere das Innenleben des modernen Menschen mit der Großstadt, dem Tempo der Bewegungen, den zerstückten Wahrnehmungen, dem Kino, der Erotik. Das alles kann man sagen, und doch wird das Erste, was den empfängt, der in den Jazz eintritt, etwas Grundsätzlicheres sein: Das Lebensgefühl, das Jazz heißt, entwickelt sich in einem Klima der Wahrhaftigkeit, der Geradlinigkeit, der Evidenz. Es ist künstlerisch zugleich so komplex, und andererseits ist es einschüchternd unverblümt, ansteckend »live« – am Leben.
Die Vitalität des Jazz bestimmt alles, was er sagt und will. Seine Formen und Stile sind beschreibbar, sie sind in Kategorien zu bringen, man kann fragen, was Bebop formal ist und wie eigentlich die triolische Spielweise der Achtelnoten funktioniert. Aber noch eigentlicher fließt etwas nicht Rubrizierbares, fließt Magma durch diese Musik hindurch, jener inspirative Strom, der im Herzen des Jazz pumpt, der seinen Puls, seine Improvisationen treibt, wie zur Feier der produktiven Energie, ihrer Selbstgerechtigkeit und Souveränität.
Ausgestattet mit dem Privileg, einige der mir liebsten, vielsagendsten Titel aus der Welt des Jazz versammeln zu dürfen (sofern die Lizenz dafür vergeben würde), bin ich keinem Kriterium gefolgt als dem der persönlichen Vorliebe. Das Lyrische zieht mich besonders an, die Durcharbeitung von einfachen Melodien, die Ergründung des Stimmungshaften, die immer wieder neuartige Zusammensetzung gemischter Gefühle, die den Eindruck hinterlässt: Manchmal kann die Musik, was Robert Musil der Literatur zuschrieb, den »inneren Menschen erfinden«.
Der Jazz hat sich, wo er sich ernst nahm, nicht einschränken lassen – von tonalen Gewohnheiten so wenig wie von kommerziellen Spekulationen und Gewissheiten. Er hat einen Raum besetzt, in dem es mehr gibt als ein paar stereotype Dreiklänge und einen durchgehaltenen Beat, er hat sich allen Schichten geöffnet und die Bildung einer exklusiven Kunst-Kirche verweigert. Nicht für Eingeweihte allein soll er sein, sondern auch für Priester, Sklaven, Arbeiter, Großstädter, Jugendbewegte, Lyriker und Impressionisten, er will aus dem Muff evangelischer Wollwaren treten, will nicht Pfeifenraucher-Musik sein, nicht an die geheimsprachlichen Diskurse vollbärtiger Feierabenddozenten erinnern. Direkt will er genommen, verstanden werden in seinem Ringen um das Gemeinschaftliche in der musikalischen Kommunikation, als Reflex von Erfahrungen, die außerhalb der Musik liegen, als expressives Massiv. Lange war jene Musik, die mich seit frühen Jahren begleitet hatte, meine Privatmusik, die wenige teilen mochten, vielleicht weil sie ein Imageproblem hatte, diese Musik, die ihre ganz eigene Schwingung auf mich übertrug und in unabschließbarer Vielfalt die Formen variierte, sich frei zu fühlen, diese im Ausdruck der Improvisation wurzelnde Musik. Unterdessen wurde mir diese Musik zum Strom, den auf- und abwärts zu reisen ich nie müde wurde – aufwärts zu den Quellen in der afrikanischen Volksmusik, im Gospel, im Sklavengesang, im Blues, abwärts in Cool Jazz, Bebop, Hardbop, Mainstream und Fusion, und als ich vor Jahren dann wieder an einer Straße in Dakar stand und eine Marching Band kam vorüber und swingte so sicher und melancholisch und unbeholfen und irgendwie auch rührend, da mischte sich viel inzwischen Durchhörtes hinein, und ich dachte: Tatsächlich, manchmal ist es sogar wahre Musik, »wenn der Zoch kütt«.
Kiss and Run. Verliebte Männer
Wie wäre es, wenn man die Musik namens Jazz einmal nicht nach Zeiten, Chronologien, Stilen, Instrumentengruppen, Regionen betrachtete, sondern nach ihrem Ausdrucksverhalten, also nach den Gefühlen, die in ihr frei werden und die die Musik auf ihre eigene Weise organisiert? Dann würde man also nicht fragen, was Bebop ist, und nicht, wie die triolische Spielweise der Achtelnoten funktioniert, man würde die Geheimsprache der Musikwissenschaft nicht sprechen und das Jägerlatein der Eingeweihten auch nicht, sondern man könnte fragen, wie Liebeskummer klingt, wie man Heimweh komponiert oder Abschiedsschmerz.
Solchen Fragen versuche ich nachzugehen. Auf der Suche nach dem Lyrischen, dem Gesanglichen im Jazz, dem, was man thematisch identifizieren kann, muss ich mich zum guten Teil an die Titel der Stücke halten oder an die Hintergründe zur Entstehung einzelner Kompositionen. Auch lässt sich manches erzählen, was mit den Aufnahmen oder den Beteiligten zu tun hat, am wichtigsten aber soll der Ausdruck sein. Mal sehen, ob man ihn beschreiben kann, ohne der Musik zu nahe zu treten.
Wir beginnen und nähern uns schon einem regelrecht paranormalen Phänomen, dem lange Für-unmöglich-Gehaltenen, manche werden sagen, dem Inbegriff des Unglaublichen: der männlichen Liebe. Ja, auch Männer können lieben, und wenn man das ihren Telefonaten, ihren E-Mails, ihren Küssen nicht anmerkt, dann weiß man es, sobald sie Musik machen. Liebende Musik kann man nicht fälschen, denn der musikalische Ausdruck ist wahrhaftig und erlaubt keinen Betrug.
Die Musik versichert uns sogar glaubwürdig, dass die männliche Liebe alles sein kann, schwülstig, fürsorglich und selber hilfsbedürftig, und alle diese Seiten werden Sie gleich kennenlernen.
Aus der Tiefe der Zeit, genau gesagt vom 19. September des Jahres 1955 aus, dringt die schöne Gewissheit herüber zu uns, dass auch Männer jenes Beben kennen, das in neuerer Zeit Frauen ganz für sich in Anspruch nehmen wollen, das Beben im Augenblick vor dem Ausbruch der Liebe. Es ist ein kostbarer Moment, und es lohnt sich, ihn ganz separat zu betrachten, jener Moment, in dem man glaubt, es gäbe noch ein Zurück in die Indifferenz, der Moment der größten Angst davor, die Liebe könne keine Liebe sein, oder sie könne nicht beantwortet werden oder in sich selbst zusammenfallen.
An diesem 19. September 1955 trat ein ziemlich unbekannter Sänger namens Don Senay ans Mikrophon und beschwor exakt diesen Augenblick. Die Ironie der Geschichte will, dass wir die Aufnahme heute vielleicht nur aus einem Grund noch haben, weil man glaubte, am Bass stehe niemand Geringeres als der später berühmte Charles Mingus, aber erstens hört man den Bass kaum, zweitens ist er nicht wichtig, und drittens ist keineswegs sicher, dass er von Charles Mingus gespielt wurde, der allerdings ein so leidenschaftlicher Liebhaber war, dass er nicht nur über viele Jahre mit zwei Frauen lebte, sondern dass er in seiner Autobiographie »Beneath the Underdog« auch viele Seiten mit einer Gebrauchsanweisung für den richtigen Sexualverkehr füllte.
Don Senay ist da viel romantischer. In einem durch den Orchesterklang und das schmelzende Timbre seiner Stimme fast überbordenden Schmachtfetzen begibt er sich auf die Gratwanderung, die den Kitsch vom Rührenden trennt. Doch da ist kein Grat, beides gehört zusammen, der Schwulst des Gefühls und die Sehnsucht, die echt darin ist: »On the Edge of Love«.
Charles Mingus: The Edge of Love (The Complete Debut Recordings Nr. 9), 2.48
36 Jahre nach dieser Aufnahme geht wieder ein junger Mann ins Studio, um seine Liebe in ein Mikrophon zu singen. Auch er hat ein Orchester hinter sich, auch er hat Schmelz, nur »On the Edge of Love« ist er nicht mehr, sondern mittendrin, Feuer und Flamme, verloren ganz und gar. Und wie anders klingt jetzt alles!
Harry Connick Jr. heißt er, die Platte, die er da gerade aufnimmt und die er »Blue Light« nennt, wird ihn berühmt machen. Man wird immer wieder schreiben, er habe die Stimme des jungen Frank Sinatra. Er wird in den Jahren, die kommen, viele Platten machen, zu viele wahrscheinlich, er wird in einem weniger als mäßigen Film an der Seite von Sandra Bullock spielen und an einem Flughafen mit einer Waffe aufgegriffen werden. Für den Augenblick ist das alles egal, alles egal bis auf dieses eine Lied, das einzige von ihm, das in meinen Ohren erschütternd klingt und das ein vollkommenes Liebeslied ist von den ersten vorsichtigen Tönen auf dem Piano an, über alle Schwellen des Fühlens, des gemessenen, beherrschten Fühlens und Ausdrückens, bis hin zur Implosion und Rückkehr in diese kleinen, reduzierten Klaviertakte, die das Ganze spieluhrartig beschließen, bevor das Orchester den Vorhang fallen lässt.
Was Harry Connick hier macht, ist in jeder Hinsicht erstaunlich. Er nutzt sein Orchester beherrscht, mit seltener Disziplin, greift Instrumentengruppen heraus, variiert die Kombinationen, meidet Streicher-Tutti und kombiniert die warme, geradezu altmodisch klingende Stimme auf das Delikateste mit Klarinetten, Saxophonen, Bläsergruppen, denen er einen räumlichen Hall gibt, der geeignet ist, die Stimme im Raum zu isolieren. So legt er eine Einsamkeit über jede Stimme in diesem Raum, und vor allem moduliert die eigene Stimme in einer Geschmeidigkeit, die dennoch ohne Glätte ist und bei aller Eleganz den Eindruck unbehauener Emotionalität nie verliert. Es ist schon erstaunlich, wie diese Stimme vor den Worten zögert, wie sie, groß wie sie ist, förmlich klein wird vor der Erregung zu sagen, wie tief, wie groß, wie warm das Gefühl ist.
Dieser erstaunliche Titel heißt einfach »Jill«, und eines Tages sah ich ein Foto von Harry Connick mit einer Frau. Die Bildlegende verriet, dass dies seine Ehefrau Jill sei, ein ehemaliges Victoria-Secret-Model et cetera. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und gehört schon wieder einer anderen Wirklichkeit an als »Jill«.
Harry Connick: Jill (Blue Light, Red Light (Someone’s There), 6.13
Harry Connick ist ein Beau, seine Frau ein Model. Die nächste, eine große Stimme, gehört Andy Bey. Physiognomisch: kleiner, schwarzer Amerikaner mit Glatze und kreisrundem Gesicht; biographisch: 1939 geborenes Wunderkind, das mit Sarah Vaughan und Dinah Washington schon vor seinem achtzehnten Lebensjahr auf der Bühne stand und mit seinen beiden Schwestern in den späten Fünfzigern und frühen Sechzigern tourte; jazzgeschichtlich: Assistenzmusiker bei Horace Silver, McCoy Tyner, Sonny Rollins, Charles Mingus; rezeptionsgeschichtlich: ein lange Übersehener, spät Wahrgenommener, nach Jahren als Gesangslehrer in Österreich ein »Geheimtipp«; auch: die Stimme, die Menschen geliebt haben wie Aretha Franklin, Marlon Brando, Bud Powell, Marlene Dietrich; aber eigentlich: Plötzlich ist diese Stimme im Raum, eine Stimme, die selbst ein Raum ist, und man hört zum ersten Mal, dass eine Kehle einen solchen Raum bauen kann. Wie kann es sein, dass der bloße Wohlklang einer Stimme eine solche Befriedung auslösen kann? Was ist es, dass man noch vor jeder Melodie sich ganz in diesem Ton zusammenzieht, der da entsteht, einem Ton, der so tief gründet, der eine solche Wärme spendet, eine solche in sich stehende Ruhe beschreibt? Wundern Sie sich nicht: Alle schwärmen für diese Stimme in Metaphern. Für die einen ist sie wie das Eintreten in einen stillen Waldsee. Für die anderen salbt sie die Verse wie mit Massageöl. Für die »New York Times« ist sie ein Zimmer, dekoriert mit Kissen, alten Vorhängen, Stofftapeten, für den »Guardian« klingt sie wie die von einem Medizinmann des Blues, meditativ, mit sparsamem Vibrato auf der Stelle swingend.
»Ballads Blues and Bey ist des unvergleichlichen Sängers erstes Album nach 22 Jahren. Und was für ein reiches, gleichwohl bescheidenes Album, auf dem sich Andy Bey nur auf dem Klavier begleitet, in jenem »quiet style«, wie er ihn nannte, ein in sich versunkener Musiker, der da vor sich hin flüstert und swingt, der vier Oktaven singen, vom Falsett in die unteren Baritonlagen wechseln kann und doch klingt wie einer, den man nach Mitternacht in einem Club an der Ecke selbstvergessen vor sich hin spielen hört, wo er den Gershwin-Klassiker »Someone to Watch Over Me« mit der Sinnlichkeit einer intimen Offenbarung vorträgt.
Niemand, der diese Stimme gehört hat, wird den Genuss ihres Timbres je vergessen. Denn dieses Organ ist stark genug, eine einzige Note zu ergründen, ihr eine Zärtlichkeit mitzugeben, als würde sie von der Kehle nur beschmust entlassen, und noch Standards erhalten so eine Bedeutung, die sie nie hatten, befreien Gefühle, die sie nicht kannten, und sprechen, wo sie früher stumm waren. So gibt er uns den Gershwin-Klassiker fast dekonstruiert, tief versunken und zugleich tief aufrichtig, fraglos: Hier singt und spielt einer wahrhaftig auf der Suche nach »Someone to Watch Over Me«.
Andy Bey: Someone to Watch Over Me (Ballads, Blues and Bey), 6.19
The Man I Love. Liebende Frauen
Im Versuch, die Musik des Jazz einmal nicht nach Instrumenten, Stilen, Strömungen zu betrachten, sondern nach dem Zusammenhang der Gefühle zu fragen, nach der Art, wie gewisse Themen mit einem gewissen Ausdruck bearbeitet werden, wenden wir uns den liebenden Frauen zu.
Die männliche Kultur bevorzugt die Frau als Schmachtende, als Sehnende, als eine, die immer mehr Seele will, als sie bekommen kann. Doch diese männliche Kultur unterschätzt bisweilen die Nüchternheit, auch den Pragmatismus der Frauen, die das Inständige kennen, den Zweifel im Angesicht der Untreue, die Blindheit der Liebe so gut wie ihre Lügen. Von all dem singen die Frauen hier, sie singen davon mit heißer, mit warmer, mit müder Leidenschaft, und natürlich muss man beginnen mit jener Einen, Wahren und Schönen, die musikalisch jede Stimmung erlebt und erlitten und biographisch jeden Schmerz erfahren hat, der ihre Stimme sättigte und zuletzt zerstörte: Billie Holiday, Lady Day genannt, bleibt als Sängerin ein zeitloser Fixstern, auch wenn sie selbst ernsthaft bezweifelte, überhaupt singen zu können. Ihre Stimme hat alle Farben, ihre Modulation ist unergründlich, sie kann im Stehen swingen, und sie kann einen Ton aufschwärmen lassen wie einen Sperlingsschwarm. Ist sie heiter, dann bricht sie das Licht in lauter feine Strahlenfächer, ist sie »blue«, dann taumelt sie herzzerreißend in Tiefen von geradezu existentieller Schwere.
Billie Holiday ist oft liebeskrank gewesen, und sie hat einmal gesagt, eigentlich sei Orson Welles der warmherzigste ihrer Liebhaber und Freunde gewesen. Als sie an jenem Augusttag des Jahres 1945 die Studio-Session mit »What Is This Thing Called Love«, Cole Porters Klassiker aus dem Jahr 1929, beschloss, war die Stimmung leicht und gelöst, und auch wenn hier eigentlich eine Frau mit gebrochenem Herzen die Frage nach dem Wesen der Liebe stellt, so wird diese Frage von Billie Holiday nicht resigniert gestellt, nicht fatalistisch, sondern noch mit jenem spielerischen Übermut, der alles von der nächsten Antwort erwartet und von der nächsten und der nächsten.
Und doch, wie fast immer bei Billie Holiday, scheint da eine Tragik durch die Leichtigkeit, die sie in gewisser Weise mit Marilyn Monroe teilt und die einen immer ahnen lässt, wie die Tragik erst sein muss, wenn die Leichtigkeit geht.
Es war ein bemerkenswerter Tag, an dem Billie Holiday den folgenden Titel einspielte. Es war der 14. August 1945. Eine Stunde und fünfzehn Minuten nach Ende der Produktion trat Präsident Truman vor die Presse und verkündete die bedingungslose Kapitulation der Japaner. Der Weltkrieg war zu Ende, und Billie Holiday hatte eben die Platte aufgezeichnet, die Sarah Vaughan später als die ihr liebste der Kollegin bezeichnen sollte. Nehmen wir ihre Version der Grundfrage aller Liebenden auf.
Billie Holiday: What Is This Thing Called Love (Decca Recordings), 3.04
Natürlich: Auch der nächste Song, ein Gershwin-Klassiker, ist von Billie Holiday bleibend und unvergesslich interpretiert worden, aber wir geben ihn heute in die Obhut einer anderen Frau und gehen mit unserer Aufnahme sogar noch einmal fast zwei Jahrzehnte zurück. Wenn man bedenkt, dass es Jazz-Plattenaufnahmen erst ab etwa 1919 gibt, dann hat eine Aufnahme aus dem Jahr 1928 fast etwas Steinzeitliches, und so darf sie auch klingen. Vor knapp achtzig Jahren haben die Gefühle in der Unterhaltungsmusik einfach weniger cool geklungen als ein paar Jahrzehnte später. Zunächst aber klären wir die Frage: Wer war die Frau, die da 1928 ans Mikrophon trat, um sich »The Man I Love« aus der Seele zu schreien?
Mit der Liebe ging es gleich los. Als Sophie Tucker am 13. Januar 1887 – das Datum ist unsicher – an der russisch-polnischen Grenze geboren wurde, befand sich ihre Mutter gerade auf der Reise nach Amerika, wohin ihr Vater geflohen war, um dem russischen Militärdienst zu entkommen. Die Eltern eröffneten ein Restaurant in Connecticut, wo Tochter Sophie die Gäste mit ihrem Gesang unterhielt. Der Erfolg und die Leidenschaft für den Unterhaltungsgesang brachten die junge Frau – keine Jazz-Interpretin im engeren Sinn, aber eine musikalische Sängerin – nach New York, wo sie nach einigen Jahren in Varietétheatern ihre eigene kleine Band gründete, mit der sie schließlich selbst in Europa tourte.
Der Stil der Sophie Tucker lag in einer Melange aus anzüglichen Texten, einer kessen Performance, heiteren, auch selbstironischen Einlagen und, wenn es sich anbot, auch leidenschaftlichen Selbstentäußerungen. Eine solche, bemerkenswerte, finden wir tatsächlich in einer Aufnahme aus dem Jahr 1928. Es ist die älteste mir bekannte Einspielung von »The Man I Love«, den später alle großen Sängerinnen interpretiert haben.
Nie aber klang er so wenig raffiniert, so roh, so inständig wie bei dieser letzten der »red-hot mamas«, wie man sie auch nannte, und wenn sich dabei – im Rückblick – etwas Komisches in den Vortrag mischt, dann liegt das wahrscheinlich nur daran, dass wir Hörer von heute falsche Freunde sind und den Liebesschwüren von Sophie Tucker so ironisch begegnen wie manchen von Werthers Briefen. Eigentlich aber ist der Ausdruck dieses Liebesbekenntnisses gerade in seiner Schlichtheit und Direktheit hinreißend und deshalb eines der archaischen Beispiele aus der Frühzeit der industriellen Produktion von Liebe auf Tonträgern. Hören Sie mitten im historischen Rauschen eine liebende Sophie Tucker mit »The Man I Love«.
Sophie Tucker: The Man I Love (Living Era), 2.58
Nein, so klar, so expressiv, so hinreißend direkt sind Gefühle nicht immer, denn eigentlich sind Gefühle in Wirklichkeit immer: gemischte Gefühle. Deshalb lassen sie sich ja musikalisch so gut ausdrücken. Es sei denn, man verarbeitet sie zur Schnulze oder zu einem der anspruchsloseren Popsongs, die auch nur von einem Gefühl handeln, einem blinden, eindimensionalen und eindeutigen noch dazu, aber nicht das Inständige der Sophie Tucker haben. Doch gerade Liebende erleben ihre Leidenschaft oft ganz anders, nämlich zweideutig, unklar, zwiespältig.
Wie gut, dass es Musik gibt, die das Gefühl gerade in diesem Zustand auffängt. Die ein Jahr nach Sophie Tuckers Aufnahme geborene Sängerin Chris Connor hat ihre hörbar »weiße« Stimme auf ebenso virtuose wie elegante Weise in den Dienst zweideutiger Gefühle gestellt.
In Kansas 1929 geboren, stieß sie 1952 zu Stan Kenton, ehe sie zur selbständigen Bandleaderin wurde, die zeitweilig große Erfolge feierte. In den Sechzigern und Siebzigern war sie fast vergessen, ehe sie in den Achtzigern zurückkehrte und ihren Rang als intelligente Interpretin von schwierigem Material bestätigte. Eine Ausnahmefigur ist die Sängerin geblieben, deren unverwechselbare Stimme eine kühle Innigkeit verbreitet, eine warme Distanz oder was der Widersprüche mehr sind.
»Be my all, be my nothing« ist ein gutes Beispiel für ihre wahrhaft meisterliche Art, das Widerstreitende zu binden und in einem Ausdruck zusammenzufassen. Beherrscht wirkt die Sängerin und doch verloren, und es gelingt ihr, in dieser sehr suggestiven Melodie ihren Ton genau in der Schwebe zu halten zwischen dem Innigen und dem Bitteren. Das Orchester bleibt diszipliniert im Hintergrund, sie schreitet vorweg, in einer Form von Selbstgewissheit, die ihrer Stimme alle Freiheit lässt zwischen dem Coolen des Tons und der Wärme, der Haltung.
Zugleich enthält dieser kleine Titel den Beweis, dass Leidenschaft grenzenlos wirken kann, gerade wo sie eine strikte Form bekommt. Worum geht es in »Be my all, be my nothing«? Da ist eine Frau, die tut, als habe sie die Liebe noch vor sich, als stünden die Möglichkeiten, zu gehen oder zu bleiben, noch offen, doch was die Stimme sagt, ist: Sie liebt. Sie kann nicht anders. Sie ist schon gefangen.
Das Thema wird im Dialog mit der Gitarre eingeführt, doch auch wenn eine kleine, klassisch anmutende und vom Englischhorn getragene Instrumentengruppe hinzukommt: Dominierend bleibt die einsame, sich selbst überlassene, geradezu nächtliche Stimme ohne Gegenüber. Und so, als müsste sich das Thema in der Instrumentierung wiederfinden, singt hier zweistimmige Innerlichkeit: Mal paart sich die Stimme mit dem Englischhorn, mal mit dem Klavier. Nein, leicht, kokett, überdreht ist die Liebe hier nicht. Vielmehr denkt man unwillkürlich an den Titel eines Theaterstücks von Alfred de Musset: »Man spielt nicht mit der Liebe«.
Und was für Widersprüche in diesem Gefühl. All or nothing? Von wegen. Alles liegt dazwischen: Friend, Lover, Darling, »be my hands, be my eyes« … Die Alternative tut nur hart und entscheidungsstark, in Wirklichkeit ist alles unklar, und so versunken ist diese Stimme in ihr Nachdenken, dass sie mal vor, mal hinter dem Bass herzulaufen scheint. Hören Sie nur: Was für ein kluger Gebrauch der Tempo-Verschleppung, die besonders drastisch erscheint, wo die Herzschlag-Pausen liegen. Ein Ernst wird da frei in dem Schweigen, in dem das Gefühl Luft holt und sich gleich wieder auf jener Stimmung niederlässt, die das innige Stück geradezu unwandelbar vorträgt.
Schließlich überlässt sich die Stimme sich selbst wie dem einzig Gewissen, Unstörbaren. Und doch liegt über der Hitze des Gefühls eine Reflektiertheit und Selbstbeherrschung, ja, eine Verstandeskühle, die der Frage »Alles oder Nichts« etwas Bedrohliches, Unausweichliches gibt. Männer haben Angst vor solchen Frauen und solchen Alternativen, aber der Klang der Stimme von Chris Connor hat etwas noch stärker Verführerisches, gerade, weil sie das Expressive ganz nach innen wendet.
Chris Connor: Be My All (Chris Craft), 4.24
Als im Jahr 1993 Cassandra Wilsons Album »Blue Light ’till Dawn« erschien und abrupt zu einem der großen Erfolge des jüngeren Jazz avancierte, da wurde die 1955 in Mississippi geborene Sängerin wie eine Erneuerin behandelt und gleich mehrmals hintereinander zur »Stimme des Jahres« gekürt.
Diese Stimme mit dem warmen Timbre, ihr freier Umgang mit den Grenzen zwischen Pop Tunes und Jazz – eigentlich nichts, das man nicht auch bei Billie Holiday oder Miles Davis hätte finden können –, ihre unkonventionellen Arrangements und vor allem die meditative Ausstrahlung ihres ebenso verhaltenen wie sinnlichen Organs, wirkten äußerst suggestiv. Ihr selbst war der kommerzielle Erfolg weniger wichtig als der künstlerische, eine Nische hatte sich für sie geöffnet, und da sie diese erste Platte eigentlich nie abgeschlossen hatte, setzte sie das Programm fort.
Den Eindruck tiefer, entspannter Melancholie hat Cassandra Wilson auf ihrem nächsten Album eher noch vertieft: »New Moon Daughter« hieß es. Auf dem Cover sieht man die Sängerin mit den Dreadlocks in einem Rückenakt in ein vom Mondlicht beschienenes Gewässer steigen, und seither wird etwas Mythisches, etwas von Voodoo und Südstaaten-Folk-Blues assoziiert. Das ist so abwegig nicht, Cassandra Wilson kommt stilistisch aus dem Umkreis der heimischen Musik der Südstaaten, sie hat natürlich Gospel gesungen, in New Orleans gelebt, Voodoo-Zeremonien beobachtet, sie liebt es bis heute, ihrer Musik etwas vom Flirren der staubigen Hitze von Mississippi zu geben, und sie kann auf Ahnen unter den nigerianischen Yoruba und den amerikanischen Ureinwohnern der Schoschonen verweisen.
Jede Stimmung sieht die Liebe anders, jede Stimmung sieht sie richtig. Kann man sie nicht mit demselben Recht das einzig Wirkliche nennen wie die große Illusion? Wenn die Liebe über den großen Bogen des Horizonts zieht, dann ist sie hier in ihrem Sonnenuntergang. Das Licht, das sie spendet, ist nur noch fahl, von ihrem Ende weiß sie schon.
Diese Phase der Liebe kennt keinen Zorn mehr, keine offene Wut, sie ist auf ruhigere Weise expressiv, und genau dort ist Cassandra Wilson. Etwas Fatalistisches ist in ihrer Stimme, sie kapituliert vor der Blindheit der Liebe, und sie findet die musikalische Form dafür, eine Monotonie, ein Abgleiten aus der Wärme in die Qual. Denn Liebe ist hier fast kalt und mechanisch, sie ist ein Unglück, und deshalb spricht man sie nur wahrhaftig aus im Lamento, im Klagegesang, den Cassandra Wilson anstimmt mit der Müdigkeit derer, die sich aufgerieben, die sich im Lieben selbst erschöpft haben.
Cassandra Wilson: Love is Blindness (New Moon Daughter), 4.53
Peace Piece. Meditationen
Eigentlich ist es nicht die schlechteste Begrüßung zu sagen: Friede sei mit Ihnen, und das hoffentlich über die nächsten Momente hinaus, in denen ich versuchen will, Ihnen nahezubringen, wie im Jazz der Frieden komponiert wurde. Lange hat es in dieser Musik meisterliche Instrumentalisten und Komponisten gegeben, die brillante, funkelnde Linien spielten, eine atemberaubende Instrumentenbeherrschung besaßen und deren Technik die Hörer schlicht überwältigte. Charlie Parker konnte so spielen oder auf dem Klavier Bud Powell. Gewiss spielten auch sie ergreifende Balladen, aber erst Miles Davis hat einen Stil kultiviert, der gerade aus der Reduktion, der Pause, dem Timing musikalische Substanz gewann, und in seinem Gefolge tauchten allmählich Musiker auf, die spielten, als laute die Schlüsselfrage: Wer spielt die wenigsten Noten? Doch wortkarg kann man selbst mit vielen Noten spielen und geschwätzig auch mit ganz wenigen.
Mit Miles Davis verbindet Bill Evans nicht zuletzt der Sinn für die Melodie und jenes Timing, das gerade in ruhigen Stücken seine ganze Magie entfaltet. Darüber hinaus aber ist Bill Evans der Lyriker schlechthin, und wenn er ein Stück »Peace Piece« nennt, dann kann man sicher sein: Bill Evans spielt den Frieden.
In der linken Hand ein Ostinato aus zwei Tönen, das ist schon fast keine Basslinie mehr, sondern ein Glockenklang, über den er seine Melodien und Miniaturen legt, mal nur ein paar Akzente, mal eine begonnene Phrase, mal ein paar Akkorde, gläsern, in einer Variation der Stimmungen, die glücklich, tief nachdenklich und befriedet ist. Wenn Musik tröstlich sein kann, hier ist dieser Trost, und ich kann nicht umhin zu glauben, dass man diese Musik Kranken bringen sollte, Verzweifelten, Trauernden. Hier werden wahrhaft Gefühle in ihrer Tiefe erkundet. Und was ist das, was sie in aller Trauer so glücklich macht? Vielleicht das Gefühl, im Gefühl eines anderen aufgehoben zu sein, der hier einen Frieden über die Trauer breitet, in dem diese wie verklärt klingt.
Man muss allein einmal hören, was Bill Evans hier mit seinem Klang, mit seinem Anschlag macht: Mal klingt er groß, schwer und voluminös, mal spitz und schneidend, mal ist er gläsern flirrend. Eine andere große Produktion von Bill Evans trägt den Titel »Conversations with myself«. Auch dies ist ein Selbstgespräch, in dem er sich befragt und antwortet, in dem er abirrt und zu sich zurückkehrt, in dem er weiß und zweifelt und ahnt und tastet und am Ende doch alles im Prozess liegt, nicht in der Ankunft.
In meinen Ohren ist dieses eines der großen riskanten Stücke aus der Welt des Jazz, groß, weil es Gefühle umspannt und differenziert, die auf so engem Raum kaum je ähnlich dicht geklungen haben, und riskant, weil Geschmack und Intelligenz von Bill Evans verhindern, diese Selbsterkundung kitschig oder auch nur sentimental werden zu lassen. So klingt er wirklich, der Frieden mit sich und der Welt, ein Frieden, in dem die Widersprüche nicht weggelogen oder mit einer süßlichen Glasur überzogen werden, nein, der Frieden bei Bill Evans kennt Molltöne, kennt Fragmentarisches, Ungelöstes, aber auch die Eintracht im Angesicht des Disparaten.
Übrigens war Bill Evans, als er dieses Album am 15. Dezember 1958 in New York aufnahm, noch weitgehend unbekannt. Im selben Jahr wählte ihn die Internationale Kritikerjury des Magazins »Down Beat« zum »New Star« des Klaviers. Dem 29-Jährigen stieg dieses Lob nicht zu Kopfe. Im Gegenteil, extrem bescheiden, zurückhaltend im Auftreten und ohne große Geste, pflegte er seine Arbeit eher herabzusetzen, und ohne Koketterie verweigerte er sich länger einem Solo-Projekt, als es bei einem Musiker seiner Größe üblich gewesen wäre. Vielleicht haben ihn seine Erfahrungen mit dem Miles Davis Sextett diese Form der Zurückhaltung gelehrt. Übrigens führte er selbst sein Verständnis der Melodie nicht auf andere Pianisten, sondern eher auf Charlie Parker und Miles Davis zurück, und so kann man erahnen, was es bedeutete, dass ausgerechnet dieser Miles auf dem Cover der Platte »Everybody Digs Bill Evans«, um die es hier geht, sagte: »Ich habe ganz sicher viel von Bill Evans gelernt. Er spielt das Klavier genau so, wie es gespielt werden sollte.«
Dieses wunderbare »Peace Piece« fiel Evans ein, als er gerade an einer Melodie für Leonard Bernsteins Show »Some Other Time« arbeitete. Als »Peace Piece« komponiert war, entschied sich Evans jedoch, dieses Solo-Stück separat zu veröffentlichen. Es wurde einer seiner Klassiker. Ich aber höre diese Komposition bis heute nur selten, um sie nicht abzunutzen, um sie nie ganz auswendig zu können.
Bill Evans: Peace Piece (Everybody Digs Bill Evans), 6.37
Ein Thema, ein Instrument und doch: zwei völlig unterschiedliche Zugänge. Wenn Sie jetzt den Pianisten und Komponisten Horace Silver mit einer Eigenkomposition betitelt »Peace« hören, dann hören Sie zugleich einen anderen Frieden.
Silver hat seine Herkunft aus dem Blues nie verleugnen können und wollen, er hat geholfen, den Jazz in den Hardbop zu führen, hat Funk, hat ein stark rhythmusbetontes, ein tanzbares Spiel kultiviert, und er hat aus dem Klavier sogar manchmal etwas wie ein Perkussionsinstrument gemacht. Afrikanische und lateinamerikanische Rhythmen werden verarbeitet, und seine Melodien haben oft etwas Gesangliches, jedenfalls sehr Zugängliches, und es sind ihm regelrechte Gassenhauer des Jazz gelungen, was ihn nicht herabsetzen soll.
Denn Horace Silver ist ein Erneuerer, ein immens einfallsreicher Mann, der seine eigenen rhythmischen Figuren gerne immer wieder bricht und mit überraschenden Wendungen konterkariert. Übrigens hat er den Bläsern viel gegeben, sie oft in den Vordergrund seiner Titel gestellt, um in den eigenen Soli dann zu explodieren und manchmal sogar bis an den Rand freier Formen vorzudringen.
Silver trat früh als Pianist und Saxophonist auf. Er wurde von Stan Getz entdeckt und schon 1950 auf eine Tournee mitgenommen. Bereits vier Jahre später gründet er gemeinsam mit Art Blakey die berühmten »Jazz Messengers«, die sich als wahre Talentschmiede für den jungen Jazz erweisen sollten und das über Jahrzehnte, wie nicht zuletzt die Tatsache verrät, dass auch Leute wie Wynton Marsalis ehemals in dieser Gruppe ihre ersten Meriten erwarben.
Interessant ist in unserem Zusammenhang auch, dass Horace Silver – der bald zu den Erfolgreichsten im Jazz gehörte – eine so genaue Vorstellung von den thematischen Elementen seiner Kompositionen hatte, dass man in der klassischen Musik wohl von Programm-Musik sprechen würde, und so erstaunt es kaum mehr, dass er später begann, Texte zu seinen Titeln zu schreiben, was man sich bei Bill Evans kaum vorstellen könnte.
»Peace« also überschreibt er eine Ballade auf »Blowin’ the Blues Away«, eine Ballade, die so viel von der für Silver typischen Kraft verrät wie Zartgefühl. Was hier so anders klingt als bei Bill Evans, ist nicht allein der Sound des Klaviers. Hier gibt es nichts Zweideutiges, keinen Impressionismus, kein Flirren der Töne, es gibt keine großen dynamischen Unterschiede, hier verläuft sich niemand, es wird auch nicht assoziiert und phantasiert, vielmehr wird die Stimmung gefunden und quasi deklariert. Man könnte über Passagen singen, was Blue Mitchell an der Trompete vorträgt, aber man befindet sich dauernd auf falscher Fährte, wenn man dasselbe mit dem Solo von Horace Silver auf dem Klavier versucht, so oft wechselt er seine Tempi, so unerwartet setzt er seine Akzente.
Der Ansatz ist also ein ganz anderer, und doch hat das Getragene in dieser Ballade etwas so tief Erfühltes, hat das überraschende Wechselspiel zwischen Mitchell und Silver ein eigenes Glück, denn hier entsteht der Friede regelrecht als Summe eines Dialogs.
Der große Reiz dieses Titels besteht nicht zuletzt in der fraglosen, ruhigen Selbstgewissheit, mit der hier das Thema auf der Trompete vorgetragen und variiert wird, und der zögernden, suchenden Form, in der das Klavier diese innere Tonlage wechselt. Auch hier ist »Friede« kein statischer Zustand, er liegt vielmehr in einer inneren Bewegung, die sich musikalisch selbstgewiss und befriedet artikuliert.
Horace Silver: Peace (Blowin’ the Blues Away), 6.02
John Coltrane hat das musikalische Universum vielleicht weiträumiger abgeschritten als irgendjemand vor oder nach ihm. Er ist der Mann, der aus Musik bestand, der im Stehen, Sitzen und Liegen spielte, den nichts so interessierte wie Musik und der sie atemlos vor sich her trieb, sie erweiterte und über ihre Grenzen hinaus ins Noch-Hörbare und Nicht-mehr-Hörbare erweiterte. Er ist der Musik verpflichtet und nicht dem Publikum, und wenn es in seinem Werk Titel gibt, die aufgelöst, zerrissen, dissonantisch und äußerst strapaziös zu hören sind, dann muss man sich immer vor Ohren halten: Sie suchten keine Gefolgschaft, keine Nachahmer – die sie vielleicht unglücklicherweise in so reichem Maße gefunden haben –, sie unterhielten zuletzt eine Kommunikation eher mit einem Jenseitigen als mit der Hörerschaft, sie waren musikalischer Gottesdienst auf eine eigene, innige Weise.
Natürlich will ich keine solche Komposition vorstellen, immerhin ist unser Thema »Frieden«. Aber eine Brücke zu unserem Thema gibt es doch. Denn häufig hat Coltrane hinter die Kompositionen mit der größten Zerrissenheit einfache, befriedete Stücke von immenser Ruhe und Versöhnung gestellt. In diesen Titeln verriet sich eine Klarheit und Selbstversenkung, ein geradezu jenseitiges Ruhen und Schauen, das höchste Verfeinerung des musikalischen Ausdrucks artikuliert.
1963 nahm Coltrane zwei Stücke auf, die erst zwei Jahre später auf der Platte »Dear Old Stockholm« erscheinen sollten. Der – nach dem Titel-Track – zweite dieser Titel ist eine Eigenkomposition und gibt eine Naturstimmung wieder, zu der sich beim Hörer sofort ein präzises Bild einstellt: »After the Rain« heißt dieses Kleinod musikalischer Stimmungsmalerei. Es assoziiert den Frieden einer Natur, die erst wieder erwacht, und es bildet eines der frühesten Beispiele für Coltranes Neigung, selbst im Kontext der Ballade den Rhythmus aufzulösen, etwas, das beim ersten Hören kaum auffällt.
Doch was der Drummer Roy Haynes – der eben erst für Coltranes alten Schlagzeuger Elvin Jones eingesprungen war – hier an Sounds, an Strukturen und Hohlräumen beschreibt, das antwortet auf das schönste McCoy Tyners Versuchen, die Stimmung nach dem Regen mit hörbar fallenden Tropfen klanglich nachzubilden, und Coltrane selbst setzt eine lange, unterbrochene Melodielinie voller Seufzerfiguren in diese Atmosphäre, und selbst wenn man sich von solchen Malereien in Anlehnung an den Titel lieber entfernt, so bleibt ein vom Frieden tief und glücklich und nachdenklich durchdrungenes Stück Musik.
John Coltrane: After the Rain (Dear Old Stockholm), 4.07
Die vier Jahreszeiten
Die meisten Menschen empfinden stark für Jahreszeiten, und das schon deshalb, weil sie etwas Symbolisches in ihnen erkennen. Sie sprechen vom Werden, Blühen, Reifen und Vergehen ganz so, wie man von den Lebenszeiten des Menschen spricht. Dass in diesem Naturkreislauf Musik liegt, macht ihn noch einmal so schön, und manche Menschen glauben sogar, sie müssten im Frühling Paarungslaune bekommen und im Herbst selbst dahinwelken. Glücklicherweise kennt die Musik auch den lüsternen Herbst und den vitalen Winter, und so führe ich Sie jetzt durch ein ganzes Jazz-Jahr, beginnend mit dem Frühling und einer wahrhaft frühlingshaften Stimme.
Grob gesagt, gibt es zwei Arten von Stimmen. Die eine verblüfft durch Volumen, Farbe, Technik, Virtuosität. Die andere verblüfft nicht, klingt nicht primär schön und wird auch nicht virtuos eingesetzt. Aber ihr Resonanzboden ist Lebenserfahrung, Persönlichkeit, Charakter. Ein paar der bemerkenswertesten Stimmen gehören in diese letzte Kategorie.
Und Blossom Dearie gehört dazu. Diese eher unbekannte, jedenfalls unterschätzte, 1926 im Staat New York geborene Sängerin besitzt ein einzigartiges Timbre, mit dem man ganz uncoole Tugenden assoziiert: Kindlichkeit, Naivität, Unschuld. Die helle Klangfarbe ihrer Stimme mit dem winzigen Vibrato klingt manchmal so, als habe sie sich aus Koketterie verstellt. Aber sie klingt so schon seit den Fünfzigern und tut es heute noch. Manchmal ist, was sie interpretiert, wie Vor-sich-Hingesungenes, wie Selbstgespräch. In solcher Einfachheit ist kein Raum für Künstliches oder Exaltiertes. Unmöglich also, dem reinen Ausdruck dieses stimmlichen Organs ungerührt zu folgen.
Blossom Dearie galt lange als rätselhaft. Aber diesen Namen zum Beispiel haben ihr die Eltern, Abkömmlinge norwegischer und schottischer Einwanderer, wirklich gegeben. Sie begann ihre Laufbahn als Sängerin und Klavierbegleiterin Ende der vierziger Jahre in Manhattan, ging für knapp fünf Jahre nach Paris, wo ihr der Begründer des Verve-Labels, Norman Granz, anbot, sie nach ihrer Rückkehr in die USA zu produzieren.
Unter der Handvoll Alben, die in jenen Jahren bei Verve entstanden, nimmt der Tribute an die Broadway-Autoren Betty Comden und Adolph Green eine Sonderstellung ein. Diese waren 1959, im Jahr der Plattenaufnahme, das strahlende Gespann der musikalischen Komödie, hatten nicht zuletzt Bernsteins »On the Town« und Gene Kellys »Singin’ in the Rain« geschrieben, Klassiker voller extrovertierter Up-tempo-Nummern. Und dann kam diese unbekannte Sängerin mit einer Zusammenstellung einiger unveröffentlichter Titel voller Innigkeit und Versenkung. Sicherheit und der Geschmack der Auswahl, Intelligenz und Humor der Interpretation begeisterten die Autoren, ebenso wie Tony Bennett, der Blossom Dearie unter die besten Sängerinnen der Zeit rechnete.
Sie selbst sah sich eher als singende Pianistin. An der Seite des unlängst verstorbenen Bassisten Ray Brown, des Gitarristen Kenny Burrell und Oscar Petersons Schlagzeuger Ed Thigpen pflegte sie am Piano ihren reduzierten Stil, setzte sparsame Klavierlinien im Bebop-Stil, Korrespondenzen zur Singstimme, überzeugt, die meisten Pianisten spielten zu viel hinzu. Vielleicht war auch diese gemeinsame Überzeugung der Grund dafür, dass Miles Davis, nicht gerade ein Freund von Sängern, sechs Abende lang sein Double Bill im Village Vanguard mit Blossom Dearie teilte.
Nicht oft verbindet sich das Inständige mit dem Aufrichtigen so glücklich wie auf dem kleinen Meisterwerk des Comden-und-Green-Tributes, in dem der Frühling wirklich eine blankgeputzte Stimme hat.
Blossom Dearie: They Say it’s Spring (Blossom Dearie), 3.24
Ist der Sommer eigentlich eine musikalische Jahreszeit? Nein, musikalisch sind die Übergangsjahreszeiten Frühling und Herbst, der Sommer ist zu heiß zum Fühlen, und der Winter friert angeblich die Leidenschaft ein. Und doch ist der berühmteste aller jahreszeitlich inspirierten musikalischen Titel ausgerechnet dem Sommer gewidmet, er ist so berühmt, dass sich kaum ein Ausübender dem Jazz je genähert hat, ohne diesen Titel zu spielen, er ist das »House of the Rising Sun« des Jazz. Man möchte für Jahre verbieten, dass er eingespielt wird, die Versionen der letzten Jahre hatten den bestehenden nicht wirklich etwas hinzuzufügen.
Sie wissen schon, wovon die Rede ist, von Gershwins Ohrwurm »Summertime«, der war auch 1957 schon ein gern gespieltes Stück, aber in meinen Ohren war es der Altsaxophonist Art Pepper – am Klavier begleitet von Russ Freeman –, der den Sommer noch einmal ganz neu Sommer sein ließ. Denn was machte er aus dem Klassiker? Er dekomponierte, er zerlegte ihn, setzte ihn neu zusammen, er machte ihn unkenntlich, um ihn verändert und doch intakt wieder in Erscheinung zu bringen. Ja, Art Pepper lässt eine andere Sonne über dem Horizont Gershwins aufgehen.
Schon die ersten klirrenden Akkorde des Klaviers, das hineinrutschende Alto, der glockenschlagende Bass geben die Tonlage vor. Plötzlich ist dieser Sommer nicht mehr schwül und brütend, sondern mal stechend, mal schwer, mal qualvoll, mal löst er sich in einem Flirren, in einer Luftspiegelung auf.
Art Pepper trägt das mit einer Sicherheit vor, und er hat so reiche musikalische und technische Mittel zur Verfügung, dass dieser Sommer selbst sich verändert. Er ist nicht mehr lässig und nicht mehr sexy, er ist beides auch, doch der manchmal schneidende, staccato daherkommende Saxophonton, den Art Pepper aufsteigen lässt wie aus einem Soprano herausgequält, dieser fragmentarisch singende, schreiende, lamentierende Ton, in dem mehr Leiden steckt als in dem satten Groove, den die Vokalisten dem Titel meist geben, dieser Ton befreit aus dem legendären Titel ein Lamento, das man so nie darin gehört hat.
Pepper macht mit der Komposition ein Lehrstück für das, was ihm Jazz bedeutete: nicht zuerst Musik, sondern eine Reise zur Musik, eine Selbsterkundung, eine Suche nach dem wahren Ausdruck, den nur der Mutige, Risikofreudige, der ganz der Improvisation vertrauende Musiker finden wird.
Erstaunlich, wie selbstsicher er diese gewagte Erkundung in die musikalischen Möglichkeiten der Gershwin-Komposition unternimmt, wie weit weg vom Original er sich traut und wie sicher er doch in seine Arme zurückkehrt. Er schmiert seine Töne auf die Leinwand, er unterbricht sich, zerstückt seine Linien, lässt ab, folgt einer anderen Idee.
Ach, Art Pepper war ein so großer, selbständiger und versessener Instrumentalist, dass man nur heulen kann über den Preis, den er zahlte: Drogenkrankheit, Gefängnisaufenthalte – die ihn elf Jahre seines Lebens kosteten –, Hospitäler, Entziehungsinstitute und immer neue, glanzvolle Comebacks, die niemand mehr erwartet hatte. 56-jährig stirbt der »Jazz Survivor«, wie jener Film ihn nannte, der drei Monate vor seinem Hirnkoma-Tod fertig wurde. Der Sommer des Art Pepper, der alle seine typischen Kennzeichen trägt, er trägt auch die Narben dieses Lebens.
Art Pepper: Summertime (Aladdin Recordings 2), 7.26
Für den Herbst begeben wir uns in einen Club, genau gesagt in den »Spotlight Club« in Washington. Es ist das Labour-Day-Wochenende des Jahres 1958. Das heißt Herbstanfang. Der 28-Jährige ist ein bekannter Mann. Miles Davis, der ein wenig als sein Entdecker gilt, hat sich zu dem Satz hinreißen lassen: »Heutzutage geht all meine Inspiration auf Ahmad Jamal zurück.« Doch wie kann das sein: Die einen haben Ahmad Jamal in die Nähe eleganter Bar-Pianisten gerückt, die anderen geklagt, er habe »nie die Anerkennung erhalten, die er verdiente«. Zu den einen gehört der bedeutende Jazz-Kritiker Nat Hentoff, zu den anderen Miles Davis, der, »begeistert« von seinem »Stil«, der »Leichtigkeit seines Anschlags«, seinem »Understatement«, der »Unbeschwertheit«, gestand, das »Konzept, der Musik mehr Raum zum Atmen zu geben«, habe er »von Jamal übernommen«.
Dieser hieß eigentlich Fritz Jones, stammte aus Pittsburgh und begann seine Berufsmusiker-Karriere mit elf Jahren, konvertierte früh zum muslimischen Glauben und tourte nach seinem ersten großen Erfolg im Jahr 1958 mit »But Not For Me« erst durch die USA, dann durch die Welt. In jenem Club in Washington erleben wir einen Jamal, der improvisieren kann und doch wie ein Arrangeur arbeitet, die Stimmen führend, Klangfarben setzend: dynamisch, kraftvoll, manchmal motorisch, als wolle er das Klavier zum Perkussionsinstrument machen und dem Bass die Rhythmusarbeit abnehmen, und manchmal wie eine Singstimme.
Auch in der Improvisation dem Melodischen verpflichtet, ist er kein Radikaler des Bebop, wie Miles Davis hat er sich an Pop-Titel gewagt, Standards immer im Programm gehabt. Dabei beschäftigt ihn meist nur ein Motiv, dessen Verarbeitung das Werk allmählich in den Rang einer Eigenkomposition hebt. Jamal besitzt die Fähigkeit, ein Standard-Thema so zu spielen, als sei es der Improvisation erwachsen, und erzählt so – vor animiertem Live-Publikum – von der Quelle der unstillbaren musikalischen Imagination. Diesmal vom »Autumn in New York«, den er mit einer Anleihe an Nat King Cole beginnen lässt und dann nach mehreren überraschenden Wendungen ebenso lyrisch begreift wie spielerisch, und zwischendurch setzt er mit trockener Akkordik strenge Akzente gegen die eigene Poesie. Was Jamal da spielt, ist in der Tat eine Übergangsjahreszeit mit vielen Farben.
Ahmad Jamal: Autumn in New York (Ahmad’s Blues), 3.18
Doch, auch der alte Winter in seiner Strenge hat seinen Komponisten, und es ist einer der weicheren, eleganteren, ja, und manchmal auch seichteren Vertreter seiner Gattung: George Shearing, von Geburt an blind, verdankt seinen Ruhm nicht zuletzt einem Zufall. Weil der Klarinettist Buddy DeFranco vertraglich verhindert war, eine Plattenaufnahme zu bestreiten, kreierte George Shearing kurzerhand die Band ohne Bläser und flankierte sein Pianospiel neben der Rhythmusgruppe durch Vibraphon und Gitarre. Eine folgenschwere Entscheidung, denn ob im Bar-Jazz oder in der Filmmusik, der Sound von George Shearing wurde bald zum Markenzeichen des populären Jazz, melodisch, sanft, ein Gegengift gegen den modernistisch aufgeregten Bebop, aber auch ein wenig harmlos. Der Klarinettist Tony Scott, der zeitweilig mit Shearing auftrat, gestand später einmal: »Ich habe ihn nie für einen bedeutenden Jazzer gehalten«, aber er sei »ein phantastischer Musiker«. Shearing hat dies erst in den siebziger und achtziger Jahren wieder unter Beweis gestellt, als er das Konzept des großen Erfolges hinter sich hatte und sich wieder seiner Wurzeln besann.