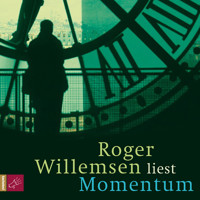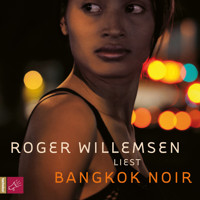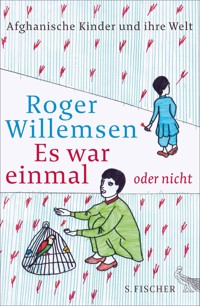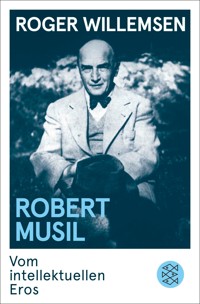
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Robert Musils Denken und Schreiben kennzeichnet eine Synthese von Genauigkeit und Leidenschaft. Sein Werk enthält nicht allein das diagnostische Bild der bestehenden Wirklichkeit, sondern auch die Bausteine einer Lebenslehre unter den Maximen einer neuen Moral. Roger Willemsens Essay zeichnet das geistige Profil dieses Jahrhundertautors und lässt sich zugleich als biographische Darstellung lesen. Er beschreibt für Musil zentrale Begriffe wie Sinnlichkeit und Erkenntnis, kritisches und utopisches Denken in ihrer Einheit und in ihren radikalen Geltungsansprüchen. Und macht verständlich, warum Musil die Literatur ganz unironisch »eine der wichtigsten Menschenangelegenheiten« nennen konnte. Robert Musil war für Roger Willemsen eine intellektuelle Leitfigur. Musils Anspruch, »Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt« zu leisten, gibt Willemsen mit Emphase an uns weiter: »Musil ist ein gegenwärtiger Autor.« Der Autor dieses wegweisenden Essays – Willemsens erstes Buch – ist es ebenso. »Ich wollte begründen, warum es Literatur geben muss.« Roger Willemsen über sein erstes Buch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Roger Willemsen
Robert Musil
Vom intellektuellen Eros
Über dieses Buch
Robert Musils Denken und Schreiben kennzeichnet eine Synthese von Genauigkeit und Leidenschaft. Sein Werk enthält nicht allein das diagnostische Bild der bestehenden Wirklichkeit, sondern auch die Bausteine einer Lebenslehre unter den Maximen einer neuen Moral. Roger Willemsens Essay zeichnet das geistige Profil dieses Jahrhundertautors und lässt sich zugleich als biographische Darstellung lesen. Er beschreibt für Musil zentrale Begriffe wie Sinnlichkeit und Erkenntnis, kritisches und utopisches Denken in ihrer Einheit und in ihren radikalen Geltungsansprüchen. Und macht verständlich, warum Musil die Literatur ganz unironisch »eine der wichtigsten Menschenangelegenheiten« nennen konnte.
Robert Musil war für Roger Willemsen eine intellektuelle Leitfigur. Musils Anspruch, »Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt« zu leisten, gibt Willemsen mit Emphase an uns weiter: »Musil ist ein gegenwärtiger Autor.« Der Autor dieses wegweisenden Essays – Willemsens erstes Buch – ist es ebenso.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Roger Willemsen, geboren 1955 in Bonn, gestorben 2016 in Wentorf bei Hamburg, war Autor und Literaturwissenschaftler. Darüber hinaus produzierte er Fernsehsendungen, drehte Dokumentarfilme und stand mit zahlreichen Programmen auf der Bühne. Willemsen war Honorarprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin und langjähriger Schirmherr des Afghanischen Frauenvereins. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Adolf-Grimme-Preis in Gold, dem Rinke- und dem Julius-Campe-Preis, dem Prix-Pantheon-Sonderpreis, dem Deutschen Hörbuchpreis und der Ehrengabe der Heinrich-Heine-Gesellschaft. Zu seinen Bestsellern gehören »Deutschlandreise«, »Der Knacks«, »Die Enden der Welt«, »Das Hohe Haus« und »Wer wir waren«, posthum erschien »Musik! Über ein Lebensgefühl«. Über das Gesamtwerk informiert der Band »Der leidenschaftliche Zeitgenosse«, herausgegeben von Insa Wilke. Willemsens künstlerischer Nachlass liegt im Archiv der Künste in Berlin.
Impressum
Neuausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Dieses Buch erschien erstmals 1985 in der »Serie Piper«.
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Kosmos Design, Münster
Coverabbildung: akg-images/Mondadori Portfolio
ISBN 978-3-10-491578-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
»In der Richtung des Lebens«
Kleine Frauen, große Frauen
In tyrannos: Musil als Törleß
Philosophische Anfänge
Literatur als Humanwissenschaft
Die Schule der Exaktheit
Die größere Neigung
»Der erotischste Schriftsteller«
Die stationäre Krise: der Krieg
Anarchie und Erlösung
Molekulardramatik
Die kleine Form
Die Abschaffung der Wirklichkeit
Die Erringung des Unwirklichen
Anhang
Zeittafel
Auswahlbibliographie
Werke von Robert Musil
Werke über Robert Musil
Personenregister
Einleitung
»Zwischen zwei Regengüssen: Die Trottoirs, die Fahrbann schwarzbraun. Die Menschen sehen alle schwarz gekleidet aus. Sie kommen aus der Fabrik, steife Hüte, keine Kragen. Sie gehen: Zwei und dann drei und dann einer und dann vier; und irgendeiner schiebt sich schneller vor, an dieser Gruppe vorbei, dann schon an jener.
Regen: etwas Aufgeschlitztes in der Luft, Blinkendes. Irgendwo ein Ruf: – Wal – di!« (Tb 273)[1]
Das war am 4. August 1913. Musil befand sich in Wien. Im Tagebuch sammelt er Bilder, meist Straßenbilder, die er für den großen Roman benutzen will. Der Roman hieß damals noch Der Spion, sein Protagonist »Anders«. »Gegen Ende des Spions nehmen«, schließt Musil die Sequenz, »wo A. sich wieder dem Interesse an den Menschen nähert.« (Tb 274)
Der Mann ohne Eigenschaften beginnt an einem Augusttag 1913, in Wien, er beginnt mit dem Wetter, die Menschen kommen massenhaft vor und anonym. Wenig später steht der Protagonist am Fenster und zählt die Gesichter. Er hat Urlaub von seinem Leben genommen, ein Jahr, für die beiden Hälften seines Lebensversuches wird er je ein halbes Jahr beanspruchen. Dann kommt der Krieg.
Am 4. August 1913 schreibt Musil außer der zitierten Tagebucheintragung auch einen Brief. Er bittet das Rektorat der Technischen Universität, an der er als Bibliothekar beschäftigt ist, um eine zeitweise Freistellung von seinem Dienst. Er bittet um ein halbes Jahr, die Bitte wird gewährt. Musil nutzt die Zeit zu extensiver literarischer Produktion.
Bezüge, Anklänge, Überschneidungen, von der Biographie zum Werk und wieder zurück, Musil als Ulrich, Ulrich als Musil, der eine lebt ein Werk, der andere schreibt es. Diese beiden Lebensformen erscheinen schon im Roman als die einzigen beiden Arten, an der »geistigen Bewältigung der Welt« (P 942) teilzunehmen. So hat man sich Musil also vorzustellen, und so muss er dargestellt werden: Die unmittelbare Einheit von Literatur und Leben, auf der er bestand, muss am Material seines eigenen Falls transparent werden. Biographische Komplexe werden in Wechselwirkung mit solchen des Werks beschrieben, Kindheitserinnerungen und -situationen also mit Kinderbildern im Werk konfrontiert, wo von naturwissenschaftlicher Berufsausbildung die Rede ist, wird das Bild der Naturwissenschaft im Werk untersucht.
Warum er denn, ein starker Mann, so viel Angst vor der kleinen Prostituierten gehabt habe, dass er mit dem Messer habe zustechen müssen? »Mir schien sie gefährlich«, antwortet der Frauenmörder seinem Richter. Aber er findet kein Verständnis.
Musils Werk beschreibt die Welt, die gefährlich »scheint«. Es ist das Fatum aller Liebenden, Wahnsinnigen und Verbrecher, aller Gottsucher, Analytiker und Gewalttäter, die dieses Werk bevölkern, dass ihnen die Welt, die sie erkennen und erkennen müssen, gefährlich wird. Hier verschmilzt die Erkenntnis der Realität mit der Unfähigkeit, in ihr auf anständige Weise glücklich zu werden. Vielmehr setzt sich diese Erkenntnis über die Begriffe hinaus fort, sie wird ausdruckshaft, bricht sich im Handeln, Dichten, Halluzinieren Bahn, infiziert sich und andere – und mehr wird sichtbar. Die Wirklichkeit wird degradiert zur Beliebigkeit, idealisiert zur Möglichkeit, ihre eindringliche sinnliche Präsenz zehrt die Logik alltagspraktischen Verhaltens auf.
»Leben, leben … nichts wollen als schöne Erlebnisse: So eingestellt erfindet man einen Roman.« (Tb 236) Musils Werk entstand auf anderen Wegen, es ist ein Dokument der Gefährdung, und es ist selbst gefährlich, wo es den Erscheinungen quer durch das Bewusstsein folgt bis zu jener Grenze, an der der Geist motorisch wird, die Motorik geistig.
Dieses hemmungslose und zugleich asketische Werk vertritt eine Erotik des Denkens, die sich in die unaufgelöstesten Gefühlsverbindungen, in die riskantesten Affektkonstellationen, in die Nervenzentren des Begehrens und Ablassens einwühlt. Es ist das Resultat einer sinnlichen Gefährdung und zugleich das Ergebnis der Anstrengung, die die Erregung korrigiert oder bricht, aber in ein Werk verwandelt. Diese Anstrengung hat viele Gesichter: Es ist die der Produktion und der Produktivität, eine Anstrengung des Begriffs und eine der Form, eine Anstrengung der sinnlichen Kräfte und eine des Überlebens, die den latenten Selbstmörder nicht eben den geringsten Teil seiner Produktivität gekostet haben muss. Es ist auch eine Anstrengung, die sich gegen jede nahe liegende Sicherheit jener bürgerlichen Existenz versperrte, die Musils Erscheinung distinguierterweise auszusprechen schien. Dieses Gesicht, von dessen »brennender Intensität« Franz Blei spricht, gehört merkwürdigerweise in die Galerie der Bohemiens, die aus den Ressourcen ihrer schöpferischen Produktivkräfte lebten.
Von diesem Standort aus, asozial, gefährdet und unter Formanstrengungen doch zum Schreiben prädestiniert, verwandelte Musil seinem Werk die Züge einer ästhetischen Lebenslehre an. »Wenn man dich recht versteht, hat man sein Leben gerettet!« (MoE 1280), jubelt die Schwester dem Mann ohne Eigenschaften entgegen, und hier liegt die pathetische Wurzel des Werks frei: Der intellektuelle Eros beschreibt die Revolte gegen eine Wirklichkeit, die sich in stereotyper Weise immer nur selbst paraphrasiert und reproduziert. In der Revolte aber erscheinen die Maximen richtigen Handelns.
Musil ist ein gegenwärtiger Autor. Die Relevanz seines Denkens ist an der Geschichte der Gegenwart spontan überprüfbar. Kaum je wurde in der Literatur des 20. Jahrhunderts die Wirklichkeit so vollständig abgebildet wie in seinem Werk. Es haftet der ordentlichen Rede über ihn auch immer Willkür an, sie muss deshalb zuletzt wenigstens andeutungsweise zur realen Vieldeutigkeit zurückgelangen, und also endet auch dieser Band mit dem Verweis auf Dinge, die außerhalb seiner Grenzen liegen.
Fußnoten
[1]
Die Abkürzungen beziehen sich auf die Auswahlbibliographie S. 295
»In der Richtung des Lebens«
Man wird Zeuge von Geburtsvorgängen in Musils Werk. Die Wirklichkeit der Texte wird erst; sie winden sich aus dem Fragmentarischen los, sie begründen das Konkrete durch Bilder. »Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Russland führt.« So beginnt der Törleß, ein unvollständiger Satz, ein Bild. »An einem Zaun.« So beginnt Tonka. »Ein Vogel sang. Die Sonne war dann schon irgendwo hinter den Büschen. Der Vogel schwieg. Es war Abend.«
Mühsam stolpern die Texte in zusammenhängende Sätze.
Man wohnt der Entstehung der erzählerischen Logik bei, ein raumzeitliches Kontinuum bildet sich heraus, allmählich kennt man sich aus: Nachdem dies geschehen war, geschah das Folgende. Die Selbstverständlichkeit des Erzählens ist für Musil nicht durch die Tatsache gewährleistet, dass es Literatur gibt. So begründen die Texte ihre eigene Legitimation oft durch die Art, in der sie sich vom unmittelbaren Erleben abspalten. Sie bilden sich am fragmentarischen Charakter unserer Erfahrung selbst heraus, sie reproduzieren die asyntaktische Logik unserer Wahrnehmung, sie gewinnen ihre Ordnung, ihren Anfang, ihre Richtung erst im Verlauf ihres Erzählens.
Oft wird auf geradezu hypnotische Weise in Musils Werk jener Moment fixiert, in dem eine Geschichte beginnt. Alle möglichen Charaktere von Anfängen kennt dieses Werk: Anfänge, die im Vergessenen liegen und erst mühsam der Erinnerung entrissen werden müssen; Anfänge, die im Vorsprachlichen liegen und nur aus Spannung, Druck und Dichte bestehen; Anfänge, die sich an der tieferen Unbestimmbarkeit alles Konkreten entzünden, oder solche, die die Sprache schlicht abschütteln.
In diesen Anfängen setzt sich zeichenhaft die Signatur des Anlasses durch, aus dem die Gestalt des Textes schließlich hervorgetrieben wird. Der Anlass hat eine doppelte Form: Er erscheint in einer Irritation der unmittelbaren Erfahrung und in der konzisen Gestalt jener »Botschaft«, die der Text in der Idee gewonnen hat. Unmittelbare Erfahrung wirkt aber in dem Augenblick irritierend, in dem sie ihre Unmittelbarkeit einbüßt und literarisch produktiv wird. In diesem Moment jedoch liegt der Auslöser dafür, das Unmittelbare zu vermitteln, zu objektivieren und zu manifestieren, und so suchen Musils Texte auch in ihren Binnenanfangen oft die Störung im Bereich des reinen Erlebens, den Impuls ihrer Entstehung. In diesem Moment begründen sie zugleich die gedankliche Schürzung, den Ausblick auf den »Gehalt«. Sie haben deshalb zwei Grenzen und kommen zwischen zwei Grenzen zu stehen. Die eine liegt in der Totalität der Erfahrung, die nicht ausgesprochen, die andere in der Kristallisation des Sinns, der im Leben nicht umgesetzt werden kann.
Musils Texte beginnen deshalb oft mit Aussagen, in denen die Abspaltung vom konventionellen Erleben zugleich den Sinn einer veränderten Organisation des Wirklichen aufdeckt. Sie tun der alltagspraktischen Orientierung Gewalt an. Ihre Eingrenzungen auf Bilder, beliebige Details oder unscharf verbürgte Vorgänge reproduzieren den produktiven Impuls, die Irritation.
Die Literatur ist eine unpraktische Lebensform. Sie ist gewalttätig in der Art, in der sie dem soliden begrifflichen Denken und Erleben die Existenzbedingungen entzieht, um diese zu zerstören. Sie ist konstruktiv in jenen Bildern, die sie als Bestandteile ihrer Zerstörung präsentiert.
Die Momente der Geburtsvorgänge in Musils Werk bilden die Bestandteile einer ästhetischen Schöpfungsgeschichte. In der Erfahrung erneuert sich das Selbstbewusstsein und in ihm jede Verhältnisbestimmung zum äußerlich Gegebenen. Das Ich fühlt sich gesteigert, Fülle stellt sich ein, in die Form dringt ein Übermaß, in einem namenlosen Zuwachs des Intensiven wird das Ich selbst passiv, die Schöpfung aktiv. Kein größerer Erzähltext Musils kommt ohne diese euphorischen Entgrenzungserlebnisse aus. Hier verschwimmen die Konturen, die Sätze sagen nicht mehr aus, sondern sie verweisen, die Bewegung verliert ihre Inhalte und ist erst so ganz bei sich. Hier ist alles Fluss, Druck, Verhältnis, Hitze, Farbe und Atmosphäre; die Bestimmtheit des Syntagmas, des Wortes, der Wortverbindungen, des Satzes tritt an Grenzen und über sie hinaus. Hier schreibt Musil seine Sprache als eine Demarkationslinie gegenüber dem Chaos, dem Amorphen, Stummen und selbst dem Unsinn. An diese Grenze aber folgt die Sprache nur einer Erregung, die selbst poetisch ist und die, wie es so oft in programmatischen Texten Musils heißt, die Dichtung eigentlich erst begründet.
Die Geburt der Dichtung findet danach in einer Erregung statt, in einer akausalen Reizung und Erschütterung, in der das Verhältnis des Ich zur Welt noch ganz aus Unmittelbarkeit und Spontaneität besteht und keine Norm und Form angenommen hat. Zu dieser Erregung kehrt bei Musil die Dichtung immer wieder zurück, und zwar nicht nur, weil sie selbst aus dieser innigsten Selbstberührung all ihre Formen hervortreibt, sondern weil sie in der verwirrten Einheit dieser reinen Affektivität das ästhetische Verhalten zur Wirklichkeit eigentlich vorfindet. In zwei Stadien ist das Ich zunächst ästhetisches Ich: in dem des Kindes und in dem des vorzivilisatorischen Wilden. Dieses Verhältnis erneuert sich in jeder Wiedergeburt reiner Unmittelbarkeit, in Momenten lebenspraktischer Entrückung und Erhebung.
Die Sprache der Dichtung stammt aus dem Amorphen, wie Musil vielfach völkerpsychologisch, mythisch, magisch, mystisch zu belegen sucht, und sie tendiert dorthin zurück. Wenn man den Prozess begleitet, in dem sich die Sprache zum Impuls ihrer ersten ästhetischen Reizung zurückbewegt, dann erhält man zugleich einen Blick in die Wirkungsgesetze der poetischen Produktion. Man erkennt, in welchem Ausmaß jedes Erscheinungsbild des Wirklichen, das der Text in konsistenter Form anbietet, einen poetischen Prozess repräsentiert. Die Geschichte der Dinge ist zunächst weder biographische Anamnesis noch Wiederkunft des Vergessenen, sondern sie liegt in der augenblickshaften Erfahrbarkeit des Gegenstands als Zeichen, als Symbol, als Abkürzung oder als euphorische Bedeutung.
In diesem Prozess bringt sich die Dichtung selbst hervor, und da der emphatische Dichtungsbegriff, jener, der die gesamte alogische Konzeption des literarischen Panoramas bestimmt, antikonventionalistisch ist, tritt das Bild der Geburt in Musils Werk vornehmlich in der Form der Sprengung auf. Dreimal spricht Musil allein in seinen Ansätzen zu neuer Ästhetik von der Aufgabe des Dichters zu sprengen: Und zwar »die Formel der Erfahrung«, die Form des normalen Totalerlebnisses, die »Formelhaftigkeit des Daseins« (P 1145ff.); im Tagebuch ist sogar von der Sprengung des ganzen praktischen Lebens die Rede (Tb 479).
Die Gewalt des Bildes ist der der Erfahrung nachgebildet: Die Sprengung hat ihren Sinn nicht in dem Blick, den sie freigibt, sondern in sich selbst, im Vorgang der Lösung und Befreiung, zu dessen Medium die Dichtung wird. In dieser Situation aber bleibt der Inbegriff der Dichtung selbst mythisch: Das primitive Denken verlegte die Seele nach außen, die Wirklichkeit erschien ihr dämonisch. Erst mit der Ausgrenzung des Selbstbewusstseins aus der Natur entstehen die Normensysteme der sozialen Verfassung: Moral statt Ethik[1], Sprache statt Suggestion, Erkenntnis statt Partizipation. Exakt in dieser Trennung entsteht aber auch die Dichtung, zunächst als Manifestation des Mythos, sodann als Organon auch der Naturbeherrschung.
Es ist zunächst von sekundärer Bedeutung, ob diese Beschreibung geschichtsphilosophische Relevanz hat, entscheidend bleibt die Form, in der der mythische Zustand literarisch avisiert wird. Die Ursprungsphantasien Musils treiben das Bild der Schöpfung als Utopie hervor. Diese Utopie ist Chaos und zugleich produktives Chaos, sie kennt keine Gesten der Naturbeherrschung. Die infinitesimale Annäherung der Sprache an den ersten ästhetischen Impuls assoziiert zugleich den Zustand, in dem das Ich zur unmittelbaren Einheit mit der Natur verschmelzen könnte. Insofern enthält die originäre einzelne Reizung, wo sie sich ganz aus der lebenspraktischen Normierung löst, bereits den Keim der Bilder vollendeter ästhetischer Totalität.
Wo Musil von »Sprengung« spricht, erscheint das Bild einer zweiten Natur, die von der Präsenz fortgesetzter Zeugung bestimmt wird. Zeugung, Schöpfung und Geburt bleiben zentrale Begriffe für Musils Dichtungsbegriff. Dichtung macht fruchtbar: Unter diesem Blick erscheint die Natur als eine außersoziale Dimension. Musils Euphorien und Entgrenzungszustände produzieren eine entvölkerte Wirklichkeit. Sie haben zum Beispiel mit Frauen zu tun, aber sie verlieren die Frau im Augenblick, da die utopische Erfahrung als Partizipationsphänomen auftritt. Diese Verschmelzung rafft die Kategorie des Sozialen in sich hinein; es existiert nicht mehr, wo die Totalität des Teilhabens keinen Widerstand mehr findet und keine Unterstützung mehr braucht. Die zahlreichen Formen der Parallelisierung von Kindheit und Utopie beziehen sich in Musils Werk demzufolge meist auf die Struktur der instabilen Welt dieser Kindheit, auf die Geburt und darüber hinaus auf die ästhetische Idee eines fiktiven pränatalen Zustands.
Vier Jahre vor Robert Musils Geburt, am 6. November 1880, verloren seine Eltern ein knapp einjähriges Töchterchen, das sie auf den Namen Elsa getauft hatten. Robert war das zweite und letzte Kind. Die Utopie der Kindheit bleibt im Werk ziemlich frei von der unmittelbaren Anschauung des Biographischen, sie ist ein literarischer Topos, der, gestützt durch erfahrungswissenschaftliche Dokumente, seinen ästhetischen Stellenwert behauptet, ohne viele Anklänge an die authentischen Kindheitserfahrungen zu zeigen. Diese liegen vor allem im Frühwerk, und sie setzen sich dort mit weitgehend negativen Implikationen durch.
Vor allem zwei motivische Komplexe sind es, die in diesem Frühwerk immer wieder auftauchen und die im Spätwerk stark zurücktreten oder verschwinden: Es ist der Einsamkeitstopos und der der »Nerven«. Die lebensgeschichtliche Einsamkeit des jungen Musil hat zahlreiche Begründungen. Allein in den ersten 18 Jahren seines Lebens musste er seinen Wohnort siebenmal wechseln. Dazu war die häusliche Situation, in die er hineinwuchs, nicht nur die der Kleinstfamilie, sie war zudem nicht mehr in dem Maße bürgerlich, das man bei dem konservativen Ingenieur Alfred Musil und seiner Frau Hermine erwarten könnte.
1881 befreunden sich die Eltern im böhmischen Komotau mit einem Mann namens Heinrich Reiter, der zum Geliebten von Musils Mutter avanciert und in dieser Eigenschaft auch vom Vater geduldet wird. Musil hat seiner in Tonka unter dem Namen »Onkel Hyazinth« gedacht. Dort sitzt der Junge mit der Mutter und dem Onkel in einem Eisenbahncoupé; im Halbschatten seiner übermüdeten Wahrnehmung erkennt er mehrmals, wie sich ihre Körper gegeneinanderlehnen, kann aber keine Gewissheit gewinnen. Wo Reiter in Musils Werk erscheint, da umgibt ihn das Fluidum einer reservierten Animosität des Autors, die sicher eher auf Eifersucht als auf empörte Sittlichkeit zurückzuführen ist. Musil sah sich selbst einmal als Geliebten der Mutter, bezeichnenderweise in einer Notiz, in der er Herma Dietz – seine frühe Geliebte und das Vorbild für Tonka – mit dieser vergleicht und feststellt, die Mutter hätte besser zu ihm gepasst. Gerade in Tonka taucht nun dieser dubiose »Onkel Hyazinth« als Personifikation der Bigotterie auf, ein Antitypus, dem Musil darüber hinaus die Züge des populären »Großschriftstellers« verleiht, der die eigenen süffigen literarischen Ideale durch seine Biographie kompromittiert.
Zieht man aber die Eifersucht des Autors einmal ab, so bleibt bemerkenswert an Heinrich Reiter, dass seine Erscheinung für Musil früh den Bezirk bürgerlicher Familienvorstellungen sprengt; auch so erscheint er in Tonka: Alfred Musil, so hat der Sohn selbst suggeriert, war von zu weichem Naturell; seine Frau hatte, nach Aussagen von Freunden, noch andere Geliebte neben Reiter. Spät notiert Musil im Tagebuch: »Mein Vater war sehr klar, meine Mutter war eigentümlich verwirrt. Wie verschlafenes Haar auf einem hübschen Gesicht.« (Tb 914) Der Vater, ein Abkömmling von Bauern, galt dem Sohn als stoisch, etwas ängstlich, aber ganz ohne Todesfurcht. Er putzte dem Sohn lieber die Schuhe, als dass er sie sich hätte putzen lassen, er weichte die Rute ein, um ihre Wucht zu mildern, bevor er Robert schlug. Musils Vater stieg mit bemerkenswerter Geradlinigkeit zum Professor für Maschinenbau auf, 1917 wurde ihm der erbliche Adel verliehen. Reiter wurde ebenfalls Professor auf mechanisch-technischem Gebiet, er ließ sich nach dem Umzug der Musils nach Brünn gleichfalls dorthin versetzen, begleitete die Familie regelmäßig auf Ferienreisen, sollte sogar eine Wohnung mit ihnen teilen und wachte an Hermine Musils Krankenbett in ihren letzten Tagen.
Das Bürgerliche war somit für Musil durch die Abwesenheit anderer Menschen einerseits, durch die Hinfälligkeit eines konsistenten sozialen Gefüges andererseits charakterisiert. Fremdheit und gesellschaftliche Exterritorialität bilden zwei Konstanten seiner frühen Jahre, und sowenig Musils Erinnerungen auch in diese Frühzeit hineinreichen, so gesättigt erscheint doch die Atmosphäre dieser Kindheit von der Melancholie der Vereinzelung.
In auffälliger Weise setzt sich diese im Frühwerk als existenzielle Kategorie durch. Der Blick der völligen Isolation präsentiert Natur und Gesellschaft in prinzipieller Gleichordnung. Die Bildlichkeit dieses Verhältnisses reicht von der hermetischen Isolation Monsieur le Vivisecteurs im Eise – damit setzt um 1899 das Tagebuch ein – über die Existenzsituation des jungen Törleß bis zu jener programmatischen Bestimmung aus dem Jahr 1918, in der es vom Dichter heißt: »Man könnte ihn beschreiben als den Menschen, dem die rettungslose Einsamkeit des Ich in der Welt und zwischen den Menschen am stärksten zu Bewusstsein kommt.« (P 1026)
Die Einsamkeit, der Musil anthropologische, soziologische, ontologische Begründungen gibt, strahlt als philosophische Größe auch zurück aus den Schriften, die den jungen Musil stark beeindrucken werden: aus denjenigen Emersons und Maeterlincks. Wo Emerson sich jedoch um eine Lebensphilosophie bemüht, die immer wieder Berührungspunkte mit Nietzsche zeigt, da versenkt sich Maeterlincks Apologie des Schweigens, der »unsichtbaren Güte«, der »inneren Schönheit« und des »tiefen Lebens« in die leere Unendlichkeit einer Spekulation, die Musil später als »gebatikte Metaphysik« (P 1643) bezeichnete und durch Diotima im Mann ohne Eigenschaften ironisierte. Dennoch bildet diese Linie der Populärphilosophie des Fin de Siècle sicher eine Quelle der späteren Existenzphilosophie, in die auch der Expressionismus, wenn auch auf anderen Grundlagen, einfließen sollte. Es wirkt über weite Passagen erstaunlich, wie sehr sich die existenziellen Bilder bei Maeterlinck und Camus gleichen.
Musil zweigt aus dieser Linie bei aller Zuträgerschaft früh und schon deshalb ab, weil er zu einer polyperspektivischen Sicht der Einsamkeit gelangt und sie bereits im Törleß, aber auch im Tagebuch zugleich als erkenntnistheoretische Größe zu erfassen weiß. Wo hier noch in sentimentaler Manier die Unversöhnlichkeit von Ich und Welt zur Klage wird, stehen im Roman bereits die Koordinaten, zwischen denen Musil später seinen Begriff der Entfremdung wie auch den psychophysischen Monismus Ernst Machs platzieren wird. Insofern schließt der frühe Begriff der Einsamkeit bereits einen Befund ein, der von Musil später auf erkenntnistheoretischer und soziologischer Basis neu begründet werden sollte.
Der zweite verbreitete Terminus des Frühwerks, der später ganz zurücktreten wird, ist der der Nerven. In den Blättern aus dem Nachtbuch des monsieur le vivisecteur, mit denen das Tagebuch einsetzt, ist es vor allem das »Leben der Nerven«, das der Schreibende pflegt und beobachtet. Auch hier tritt aus der Pose des analytischen Dekadents die Erscheinung des Kindes: »Ich trete ans Fenster um meinen Nerven die schaurige Lust der Isolation wieder einzuflößen.« (Tb 2) Die Merkmale der Kindheit zeigen sich, indem eine Situation beschworen wird, durch die Musil einmal die Grundbefindlichkeit seiner frühen Jahre bezeichnet hat: den Kindheitszug, dieses einsame Brüten am Fenster. Dass sich Monsieur le Vivisecteur auf die Nerven beruft, verweist nicht nur auf einen Terminus technicus der Fin-de-Siècle-Nervenkunst, es assoziiert über die stereotype Kindheitssituation auch die sensitive Labilität des jungen Musil. Bereits in den ersten beiden Grundschuljahren musste dieser verschiedentlich für längere Zeit wegen einer »Nerven- und Gehirnkrankheit« aus der Schule genommen werden. Bezeichnenderweise erscheint in den Vivisecteur-Fragmenten die ästhetische Huldigung an die Nerven zum Teil in der Fensterszenerie der Kindheit, und sie bleibt, zumindest in diesem Strang, ein Musil’scher Topos: Auch Ulrich zeigt sich dem Leser zum ersten Mal am Fenster stehend, isoliert und distanziert, Distanz als Lebensgefühl beschreibend. Immer wieder erscheint auch im übrigen Werk die Glasscheibe als Demarkationslinie zwischen dem gegebenen und dem »anderen« Leben, dem gespenstischen Leben der Literatur.
Die Gestalt, die da hinaussieht, die das Bewusstsein der Scheidung selbst ist und es im Werk manifestiert, ist schon Dichter. Die Literatur greift in solchen Selbstbeschreibungen nach ihrem Schöpfer, sie symbolisiert in der Situation die eigenen Bedingungen und platziert in ihrer Mitte das produktive Bewusstsein. Sein »eigener Historiker sein zu können«, dadurch »sich selbst Gesellschaft« zu leisten (Tb 3) – in diesen Wendungen greift die Kunstfigur zur literarischen Artikulation, um die eigene Künstlichkeit zu durchbrechen, und es entsteht die Literatur.
Erst im Augenblick, da sich Musil als hermetisch eingeschlossener Einzelmensch transzendiert, wird er literarisch und sich selbst zur Literatur. Deshalb enthalten die frühen Vivisecteur-Fragmente des Tagebuchs in ihrer analytischen Romantik das Leben nur negativ, in einer verdrängten, abgespaltenen Form, und auch die Literatur selbst erscheint hier nur negativ, als eine kommunikative Anstrengung, die das Bild der selbsterrichteten Isolation redend zu sprengen sucht. Dieser Sprengungsvorgang tritt nun abermals mit dem Topos der Geburt auf, und es bleibt ein Grundmotiv des Musil’schen Werks, dass die Begründung des Lebens mit der der Literatur Hand in Hand geht.
Die stilisierte Fremdheit der Kulisse in den frühesten Texten und auch die Verfremdungen im späteren Werk bezeichnen immer wieder einen Schauplatz außerhalb des Lebens. Musil hat den globalen Begriff des »Lebens« oft verwendet, und er hat ihm eine eindeutige Bestimmung gegeben. Dieses »Leben« bildet für ihn den letzten Rückhalt dessen, was man Konvention nennt, er ist das Apriori jeder Wahrnehmung, jeder Bewegung, jedes Eintretens in die Welt der Kausalität. Sämtliche Ordnungsprinzipien der sozialen Wirklichkeit fußen auf jener ersten Orientierungslogik, die mit der Anerkennung der Tatsache des Lebens und seiner Einrichtung gegeben ist. Es sind nicht nur die utopischen Bewegungen in Musils Werk, die ins Fremde oder Anorganische oder Vorbewusste drängen, es ist nicht der Freud’sche Thanatos, der sich grundsätzlich durchsetzt, wo Musil einen Lebensstillstand fixiert, aus dem sich in Bildern der Geburt die Existenz noch einmal, in einer bewussten Neubegründung, herausschält. Das innovatorische Moment des Musil’schen Werks liegt in der Form, in der es moralisch, politisch, sozial, ästhetisch die Neubestimmung des Wirklichen aus dem Schöpfungszustand gewinnt. Der Begriff des Lebens bildet dabei die erste Erstarrungsform des Bewusstseins.
Schon in der Art, in der wir ihn anerkennen, legen wir unser ästhetisches Verhältnis zur Wirklichkeit und damit partiell auch unser moralisches fest. Das Leben, das Gottfried Benn 1955 den »Letzte[n] Glaubenshalt des augenblicklichen, unseres Kulturkreises«, ein »Residuum des biologischen neunzehnten Jahrhunderts«, einen »Ordnungs- und Grundbegriff« nannte, »vor dem alles haltmachte«, den »Abgrund, in den sich alles trotz sonstiger Wertverwahrlosung blindlings hinabwirft, sich beieinander findet und ergriffen schweigt«[1], dieses Leben ist nicht allein der Inbegriff der Konvention, es ist auch ein sittliches Massiv.
Spätestens mit der Versittlichung des Tragischen bei Lessing und Corneille ist die Anerkennung der moralischen Indifferenz des Lebens einer positiven Bewertung der bloßen Tatsache des Existierens gewichen. Dass gelebt wird, ist gut, so lautet die vitalistische Doktrin des aufgeklärten Abendlands, die von einzelnen Werken nur augenblickshaft unterbrochen wird. Es bedurfte des expressionistischen Vitalismus im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, um hier eine Revision einzuleiten, die nicht zufällig mit den Insignien des Archaischen, Pseudomythischen oder Antiken auftritt. Die moralische Indifferenz des Lebens, von Nietzsche ausgesprochen, kommt in der Literatur nun gerade in Phänomenen ans Licht, in denen sich das Tragische zersetzt. Indifferent wie die moralische Natur des Menschen ist auch die Tatsache seiner Existenz. Möglich, dass Musil der Erste war, der dieser Erkenntnis eine ästhetische Formulierung gab, in der der Wert des Lebens selbst zu einer Formbestimmung verbleicht.
Der Gedanke der Schöpfung, der sein gesamtes Werk immer wieder positiv bestimmt, fußt also auf einer Zerstörung, die diese Schöpfung bedingt. Sadismus und Hingabe treiben sich wechselseitig hervor. In der Absage an den Bauwillen und an seine Objektivationen enthüllt sich das destruktive Prinzip einer Erfahrung, die als zweite Natur eine ewig variable Vorstellung vom Leben produziert. So manifestiert sich in der Literatur ein Schöpfungsprinzip, das sich der Notwendigkeit der bestimmten Wirklichkeit ebenso wenig unterwirft wie einer positiven Bestimmung der Tatsache der Existenz.
Einmal geht Ulrich im Mann ohne Eigenschaften durch die diffuse Stilkakophonie seines Schlösschens, und er empfindet: »Alle diese Olinien, Kreuzlinien, Geraden, Schwünge und Geflechte, aus denen sich eine Wohnungseinrichtung zusammensetzt und die sich um ihn angehäuft hatten, waren weder Natur noch innere Notwendigkeit, sondern starrten bis ins Einzelne von barocker Überüppigkeit. Der Strom und Herzschlag, der beständig durch alle Dinge unserer Umgebung fließt, hatte einen Augenblick ausgesetzt. Ich bin nur zufällig, feixte die Notwendigkeit; ich sehe nicht wesentlich anders aus als das Gesicht eines Lupuskranken, wenn man mich ohne Vorurteil betrachtet, gestand die Schönheit. Im Grunde gehörte gar nicht viel dazu; ein Firnis war abgefallen, eine Suggestion hatte sich gelöst, ein Zug von Gewohnheit, Erwartung und Spannung war abgerissen, ein fließendes, geheimes Gleichgewicht zwischen Gefühl und Welt war eine Sekunde lang beunruhigt worden. Alles, was man fühlt und tut, geschieht irgendwie ›in der Richtung des Lebens‹, und die kleinste Bewegung aus dieser Richtung hinaus ist schwer oder erschreckend.« (MoE 128)
Die Durchbrechung bildet das Medium der Literatur, sie ist, Musils Bestimmung zufolge, das eigentlich dichterische Moment, der Punkt der poetischen Identität. Sowenig die Dichtung jedoch in der Dauererregung ihres Schöpfungspotenzials existieren kann, so wenig beharrt auch das Bewusstsein, wo es denkt und handelt, auf der Kontinuität der Durchbrechung. So führen die Schöpfungsmomente im Werk zurück in die Wirklichkeit des Habituellen. Auch Musils Ekstatiker und Musils Erzähler gewöhnen sich wieder an das Leben, nachdem sie es einmal im Zustand atomistischer Auflösung erfahren haben. Die Wirklichkeit entsteht ihnen noch einmal, aber nicht mehr präzise in der Form, in der sie sie zurückgelassen haben, sondern unter der Perspektive der Veränderbarkeit, im Zustand einer grenzenlosen Möglichkeit.
Diese Wirklichkeit steht unter dem Gesetz der Anamnese. Sie wird ebenso wiedererkannt, wie die schöpferische Welt der Entrückung wiedererkannt wurde. Beide, die lebenspraktisch orientierte und die sprengende Wahrnehmung, beziehen sich auf Grundstrukturen der Erfahrung, die Musil in zwei geschichtlichen Entwicklungslinien rekonstruiert hat. Seine Dichtung ist exakt, nicht nur, wo sie aus der starren Wirklichkeit die schwebende Logik der Euphorie entwickelt, sondern auch, wo sie den Prozess darstellt, in dem das liquide Element der »anderen« Erfahrung in die Orientierungslogik alltagspraktischer Vollzüge zurückfließt.
So ist die Gewinnung der Tatsächlichkeit des Lebens in Musils Werk außerordentlich vielschichtig: Er gewinnt das Leben als Begriff, das Leben als bestimmten Inhalt und schließlich das Leben als individuelle Geschichte, und erst hier entstehen Autobiographik und Autobiographie als letzte Emanationen des Wirklichkeitssinnes. Er muss sich in seinem Werk an das eigene Leben erst gewöhnen – das verleiht den euphorischen Sensationen ihre frühkindliche Perspektive, das erhellt die kindliche Motivik dieser Erfahrungen. Das Kind steht hier vor der festen Welt und vor der Anerkennung seiner eigenen Geschichtlichkeit und Musil selbst vor der Notwendigkeit und Wirklichkeit dessen, was seine eigene Biographie bedeutet.
In einer Prosaskizze, die er um 1908 verfasste und der er den Titel P.A. und die Tänzerin gab, vermischen sich diese Elemente zur Einheit eines Erinnerungsprogramms. Ein Herr sitzt im Varieté. Die Gestalt einer Tänzerin weckt seine Erinnerung. Wieder ist Kindheit: »Wie war es? Ich habe mich manchmal nach einem Glas Wasser gesehnt, wenn ich mich aber am tiefsten nach einer Geliebten sehnte, wollte ich keine wirkliche. Ich sah nicht plötzlich ein neues Ziel, ich sah überhaupt kein Ziel, aber ich wurde von einer stärkeren, herrlicheren, fremden Art der Erwartung durchströmt wie ein leeres leuchtendes Zimmer und man glaubt, es muss etwas eintreten. Man fühlt eine Wunderbarkeit des Empfangens, zu der es nichts Wirkliches gibt, das man empfangen könnte … Die Tänzerin lockte seine Erinnerungen wie leises heißes Lampensummen langsam in seinen Gliedern empor. Die mit dem Geruch und dem Herzklopfen stammte von einem Zirkus in der Stadt Steyr in Oberösterreich. Er war damals ein kleiner Bub […].« (P 712) Hier weist alles ins Autobiographische: Mama, der frühe Eros und die unfeste Welt der auratisch umflossenen Gegenstände. Die Texte drängen dorthin ebenso, wie Ulrich mit der Zwillingsschwester in die frühkindlichen Erinnerungen drängt. Wo sie ankommen, ist ein Stück Autobiographie gewonnen, die Ursprünge liegen frei, das eigene Leben kann beginnen.
Fußnoten
[1]
»Moral« meint bei Musil meist, abweichend von der strafrechtlichen Bedeutung des Begriffs, das gesellschaftlich codierte Wertesystem, »Ethik« den Zusammenhang individueller oder selbst gesetzter Werte.
Kleine Frauen, große Frauen
Musil hat sich im Verlauf seines Lebens immer wieder Aufzeichnungen zu einer Autobiographie gemacht – die frühesten im Tagebuch-Heft Nr. 3, das er etwa ab 1899, die spätesten im Heft Nr. 33, das er zwischen 1937 und dem Ende des Jahres 1941 führte. Dazwischen liegen zahlreiche Versuche zu einem autobiographischen Roman, der zunächst »Der Bibliothekar«, später »Der Archivar« heißen sollte. Diese autobiographischen Aufzeichnungen nehmen ihren Ausgang häufig bei erotischen Bildern. Deutlich wird das ästhetische Potenzial der Begriffe »Schöpfung« und »Zeugung« mobilisiert, deutlich werden beide Bereiche miteinander parallelisiert. Die appetitartigen Impulse des jungen Musil zeigen sich – wenn man den Selbstbeschreibungen glauben darf – also in einer erotischen Aneignung des Wirklichen, der Musil später durchaus narzisstische Deutungen gab. In seiner Datentabelle aus dem Jahr 1922 nennt der 1880 geborene Musil die Periode von 1884 bis 1890 »sex bewegt – romantisch« (P 938), andere Notizen zur Autobiographie setzen unmittelbar bei erotischen Erlebnissen ein.
Vergleicht man die über das ganze Leben verstreuten Notizen zur Kindheit, so sieht man, wie ein Bewusstsein die Anfänge der eigenen Geschichte mühsam zusammensetzt. Am Anfang steht ein literarisches Bild, das Musil anonym während des Ersten Weltkrieges in der Soldatenzeitung veröffentlichte: »Einer der dunkelsten Punkte im Leben des Menschen ist die Geburt. Nichts weiß man davon, als dass eingehüllt von urweltlichen Massen etwas Quiekendes, Blaurotes, wie eine Wursthaut Glänzendes mit fessellosem Wehgebrüll in die Welt gestoßen wird« (LWW 265). Wo Musil sich der eigenen Person erinnert, fehlt zunächst jede Kontinuität. Er, der sich bewusst war, die Dinge in Sachverhalten und Bedeutungszusammenhängen aufzufassen, sich daher an keine Einzelheiten zu erinnern und aus diesem Grunde »so schwer« zu schreiben (Tb 314), gewinnt die Gestalten seiner Kindheit aus der sinnlichen Aneignung, zunächst aus dem Geruch: »Mein ältestes Wissen betrifft meine Kinderfrau. Sie hieß Berta […] Wenn ich an sie denke, ist mir, als ob ich sie riehen würde. Ein gutmütiger trockener Schweißgeruch wie er an nicht zu oft und nicht zu selten gewechselten Kleidern haftet. Ich muss damals etwa 4 bis 6 Jahre alt gewesen sein.« (Tb 314)
Die zweite Geruchserinnerung, die er notiert, bezieht sich auf das »Chinchillapelzwerk meiner Mutter«: »Ich glaube, dass in diese Erinnerung etwas Geschlechtliches gemischt ist, obgleich ich mich durchaus nicht an etwas Ähnliches erinnere. Nach der Färbung der Erinnerung an den Pelz müsste es ein Begehren gewesen sein.« (Tb 314)
Nachvollziehbar bleibt in allen Aufzeichnungen, die sich auf diese Zeit beziehen, wie sich die exakte sinnliche Intelligenz des jungen Musil synchron zur Beobachtung der Verbote entwickelt, die sich um die einzelnen Wahrnehmungen gruppierten. Die Furcht vor der körperlichen Sünde, die Vorstellung der elterlichen Geschlechtsteile, die dem Jungen »entsetzlich« war, der sexual-hygienische »Terror« (Tb 314) der Mutter – sie erotisieren die kindliche Erfahrung im selben Maße, in dem sie diese erotische Erfahrung in sphärische Details zusammendrängen. Die erotische Biographie bildet sich aus diesen Nebeln erst allmählich und in schockhaften Bildern heraus. In einem Schwimmbad sieht Musil die über 40-jährige Mutter für einen Augenblick nackt, »sehr weiß und voll und schön gebaut«. Trotz einer gewissen Anerkennung, die er dabei für ihre Schönheit empfindet, durchfährt ihn ein »schamhafte[s] und ich glaube zornige[s] Entsetzen« (Tb 315) vor dem Bild: Das Verbot präsentiert Eros als Schock.
In der nächsten Episode, die die autobiographischen Notizen regelmäßig in der Sequenz der frühen erotischen Erinnerungen aufruft, wird Musil selbst zum Opfer des Verbots. Im Vorschulalter entführt er ein kleines Mädchen, Carla R., aus dem Kindergarten. Noch sehr viel später soll er, Gustav Donath zufolge, diese frühe Liebe als »etwas Unberührbares«[1] gehütet haben. Noch in dem letzten autobiographischen Tagebuch setzt er mit diesem Erlebnis ein Abzweigen aus der bis zu Martha Musil reichenden Linie der stärker altruistischen Liebesverhältnisse an. In der Entführung schlug sich dagegen ein Narzissmus nieder, der auch die Liebe zu den eigenen Kleidern, zur Selbststilisierung in literarischen Gestalten, der die abergläubische Bewertung Einzelner mit der eigenen Person verbundener Zahlen mitbestimmte.
Die Struktur der Kindheitserinnerung in Musils Werk zeigt immer wieder die Merkmale dieser drei Quellen: Der Geruchs- und atmosphärischen Erinnerung, der erotischen oder Verbotserinnerung und der Vergegenwärtigung von Dingen und Zahlen, die sich auf narzisstische Weise dem frühkindlichen Bewusstsein verbanden: eine Eisenbahn, eine kleine Hose, eine Kanone, ein Würfelspiel, eine Rennbahn, ein versprochener und nie erhaltener »Schweißfuchs«, die Glückszahl sechs – der Geburtstag Musils –, die Glückszahl fünf – mit der er einmal im Würfelspiel gewonnen hatte.
In einer früh veröffentlichten Prosaskizze zum Mann ohne Eigenschaften – sie stammt aus dem Jahre 1926 und trägt den Titel Die Entdeckung der Familie – wird offenbar, wie Musil solche Details erzählerisch integriert und welche Verflechtung sie untereinander eingehen. »Es regnet leider! – Kaum klingt, erste Morgenentdeckung nach dem Zurückziehen der Vorhänge, dieses Wort vom Fenster zurück, so verändert sich das ganze Zimmer.« Wieder am Fenster. »Du bist nun bei der Kinderzeit.« Wieder das »Abgesperrtsein von den Gespielen« (MoE 2023). Und nun stellt die Erinnerung die Figuren auf, die Bevölkerung des Lebens aus der Erinnerung greift nach den autobiographischen Details und schachtelt sie ineinander. Diese innere Autobiographie ist substanziell beliebig, ist Stoff im äußerlichsten Sinn, aber sie hat Formbedeutung. Dass eine ästhetische »Veränderung« eintritt, im Augenblick, da der Regen im Bewusstsein erscheint, verleiht den Bildern eine an Marcel Prousts Erinnerungstechnik rührende Qualität. Die Elemente dieser Autobiographie bilden eine Geschichte des Regens. Einmal erfahren und nicht bloß erlebt, wird der Regen zum ästhetischen Kontingent dieser eigenen Geschichte, in der sich Pferde, Rennbahn, Farben, Würfelspiel, Zahlen und Besitzverhältnisse konzentrisch dem Regen zuordnen. Hier wird evident, wie Erfahrung, im emphatischen Sinn, eine Umwertung der Wahrnehmung einleitet und deren Ergebnisse neu arrangiert.
Musil greift wie Proust in den Augenblicken der Präsentation solcher Erlebnisse auf das Material der eigenen Biographie zurück. Nicht nur die sinnliche Substanz der Details bestimmt den Text, sondern zugleich ihre Struktur: Die Zuordnung, Verflechtung, Umwertung, Zentrierung der Erfahrung und die Bewegung, in der die Kindheit in die Kulisse der stabilen Wahrnehmungswelt hineinströmt. Hierin steckt ja nicht nur eine Technik der Darstellung, sondern ein literarisches Programm, das die Geschichtsschreibung in der Struktur der Erfahrung begründet und aus diesem Zusammenhang die Legitimation des Fiktionalen wie die der autobiographischen Formulierung gewinnt.
Die Entstehung der Familie hat aber in diesem Kontext noch die weiterleitende Bedeutung, dass nicht nur das ästhetische Material des Weltaufbaus aus dem begrenzten Radius der kindlichen Erfahrung genommen, sondern dass im selben Prozess zugleich die Erkenntnis des Sozialen begründet wird. Die Festschreibung des frei verfügenden Bewusstseins in einem Ordnungsverhältnis zwischen Menschen etabliert mit dem Rollenbewusstsein zuerst den Begriff des Systems, das die Familie im Kleinen bildet und abbildet. Dieses System besteht nicht aus Macht allein, sondern aus Sprachformen verzweigtester Art: Formen und Gegenständen des Lachens, der Marotte, der Ausgrenzung, der Zustimmung, der Leidartikulation, des Verschweigens und so fort.
Die kindliche Welt, an die sich Musil erinnert, besteht aus liquiden, allmählich starr und fest werdenden Werten, solchen, die irgendwo zwischen herrschaftlichen, autoritativen, atmosphärischen, ethischen Ansprüchen zur Erscheinung kommen und sich zuerst noch gar nicht recht unterscheiden lassen. Wo diese Welt literarisch kopiert wird, tauchen Gestalten aus einer einzigen Handlung, einer Detailansammlung aus nackten Armen, Virginia-Zigarren und einer Bewegung auf. Sie sind so unfest wie das Bewusstsein, das sie heraufholt und nichts anderes von ihnen zu sagen weiß, als die Sprache der narkotischen atmosphärischen Elemente preisgibt.