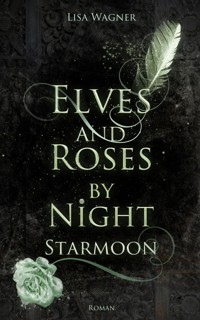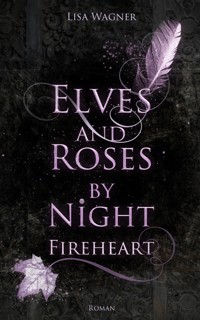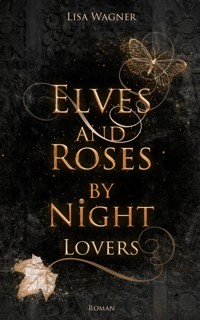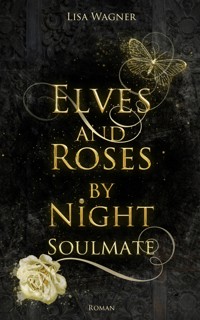Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fast-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Du kannst mir nicht einfach aus dem Weg gehen. Wir gehören zusammen! - Thórvi wusste, dass der wunderschöne Mann vor ihr recht hatte. Er war ihr Seelengefährte und ihr dennoch total fremd. Viel zu sehr hatte sie an ihrem Leben gearbeitet und gekämpft, um das jetzt für ihn aufzugeben. Trotzdem würde sie ihm nicht aus dem Weg gehen können. Niemals! Ausgerechnet dieser Mann brauchte nun ihre Hilfe, um nicht nur sein Volk, sondern auch ihr Eigenes vor einer Katastrophe zu bewahren. Sie mussten sich zusammentun, auch wenn Thórvi am liebsten davongerannt wäre. Könnte sie es schaffen, die Schatten aus ihrer Vergangenheit hinter sich zu lassen? Oder würde sie ihr Herz weiter vor der Wahrheit in ihrem Inneren verschließen? Band 1 der magischen Fire and Souls tonight-Reihe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die Liebe, die uns alle zusammenbringt! Für Shanice! Für Mama! Ich liebe euch sehr!
PERSONEN
Thórvlyn Blackthorn - Tzohrv-lin / Tzhor-wie
Daymón Szinárdín - Dei-men Zienar-den
Thylion Blackthorn - Thü-lion
Thalia Blackthorn - Tzah-lia
Medina Blackthorn - Me-di-na / Me-die
Tobén Blackthorn - Toh-ben
Gildá - Gil-dei
Garrow - Ger-roh
Loóna - Luh-na
Faolán - Fao-len
Rayánne - Rei-en
Philiás - Fili-jäs
Connáh - Kon-nei
Siénah - Zieh-en-nah
Carrán - Kar-rein
Melody - Mel-odie
Ronán - Ruh-nen
Fréya - Frei-jah
Rueth - Ruh-ß
Maéron - Me-ron
Keálas - Kiel-li-es
Endovíer - En-do-wir
Chará - Ka-rah
Deégan - Die-gen
Maghnus - Mag-nuß
Ráihn - Rei-n
Nephíles Szinárdín - Ne-fie-les Zienar-den
Ménelaos Szinárdín - Mieneh-laos Zienar-den
Gréycia - Gries-ja
Édessa - Ih-deßa
Nikósz - Nie-kosch
Dexter - Dex-ter
Hawke - Hoh-k
Séron Dento - Sie-ron Dento
Yvaná - Jieh-wa-nei
Geroh - Gier-roh
Glyn - Glin
Sloan - Slo-ehn
Eydána - Ih-dena
Kasimyr - Ka-si-mür
Méave - Mie-wah
Fhongan - Fon-gahn
Dhjaná - Die-janah
Béal - Bie-hl
Breack - Brie-k
Ínnogen - Ih-no-gien
Cianná - Zie-jan-ie
ORTE
Lyvián - Lüh-wian
Anduvár-Fluss - An-du-wiar
Dragongóul-Berg - Dra-gon-guhl
Elládan-Gebirge - El-ja-den
Thierim - Tzi-rim
Therren - Tzer-ren
Éldem - Iel-dem
Merédyn - Meri-dün
Delhyá - Del-jia
Gréyven - Grie-wen
Nadhíla - Nat-jilah
Tempel Midháan - Mida-an
Warnung!
Die folgenden sexuellen und gewaltverherrlichenden Inhalte können auf Leser/innen verstörend wirken. Bitte denkt immer daran, dass der folgende Inhalt meiner Fantasie entstammt und keine realen Augenblicke zeigt, die ich oder jemand anderes erlebt hat.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Daymón hatte sich immer ein Leben voller Abenteuer und nervenaufreibender Situationen gewünscht. Er war ein aufgeschlossener und begeisterungsfähiger Mann gewesen und hatte sich immer das genommen, was er wollte.
Manchmal auch Dinge, die er lieber in Frieden gelassen hätte. Geld. Alkohol. Frauen. Und von den Frauen hatte er nie genug bekommen. Vor allem scheute er nicht zurück, wenn plötzlich der Ehemann oder Freund in das Zimmer gestürmt kam und er nicht nur einmal eine Faust gegen den Kiefer gehauen bekommen hatte. Diese Abenteuer liebte er mehr als alles andere, doch die Fäuste in seinem Gesicht waren noch das geringere Übel.
Zu oft hatte er den Zorn hochrangiger Lords auf sich gezogen, wenn er mit ihren Frauen eine heiße Nacht verbracht hatte. Er hatte sich bei einigen sogar eine zweite Nacht gegönnt, nur um es noch etwas weiter zu treiben.
Um den Nervenkitzel so richtig auszukosten.
Dass ihm seine Eltern zu gerne das Recht auf den Thron genommen hätten, war ihm mehr als bewusst. Trotz seiner weiteren Eskapaden war in dieser Hinsicht noch immer nichts passiert. Womöglich lag es daran, dass er ein Einzelkind war und niemand sonst sich diesem Schicksal hingeben wollte. Also machte er einfach so weiter wie bisher und störte sich nicht daran, dass er als Frauenheld dargestellt und mit mürrischen Blicken bedacht wurde. Ihm war es schon immer egal gewesen, was andere über ihn dachten. Er war einfach nur Daymón, der arrogante, leidenschaftliche und egoistische Mann.
Die Maske, die er perfektioniert hatte und die alle Augen jeden Tag aufs Neue sehen konnten. Doch ganz tief in ihm versteckt schlummerte sein wahres Ich.
Nicht ohne Grund hatte er seine Eltern darum gebeten, als Botschafter für sein Volk zu fungieren. Die Abenteuerlust war nie aus ihm verschwunden, und dank dieser Aufgabe hatte er etliche Orte bereisen können, ohne groß aufzufallen. Er hatte gehofft, dass ihm das irgendwie in die Karten spielen würde.
Jahrelang war er in seinem Königreich geblieben und hatte dort alle Straßen und Häuser abgesucht. Er hatte die Nacht zum Tag gemacht und manchmal sogar vergessen zu essen. Doch das alles hatte nichts gebracht. Seine Suche war erfolglos geblieben. Es gab niemanden in seinem Volk.
Nichts!
Seine Seelengefährtin war nicht dort und das hatte ihn fast zur Weißglut getrieben. Sie zu finden, war der größte und wichtigste Wunsch, den er in seinem Inneren hegte. Er wollte glücklich sein mit dieser einen Person, die ihm den Atem rauben würde. Die ihm das Herz brechen und auch wieder zusammensetzen könnte.
Er wollte genau das!
Liebe.
Das unbändige Verlangen, nicht von einer Person loszukommen und die Angst zu spüren, wenn man in Gefahr geriet und sich vielleicht nie wieder sehen würde.
Es war so viel komplizierter, als er es sich jemals vorgestellt hatte. Und obwohl er die Möglichkeit hatte, die Welt frei zu bereisen, war er immer noch nicht fündig geworden. Daymón verzweifelte mit jedem Tag mehr und in etlichen einsamen Nächten hatte er sich wieder in unbedeutende Arme verschiedener Frauen gleiten lassen, nur um dieses Verlangen für einen Moment zu stillen.
Für einen Moment zu vergessen.
Doch sein Herz wusste genau, wie es in ihm aussah, und dieser Schmerz - das fehlende Puzzleteil - ließ sich langsam nicht mehr weiter verdrängen. Er war ein aufrichtiger, loyaler und liebenswerter Mann. Auch wenn er es niemanden wissen ließ.
Nur eine Handvoll - darunter seine Eltern - wussten, nach was er strebte und womit er seine wertvolle Zeit wirklich verbrachte. Die Frauengeschichten waren immer nur eine Ablenkung gewesen und manchmal gab es keine aufreizende Frau, die in seinem Bett gelandet war. Manchmal glaubten die Leute einfach das, was man ihnen erzählte oder wovon sie sowieso ausgegangen waren. Seit Monaten hatte er sich nicht mehr vergnügt. Ihm war einfach nicht mehr danach. Irgendetwas hatte sich verändert und er hatte sich von den Frauen abgewandt. Er wollte nicht mehr einfach nur ein unbedeutendes Spielzeug in dem Bett irgendeiner Frau sein. Er wollte in ihrem Bett liegen, ihre nackte Haut auf seiner spüren und sich in ihrem Geruch und ihrer Schönheit verlieren. Doch an seiner Seite war Leere, die er nur durch Lügen und Intrigen weiterhin verstecken konnte.
Ein nervenaufreibendes Spiel mit dem Feuer.
Ein Spiel, welches Daymón perfektioniert hatte. Ein Meister der Maskerade. Prinz Daymón Szinárdín, das größte Arschloch unter dem Meeresvolk.
Er wusste nicht mehr, wie lange er bereits in der versteckten Bucht am nördlichen Ende von Merédyn saß. Der fein geriebene, hellbraune Sand klebte an seinen nassen Händen, den Schultern und kitzelte zwischen den Schuppen seiner Flosse. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, zu einem der Heiler zu gehen, und nach dem Trank zu fragen, der seine Schuppen in Beine verwandeln würde. Daymón hatte nicht vorgehabt an Land zu gehen, doch die warme Sonne, die den Sand ordentlich aufgeheizt hatte, hatte ihn magisch angezogen.
Das dunkelblaue Meer schwappte sanft über seinen Unterkörper, während er sich mit den Ellbogen im Sand abstützte und der langsam untergehenden Sonne zusah, wie sie sich weiter auf den Horizont zu bewegte. Er hatte schon oft hier gesessen, in der unendlichen Stille und sich nur auf das Hier und Jetzt konzentriert. Manchmal brauchte er diese Stille um sich herum.
In seinem Kopf.
Die Sonne schickte ihre letzten warmen Strahlen auf seine Haut und ein wohliges Brummen drang aus seiner Kehle. Er genoss es, obwohl er diesen Anblick wieder einmal allein genießen musste. Er stemmte die Hände in den Sand und ließ die klitzekleinen Körner langsam durch seine Finger gleiten.
Er hatte es wirklich satt.
Und zu seinem Pech schien auch die Stille heute gegen ihn zu sein. Ein Schwarm Möwen kam von Osten auf ihn zugeschossen und flog in rasantem Tempo über seinen Kopf hinweg. Ihr Kreischen war nicht freudig oder musikalisch.
Sie schienen in Panik zu sein. Irgendetwas musste sie aufgeschreckt haben und eine Gänsehaut bildete sich auf Daymóns Armen, als weitere Vogelschwärme an ihm vorbeischossen. Und selbst das Meer vor ihm wand sich gegen etwas, das er bis jetzt noch nicht erkannt hatte. Dicke, kräftige Wellen schwappten an das Ufer und peitschten um seinen Körper.
Sekunden später stemmte er sich auf und ließ sich mit einer schnellen, aber eleganten Bewegung durch die Oberfläche in die Tiefe gleiten. Das Meer war dunkel, doch nicht wegen der bereits untergehenden Sonne.
Nein!
Auch hier versuchten die Meereslebewesen, vor etwas davonzulaufen. Aale schossen in Panik an ihm vorbei, Lachse bildeten größere Gruppen und eine undurchdringbare Wand. Selbst die Rochen suchten Schutz in den dunklen Höhlen unterhalb Merédyns oder buddelten sich am Erdboden unter einer dicken Schicht Sand ein.
Er sah den Schock deutlich in ihren Augen und da war noch etwas mehr. Sie hatten Panik!
Todesangst.
Daymón wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Trotzdem konnte er nicht anders. Er ließ sich langsam in die Richtung gleiten, aus der immer noch weitere Lebewesen angeschossen kamen. Und dann schien die Welt sich aufzubäumen.
Das Wasser vibrierte stärker, als Daymón es jemals zuvor gespürt hatte. Die Fische hielten abrupt inne und versuchten, sich in ihrer Position zu halten. Auch Daymón selbst musste sich stark zusammenreißen, nicht von einer Welle erwischt und herumgewirbelt zu werden.
Das Meer spielte verrückt.
Nein!
Das Wasser selbst versuchte, vor etwas zu fliehen. Immer wilder peitschten die Wogen des sonst so friedlichen Meeres und Daymón gelang es nur mit Mühe, seine Augen offen zu halten. Er war in einem Strudel aus Angst, Zorn und Neugierde gefangen.
Dann brüllte etwas weit vor ihm auf und dieses Geräusch konnte nicht von dieser Welt sein. Das Meer verstummte, die Lebewesen blieben wie angewurzelt stehen und alle Blicke richteten sich nach Osten.
Nach Delhyá, der Schwesterinsel von Merédyn.
Als sich das Meer noch weiter verdunkelte, wusste Daymón, dass er nicht länger warten durfte. Irgendetwas geschah auf Delhyá und er wünschte, er hätte noch Zeit gehabt, nach Verstärkung zu rufen. Doch sein Körper war bereits in Bewegung und sauste so schnell durch die stumme Masse des Meeres, dass er kaum mehr zu erkennen war. Er musste mit eigenen Augen sehen, was diese Unruhe in seiner Heimat hervorrief.
Er schwamm so schnell er konnte, und seine Lungen fingen an zu brennen. Die ganze Situation hatte ihn in einen Schock versetzt und sein Körper rebellierte. Trotzdem schwamm er weiter, ohne auf das Flimmern in seiner Brust zu achten.
Das Gefühl der Hilflosigkeit und Verzweiflung wurde noch größer, als er das Schrecken direkt vor sich erblickte. Er hielt abrupt in seiner Bewegung inne und musste sich dazu zwingen, die Augen direkt darauf zu richten.
Er hatte nie wirklich gewusst, was Delhyá so besonders und wertvoll machte und warum seine Eltern so großes Interesse an dieser unscheinbaren Insel hatten. Doch jetzt ahnte er Böses und ihm wurde mit einem Schlag bewusst, dass er sich mehr in die Interessen seiner Eltern hätte einmischen müssen. Die ganze Zeit hatte er geahnt, dass sie etwas vorhatten. Dass sie den Onyx - einen magischen und mächtigen Stein - nicht nur dazu einsetzen würden, um ihre Armee zu verstärken.
Das hätten sie auch mit einfacheren Mitteln zustande gebracht. Doch es war das, was er nun vor sich sah, woran er nicht eine Sekunde einen Gedanken verschwendet hatte.
Delhyás Sockel, der sich bis in den Abgrund des Meeres bohrte und mit dem felsigen Stein eine Einheit bildete, um die Insel an Ort und Stelle zu halten, war nicht mehr zu erkennen. Eine dicke, schleimige Wolke zog sich aus den Ausläufern der Insel in das Meer und schwebte wie eine schützende Wand um den massiven Sockel. Es war eine Masse, so dunkel und schwarz, wie die Hölle selbst es sein musste.
Ölige Schlieren, die das Wasser um sich herum in Angst und Schrecken versetzten. Daymón konnte nur erahnen, dass dieser Anblick erst der Anfang war und ihn wahrscheinlich noch mehr erwarten würde, wenn er näher heran schwamm. Er wusste nicht, ob es eine gute Idee war und ob er überhaupt versuchen sollte, sich an den öligen Schlieren vorbeizuschleichen. Er war ganz allein und hatte zudem niemandem gesagt, wo er hinwollte.
Er konnte es riskieren, doch was brachte es ihm und seinem Volk, wenn er sich auf einen Kampf einließ, den er womöglich nicht gewinnen konnte? Es war viel zu riskant und doch konnte er nicht einfach tatenlos abwarten. Es war immerhin seine Heimat, die gerade von etwas angegriffen wurde, von dem er noch nie etwas gehört oder gelesen hatte. Am liebsten hätte er geschrien, doch die Wut blieb ihm im Hals stecken. Er schloss die Hände zu Fäusten und sein ganzer Körper verkrampfte sich.
Die dünne Muschelkette um seinen Hals vibrierte auf und ein stetiges Leuchten sendete ein Signal an sein Gehirn, dass ihn jemand rief. Seine Hand schmiegte sich um den gelb leuchtenden Anhänger und sofort hörte er die Stimme in seinem Kopf.
Komm nach Hause. Sofort!
Ménelaos Szinárdín.
König der Meerwesen.
Und sein Vater.
Die wenigen Worte hatten gereicht, um Daymón deutlich zu machen, dass seine Eltern bereits wussten, dass etwas nicht stimmte. Sein Vater war ein starker und furchtloser Meermann, doch in seiner Stimme hatte eine endlose Qual und Verzweiflung mitgeschwungen, die Daymón noch eine weitere Sorgenfalte auf sein makelloses Gesicht zauberte. Und sein Vater hatte ihn nicht gebeten.
Es war ein Befehl.
Auch wenn er sich sonst gerne gegen seinen Vater auflehnte und seine Spielchen mit ihm spielte, hatte Daymón heute kein Interesse daran, auch noch seine Eltern gegen ihn aufzubringen.
Die Verzweiflung seines Vaters hatte noch dazu beigetragen, dass sich seine Angst immer weiter nach oben bahnte und ihn zu verschlucken drohte.
Doch Daymón schwamm.
Er nahm die Abkürzung durch eine schmale Gasse zwischen zwei Steinwänden, die Merédyn mit dem Untergrund verbannt und wegen der er mindesten fünf Minuten Zeit gutmachte.
Vielleicht waren es sogar sechs.
Es war ihm egal. Jede Sekunde zählte.
Als Daymón die kleinen Lichter und die funkelnde Glaskuppel in der Ferne erkannte, die sich über dem Thronsaal aufbäumte, legte er noch einen Zahn zu. Seine türkis-grüne Flosse peitschte unaufhörlich durch das warme Nass und er konnte sich nicht daran erinnern, ob er jemals so schnell gewesen war.
Er hätte Dexter zu gern darum gebeten, die Zeit für ihn zu messen und ihm mit Freude zu verkünden, dass er eine neue Bestzeit aufgestellt hatte. Sie hatten möglicherweise noch andere Tage dafür zeit.
Hoffentlich.
Daymón erreichte die Öffnung, die ihn direkt in den Palast führte. Er hievte sich mit beiden Händen auf den Rand des Beckens und zog sich weiter heraus. Eine Salve aus unzähligen Wassertropfen fiel von der Decke auf seinen Körper hinab und verwandelte seine Schuppen in zwei starke, muskulöse Beine.
Die Dusche der Verwandlung. Oder wie Daymón es immer nannte: das verzauberte Wasser.
Die Heiler hatten diese Technologie entwickelt, damit es für das Volk der Meerwesen leichter war, direkt aus dem Wasser in den Palast zu gelangen, ohne unzählige Minuten - oder sogar Stunden - auf einen der Heiler zu warten, damit er ihnen den Trank geben konnte. Solange sich das Wasser - welches einfach nur mit dem Trank gemischt worden war - auf der Haut befand, konnte man sich nicht mehr in einen Meerjungmann oder eine Meerjungfrau verwandeln. Erst, wenn man sich durch einen der Ausgänge in das Wasser gleiten ließ und damit den Trank von seiner Haut wusch, verwandelten sich die menschlichen Gliedmaßen wieder zurück.
Für Daymón war diese Technologie immer ein Segen gewesen. Er konnte verschwinden und hinschwimmen, wohin er wollte, ohne jemandem etwas davon zu berichten.
Auch jetzt war er froh darüber.
Seine Beine hatten sich schnell an das Gewicht seines Körpers gewöhnt und zum Glück hatte er sich heute Morgen für eine weite Baumwollhose entschieden, die ihm locker um seine Hüfte fiel. Er hatte genug platz, um mit ausladenden Schritten über den Gang und um die nächste Ecke zu schießen. Mit einem lauten Schnaufen stieß er die große Metalltür auf, hinter der sich der Thronsaal in seiner vollen Pracht zeigte.
Niemand war hier.
Keine Wachen.
Keine Lords oder Bedienstete.
Seine Eltern waren allein und ein weiterer Schock durchlief bei ihrem Anblick seinen Körper.
Sein Vater kniete auf dem Boden und hielt seine geliebte Frau in den Armen.
Daymóns Mutter.
Sie war nicht tot, das erkannte er, denn sie hielt ihre Augen offen und strich ihrem Mann zärtlich mit den Fingern über die Wange. Ihre andere Hand hielt sie steif auf ihrem Bauch, ihre Finger so schwarz wie die öligen Schlieren unterhalb von Delhyá. Was hatten sie getan? Waren sie noch ganz bei Trost?
Ménelaos zitterte, während er seiner Frau eine Strähne aus dem Gesicht strich. Daymón hatte ihn noch nie zittern gesehen.
Er lief auf sie zu und ließ sich direkt neben ihnen auf den Boden fallen. Ménelaos blickte seinem Sohn tief in die Augen, doch kein Wort kam über seine Lippen. Er starrte ihn einfach nur an.
Ängstlich.
Verstört.
Blass.
Daymón hielt sich nicht länger damit auf. Er packte das Gesicht seiner Mutter mit beiden Händen und zwang sie dazu, ihm in die Augen zu blicken. Ihre Haut war mindestens genau so blass wie die seines Vaters und ihre Augen wirkten trüber, als er es jemals zuvor gesehen hatte. Er packte sie noch etwas fester und musste sich zusammenreißen, dass er seine Mutter nicht hin und her schüttelte.
»Was habt ihr getan?« Daymóns Stimme war lange nicht so stark und überzeugend, wie er es selber von sich kannte.
Der Anblick seiner Eltern.
Die öligen Schlieren unterhalb von Delhyá.
All das zog seinen Magen zusammen und er hatte keine Kontrolle mehr über seine Stimme. Er wollte nur noch wissen, was passiert war und was seine Eltern damit zu tun hatten.
Nephíles Szinárdín kniff ihre Lippen zu einem schmalen Strich zusammen und Tränen liefen aus ihren Augenwinkeln über ihre schweißnassen Wangen. Von ihr konnte Daymón gerade keine Antwort erwarten, also drehte er seinen Kopf ruckartig zu seinem Vater herum.
Die Schultern von Ménelaos hingen schlaff herunter und er fuhr sich mit einer Hand nervös durch das kurze weiße Haar. Dann trafen seine Augen auf die seines Sohnes.
»Wir wollten unser Volk wieder zu dem machen, was es einmal war,« sagte er leise und die Angst schwang auch in seiner Stimme mit, »doch deine Mutter war zu schwach. Ich war zu schwach. Wir konnten nicht allein mit der Macht des Onyxes umgehen ... Wir hätten uns Hilfe holen müssen!«
»Ihr hättet gar nicht erst auf die Idee kommen sollen, irgendetwas mit diesem beschissenen Stein anzufangen!« Ménelaos zuckte deutlich zusammen, als er die Wut in den Worten seines Sohnes bemerkte.
Und Daymón war es mehr als schleierhaft, dass er so ruhig bleiben konnte. Er konnte das alles nicht glauben und noch immer wusste er nicht, was seine Eltern getrieben hatten. Gab es den Onyx überhaupt noch? Oder hatten sie auch ihn vernichtet? Und was befand sich auf Delhyá, dass sie es nur dort hatten vollbringen können?
Daymóns Gedanken fuhren Achterbahn und sein Kopf schien zu platzen. Und dann riss die leise, gebrochene Stimme seiner Mutter ihn aus seinen Gedanken. »Es tut mir leid mein Sohn. Wir haben Schande über unser Volk gebracht und können es nicht mehr gutmachen. Nur du kannst dagegen ankämpfen. Du und deine Seelengefährtin! Finde sie und rette unsere Heimat. Du musst Thórvlyn finden und eure Magie muss sich miteinander vereinen ...«
Die Augen von Nephíles Szinárdín schlossen sich zum letzten Mal und bevor Daymón es richtig realisieren konnte, drang ein kehliger, zugleich trauriger und wütender Schrei aus seiner Kehle. Stille breitete sich in dem Thronsaal, dem Palast und den Wellen des Meeres um sie herum aus, doch der Schrei des Prinzen der Meerwesen war noch meilenweit zu hören.
1
Hättest du an meiner Stelle das Licht der Welt erblickt und wärst in mein Leben, in meinen Körper hineingeboren, dann hättest du aus drei unterschiedlichen Optionen wählen können.
Die erste Option - und wahrscheinlich die ansprechendste von allen - hätte dich auf den Thron der Nachtelfen gesetzt, als ihre High Lady, nachdem deine Eltern abgedankt hätten. Natürlich hätte das noch eine ganze Weile gedauert, also hättest du dir gar keinen Stress machen müssen.
Die zweite Option - und irgendwie auch die Langweiligste von allen - hätte dich dazu getrieben, den Anspruch als Erstgeborene auf den Thron aufzugeben, dich in deine wunderschönen Kleider zu hüllen und ein Leben an der Seite eines Mannes zu führen, den du vielleicht geliebt hättest.
Aber auch nur vielleicht.
Kommen wir zur letzten - und besten - Option, die mein Leben für mich bereitgehalten hat. Du hättest dich der lyrischen Kriegertruppe und ihrem Volk angeschlossen, die vor vielen Jahren einfach aufgetaucht waren und ein Bündnis mit deinen Eltern schlossen, wodurch sie einen Teil eures Landes besiedeln durften. Du wärst zu ihnen gegangen, um mit ihnen zu trainieren, zu kämpfen und die beste Spionin des ganzen Landes zu werden.
Könntest du eine dieser Optionen mit deinem Gewissen vereinbaren? Nun ja, ich war schon immer ein bisschen von der Norm abgewichen. Dank der Liebe meiner Eltern hatte ich die freie Entscheidungswahl, nicht nur in diesem Belang. Sie hatten es geschafft, mir eine Zeit lang eine freie, unkomplizierte Kindheit zu schenken und dafür war ich ihnen heute noch dankbar. Im Endeffekt hatte ich mich für zwei von diesen Optionen entschieden und kann auch heute ehrlicher Weise noch sagen, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war.
Ein leichter Wind wehte um meinen Körper herum und ich musste mir die Hände aneinander reiben, da sie bereits ziemlich kalt waren. Was hatte ich mir auch gerade diesen Ort ausgesucht? Ich hätte genau so gut in einem Gebüsch unter mir Stellung beziehen können. Auf diesem Baum in schwindelerregender Höhe war die Luft um mich herum deutlich kühler.
Ich bereute meine Entscheidung jetzt schon.
Trotzdem hatte ich durch das dichte Blätterdach einen hervorragenden Blick auf meine Umgebung.
Zudem schützte sie mich exzellent vor fremden Blicken, die ich nicht gebrauchen konnte. Diese Mission war einfach - eine normale Überprüfung - und doch musste ich auf der Hut sein. Es konnte immer etwas schief gehen. Das hatte ich schon viele Male lernen müssen.
Nicht immer auf die sanfte Weise.
Obwohl ich die Erstgeborene in der Thronfolge war, hatten mir meine Eltern erlaubt, das Recht auf den Thron abzulegen und an meinen jüngeren Bruder zu übergeben. Thylion hatte sich sichtlich darüber gefreut und mit geschwollener Brust mein Erbe angenommen. An diesem Tag fiel mir ein Stein vom Herzen und ich hatte ihm mehrere Wochen lang jeden Tag aufs Neue gedankt.
Seitdem hatte Thylion meine Eltern immer unterstützt und sich einen Namen in Lyvián gemacht. Er würde ein guter High Lord werden, da war ich mir sicher.
Thylion war schon immer ein gut aussehender Mann gewesen und das wusste er. Sein lockiges, goldbraunes Haar hatte er von unserer Mutter geerbt und auch in ihren Gesichtszügen ähnelten sie sich, trotzdem war er der Einzige in der Familie, der weiß-gelbe Augen hatte. Dank ihnen hatte ich oft genug schon vorher gewusst, wann er in seine Launen verfiel und kurz davor stand aus seinem Inneren herauszubrechen. Dann leuchteten sie immer gelb auf und das Weiß trat deutlich in den Hintergrund. Und ja, Thylion war ein ziemlich launischer Kerl, auch wenn ich es oft genug darauf angelegt und ihn provoziert hatte. Unser Verhältnis war nie richtig gut gewesen. Wir waren Bruder und Schwester.
Mehr aber nicht.
Dass er schon immer ambitionierter an die königlichen Pflichten herangegangen war, hatte dieses Verhältnis nicht besser werden lassen. Zudem war er ein Besserwisser, was sich mit meiner Sturheit nicht wirklich vereinbaren ließ. Als ich mich für die Ausbildung im Süden entschieden hatte, waren nur wenige Worte zwischen uns gefallen und wir beide hatten unser Verhältnis seitdem akzeptiert und so hingenommen.
Thylion hatten damals schon viele Türen offen gestanden und mit den Jahren kamen immer mehr dazu. Er hatte sich zu einem Magier ausbilden lassen, was ihm durch seine eigene Magie - die Beeinflussung der Sinne - umso leichter gefallen war. Und obwohl er nur zwei magische Jahre jünger war wie ich, trug die Frau an seiner Seite bereits einen Verlobungsring an ihrem Finger.
Unsere Mutter wäre fast in Ohnmacht gefallen, als ihr einziger Sohn mit der Königin der Riesen vor ihr gestanden und offenbart hatte, dass sie sich verliebt hatten und heiraten wollten. Thylion hatte wie immer nichts anbrennen lassen und sich direkt eine Königin geschnappt. Doch Chará war mir ans Herz gewachsen, auch wenn wir uns nicht oft gesehen hatten. Sie war eine tolle Frau und vor allem hatte sie meinen Bruder von seinem hohen Ross heruntergeholt.
Sie tat ihm gut und obwohl sie keine Seelengefährten waren, liebten sie sich aufrichtig. Dass er bald zwei Völker regieren müsste, war wohl nur ein willkommener Bonus für ihn. Zusammen würden sie das hinbekommen.
Sie mussten es!
Denn ich hätte das Erbe des Thrones nicht wieder auf mich genommen. Niemals! Für mich war es schon immer undenkbar gewesen den Thron zu besteigen, mich mit dem Geplänkel und der Etikette abzugeben. Rüschen hier, Schminke da. Nein, das war einfach nicht ich. Ich hatte mir schon immer mehr von meinem Leben erhofft. Deswegen kam es auch nicht infrage, dass ich ohne richtige Perspektive mein weiteres Leben bestreiten wollte.
Ich wollte mehr!
Und dafür hatte ich alles getan. Aus Respekt zu meinen Eltern hatte ich mich in ihre Dienste begeben, um mich von ihnen in der Kunst der Magie lehren zu lassen. Danach hatten sie mir gestattet meine eigenen Wege zu gehen und genau das hatte ich getan.
Wieder wirbelte eine starke Böe um meinen Körper und ließ meine Knochen und Muskeln unsanft zittern. Diese Kälte und die Dunkelheit erinnerten mich an meinen ersten Tag bei den lyrischen Kriegern im Süden.
Niemand hatte mich abgehalten oder mir gesagt, dass ich zu schwach sei, um diese Ausbildung zu überstehen. Ich selber hatte mir sehr viel davon erhofft und am Ende der fünf Jahre war ich zu der Spionin ernannt worden, die gerade in diesem Baum saß und sich die Finger abfror.
Das habe ich dir mehr als einmal gesagt!
Ich ließ meinen Blick von dem Fenster vor mir schweifen, um mich kurz nach rechts zu richten. Der nächste Baum war mindestens genau so gut mit Blätterwerk bestückt wie meiner. Auch in ihm konnte man nichts erkennen, doch ich wusste, dass sie da war und mich im Auge behielt. Ihre stahlgrauen Augen blitzten kurz in meine Richtung und richteten sich dann wieder von mir ab.
Du weißt doch, dass ich meinen eigenen Sturkopf habe. Dieser Platz war einfach der Beste, Kälte hin oder her.
Sie wusste besser als jeder andere, wie stur und dickköpfig ich manchmal sein konnte.
In Lyvián war es einer mächtigen Person - einem König, High Lord oder High Lady, einem Lord - vorherbestimmt, sein Leben mit einem Geschöpf zu teilen, das dazu auserkoren war, sich um den Schutz dieser Person zu kümmern. Es waren Wesen, die man unmittelbar mit einem zu großen Hund vergleichen würde.
Trotzdem unterschieden sie sich nicht nur in der Größe, sondern vor allem in ihren magischen Fähigkeiten, gekoppelt mit ihren steinharten Krallen und den brachialen Reißzähnen.
Auch Méave, mein Schattenwolf, war zu einem Leben an meiner Seite bestimmt worden. Sie hatte sich aus meiner Magie und dem Herzen in meiner Brust geformt und stand mir seit vielen Jahren zur Seite. An dem Tag, als sich meine Magie zum ersten Mal gezeigt hatte, war auch Méave aufgetaucht. Und obwohl sie manchmal eine Besserwisserin war, liebte ich sie.
Du weißt zum Glück, dass ich all deine Gedanken hören kann.
Natürlich wusste ich das und natürlich wusste auch Méave, dass ich mir nicht zum ersten Mal einen Spaß daraus machte. Trotzdem war unsere Verbundenheit stärker als jemals zuvor.
Auch dank der anstrengenden und aufreibenden Ausbildung, die uns das lyrische Volk abverlangt hatte.
Sie hatten so etwas wie einen Schattenwolf noch nie zuvor gesehen und waren umso interessierter daran gewesen, Méave und mich zu trainieren. Ich wusste, dass sie von einem weit entfernten Kontinent kamen, der irgendwo weiter im Süden liegen musste und in manchen Lehrstunden hatten sie davon gesprochen, doch es war mir immer egal gewesen.
Ich machte mir nicht viel daraus, woher jemand kam. Außerdem hatten sie ein Bündnis mit uns geschlossen und sich auf unserem Land angesiedelt. Der Frieden, der von Anfang an zwischen uns geherrscht hatte, war ein weiterer Punkt gewesen, warum ich mich ihnen angeschlossen hatte.
Und noch etwas hatte mich so an ihnen fasziniert.
Die lyrischen Krieger hatten zwar keine Schattenwölfe, dafür aber eine grauenvolle Kunstfertigkeit zu töten, und wunderschöne graue Schwingen, die ihnen aus den Schultern ragten und sie zu Bestien werden ließ. Sie hatten keine Probleme damit, ihre Gegner aus der Luft anzugreifen und ein Massaker zu veranstalten. Auch ich hatte mir sofort eigene Schwingen gewünscht und erinnerte mich zu gern an ihre Schönheit, an ihre Grazie und die weichen Federn, die sich nicht nur einmal in meinen Haaren verfangen hatten, während Hawke und ich zusammen ...
Lässt du dich wieder von deinem Spielzeug ablenken? Du weißt, was beim letzten Mal passiert ist ...
Ruhe Méave!
Ich wollte dieses leidige Thema nicht schon wieder in meinem Kopf durchspielen. Hawke war einer der besten lyrischen Krieger, die es in Lyvián gab. Ich hatte ihn während meiner Zeit bei ihnen kennen und lieben gelernt.
Obwohl man wohl nicht von wahrer Liebe zwischen uns sprechen konnte, denn die Zeit, die wir zusammen verbrachten, war eher ein Vertreiben der Langeweile, bestehend aus Training und wilder Vögelei.
Auch wenn Hawke mich mehr als nur in einer Hinsicht ansprach - seine Schwingen waren einfach länger als alles, was ich vorher gesehen hatte -, wusste ich, dass er nicht derjenige war, dem mein Herz schon vor langer Zeit versprochen worden war.
Auch das hatten mir meine Eltern erzählt und ich wusste bis heute nicht, ob ich wirklich damit zurechtkam, jemandem versprochen zu sein, den ich nicht kannte. Doch wenn ihr jetzt dachtet, meine Eltern seien Tyrannen und würden mir eine Hochzeit aufzwingen, würde ich euch enttäuschen müssen.
Dieser Mann hatte genau so wenig Schuld daran wie meine Eltern oder ich selbst. Das Problem an einer Seelenverbindung liegt nun einmal darin, dass man sie nicht ignorieren kann. Sie ist vorherbestimmt und unumgänglich. Außer man ging die Dinge so an wie ich und lief einfach vor allem davon. Das konnte ich schon immer gut, weswegen ich wahrscheinlich auch zu den lyrischen Kriegern gegangen war und mir eine eigene Hütte im Süden gesucht hatte.
Meine Eltern - und auch Thalia - waren nicht glücklich darüber gewesen. Vor allem meine Mutter hatte besorgt ausgesehen, als ich ihr meine Entscheidung mitgeteilt hatte. Thalia hatte bittere Tränen vergossen und mich angefleht nicht zu gehen.
Meine Schwester - die Jüngste von drei Kindern - war damals, als ich zu den lyrischen Kriegern aufgebrochen war, erst achtzehn Jahre alt gewesen. Wir waren schon immer mehr als nur Schwestern gewesen und das hatte Thylion zur Weißglut getrieben. Thalia war die Schlauere von uns beiden.
Stilsicher.
Liebenswürdig.
Und an manchen Tagen so sensibel, dass man sie besser nicht ansprach und sich weit genug von ihr fernhielt. Sie trug nicht nur die Schönheit unserer Mutter, sondern auch die unseres Vaters in sich, und dafür hatte ich sie keinen Tag lang beneidet. Die lockigen, langen schwarzen Haare hatten ihr so einige Blicke der Männer eingebracht und sie war die Einzige von uns, die den gleichen schwarzen Glanz wie unser Vater in ihren weißen Augen trug. Meine markanten und schroffen Gesichtszüge wurden von ihrer Weichheit und Eleganz abgelöst. Auch mich hatte sie mit ihrem schlanken Körper schon unzählige Male überrascht, wenn sie eines der wunderschönen Kleider anzog, die sie von morgens bis abends trug.
Thalia war die geborene High Lady und hätte Thylion den Thron abgelehnt, wäre ich stolz darauf gewesen, sie meine High Lady und Schwester nennen zu dürfen. Doch Thylion hatte nicht abgelehnt und Thalia hatte sich ihrer Magie verschrieben.
Heilende Hände.
So hatten wir ihre Magie immer heimlich genannt, wenn unsere Eltern oder Thylion nicht zugehört hatten. Seit ihrer Ausbildung zur Heilerin - die sie im Süden bei engen Freunden der Familie absolviert hatte - hatte sie bereits unglaubliche Dinge erreicht. Man kannte sie nicht nur unter den Nachtelfen, sondern auch in den anderen Völkern.
Jeder von ihnen kannte Thalia Blackthorn, die Heilerin der Nachtelfen. Mit zweiundzwanzig war sie das erste Mal durch Lyvián gereist, um auch den anderen Völkern ihre Unterstützung anzubieten, ihre Gabe weiterzutragen und neue Allianzen zu schmieden. Es hatte mich nicht gewundert, dass sie nach zwei Jahren zurückgekehrt war und verkündet hatte, dass sie ihren Seelengefährten gefunden und sich in ihn verliebt hatte.
Und mich hatte es auch nicht gewundert, dass es sich dabei um niemand Geringeren als den High Lord der Elfen gehandelt hatte. Als ich von dieser Neuigkeit erfahren hatte, war ich so glücklich gewesen wie schon lange nicht mehr. Ich hatte mich öffentlich für meine Schwester gefreut und ihr meinen Segen gegeben, denn Rueth war ein liebenswürdiger, tapferer und aufrichtiger Mann.
Er hatte das Volk der Elfen nach einem schrecklichen Krieg wieder neu aufbauen müssen, was ihn viel Tapferkeit gekostet haben musste. Rueth war kein ungeschriebenes Blatt, das wusste ich von meinen Eltern, die ihn damals auf den Thron der Elfen geholfen hatten. Und natürlich wäre ich eine schlechte Schwester gewesen, wenn ich nicht selber ein paar Informationen eingeholt hätte.
Seit einem Jahr lebte meine Schwester nun in der Stadt der Elfen - die aus dem Nichts neu aufgebaut worden war - und das Volk liebte Thalia. Ich konnte es ihnen nicht verübeln.
Man musste Thalia einfach lieben. Sie war in jeder Hinsicht besser und charmanter, als ich es wohl jemals sein würde.
Meine Geschwister hatten bekommen, was sie verdienten. Sie hatten das Beste aus ihren Leben gemacht und ich wollte das auch. Nachdem ich die Ausbildung zur Spionin absolviert hatte, fand ich die Hütte im Süden, die fast an das Meer grenzte und von einem kleinen dichten Wäldchen umgeben war. Natürlich hatte meine Mutter mich versucht davon abzuhalten und gesagt, dass es in der Burg der Nachtelfen genügend Platz und Zimmer gebe, die ich bewohnen könnte. Ich hatte ihr nicht wirklich einen klaren und plausiblen Grund entgegengebracht, als ich dieses Angebot verneinte.
Trotzdem hatte sie mich nicht aufgehalten.
Mir war sehr schnell klar geworden, dass sie mich nur hatte gehen lassen, weil in der Nähe der Hütte eine größere Gruppe unseres Volkes lebte, die sich dort schon vor langer Zeit angesiedelt hatte. Auch sie standen unter der Herrschaft meiner Eltern, wurden aber von einem Lord regiert, der sie beschützte und von meinem Vater selbst für diese Aufgabe auserwählt worden war. Auch jetzt hoffte ich immer noch, dass meine Mutter nichts davon mitbekam, dass Faolán und seine Frau Rayánne sich nur sehr selten nach mir erkundigten und mich eigentlich in Ruhe ließen.
Aber ich wiegte mich in Sicherheit.
Hätte sie etwas davon erfahren, wäre sie ohne zu zögern bei mir aufgetaucht, hätte die Tür zerborsten wie ein Stück modriges Holz und Hawke und mich wahrscheinlich noch in einer sehr intimen Situation erwischt.
Oh Götter, das darf niemals passieren!
Eine Bewegung in dem hell erleuchteten Fenster ließ meine Gedanken sofort in den Hintergrund wandern. Und als hätte sie gespürt, dass ich gerade noch an sie gedacht hatte, erkannte ich die Silhouette meiner Mutter. Es wunderte mich nicht, dass sie heute Abend hier war.
Sie hatte mich ja schließlich beauftragt.
Nicht, weil hier etwas Unheilvolles vor sich ging.
Ein Treffen der Berater aller Völker war einberufen worden und meine Mutter war eine von ihnen. Sie hatte sich kurz nach Thalias Geburt dazu ernennen lassen, als Beraterin der Nachtelfen und der Menschen sprechen zu können. Nur noch wenige Personen wussten überhaupt, dass meine Mutter vor langer Zeit als Mensch geboren worden war. Die Erste ihrer Art, die mit der Seele der Retterin gesegnet war und die Aufgabe hatte, Lyvián vor dem Untergang zu bewahren.
Sie hatte ihre Aufgabe gemeistert, auch dank der Hilfe und unbändigen Liebe meines Vaters, und nun stand sie hier unter all den anderen Beratern.
Sie war immer noch so schön und jung wie bei meiner Geburt. Einige kleinere Falten hatten sich in ihr sanftes Gesicht geschlichen, doch wenn man bedachte, wie langsam wir alterten, war das wohl zu verkraften.
Ich hatte mein achtundzwanzigstes Lebensjahr bereits vor zwei Jahren erreicht. Ab da alterte man nicht mehr in einem Zyklus, der den Menschen gleichkam. Alles ging viel langsamer vonstatten. Es dauerte immer zehn Jahre, bis man das nächste offizielle Lebensjahr erreichte.
Meine Mutter war bei meiner Geburt erst fünfundzwanzig Jahre alt gewesen. Obwohl Thylion und ich die normale Lebensphase bereits überschritten hatten, war unsere Mutter selbst erst Anfang 30.
Und das sah man noch deutlich.
Ihr Körper war atemberaubend schlank und gut geformt, was nicht allein an der Magie in ihr lag. Sie liebte es, zu kämpfen und stundenlang mit meinem Vater oder Siénah - ihrer Leibwächterin und besten Freundin - zu trainieren. Sie war in dieser Hinsicht schon immer mein Vorbild gewesen.
Ein Abbild der längst vergangenen Mondgöttin.
Das Einzige, was sich in den ganzen Jahren an ihr verändert hatte, waren ihre Haare. Als ich noch jünger gewesen war, hatte sie sie bis kurz unter ihrer Brust getragen. Als Thalia geboren worden war, hatte meine Schwester es geliebt, sich mit ihren Fingern in den dicken Strähnen festzuklammern und meiner Mutter einige Tränen in die Augen zu treiben, wenn sie kraftvoll daran gezogen hatte.
Für mich wäre es ein triftiger Grund gewesen, sie sofort wieder kurz zu schneiden, doch meine Mutter hatte sie einfach immer weiter wachsen lassen. Jetzt fielen sie ihr bis zu den Knöcheln und ihre Kammerzofe und Freundin Gildá hatte größte Mühe, eine ordentliche Frisur aus der Masse an Haaren zu formen. Auch jetzt trug meine Mutter ihre Haare wieder mit zwei silbernen Spangen an den Seiten nach hinten gesteckt. Der Rest fiel ihr offen über den Rücken. Die prächtige Krone der High Lady der Nachtelfen saß mittig auf ihrem Kopf.
Ihr Blick huschte ganz kurz durch das geschlossene Fenster zu mir und ich wusste genau, dass sie mich gespürt haben musste. Niemand konnte mich in diesem brillanten Versteck sehen, doch meine Mutter und mich hatte schon immer etwas verbunden.
Zum Glück richtete sonst keiner der Anwesenden seinen Blick nach draußen und auch meine Mutter konzentrierte sich schnell wieder auf das Gespräch, welches um sie herum stattfand.
Sie hatte mir nicht viel über meine Aufgabe erzählt oder worum es bei diesem Treffen überhaupt ging. Nachdem sie mir für meine Dienste auch noch Geld geboten und ich es dankend abgelehnt hatte, - für meine Eltern würde ich auch ohne Geld alles tun - hatte ich nicht weiter nachgefragt.
Ich wusste nur, dass ich den Botschafter des kleinen Volkes im Auge behalten sollte, da er sich dagegen strebte, dass das vergessene Land mittig in Lyvián neu besiedelt werden sollte. Obwohl das Volk, welches dorthin zurückkehren wollte, sowieso ein Anrecht auf dieses Stück Land hatte und der Botschafter sich nicht nur gegen die Nachtelfen, sondern auch gegen die Riesen und die Druiden stellte.
Und obwohl die lyrischen Krieger noch nicht lange unter uns lebten, waren auch sie für diese Neubesiedlung. Meine Mutter hatte sich schon lange dafür eingesetzt, dass das verschwundene - ausgerottete - Volk der Druiden wieder zurück in ihre Heimat konnte. Keálas - ein langjähriger Teil unserer Familie und starker Magier - wollte den alten Druidenwald und die freien Flächen ringsherum neu aufbauen. Er stammte selber von den Druiden ab und wurde lange Zeit als Letzter seiner Art betitelt. Bis Chará aufgetaucht war.
Die Verlobte meines Bruders war nicht nur die Königin der Riesen und somit eine hochgeborene Riesin, sondern auch Halb-Druidin. Wie das zustande gekommen war, hatte mir mein Vater vor langer Zeit erklärt, doch ich erinnerte mich nur noch bruchstückhaft daran.
Ich hatte es mit Sicherheit für unwichtig gehalten oder es war zwischen den unzähligen Lektionen einfach untergegangen.
Trotzdem versuchten Chará, Keálas und noch einige weitere Überlebende und Mitglieder der Organisation der Rosen der Nacht - Keálas lang geheimgehaltener Bund - ihren Heimatort wieder zu besiedeln. Was anscheinend schwieriger war als gedacht.
Und genau deswegen war ich hier, saß auf einem Ast in einem hochgewachsenen Baum und fror mir die Finger ab.
Selbst schuld, würde ich behaupten!
Danke Méave. Deine Meinung ist mir gerade ziemlich egal!
Nur ein Rascheln in dem Baum neben mir machte deutlich, dass Méave noch bei mir war. Sie war von ihrem Ast eine Etage tiefer gesprungen und hatte immer noch einen guten Blick auf das andere Ende des Saals, in dem sich die Botschafter und meine Mutter befanden.
Bis jetzt hatte sich der knochige, alte Kerl, der für das kleine Volk sprach, noch nichts zu Schulden kommen lassen. Wie alle anderen auch wackelte er gelangweilt durch den Saal und nahm immer wieder Gespräche mit anderen Anwesenden auf.
Nichts Auffälliges.
Auch meine Mutter ließ sich von einem Gespräch in das andere gleiten. Einige der Personen kannte ich gut. Entweder hatte ich Informationen über sie beschafft oder sie waren zu mir gekommen und hatten mich für meine Dienste angeheuert oder waren Teil der Familie.
So erkannte ich auch Yvaná, die Botschafterin des lyrischen Volkes. Sie hatte ihre riesigen grauen Schwingen ganz dicht an ihren Rücken gelegt, wo sie trotzdem noch weit über ihren Kopf reichten. Sie hielt ein Glas mit heller Flüssigkeit in der Hand und schien einem von den Begleitpersonen schöne Augen zu machen.
In einer anderen Gruppe erkannte ich den Botschafter der Riesen, der auch gleichzeitig ein guter Freund der Familie war. Obwohl ich mir nie wirklich hatte vorstellen können, dass Deégan die Aufgabe des Botschafters Freude bereitete. Er war eher der rustikale Typ.
Ein Krieger.
Und am Anfang hatte er wohl nur die Position als Leibwächter der Königin innegehabt. Dass Chará ihm ihr Leben anvertraute, wusste nicht nur ich. Ihre Freundschaft und Vertrautheit lag länger zurück, als mir jemals begreiflich sein würde. Und auch Thylion hatte es am eigenen Leib erfahren müssen.
Deégan war Charás Schatten. Ein geborener Beschützer und manchmal kam es mir so vor, als würde er die Vaterrolle übernehmen. Thylion hatte sich an ihm die Zähne ausgebissen, bis Deégan irgendwann der Verlobung zugestimmt hatte.
Ich mochte ihn. Er hatte uns in meiner Kindheit sehr oft besucht und mir später einige wichtige Techniken mit dem Schwert beigebracht. Deégan war ein guter Mann.
Genauso bekannt war mir auch Endovíer.
Eigentlich war er der Wächter des Druidenwaldes und eigentlich war er auch schon lange nicht mehr am Leben. Ich hatte ihn öfter schon als Geist bezeichnet, da meine Mutter mir gegenüber erwähnt hatte, dass die Menschen Verstorbene so nannten. Auch in Lyvián war er tot, doch eigentlich war er gefangen in seiner Aufgabe.
Ein Wanderer, der niemals zur Ruhe kommen würde. Ein Wächter seines Landes, um das sich dieses Treffen drehte. Auch heute hatte er wieder seine feste, lebende Form angenommen, die er immer trug, wenn er zu wichtigen Veranstaltungen geladen wurde. Und er genoss es sichtlich, dass er die Getränke und das Essen in seinem Mund schmecken konnte.
Ich stellte mir ein Leben als Geist ziemlich öde und langweilig vor. Vor allem, da ihn anscheinend nicht viele Leute regelmäßig besuchten.
Und genau deswegen tat er mir irgendwie leid.
Sie an, wen deine Mutter mitgebracht hat. Ich dachte, er hätte etwas anderes zu tun.
Mein Blick huschte wieder zu meiner Mutter, die immer noch direkt vor dem Fenster stand und mir weiterhin den Rücken zukehrte. Sie hatte sich in ein Gespräch mit Maéron, dem Botschafter der Elfen und Rueth persönlichem Leibwächter, vertieft, der sich gerade in dem Moment verabschiedete, als jemand anderes an meine Mutter herantrat.
Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Dieser Blödmann! Als ich ihn heute Mittag gefragt hatte, ob er heute Abend schon etwas vorhatte und was er tun würde, hatte er mich doch tatsächlich eiskalt angelogen.
Nicht zu fassen!
Er hatte sogar nicht davor gescheut, Ronán mit in die Sache hineinzuziehen und mir, ohne mit der Wimper zu zucken, zu sagen, dass sie sich heute Abend bei den Lyrischen vergnügen würden.
Connáh - mein angeblich so toller bester Freund - konnte definitiv mit einer Standpauke rechnen. Auch wenn ich wusste, dass er sich seit zwei Jahren als angehender Botschafter meiner Mutter angeschlossen hatte, hieß das mit Sicherheit nicht, dass ich ihm gestattete, mich anzulügen. Und natürlich ging ich stark davon aus, dass er nicht wusste, dass auch ich hier war.
Vielleicht hätte er mir sonst direkt die Wahrheit gesagt und sich nicht in diese Lügen verstrickt.
Er lächelte meine Mutter süffisant an, während sie miteinander sprachen, und ich hätte ihm zu gerne gesagt, dass er ein elendiger Lügner war, nur um das Lächeln aus seinem Gesicht zu vertreiben.
Trotzdem ließ ich meinen Blick weiter über ihn wandern. Nicht, weil ich ihn begehrte.
Connáh war mein bester Freund und das schon mehr als zwanzig Jahre. Ich hatte nie das Verlangen gespürt, ihn als mehr zu sehen.
Ja, ich liebte ihn!
So, wie ich meinen echten Bruder hätte lieben sollen.
Aber bei Connáh war es schon immer leichter gewesen als mit Thylion. Es musste daran liegen, dass Connáh und ich vom selben Schlag waren.
Er war ein geduldiger und selbstsicherer Mann.
Mutig.
Und er hatte sich schon sehr früh eine dicke Haut wachsen lassen müssen, was wohl an der Frau lag, die ihm vor vielen Jahren das Herz gebrochen hatte. Und natürlich an dem Ruf, den seine Eltern innehatten und mit dem er sich messen wollte.
Eigentlich hatte ich immer gedacht, dass nur ich mit einem Druck kämpfen musste, der nicht von meinen Eltern ausging, aber durch sie und ihren Status hervorgerufen wurde. Doch der einzige Sohn des ersten Kommandanten der Nachtelfen zu sein und die schonungslose Kriegerin mit den brutalen Kampfkünsten aus dem Westen als Mutter zu haben, brachte wohl auch enormen Druck mit sich. An manchen Abenden war Connáh kläglich gescheitert und seine Fassade hatte Risse bekommen, von denen nur ich wusste.
Doch wir hatten all die Jahre zusammen durchgestanden und uns gegenseitig unterstützt. Wir waren beste Freunde und selbst diese kleine Notlüge würde daran nichts verändern.
Er würde trotzdem einen Schlag in die Rippen von mir bekommen. Nur damit er sich an den Schmerz erinnerte und nicht wieder auf die Idee kam, mich anzulügen.
Im nächsten Moment huschte mein Blick an das andere Ende des Zimmers und meine Sensoren stellten sich schlagartig auf. Ich wusste sofort, dass es jetzt interessant werden würde.
Der Botschafter des kleinen Volkes blickte sich hektisch um, während er annahm, dass ihn niemand beobachtete. Dann schlüpfte er durch die Tür am anderen Ende und verschwand in dem Gang dahinter.
Das ist viel zu einfach!
Ich wusste genau, wohin der schmale Verbindungsgang den Botschafter führen würde. Nicht umsonst hatte ich den Titel einer Spionin bekommen.
Bevor ich meine Stellung in dem Baum wahrgenommen hatte, war ich einmal um das ganze Gelände gelaufen und hatte alle möglichen Fluchtwege abgeschätzt und mir jedes Detail eingeprägt. Der kleine Innenhof mit dem Springbrunnen war mir sofort ins Auge gefallen. Und der Gang, den der Botschafter gewählt hatte, führte genau dorthin.
Ich hangelte mich an den dicken Ästen des Baumes hinauf und erkannte im Augenwinkel, dass auch Méave mir folgte. Natürlich war sie viel schneller und erreichte den letzten dicken Ast zuerst. Mit einem kräftigen Satz flog sie über den Abgrund zwischen Baum und Haus und landete so elegant auf dem rot gekachelten Dach, wie nur Méave es vollbringen konnte.
Ich schmunzelte.
Auch ich packte jetzt den letzten Ast und zog mich hinauf. Meine Füße in den eng anliegenden Lederstiefeln trafen auf die schroffe Rinde, und als ich mich aufrichtete, brauste der Wind noch kräftiger um meinen Körper. Ich hielt mich nicht länger damit auf und rannte los.
Wäre Connáh hier bei mir, hätte er mir mit Sicherheit nachgerufen, dass ich es sowieso nicht auf die andere Seite schaffen würde und der Ast viel zu schmal wäre. Dieser Gedanke spornte mich noch mehr an und ich wusste zu gut, dass er unrecht behalten würde.
Schon immer hatten mir schmale Wege, enge Gassen oder schwindelerregende Höhen nichts ausgemacht. Ich liebte es auch heute noch, mich auf den höchsten Turm der Burg der Nachtelfen auf dessen Dach zu setzen und die Füße baumeln zu lassen. Mindestens genau so oft hatte ich dasselbe auf der Plattform des Dragongóul-Berges getan.
Die Abenteuerlust brannte in mir wie ein loderndes Feuer.
Und doch verließ ich mich bei meiner Arbeit und meinen Abenteuern viel zu oft auf meine Magie. Wozu war ein Schutzschild, dass ich aus meiner Magie formen und um mich legen konnte, wann ich wollte, sonst gut?
Es hatte mir nur noch mehr Freiheiten geschenkt.
Mein letzter Schritt auf dem Ast wurde von einem Knacken untermalt, als ich mich von ihm abstieß und das Adrenalin durch meine Adern schoss. Ich überflog die drei Meter mit Leichtigkeit und vollführte einen kleinen Salto, um meine Kraft abzubremsen.
Dann landeten meine Füße auf dem Frist des Daches und ich blickte mich suchend um. Ich hoffte, dass mich niemand entdeckt hatte.
Auf der anderen Seite hätte dieser makellose Auftritt ein paar Zuschauer verdient gehabt.
Angeberin!
Ein süffisantes Lächeln trat auf mein Gesicht. Die Umgebung lag weiterhin in Stille, nur der Mond über mir war Zeuge von meiner Kunst geworden. Ich hockte mich hin und ließ den Wind weiter um meinen Körper wehen. Mein Mantel wurde mir unsanft von meinem Rücken gezogen, doch ich konnte mich mühelos halten.
Noch ein letztes Mal blickte ich hinauf zu dem Mond und schätzte seine Helligkeit ab. Meine Hände griffen nach meiner Kapuze, die ich noch weiter in mein Gesicht zog, und nach dem Tuch, das um meinen Hals gelegen hatte und sich jetzt sanft über meine Nase und meinen Mund zog. Natürlich musste ich versuchen, unerkannt zu bleiben.
Ich hatte mir zwar einen stattlichen Ruf aufgebaut und konnte von dem Geld, das ich durch unzählige Aufträge erhielt, sehr gut leben, aber niemand wusste, wer wirklich in der Hütte im Süden lebte.
Niemand, außer meiner Familie und dem engsten Kreis der Nachtelfen.
Wenn mich jemand entdecken sollte und vor allem wusste, wer sich wirklich unter dieser Maske versteckte, war es nicht nur mit meiner Karriere vorbei.
Ich musste auch meine Mutter und meinen Vater schützen.
Meine Geschwister.
Alle, die ich liebte.
Es gab genügend Leute, die mich tot sehen wollten, weil ich ihr Leben ruiniert hatte. Es war ein Leichtes an Informationen zu kommen, wenn man wusste, wie man Druck auf jemanden ausüben musste. Nicht nur diese Eigenschaft hatte ich in all den Jahren perfektioniert.
Automatisch glitten meine Hände an meinen Rücken, wo ich die beiden Kurzschwerter versteckt hielt, die sofort ein warmes Summen aussandten, als meine Finger den glatt geschliffenen Stahl berührten.
Alles war bereit.
Es konnte also losgehen.
Bist du bereit, jemandem eine Menge Angst einzujagen, Méave?
Das Wesen neben mir hatte sich in der ganzen Zeit kein Stück bewegt. Méave stand noch immer an der Stelle, an der sie gelandet war. Der Wind strich auch ihr unbändig durch das Fell und sie hatte ihren Kopf leicht gesengt und blickte hinunter auf den Innenhof, der mindestens sechs Meter unter uns lag. Ihre Ohren waren gespitzt und zuckten wild Hin und Her, und auch ihre Nase nahm jeden noch so kleinen Geruch auf.
Ein Jäger auf der Suche nach seiner Beute.
Und wieder einmal konnte ich den Blick nicht von ihr nehmen.
Der Schattenwolf an meiner Seite, mit dem Herzen einer Kriegerin, war schöner und anmutiger als alles, was ich jemals gesehen hatte.
Nicht nur ihre stahlgrauen Augen hatten mich schon immer fasziniert und mir manchmal sogar Angst eingejagt. Ihr Fell war so dunkel und Schwarz, dass es selbst jetzt das Licht des Mondes zu verschlucken schien. Sie war kräftig und stark und von den Schattenwölfen, die ich kannte, sogar die Größte. Auch das hatte Thylion dazu gebracht, mich noch etwas weniger zu mögen, als es Geschwister sonst taten. Fhongan - sein Schattenwolf - war wenige Zentimeter kleiner und zudem strotzte er nicht so vor Kraft und Energie wie Méave.
Ich hatte es immer wieder als Mittel genutzt, um Thylion aus seiner Fassung zu bringen. Nicht nur einmal war ein Glas mit voller Wucht direkt neben mir an der Wand zersprungen und nicht selten war dabei das gesamte Weiß aus seinen Augen durch Gelb ersetzt worden.
Der einzige Makel - und für mich ein weiteres Detail ihrer Schönheit - war ihre rechte Vorderpfote.
Sie war Weiß.
Sowohl die Haut ihrer Ballen als auch die Krallen waren komplett von dem Schwarz ihres Felles ausgeschlossen worden. Ich hatte mir oft vorgestellt, dass ihr Aussehen mein Inneres widerspiegelte. Dass ich schon immer gewusst hatte, dass ich noch nicht komplett war.
Dass mir irgendetwas fehlte.
Irgendjemand.
Doch auch jetzt war wieder einmal nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken. Méave und ich hatten schließlich eine Aufgabe zu erfüllen und ich wusste, dass es uns ziemlich viel Freude bereiten würde, dem alten, aufsässigen Kerl dort unten Angst einzujagen.
Als würde die Zeit uns entgegenkommen, richteten sich Méaves Ohren plötzlich auf einen Punkt und ihre Augen fokussierten sich auf die Gestalt unter uns. Die Energiesteine in ihrer Haut rings um ihren Hals pulsierten und leuchteten in einem Rhythmus, den ich nur allzu gut kannte.
Ihre Magie wollte etwas tun.
Sie wollte sich jetzt sofort auf den armen Botschafter werfen. Ich wusste nur zu gut, dass ich sie nicht aufhalten würde. Der Botschafter hatte sein Schicksal bereits selbst gewählt, auch wenn wir nicht hier waren, um ihn zu töten. Wir würden ihm nur etwas Angst einjagen.
Vielleicht auch etwas mehr.
Und natürlich in Erfahrung bringen, warum er sich gegen die Neubesiedlung wehrte und wer womöglich mit ihm gemeinsame Sache machte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass der dümmlich wirkende Kerl alleine darauf gekommen war, sich gegen das gesamte Volk Lyviáns zu stellen.
Mein Blick verharrte noch immer auf Méave, doch dann richtete ich ihn nach vorne. Obwohl der Mond die Gegend hell erleuchtete, blieb der Innenhof unberührt davon. Doch der Botschafter stellte sich zu ungeschickt an, als dass er die Dunkelheit für sich hätte nutzen können.
Sein Herz pochte wild und war lauter zu hören, als wenn zwei Steine aufeinander geschlagen wurden. Außerdem blickte er sich immer noch hektisch um und machte sich auch nicht die Mühe, sein Gesicht vor fremden Blicken zu schützen. Ich sah deutlich das Adrenalin in ihnen.
Und die unbändige Angst davor, vielleicht doch noch entdeckt zu werden. Dafür war es wohl oder übel schon lange zu spät. Wie gern hätte ich ihm gesagt, dass ich seit seiner Ankunft wie ein Schatten an ihm klebte und sogar gesehen hatte, wie er sich vor der Tür noch einen Popel aus der Nase gezogen und in den Mund gesteckt hatte.
Ekelhaft!
Womöglich würde ich gleich noch die Chance dazu bekommen, es ihm persönlich zu sagen, doch erst einmal waren die anderen Informationen wichtig.
Adrenalin schoss zurück in meinen Körper, welches sich mit dem leisen Brummen aus Méaves Kehle vermischte.
Unser Signal, das wir beide bereit waren.
Doch ich musste auch für Méave noch eine Sicherheitsvorkehrung schaffen. Es war unmöglich, meiner Arbeit nachzugehen, wenn jeder sie sehen konnte. Da nur die hochrangigen Lords und Ladys mit einem Schattenwolf gesegnet waren, hatte ich mir schnell etwas einfallen lassen müssen.
Die ersten Male hatte ich sie versteckt in meinem Inneren gehalten und mir danach eine ellenlange Standpauke von ihr abgeholt.
Ich bin erschaffen worden, um dich zu beschützen.
Du kannst mich nicht einfach versteckt halten!
Und ich wusste, dass sie recht hatte. Sie war meine Beschützerin und ohne sie hätte ich wohl schon etliche Gliedmaße verloren.
Vielleicht sogar mein Leben geben müssen.
Bei unserer ersten gemeinsamen Mission hatte ich schnell gemerkt, dass wir uns ergänzten und zusammen viel schneller vorankamen, als wenn ich allein fungiert hätte. Sie verstärkte meine Ohren und Augen und wenn es zu einem Kampf kam, war sie genauso gnadenlos wie ich. Wir hatten uns gegenseitig zu Höchstleistungen getrieben, trotzdem hatte man sie entdeckt und als Druckmittel gegen mich verwendet.
Méave hatte mich angefleht, zu fliehen und nicht zurückzublicken, doch ich war geblieben.
Ihretwegen.
Und an diesem Tag hatte ich mir geschworen, dass ich dieses vernichtende, hilflose Gefühl nie wieder spüren und erleben wollte. Also hatte ich mich darum gekümmert.
Langsam richtete ich meine Hand auf meine Brust, die unter den dicken Lagen meiner Rüstung versteckt gehalten wurde. Ich spürte das ruhige Pochen meines Herzens und ging noch ein Stück tiefer in mich hinein. Ganz weit hinten, tief in mir verborgen, schlummerte meine Magie und wartete darauf, dass ich sie an die Oberfläche ließ.
Doch heute würde ich das brennende Feuer in mir nicht brauchen. Ich war auf die sanfte Woge aus, die sich in leichten Wellen um die Hitze in mir schmiegte.
Mein Schutzschild.
Ich sendete einen Funken davon an Méave. Ein leicht silberner Film legte sich über ihren Körper und verschluckte sie mit Haut und Haaren. Im nächsten Moment war von dem Schattenwolf neben mir nichts mehr zu sehen. Die rostroten Schindeln auf dem Dach waren wie unberührt, doch ich wusste genau, dass sie immer noch da war.
Auch mir schickte ich etwas von dem Schutzschild über die Haut. Es war nicht viel Magie dazu notwendig, trotzdem reichte es aus, um mich vor plötzlichen Messerangriffen und blutigen Wunden zu schützen.
Die erste Lektion, die ich bei den lyrischen Kriegern gelernt hatte: Du musst immer auf Nummer sichergehen!
Und genau das tat ich.
Ich packte das Seil, welches neben mir über das Dach lief und ich vor etlichen Stunden hier angebracht hatte. Dann ließ ich mich über die Schindeln und mit Schwung über die Kante gleiten und fiel in rasantem Tempo zu Boden. Der Wind rauschte in meine Ohren, trieb mir Tränen in die Augen und im ersten Moment tat mein ganzer Kopf höllisch weh, doch als ich mit beiden Füßen auf dem Boden hinter einer hohen Hecke aufkam, ließ auch das dumpfe Gefühl schnell nach.
Das Seil drapierte ich mit einem Stein nahe an der Mauer. Falls es ein schnelles Entkommen - einen Plan B - benötigte, war dieses Seil meine Rettung. Ich ging zwar nicht davon aus, dass der Botschafter ein exzellenter Kämpfer war, doch wie ich gerade schon erwähnt hatte, ging ich immer auf Nummer sicher.
Ich nahm Méaves Geruch wahr, der von rechts in meine Nase wehte. Während ich den Blick nicht von dem Bild vor mir löste, ließ ich meine Hand langsam in die Richtung gleiten, wo ich sie vermutete.
Ich zuckte, als mich der bekannte leichte Stromschlag durchfuhr, der von dem schützenden Schild ausging. Und ich war noch glücklicher darüber, dass ich nicht meilenweit gegen die nächste Mauer prallte, so wie es schon einmal Connáh widerfahren war.
Seine Neugierde hatte ihn schon oft zu unüberlegten Handlungen getrieben. Mich zu umarmen, während ich ein vollständiges Schutzschild um mich gelegt hatte, war nur eine davon gewesen. Danach hatte er vier Wochen nicht reiten können, da seine Wirbelsäule leicht angeknackst worden war.
Zu meiner Verteidigung: Ich hatte ihn gewarnt!
Nur leider war Connáh mindestens genau so stur wie ich.
Ich schüttelte den Gedanken ab und konzentrierte mich wieder auf mein Umfeld. Der Innenhof lag noch immer in Dunkelheit und nur aus ein paar Fenstern drang etwas Licht zu uns durch. Doch das reichte mir vollkommen aus, um den Botschafter vor mir deutlich zu erkennen. Er stand vor dem Brunnen, aus dem bereits das Wasser abgelassen worden war. Auch hier würde der Winter bald einbrechen und seine weißen Massen über das Land verteilen.
Der Botschafter schien auf jemanden zu warten, denn er blickte immer wieder zu der Tür, aus der auch er gerade gekommen war. Doch niemand kam. Auch die nächsten fünf Minuten passierte nichts und langsam kroch die Kälte wieder in meinen Körper. Würde ich hier noch länger sitzen bleiben müssen?
Nein!
Ich entschloss mich dazu, jetzt die Oberhand über die ganze Situation zu bekommen. Niemand außer dem Botschafter war hier, also konnte ich meinen Plan durchziehen. Ich richtete mich zur vollen Größe auf. Das Leder meiner Rüstung knarzte bei jeder Bewegung, die ich machte, doch das gehörte zu meinem Plan.
Ich wollte diese kleinen, zermürbenden Geräusche.
Ich wollte, dass der Botschafter aufhorchte und zu zittern anfing.
Und dann trat ich auf den dünnen Ast, der direkt vor meinen Füßen gelegen hatte. Das Knacken ließ den Botschafter herumfahren und endlich hatte ich seine gesamte Aufmerksamkeit. Noch immer schützte die dichte Hecke mich vor seinen Augen, doch Méave war mit Sicherheit schon näher an ihn herangetreten.
Immer noch unsichtbar für seine Augen.
»W-wer ist d-da?«, fragte er mit zittriger Stimme. Es war auch jetzt immer noch viel zu einfach. Ich wusste nicht mehr, wie oft ich genau diese Herangehensweise ausgewählt und wie oft sie mich zum Erfolg gebracht hatte. Es war immer wieder faszinierend, wie jeder Einzelne von ihnen auf diese zermürbende Art reagiert hatte. Es war ein einfacher Trick, die Augen und Ohren seiner Gegner in Unruhe zu versetzen. Und es machte Spaß, ihre geweiteten Augen aus meinem Versteck heraus zu beobachten. Ihre Haltung zu sehen, die sich von kraftvoll und überzeugt in ängstlich und verzweifelt verwandelte.
Und der Botschafter war viel zu leicht zu knacken gewesen.