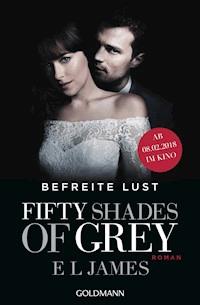Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Sein Erotikroman war ein Bestseller, aber das ist Jahre her. Jetzt steht Leon Walsky vor dem Ruin. Da überrascht ihn eine Unbekannte mit einem Angebot. Sie will ihn für erotische Storys bezahlen, verfasst nach ihren Ideen. Eine literarische Reise ins Begehren beginnt … "Flamingofeuer" ist ein Buch im Buch, ein verführerisches Vexierspiel, das mit Witz und Verve Gewissheiten über erotische Rollenbilder zu Fall bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Das Geheimnis der Flamingofrau
Gerüchte
Der gekaufte Schriftsteller
Die schöne Laura
Der rätselhafte Fensterladen
Die widerspenstige Sklavin
Die junge Frau, die nicht mehr jung war
Der Besuch bei Tanya von Rosenfels
Erste Verunsicherung
Laura wird angeschaut
Der junge Morgen
Strafe muss sein
Kontakt
Ménage-à-trois
Das Geheimnis der Flamingofrau
Fieber
Kleines Geheimnis
Was die Zukunft kostet
Cocktail-Queen
Die wahre Bedeutung von Dessous
In den Zügen der Nacht
Heißer Sommer
Das Glück versuchen
Die Erotik der Züge
Geheimnisvolle Weissagungen
Charisma Coaching
Ein besonderer Fall
Nabelschau
Überraschende Fähigkeiten
Das goldene Zelt
Obsession
Düstere Geheimnisse
Im Dunkeln kann alles geschehen …
Geschöpf der Nacht
Die schwarze Augenmaske
Pyromantische Affäre
Lila rennt
Berit und Tan-Ya
Blicke im Bus
Berit geht an Tan-Yas Tisch
Joe am Flughafen
Tan-Ya in den Feldern
Lila war nicht brav
Ein Zettel für Berit
Brav sein
Berit und Tan-Ya am See
Angezogen und nackt
Wie man einen Film dreht
Zöpfe
Elektrisch
Vom Lügen
Der Sammler
Epilog
Die lila Handtasche
Dank
Laura Lay
FLAMINGO
FEUER
Ą
RomanULRIKE HELMER VERLAG
ISBN (eBook) 978-3-89741-426-6
ISBN (Print) 978-3-89741-951-3
© 2019 eBook nach der Originalausgabe
© 2019 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Roßdorf b. DarmstadtAlle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NLunter Verwendung des Fotos »Mädchenbild« © Blindguard / Photocase
Ulrike Helmer Verlag
Blütenweg 29, 64380 Roßdorf b. Darmstadt
E-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
AlbertEinstein
Das Geheimnisder Flamingofrau
Gerüchte
Tanya von Rosenfels.
Sobald der Name fiel, gerieten die Gespräche am Lehrertisch kurz ins Stocken und hastige, kleine Blicke wurden gewechselt. Der Name fiel oft. Tanya von Rosenfels war nicht nur an der Schule in aller Munde, sondern auch in der ganzen Stadt.
Jeder kannte sie, zumindest war jeder ihr schon einmal begegnet. Dennoch war sie allen ein Rätsel. Es sei schwer, sie kennenzulernen, hieß es. Angeblich hasste sie Vertraulichkeiten.
»Gestern sah ich sie beim Bäcker«, erzählte die Geschichtslehrerin, während sie ihr Kasseler Steak sorgsam klein schnitt, dann in Soße tunkte und den Blick hob. Das gesamte Lehrerkollegium lauschte interessiert. »Ich hab sofort den Unterschied zwischen höflich und freundlich verstanden. – Sie ist reingekommen, hat gegrüßt, hat gelächelt. Ja, höflich. Da kann keiner was sagen. Aber sie war so kalt dabei, meine Güte. Alles, was mir an Small Talk auf der Zunge gelegen hatte, hab ich vor Schreck gleich wieder heruntergeschluckt!« Sie schaufelte sich noch etwas Sauerkraut und ein Stück Kartoffel auf die Gabel und schob sie in den Mund.
Tanya von Rosenfels war neu in Hainburg. Vor Kurzem hatte sie das seit Jahren leerstehende Gutshaus gekauft. Am äußersten Stadtrand. Dort, wo die Felder die Häuser ablösten. Wo der Wald begann. Wo man keine flirrenden Autogeräusche mehr hörte, sondern nur noch den Wind in den Bäumen und die Eichelhäher. Wie man dort hinkam? Man musste die Autobahn verlassen und die Hauptstraße entlangfahren, erst am Einstein-Gymnasium und dann am Bio-Supermarkt vorbei, immer weiter, bis zum Kirchhof, wo die Straße in diesen unscheinbaren alten Feldweg überging. Der mit dem staubigen Ginster an der Seite. Und dieser Weg führte zwei Kilometer über rissige Erde, an Ginster und Disteln, an brachliegendem Bauland und Lagerhallen vorbei, bis man die Auffahrt erreichte. Sie lag immer schattig, diese Auffahrt, weil sie von uralten Linden gesäumt war. Und dort, hinter dem schmiedeeisernen Tor, das mit seinen rostigen Zacken die Luft aufspießte, stand es: das Gutshaus.
Es sei eine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen, hatte der Sportlehrer erzählt. Er und der Makler gingen zusammen ins Fitnessstudio, sie waren seit Jahren befreundet. Sie habe das Haus telefonisch gekauft, einfach so und ohne vorher auch nur einen Blick darauf zu werfen!
Mehrere Wochen lang hatten die Hainburger beobachtet, wie plötzlich Autos verschiedener Handwerkerfirmen durch die Stadt kurvten, irgendwann anhielten und die Fenster herunterließen, um nach dem Anwesen zu fragen.
Erst war das Dach, dann die Elektrik des alten Gebäudes repariert worden. Die Flügelfenster hatten zur Parkseite hin weit offen gestanden, und viele Hainburger hatten wie aus Zufall ihre Sonntagsspaziergänge Richtung Gutshof verlegt und verfolgt, wie die fleckigen Wände erst trockengelegt, dann geweißt und wie die zertretenen Dielen abgeschliffen und geölt wurden. Später war eine Umzugsfirma angerollt und hatte einen Tag lang Möbel und schwere, mit Rot und Gold durchwebte Teppiche hineingetragen.
Und schließlich, an einem klaren Frühlingstag, war sie selbst angekommen. In ihrem schwarzen Cabrio. Sie war die Hauptstraße entlanggefahren, hatte niemanden gegrüßt, niemanden angesehen. Mit dunkler Sonnenbrille und einem flatternden Tuch im Haar war sie in den von Ginster umstandenen Feldweg eingebogen: Tanya von Rosenfels.
Auch nachdem sie schon einige Wochen in Hainburg wohnte, war ihr Name an unserem Mittagstisch nie mit einem Lachenverbunden. Er wurde gedämpft ausgesprochen.
Natürlich erregte sie Aufsehen und natürlich sah man sofort hin, wenn sie die Confiserie, die Buchhandlung oder die Boutique für Damenunterwäsche betrat, doch Genaues … wusste denn irgendjemand Genaues?
Nein. Stattdessen war das Angebot an Gerüchten schier unerschöpflich.
So erzählte der Musiklehrer zum Beispiel, sie brauche nicht zu arbeiten, weil sie eine stattliche Erbschaft gemacht habe. Auf die Frage der Kunstlehrerin, woher er das wüsste, antwortete er: »Hast du eine andere Erklärung?« Dann wieder hieß es, sie lebe so abgeschieden am Waldrand, weil sie Schriftstellerin sei und Ruhe brauche, um blutrünstige Bestseller zu schreiben. Ob mir als Deutschlehrer ihr Name nichts sagte? Aber ich schüttelte nur den Kopf. Die Sekretärin behauptete, sie handle im Ausland mit Immobilien.
Konkretes wusste niemand. Es waren alles nur Vermutungen. Als unumstößliche Tatsache jedoch galt ihr Reichtum. Schließlich warf sie mit Geld nur so um sich.
Tanya von Rosenfels trug stets die elegantesten Kreationen, sie ging einmal wöchentlich zum teuersten Friseur im Ort, und wer – wie der Schuldirektor und seine Frau – das Glück gehabt hatte, zu dem Begrüßungsfest kurz nach ihrem Einzug eingeladen worden zu sein, konnte von einem üppig-extravaganten Büfett berichten, von einer Kollektion erlesener Düfte, die sie den weiblichen Besuchern in der Eingangshalle und im Bad vor dem Schminktisch zur Verfügung gestellt hatte, und von einer edlen Zigarrenauswahl für die Herren.
Doch Tanya von Rosenfels lebte nicht nur für ihr eigenes Vergnügen – sie begann schon wenige Tage nach ihrer Ankunft die sozialen Projekte der Stadt zu unterstützen: Sie spendete großzügig für das neue Kirchdach und gab Geld für die Renovierung einer Kita. Außerdem zeigte sie Interesse an Kunst. Sie hatte Kontakt mit der hiesigen Galerie aufgenommen, wo sie Bilder junger Künstler kaufte. Es hieß, einige ausgewählte Künstler unterstütze sie auch als Mäzenin.
Obwohl sie erst wenige Wochen in der Stadt lebte, hatte sie schon einen Ruf. Es war kein guter, und sie musste ihn mitgebracht haben, denn in Hainburg hatte sie sich bisher nichts zuschulden kommen lassen. Sie sei unverheiratet und habe Affären mit Männern und Frauen geführt, erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand. Leidenschaftliche, aufreibende Geschichten. Ein bekannter Tänzer sei darunter gewesen, eine ungarische Diplomatin und auch dieses neue Mey-Model für Herrenunterwäsche.
Am allermeisten aber wurde über jenen Komponisten getuschelt, von dessen Selbstmord man – seltsamerweise genau zu der Zeit, als Tanya von Rosenfels so überstürzt nach Hainburg gezogen war – in jeder Zeitung lesen konnte. War es Scharfsinn oder Sensationslust, dass der Physiklehrer beide Ereignisse – den Tod dieses talentierten jungen Mannes und die Ankunft Tanya von Rosenfels’ in der Stadt – miteinander in Verbindung brachte?
Kühne Vermutungen machten die Runde, und zwar nicht nur an unserem Mittagstisch: dass er ihr Liebhaber gewesen sei und sie ihm den Laufpass gegeben habe, was er nicht verwinden konnte. Dass sie … an dieser Stelle verstummte der Physiklehrer kurz, um gleich darauf leiser fortzufahren … etwas von ihm verlangt habe, was er ihr nicht geben mochte. In welche Richtung dieses Etwas wies, konnte man an seinen glänzenden Blicken, den feuchten Lippen ablesen. Es hieß, dass ebendiese Sache einen Skandal in Tanya von Rosenfels’ Heimatstadt ausgelöst habe. Sodass sie schließlich nicht mehr dort bleiben konnte und quasi über Nacht abreisen musste. Hierher – nach Hainburg!
All dies erfuhr ich nun wie gesagt schon seit Wochen in der Mittagspause – zwischen der vierten und fünften Unterrichtsstunde, bei Essensgeruch und Besteckklappern. Ich selbst beteiligte mich kaum an diesen Gesprächen, denn ich wusste nichts. Jedenfalls nichts Genaues. Und ehrlich gesagt: Diese Frau interessierte mich nicht.
Ich hatte sie nur einmal aus der Ferne gesehen. Sie hatte im italienischen Schuhladen gesessen, als ich vorbeigegangen war, und sich hohe Stiefel zeigen lassen. Obwohl ich nur einen kurzen Blick durch das Schaufenster geworfen hatte, war mir ihre Schönheit aufgefallen. Eine ungewöhnlich kühle Schönheit, die mich nicht anzog.
Wann immer seither das Gespräch am Mittagstisch auf sie kam, hatte ich ein leeres Gefäß vor Augen. Ein Gefäß, das nach und nach mit den Vorstellungen und Vermutungen anderer gefüllt wurde. Anders gesagt: Tanya von Rosenfels war mir gleichgültig. Das sollte sich jedoch schlagartig an jenem Tag ändern, an dem sie mich in ihrem Cabrio überholte.
Jetzt, im Nachhinein, sage ich mir, dass nichts meinen inneren Aufruhr rechtfertigte. Nichts. Es war nur ein winziger Zwischenfall an einem ganz normalen Dienstag mitten in der Schulzeit, der aber eine Geschichte in Gang setzte, von der ich noch immer nicht absehen kann, wo sie enden wird. Ich lebe von einer Fortsetzung zur nächsten, und ich frage mich, wann der Moment kommen wird, an dem derjenige, der das Skript zu dieser Geschichte hier schreibt, die Lust verliert und dem Plot zu einem nachlässigen, lieblosen Ende verhilft.
Ich glaube, ich bin an jenem Tag mit etwas infiziert worden, mit einer seltenen Form von Wahnsinn, und langsam frage ich mich, ob an der Geschichte mit dem jungen Komponisten vielleicht etwas dran sein könnte.
Ich fuhr also an diesem Dienstagmorgen in meinem klapprigen VW zum Gymnasium und sah, wie sie sich hinter mir in ihrem schwarzen Flitzer näherte. Ich wusste, dass nur sie es sein konnte, denn ganz Hainburg redete von ihrem nachtschwarzen Cabrio.
Im Rückspiegel sah ich, dass sie ein Tuch im Haar trug. Es hatte eine ungewöhnliche Farbe, nicht pink und nicht orange, sondern irgendwas dazwischen. Flamingofarben, dachte ich. Sie hatte eine Sonnenbrille auf, und ihr Mund war dunkelrot geschminkt. Das Tuch flatterte.
Sie setzte zum Überholen an, und als sie auf gleicher Höhe mit mir war, drehte sie den Kopf in meine Richtung, lachte und rief mir etwas zu. Sie lachte so herausfordernd, dass mir klar war, dass sie auf eine Antwort wartete.
Ich kurbelte das Fenster herunter und rief: »Ich kann Sie nicht verstehen!«
Daraufhin machte sie ein merkwürdiges Zeichen: Sie malte ein Viereck in die Luft, so groß wie ein Fenster. Dann lachte sie wieder, rief noch etwas, warf mir eine Kusshand zu und brauste vorbei. Ich versuchte dranzubleiben, aber mein Wagen fing an zu keuchen und zu stottern, und hastig ging ich vom Gas.
Vielleicht wäre nichts weiter passiert, vielleicht hätte die Geschichte an dieser Stelle geendet und ich wäre ganz normal geblieben, wenn mir Tanya von Rosenfels nicht am selben Abend auf der Benefizveranstaltung fürs Kinderkrankenhaus wiederbegegnet wäre.
Ich war nicht zum Vergnügen dort. Ich hatte an der Schule nur eine Vertretungsstelle, ich arbeitete Halbzeit. Ein paar Stunden Biologie, ein paar mehr Stunden Deutsch. Zu wenig, um davon leben zu können. Deshalb war ich auf einen Nebenverdienst aus. Im Flinken Boten waren in einer Annonce Redakteure gesucht worden, und ich hatte nicht lange gezögert. So schrieb ich nun Woche für Woche Kulturbeiträge für den Lokalteil der Zeitung. Die Benefizveranstaltung war ein wichtiges Ereignis, zu dem die zahlungskräftige Elite der Stadt eingeladen war, und ich sollte für den Flinken Boten darüber berichten.
Ich betrat den Saal mit meiner Pressekarte und ließ den Blick wandern. Der Chefredakteur hatte nicht übertrieben: Alles, was in Hainburg Rang und Namen besaß, war vertreten. Das Bürgermeisterehepaar, der Zahnarzt und sein Lebensgefährte, der Schuldirektor mit seiner Frau, die mir freundlich zunickte.
Alle waren ordentlich herausgeputzt: Die Männer trugen maßgeschneiderte Anzüge, die Frauen funkelten in bodenlangen Abendkleidern. Das Licht kam von verschiedenen im Raum verteilten Spots, die langsam ihre Farben wechselten: von Gelb zu Orange ins Rot. Von Rot zu Grün ins Blau. Die Tanzfläche war gut gefüllt. Eine Band auf einem Podest spielte Rumba und Foxtrott.
Tanya von Rosenfels entdeckte ich an der Bar. Sie tanzte nicht. Sie trank Champagner und beobachtete die Tanzenden. Sie stand in einem eisblauen Kleid, und sie stand allein. Das Licht wanderte über ihren Körper, von Rot zu Grün ins Blau. Die Pailletten an ihrem Kleid sahen aus, als würden sie glühen.
Ich erinnerte mich an das Cabrio. An das merkwürdige Fenster-Zeichen, das sie mir aus dem Wagen heraus gemacht hatte. Vor allem aber an den lachenden, brennend roten Mund unter der Sonnenbrille, ein Rot, das aus ihrem weißen Gesicht herauszuspringen schien.
Ich ging zu ihr hin. Irgendetwas ritt mich, vielleicht hatte ich das Gefühl, ich dürfte ihr einfach so ein Gespräch anbieten, nachdem wir uns schließlich bereits Zeichen durchs Autofenster gaben, jedenfalls sagte ich lächelnd: »Guten Abend. Darf ich mich vorstellen? Christian Konrad.«
Sie schaute kurz zu mir, auf meine ausgestreckte Hand, dann sah sie wieder auf die Tanzfläche. Ich ließ die Hand sinken.
»Ich unterrichte Deutsch und Biologie am Einstein-Gymnasium«, versuchte ich es weiter. »Im Augenblick bin ich aber als Journalist hier.« Sie sah immer noch auf die Tanzfläche, als suche sie dort etwas oder jemanden. Ich räusperte mich nervös und fuhr fort: »Möchten Sie vielleicht … tanzen?«
Sie wendete den Blick wieder zu mir, betrachtete mich langsam von oben bis unten. In ihren Augen glänzte Hohn, und ich spürte, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg. Schlagartig wurde ich mir der Schäbigkeit meiner Kleidung bewusst. Je länger sie schwieg, desto unerträglicher wurden mir meine Discounter-Schuhe, der an den Knien dünngeriebene Hosenstoff, der leichthin geöffnete obere Hemdknopf.
Tanya von Rosenfels sah mir ins Gesicht und sagte: »Nein.«
Der gekaufte Schriftsteller
Tanya von Rosenfels sah mir ins Gesicht und sagte: »Nein.«
Als Leon den letzten Satz getippt hatte und vom Laptop hochschaute, stand die junge Frau noch immer bei den Flamingos.
Sie stand mit dem Rücken zu ihm. Ihre Haarspangen glänzten.
Das Kleid war zu kurz. Ein Kinderkleid. Die Sonne kam an zu viel Haut. Die Haut war sehr blass, was er erstaunlich fand. Seit Wochen herrschten Traumtemperaturen, ein Jahrhundertsommer, und diese junge Frau dort sah aus, als wäre sie das erste Mal in ihrem Leben an der Sonne. Sie stand schon seit zehn Minuten an den Gitterstäben.
Es ist selten, dass Zoobesucher bei den Flamingos verweilen.
Flamingos sind zwar schön, das stimmt, sie sind ein Blitzschlag fürs Auge, und wenn die Leute sie von Weitem sehen, stürzen sie zum Gehege, wie angesaugt von der wilden Farbe des Gefieders. Aber sie sind schnell gelangweilt und gehen weiter. Zu den Affen, wo immer was los ist: lautes Geschrei, Gerangel um ein Stück Obst, eine Balgerei. Oder zu den Löwen, bei denen selbst das Gähnen noch gefährlich wirkt.
Flamingos sind harmlos. Meist schlafen sie auf einem Bein, den Schnabel tief im Gefieder. Nichts, was die Aufmerksamkeit lange fesselt.
Die junge Frau sah sich um, es war kein Mensch da, nur er, Leon, aber ihn konnte sie hinter den Rhododendronbüschen nicht sehen, und dann legte sie die Hände um zwei Gitterstäbe und fing an, wild daran zu rütteln. Das ganze Gitter krachte und wackelte.
Die Flamingos schreckten hoch, kreischten und rannten hektisch durcheinander. Die Tiere in den Nachbargehegen wurden sofort angesteckt. Fingen an zu trillern, schnattern, heulen, brüllen.
Die junge Frau war zurückgetreten. Ihre Hände hingen unschuldig an den Seiten herunter. Sie schaute sich heimlich um. Familien kamen angerannt, um sich die Ursache für das Spektakel anzusehen. Als sich die Frau ein bisschen zur Seite drehte, sah er, dass sie grinste. Sie war wirklich sehr jung, fast noch ein Mädchen. Verstohlen beobachtete sie das Durcheinanderflattern der Flamingos, beobachtete die Nervosität der Leute, und ja, es war offensichtlich: Sie freute sich diebisch. Als sie sich kurz in Leons Richtung drehte, war ihm, als hätte ihr Blick ihn gestreift, aber er konnte nur die Rhododendren berührt haben, denn er, Leon, saß dahinter. Gut verdeckt.
In dem Moment erinnerte er sich wieder, dass er nicht zum Vergnügen hier saß, sondern um Geld zu verdienen.
Vor wenigen Wochen hatte er sein drittes Buch vollendet.
Still, man beobachtet uns war ein Roman über einen Mann, der in einem Hochsicherheitsgefängnis lebte. Fünfhundert Seiten, und er hatte zwei Jahre daran gearbeitet. Das Buch hätte im September erscheinen sollen. Im Juni ging der Verlag pleite.
Sein erstes Buch war vor fünf Jahren dort herausgekommen: Buchstabenwut. Ein Erzählband über einen Schriftsteller, der aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten hat zu schreiben.Der Band war schlecht gelaufen. Gerade mal dreihundert Bücher von den insgesamt dreitausend der ersten Auflage waren über die Ladentische gegangen. Seither stagnierte der Verkauf, und die restlichen Exemplare verstaubten im Lager. Dabei hatte der Verlag viel Geld in Buchstabenwut investiert. Es war ein Hardcover mit aufwändig gestaltetem Einband geworden, der Titel als glänzender Prägedruck in edlem Dunkelblau. Ein Augenschmaus. Dennoch. Buchstabenwut lag wie Blei in den Regalen. Hinzu kamen Verrisse in der Presse.
Er hatte seiner Verlegerin die Enttäuschung über den Misserfolg angemerkt. Zwar war sie weiterhin herzlich zu ihm gewesen, doch die spontanen Einladungen zum Abendessen, die sie vorher so häufig ausgesprochen hatte, waren seltener geworden und schließlich ganz ausgeblieben. Manchmal, wenn er im Verlag angerufen hatte, und eine Volontärin war an den Apparat gegangen, beschlich ihn das Gefühl, die Verlegerin säße im Raum, machte der Volontärin aber stumme Zeichen, dass sie nicht zu sprechen sei. Nicht für ihn – Leon Walsky.
Aber vielleicht hatte er sich alles auch nur eingebildet. Misserfolg macht ängstlich. Vielleicht sogar paranoid.
Wenn sie sich zufällig in der Stadt begegnet waren, hatte Leon die blasse Haut der Verlegerin und ihre Augenringe bemerkt. War das eigentlich der Moment gewesen, an dem er zu ahnen begann, dass es dem Verlag finanziell nicht gut ging? Er, Leon, hatte die Augenringe irgendwie auf sich zurückgeführt; er hatte sich wegen des grandiosen Misserfolgs von Buchstabenwut schuldig gefühlt.
»Weinerlich«, schrieb die Presse über das Buch. »Peinliche Nabelschau.« Und: »Zäh und langweilig! Schriftsteller, die über scheiternde Schriftsteller schreiben – gähn!«
Er müsste lügen, wenn er behaupten würde, dass es ihm gleichgültig gewesen wäre. Er hatte gelitten.
Doch dann.
Dann war alles anders geworden.
Als es schien, dass er, Leon Walsky, sang- und klanglos untergehen würde, da vollbrachte er ein Wunder! Es gelang ihm, das Ruder herumzureißen und quasi über Nacht zum Shootingstar zu werden, und zwar mit seinem überragenden zweiten Manuskript!
Doch er wusste: Für diesen Erfolg hatte er etwas Unverzeihliches getan, etwas … Ungeheuerliches. Etwas, das er vergessen wollte …
Aber alles, was man vergessen will, heftet sich nur umso hartnäckiger im Gedächtnis fest, während Ereignisse, die man gern behalten würde, einem oft mit erschütternder Beiläufigkeit verloren gehen. Er, Leon, wusste noch ganz genau, was er für dieses zweite Manuskript getan hatte. Es stand wie mit Ätzmittel auf die Innenwände seiner Augenlider geschrieben.
Nicht daran erinnern, nicht daran erinnern, nicht …
Schnell an etwas anderes denken! Vielleicht daran, wie gut damals alles gelaufen war. Wie … wie im Märchen!
Einige Wochen nach dem verheerenden Misserfolg von Buchstabenwuthatte er seine Verlegerin angerufen. Zufällig war sie selbst ans Telefon gegangen, konnte sich dieses Mal also nicht verleugnen.
»Frau Santowski, ich muss mit Ihnen reden …«
Sie hatte ihn in ihr Büro gebeten.
Nervös war er dort erschienen. Aber auf eine andere Weise nervös als all die Male zuvor, die er in diesem Büro gesessen hatte. Kaum saß er, hatte er ihn schon aus seiner Kollegmappe gezogen: einen schmalen Stapel bedruckter Blätter. Sein neues Manuskript. Das zweite. (Das legendäre zweite, wie es später heißen würde.)
Auf dem Deckblatt stand:
Die schwarze Augenmaske
Eigentlich ist der Titel völlig bescheuert, hatte er im selben Moment gedacht. Die schwarze Augenmaske – das klang doch wie ein angestaubter Kriminalroman!
Seine Verlegerin war völlig überrumpelt gewesen. Sie hatte den Stapel genommen, jedoch mit spürbarem Zögern. Und in jenem Zögern hatte Leon erkannt, wie schlecht es wirklich um ihn bestellt war. Es war klar, dass sie nichts mehr von ihm veröffentlichen wollte, nur noch überlegte, wie sie es ihm schonend beibringen konnte.
Doch bevor auch nur ein Wort von ihr kam, hatte er hastig gerufen: »Frau Santowski, lagen konnte, hatte er gesagt: " agen konnte, hatte er gesagt: "Bitte lesen Sie die ersten drei Seiten!"hr von ihm veröffentlicesen Sie die ersten drei Seiten. – Nur die ersten drei!«
»Wie … Sie meinen jetzt?«
»Tun Sie mir den Gefallen. Bitte!«
Unwillig hatte sie sich die erste Seite vorgenommen, und dann konnte er ihr dabei zusehen, wie sie anfing zu lesen und wie mit jeder Minute, die verging, der Missmut aus ihrem Gesicht schwand, wie er erst einem vorsichtigen Erstaunen und schließlich purer Begeisterung wich.
Sie las nicht nur drei Seiten, sie las das ganze erste Kapitel. Dann las sie das zweite. Dann senkte sie das Manuskript und sah ihn an. Auf ihrem Gesicht lag Verblüffung.
»Herr Walsky«, sagte sie, »ich muss sagen, ich hätte nie … vor allem nach dem Erzählband über Schriftsteller, die Schwierigkeiten haben zu … Wie haben Sie das …«
Er war rot geworden – er hatte es gespürt. Das Blut war ihm heiß ins Gesicht gestiegen. Sie hatte das offenbar als Bescheidenheit gedeutet, denn sie lächelte ihn strahlend an.
»Ich dachte, dass ich …«, hatte er gestammelt. »Dass ich … na ja, mich irgendwie verändern müsste. Die Bandbreite erweitern. Neue Wege gehen. – Drucken Sie es?«
»Herr Walsky! Ich wäre verrückt, es nicht zu tun!«
Die schwarze Augenmaske war, wie sagt man so schön: durch die Decke gegangen. Ein Überraschungserfolg. Über Nacht war das Buch plötzlich in aller Munde. Die erste Auflage – fünftausend Stück – ging schneller weg als Erdbeereis im Hochsommer.
Aber dieser Erfolg, das wusste er genau, hatte seinen Preis. Er hatte etwas dafür getan, an das er nicht denken wollte … Nein, nicht daran …
Lieber … lieber an die Presse! Wie sie sich auf das Buch stürzte! Es war natürlich nicht das Feuilleton gewesen. Es war die Publikumspresse.
»Die erotische Entdeckung der Saison! –« titelte die Marie Claire.
»Fesselt die Sinne …«, stand in der Bild der Frau.
»Raffiniert und voller erotischer Verwicklungen!« Das schrieb die Petra.
Er war eingeladen worden zu Talkshows, hatte im Radio Interviews gegeben und sogar im Nachtfernsehen aus dem Buch gelesen. Sein Erfolg … der war etwas Verrücktes gewesen, hatte auf ihn selbst, Leon, offenbar abgefärbt und ihn strahlend schön gemacht wie einen Goldpokal, den man gern herumzeigte.
Seine Verlegerin hatte die unglaubliche Elizabeth Hull engagiert, ja, diese extrem begehrte Berliner Fotografin, die ganz und gar andere Pressefotos von ihm machen sollte. Er erinnerte sich, wie er die junge Wilde anstaunte mit ihrem blauschwarzen, raspelkurzen Haar und den ganzen Piercings in Nase, Oberlippe und Kinn!
Elizabeth Hull hingegen hatte die Brauen gehoben, als sie seinen Anzug und seine Frisur sah. Hatte mit flinken Fingern erst seine Krawatte gelockert und dann einen Knopf zu viel an seinem Hemd geöffnet. Er hatte steif dagestanden und wollte protestieren, doch da war sie ihm mit der Hand in sein sorgsam gekämmtes Haar gefahren, hatte es verwirbelt und die Wirbel mit so viel Haarspray fixiert, dass er niesen musste. Und dann hatte sie ihn von links nach rechts durchs Studio gehetzt, hatte ihn hocken, sitzen, liegen, stehen lassen, hatte alle möglichen Positionen probiert und doch kein einziges Foto gemacht, bis er schließlich außer Atem, verschwitzt und ziemlich sauer war. Und in dem Moment, als er dachte, er würde einfach seine Tasche nehmen und abhauen – da drückte sie ab. Eine Salve aus Fotoschüssen, die ihn traf, sein erschrockenes Gesicht, die hochgerissenen Hände – und als er später diese Bilder gesehen hatte, war er verblüfft gewesen: Da stand nicht Leon Walsky, wie er ihn jetzt schon seit dreißig Jahren kannte: schmal, blass und korrekt. Da stand ein unbekannter Mann. Einer, der Verwegenheit ausstrahlte wie ein Radiator Hitze, einer, der die Energie nur mit Mühe zurückzuhalten schien. Seine Verlegerin ließ das Foto auf die Klappe der zweiten Auflage der schwarzen Augenmaskedrucken.
Wie gern er an jene Zeit zurückdachte. An die Berge von Fanpost, die er bekommen hatte. An die schmeichelhaften Artikel in den Zeitungen, an die strahlenden Gesichter bei seinen Lesungen.
Aber all das war nun schon über vier Jahre her, und der Buchmarkt war ein hartes Geschäft mit Kurzzeitgedächtnis. Das jedoch erkannte er erst, als er sich nach der Insolvenz seiner Verlegerin mit dem nun heimatlosen dritten Roman Still, man beobachtet uns an andere Verlage wendete. Keiner wollte das Manuskript. Und keiner schien sich an seinen Namen zu erinnern. Leon Walsky? Nie gehört!
Erst hatte er es nicht glauben wollen. Er war ein Star! Vor vier Jahren hatte man einen ganzen Sommer lang Die schwarze Augenmaske gefeiert!
»Ach?«, fragte der ein oder andere Lektor und musterte Leon interessiert. »Sie haben das geschrieben?«
Wie konnte das sein? Wieso war sein Name vollkommen unwichtig geworden? Wieso war er aus dem Bewusstsein verschwunden? – So viele hatten Die schwarze Augenmaske geliebt!
Aber so viele mögen auch den Song San Francisco von Scott McKenzie, dachte er. Oder Oh Happy Day von Edwin Hawkins. Zwei der bedeutendsten musikalischen Eintagsfliegen. Jeder kennt die Songs, keiner die Künstler. Und was war eigentlich aus Fool’s Garden geworden? Die hatten nach Lemon Tree andere Songs geschrieben,andere Alben veröffentlicht, aber wer kaufte sie?
Er, Leon Walsky, wollte kein literarisches One-Hit-Wonder werden! Er musste etwas unternehmen.
Und so beschloss er, nicht mehr allein weiterzusuchen, und schickte das Manuskript stattdessen an einen Literaturagenten, der es las und ihn beruhigte.
»Das bekomme ich unter«, sagte er am Telefon. »Ich meine: Sie sind schließlich der Autor von Die schwarze Augenmaske! Bereits in Kürze wird der Name Leon Walsky wieder in aller Munde sein!«
Doch Wochen vergingen und schließlich Monate, ohne dass etwas anderes geschah als der frustrierende Freitagsanruf des Agenten: »Absagen, Leon, leider nur Absagen. – Die Verlage sind schon interessiert, das ist es nicht«, sagte er vorsichtig. »Aber sie wollen etwas wie die Augenmaske. In Ihrem neuen Manuskript sehen sie diese Fabulierlust nicht, nicht das Freche und Sinnliche, was Die schwarze Augenmaskehatte.«
Leon fluchte. Diese verdammte Augenmaske. Sie stand ihm im Weg!
Langsam wurde das Geld knapp, es ging an seine Ersparnisse. Und als Leon nach einer Weile begriff, dass er vielleicht mit einer größeren finanziellen Durststrecke zu rechnen hätte, gab er seine Zweizimmerwohnung auf und zog in ein winziges Räumchen. Es befand sich in Kreuzberg, gleich über der Scharfen Ecke. Es gab keine Dusche, nur ein Waschbecken, so groß wie ein Schuhkarton. Das Klo zu seinem Zimmer lag außerhalb der Wohnung, eine halbe Treppe tiefer. Wenn man die Spülung betätigte, klang es, als würde tief im Gedärm des Rohrsystems etwas röcheln, und dann rülpste Wasser in Schwallen aus dem Kasten. Das Zimmer war winzig und schäbig, aber billig. Die Fenster waren undicht. Wenn Wind ging, klapperten sie. In den Ecken rollte sich die Tapete zusammen. Nachts hörte er die Musik und das Grölen der Kneipenbesucherdurch die Bodenbretter.
Jeden Tag kaufte er Zeitungen und verbrachte Stunden damit, Stellenangebote durchzulesen und Telefonnummern anzustreichen. Doch er rief nirgendwo an. Er konnte nicht.
Er war Schriftsteller. Etwas anderes zu tun als schreiben, kam für ihn einem Scheitern gleich. Er wollte nicht gescheitert sein!
Aber er brauchte eine Ablenkung, um im Warten auf den Freitagsanruf seines Agenten nicht den Verstand zu verlieren. Und indem er nun jeden Morgen sein Kämmerchen verließ und Tageszeitungen kaufte, um sie dann auf dem splitterigen Holzboden auszubreiten und Stunden damit zuzubringen, Telefonnummern anzustreichen, die er nie anrief, konnte er sich einbilden, der Tag verliefe nicht umsonst, und er täte etwas Sinnvolles.
Doch sein Konto schrumpfte.
Und als er eines Tages feststellte, dass er die nächste Monatsmiete von hundertfünfzig Euro nicht mehr zahlen konnte, brachte er die letzten sorgfältig zusammengefalteten Zeitungen hinaus in den Papiercontainer und kaufte keine neuen mehr. Er kaufte auch keine Lebensmittel; er aß, was da war, und verließ das Zimmer gar nicht mehr. Er lief den ganzen Tag in dem kargen Raum auf und ab.
Das Zimmer bot genug Platz zum Gehen, denn es war mit den Monaten lichter geworden. Nach und nach hatte Leon seine Möbel verkauft: den herrlichen Schrank aus den Zwanzigerjahren, seinen geschnitzten Eichenschreibtisch, den er sich von dem Preisgeld für Die schwarze Augenmaskegekauft hatte und dessen Verlust ihm wirklich ans Herz ging, den mannshohen Jugendstilspiegel. Am Ende musste er auch das Geschirr und den Drucker verkaufen, den Fernseher und seine Kamera, und als gar nichts mehr zu Geld zu machen war, hatte er sich von seinen Hosen und Anzügen getrennt. Nun war nichts mehr übrig als eine nackte Matratze und ein Schlafsack auf dem Boden, das Zeug, das er am Leib trug, und sein Laptop. Den Laptop zu verkaufen, wäre der Kapitulation gleichgekommen. Er, Leon, war ein sinkendes Schiff, doch sein Laptop war der Kapitän, und dieser würde das Schiff als Allerletzter verlassen. Doch nun gab es nichts mehr zu veräußern, sein Zimmer war so leer wie sein Konto. Er war am Ende.
Am Ende.
Er, Leon Walsky, hatte versagt.
Und als er das gedacht hatte, konnte er aufhören, endlose Runden zu drehen. Endlich wurde er ruhig, setzte sich auf den Boden – einen Stuhl besaß er ja nicht mehr – und sah an die Tapete. Er schaute ganz starr und legte die Hände flach auf die Bodenbretter. Der Schatten der Birke vor dem Fenster lief langsam über die Wand. Leon schaute, bis die Rankenmuster der Tapete sich ablösten. Sie verschlangen sich, und irgendwann war ihm, als führte das Rankengeflecht nicht mehr auf der Oberfläche der Wand entlang, sondern tief in die Mauersteine hinein, denn sein Blick folgte ohne Mühe, ging gleichsam durch die Wand, in einen versteckten Spalt, der in einen Tunnel mündete, in ein heimliches, unergründbares Labyrinth hinter der Tapete …
Und in jenem Moment, als Leons Geist zu entrücken, als er in einer Art Trance zu versinken drohte, weil die Ranken sich vor seinem Blick zu drehen begannen und einen Strom, einen Strudel bildeten, an dessen Rändern das Zimmer sich auflöste, einen Sog, der ihn immer näher, immer tiefer zog – klingelte das Telefon.
Er zuckte zusammen.
Die Wand war wieder flach, die Ranken standen still.
Am anderen Ende war sein Agent.
»Hören Sie zu, Leon«, sagte er. »Zuallererst: Nein, ich hab noch immer kein Angebot. Ich hab alle großen und mittelgroßen Verlage abgegrast. Nur Absagen. Ich versuche es jetzt bei den kleinen.« Leons Herz sank. »Aber ich hab da was anderes für Sie«, fuhr sein Agent fort. »Keine Ahnung, ob es nur ein Scherz ist. Heute rief eine Frau an, sie nannte sich Tanja R. – Ja, R Punkt. Kein richtiger Nachname. Sie scheint jedenfalls ein Fan von Ihnen zu sein, fragte, ob nicht bald ein neues Buch herauskäme, und als ich ihr die Lage erklärt hatte, gab sie mir ihre E-Mail-Adresse durch. Sie sagte, sie wäre wohlhabend und habe großes Interesse an Ihren Texten. Sie sollen sie kontaktieren, sie will Ihnen etwas abkaufen. Haben Sie Interesse? Soll ich Ihnen die E-Mail-Adresse geben?«
Leon schrieb ihr sofort. Er schrieb von Still, man beobachtet uns und dass sie das Manuskript gern lesen dürfe. Sie wäre die Erste, die es zu Gesicht bekäme. Er fragte schamlos, was sie dafür zahlen würde.
Schon eine Stunde später schrieb sie zurück.
Sie schrieb, sie würde seitenweise bezahlen. Pro Seite zwanzig Euro.
Leons Herz hämmerte. Das Angebot war gut. Das Manuskript umfasste nahezu fünfhundert Seiten, und wenn sie ihre Ankündigung wirklich wahr machte, wäre er über Nacht sämtliche Probleme los.
Doch als er weiterlas, sah er, dass die Sache einen Haken hatte.
Tanja R.: Vielen Dank für das durchaus verführerische Angebot. Aber ich bin nicht interessiert an Still, man beobachtet uns. Ich bin Sammlerin. Sammlerin besonderer Texte. Mein Interesse gilt Geschichten, die man ausschließlich für mich schreibt. Und genau dafür werde ich Sie bezahlen. Wenn mir gefällt, was Sie schreiben, erhöhe ich das Seitenhonorar. Das heißt aber auch, dass ich die Richtung der Geschichten vorgeben und deren Verlauf bestimmen kann. Wenn mir eine Figur nicht gefällt, kann ich von Ihnen verlangen, sie abzuändern, ich kann Einfluss auf den Konfliktverlauf nehmen, und ich kann das Ende herbeiführen, verändern oder aufheben. Der Rest jedoch liegt völlig in Ihren Händen. Schließlich sind Sie der Schriftsteller. Ich würde mich freuen, wenn Sie mein Angebot annehmen würden. Wenn Sie mögen, können Sie mich als Ihre Mäzenin betrachten. Herzliche Grüße, Tanja R.
Leon war erst erstaunt. Dann beleidigt. Schließlich wütend.
So eine Anmaßung!
Man schrieb Geschichten nicht, wie man Brot backte!
Mäzenin – er lachte trocken auf.
Er beschloss, dieses Angebot zu ignorieren. Er tat es. Er antwortete nicht, saß stattdessen wieder reglos in seinem Zimmer, starrte an die Tapete, die jedoch still blieb, die Ranken verharrten in ihrer gemalten Position, und er wartete auf ein Wunder. So vergingen weitere zwei Wochen. Am Ende des Monats hatte er nur noch Mehl und etwas Zucker in seinem Schrank, und ihm wurde übel vom Geruch der täglichen Mehlsuppe.
Und eines Nachmittags klopfte es an der Tür. Als er nicht öffnete, drehte sich plötzlich ein Schlüssel im Schloss, und sein Vermieter stand mitten im Raum!
Seinem Vermieter gehörte das ganze Haus. Nicht nur die Wohnungen darin, sondern auch die Kneipe im Erdgeschoss. Die Scharfe Ecke. Dort hatte Leon ihn oft am Tresen stehen sehen, und diesen Mann mit seinem tätowierten Nacken, den Muskeln, die das Achselshirt spannten, und der heftigen Hitze, die er abstrahlte, zutiefst faszinierend gefunden. Er hatte sich schon öfter dabei ertappt, wie er von draußen durchs Fenster in die Kneipe hineingestarrt und versucht hatte, sich jede Einzelheit an diesem Kerl zu merken, den das Testosteron wie ein unsichtbarer Sprühnebel zu umgeben schien. Eine Figur, hatte er oft gedacht. Der könnte eine Romanfigur sein, aber bevor der Gedanke in ihm Wurzeln schlug, hatte Leon sich jedes Mal vom Fenster wieder abgewendet und die Kneipentür nicht geöffnet, sondern war stattdessen in den Hausflur getreten und die ausgetretenen Treppenstufen bis zu seiner Wohnung emporgegangen.
Und dieser Mann, dieser Turm von einem Mann stand jetzt in seinem niedrigen Zimmer!
Das erste Mal seit Tagen kam wieder Bewegung in Leon. Er schreckte aus seiner Lethargie auf, erzählte eine haarsträubende Geschichte von einem Überfall, erzählte, ein hässlicher Typ, nein, gleich eine ganze Gang hätte ihm aufgelauert und sein Portemonnaie gestohlen, die Kreditkarte, den Ausweis, alles Drum und Dran, er erzählte, dass er sein Konto zur Sicherheit hätte sperren lassen und nun selbst nicht an das Geld herankäme, dass sich aber bis nächste Woche garantiert alles wieder lösen ließe. Irgendetwas musste an seiner Stimme gewesen sein – jedenfalls entschloss sich der Vermieter tatsächlich, das zu glauben, nicht ohne jedoch zu drohen, ihn sofort auf die Straße zu setzen, wenn das Geld nicht in den nächsten sieben Tagen eintrudeln würde. Leon sah ihm hinterher, betrachtete die Tätowierung in seinem Nacken, einen Tiger mit gestreckten Krallen, und hatte das Gefühl, einem wilden Tier entkommen zu sein.
Als die Tür hinter dem Vermieter zugefallen war, gab Leon seinen Widerstand auf. Er schrieb Tanja R., er sei einverstanden, und fragte, was genau sie von ihm lesen wolle.
Schon eine halbe Stunde später war die Antwort da.
Tanja R.: Es freut mich, dass Sie sich mein Angebot doch noch überlegt haben. Ich wünsche mir etwas Erotisches von Ihnen. Denken Sie sich etwas aus. Fassen Sie es in Worte. Sie sind Schriftsteller, also sollte Ihnen das nicht schwerfallen. Vor allem nicht nach Ihrem erotischen Bestseller Die schwarze Augenmaske!
An der Stelle musste er schlucken. Er hatte es geahnt: Irgendwann würde er den Preis zahlen müssen.