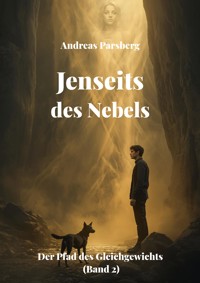4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Spiel der Dämonen
- Sprache: Deutsch
Als ein uraltes Ritual den Dämon Chimay zurück in die Welt ruft, gerät der siebzehnjährige Cedric aus Germering in den Strudel des Übernatürlichen. Er hat keine Wahl: Vor den Augen des finsteren Wesens muss er dem "Spiel der Dämonen" zustimmen, einem Wettstreit um Leben und Tod, in dem nicht nur sein Schicksal, sondern das der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht. Das erste Spiel führt ihn durch eine Zeitreise ins Schottland des Jahres 1601. Dort findet er sich in einer Welt wieder, in der alte Flüche, blutige Rituale und dunkle Magie zum Alltag gehören. Zwischen zerfallenen Burgen, geheimen Gängen und vergessenen Gruften trifft er auf die schöne, aber tödliche Lady Grizel Seton, die Hexe, die Tote aus ihren Gräbern ruft. Er begegnet dem stolzen Geist von William Wallace, der ihm die Kraft des Schwertes schenkt, und der geheimnisvollen Lady Eileen, die sein Herz berührt. Doch der Weg zum Sieg ist grausam: Cedric muss gefesselt auf dem Opfertisch dem Blutritual der Hexe entkommen, sich Zombies entgegenstellen, Geister beschwören und sich schließlich seiner größten Prüfung stellen, dem Schwertkampf gegen Chimay, den Dämon selbst. Nur wenn er siegt, kann er das erste Spiel gewinnen! Doch der Preis ist hoch, und Cedric erkennt, dass Mut und Schwertkunst allein nicht reichen. Um zu überleben, muss er lernen, sich selbst zu vertrauen. Ein packender Roman voller dunkler Geheimnisse, gefährlicher Prüfungen, unheimlicher Rituale und zeitloser Abenteuer. Magie, Schwertkampf und der uralte Kampf zwischen Gut und Böse, mit Cedric im Zentrum eines Spiels, das niemand ungestraft spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andreas Parsberg
Fluch der Hexe
Das Spiel der Dämonen (Band 1)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Impressum neobooks
Prolog
Karl V. aus dem Hause Habsburg war im Jahr 1530 von den Händen des Papstes selbst zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt worden. Die Krönung hatte Glanz, Pracht und das Gewicht einer neuen Epoche in sich getragen.
Doch kaum war die Tinte auf den Urkunden getrocknet, überraschte der junge Herrscher mit einem Befehl, der wie ein Donnerschlag durch die Hallen der Macht hallte: Chimay, Herzog von Croy, sollte mit sofortiger Wirkung den Hof verlassen.
Der Bann kam unerwartet und traf den gesamten Adel ins Mark. Denn gerade dieser Herzog war es gewesen, der den Knaben Karl unterrichtet, ihm die Bücher der Alten aufgeschlagen, ihm Disziplin beigebracht und ihn durch die Wirren seiner Jugend geführt hatte. Als Erzieher und enger Vertrauter hatte er den Thronfolger wie ein zweiter Vater begleitet, und nun wurde er ohne Gnade verstoßen.
Mit dem Ausschluss verlor Croy zugleich seine glänzenden Titel: den Rang als Ritter des spanischen Ordens vom Goldenen Vlies, das Amt des Baillis und das Großkreuz des souveränen Malteser-Ritterordens. Was einst an seinem Wams geglänzt hatte, lag nun wie wertloser Staub zu seinen Füßen.
Manch einer am Hof wagte, hinter vorgehaltener Hand zu flüstern, der Kaiser zeige sich undankbar. Doch wer Karl V. näher kannte, wusste, dass er nicht vergaß. Er hatte die Stockschläge im Unterricht nicht vergessen, die endlosen Strafaufgaben, die bitterkalten Nächte in der Kapelle, wenn der Herzog ihn kniend zur Buße zwang. Die Erinnerungen an Demütigungen, die in seiner Kindheit wie eiserne Fesseln gelegen hatten, ließen sich nicht mehr abschütteln.
So blieb Croy nichts, als sich in die Schatten seiner eigenen Ländereien zurückzuziehen. Dort, fern vom Glanz des Hofes, begann sich der Mann zu verwandeln. Aus dem gebildeten und höfischen Mentor wuchs ein von Groll zerfressener, zorniger Geist. Der Edelmann wich, und an seine Stelle trat ein Mann, der nur noch Hass kannte.
Bald schon verbreiteten sich unheilvolle Gerüchte. Reisende sprachen von Menschen, die verschwanden. Bauern flüsterten am Feuer, dass der Herzog Unschuldige entführte, sie in finsteren Kammern foltern ließ, nur um ihren Schmerz zu kosten. Grausam zerstückelt, hieß es, habe er sie zurückgelassen.
Ein Name haftete bald an ihm wie Pech: „Der Schreckliche“.
Karl V., der einstige Zögling, nun mächtiger Kaiser, duldete dieses Treiben nicht länger. Er sandte seine Leibgarde aus, die den Herzog fassen sollte. In Eisen gekettet, wurde Croy vor die Gerichtsbarkeit des Kaisers gezerrt. Unter den Qualen der Folter brach er zusammen und bekannte alle Gräueltaten mit bebender Stimme. Es gab kein Erbarmen: zum Tode verurteilt, seiner Würde beraubt, wurde er von der Kirche exkommuniziert.
Doch die Strafe war grausamer als bloße Hinrichtung. In der Abtei St. Laurentius, dort, wo Weihrauch die Mauern tränkte und Glocken die Stille brachen, ließ man ihn lebendig einmauern. Stein um Stein verschloss sein Grab, ohne dass er tot war. Was übrig blieb, war kein Mensch mehr. Er verlor seine Seele, verließ das Licht – und diente fortan den Mächten der Schattenwelt.
Die Zeit des Herzogs von Croy, so schien es, war zu Ende. Die Chronisten setzten den Schlusspunkt, die Menschen atmeten auf.
Doch sie irrten.
Denn Finsternis gibt nicht auf. Sie flackert nicht wie eine Kerze im Wind, sie lauert, sie wartet.
Und so harrte der Eingemauerte in den feuchten Kellergewölben der Abtei. Jahr um Jahr, Jahrhundert um Jahrhundert. Kein Atemzug alterte ihn, kein Sonnenstrahl berührte ihn. Er wartete. Er überdauerte. Er hoffte auf Erlösung – oder auf eine neue Stunde der Rache.
Im Nordwesten der kleinen Stadt Germering lagen zwei stille Orte, die im Sommer von Spaziergängern und Familien gern besucht wurden: der künstlich angelegte Germeringer See, an dessen Ufer Libellen im Schilf tanzten, und der kleine, bewaldete Parsberg, ein dichtes Stück Natur, das wie eine grüne Insel aus der Stadt emporragte.
Mitten in diesem Wald erhob sich, halb verborgen von Bäumen und Efeu, die alte Abtei St. Laurentius. Ihr graues Mauerwerk wirkte, als sei es aus der Zeit gefallen, und die Bewohner der Stadt erzählten sich seit Jahrhunderten, dass tief unter dem Kloster geheime Gänge und Gewölbe verliefen, in denen unheimliche Dinge geschahen. Man sprach von Schatten, die dort hausten, von Stimmen, die in der Dunkelheit wisperten.
Als nun eine Renovierung anstand, hatte die ortsansässige Baufirma von Reimund Haas den Auftrag abgelehnt. Man solle die maroden Kellertreppen abstützen, hieß es, doch der Firmenchef winkte ab.
Josef Kistler, erst seit einem Jahr Bürgermeister, saß ihm im Rathaus gegenüber. Ein gedrungener Bau aus rotem Backstein, in dessen fensterlosen Sitzungssaal das Licht der Nachmittagssonne durch Jalousien strich. Kistler hatte sich vorgenommen, den Bürgern Taten zu zeigen, nicht nur Worte. Die Abtei sollte gerettet werden – und nun sperrte sich der Bauunternehmer.
Reimund Haas, ein freundlicher Mann mit runder Figur und lichter Stirn, räusperte sich und sprach: „Herr Bürgermeister, Sie müssen das verstehen. Die Leute hier sind überzeugt, dass es in der Abtei spukt. Dämonen, Geister, das hält sich hartnäckig. Meine Männer würden sich weigern, auch nur einen Fuß in die Keller zu setzen.“
Er lachte kurz auf, als wolle er zeigen, dass er selbst nicht an solchen Unsinn glaube, doch seine Miene verriet, dass er die Furcht seiner Arbeiter ernst nahm.
Kistler seufzte und schüttelte den Kopf. „Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine andere Firma zu beauftragen. Die Gelder sind bewilligt, die Arbeiten sollen sofort beginnen.“
„Es tut mir leid, wirklich“, sagte Haas, erhob sich und zog seinen Mantel glatt.
„Schon gut“, antwortete der Bürgermeister. „Die Ausschreibung hat eine Firma aus Tirol gewonnen. Hoffentlich kennen die Österreicher keine Angst vor Gespenstern.“
Mit einem Händedruck verabschiedete er Haas. Groll hegte er nicht. Wie auch? Kistler wusste, dass Geschichten, die sich über Jahrhunderte in den Köpfen festgesetzt hatten, nicht durch ein Amtsblatt verschwanden.
Und im Grunde hatten die Germeringer ja recht. Hinter den Mauern der Abtei lauerte tatsächlich etwas. Man erzählte sich von einem Gerippe mit Knochenhänden, von einem Wesen, das aus den Schatten geboren war, grausam, gierig und voller Freude am Quälen. Jede Generation hatte die Warnung an die nächste weitergegeben.
Die Firma aus Tirol aber nahm den Auftrag ohne Zögern an.
Josef aus Mayrhofen war der stärkste Mann der Truppe. Ein Hüne mit breiten Schultern und Armen wie Baumstämme, dessen Spitzname schlicht „der Bär“ war. Er war es gewohnt, der Erste in den Staub zu gehen, und so setzte er den Pressluftbohrer an der mit Kreide markierten Stelle an.
Das Dröhnen erfüllte das Gewölbe, Staub quoll hervor, und der scharfe Bohrkopf fraß sich in das jahrhundertealte Mauerwerk. Josef trug Maske und Schutzbrille, während seine Kollegen vor dem Portal der Abtei eine Zigarette rauchten. Jeder wusste: wenn Josef den Bohrer ansetzte, tat man gut daran, sich fernzuhalten.
Erst schien die Mauer unbezwingbar, dann gab sie plötzlich nach. Mit einem Krachen brach der Stein, und Josef stürzte in die Schwärze eines dahinterliegenden Raumes.
Hinter ihm krachten weitere Brocken in das Loch, Staub wirbelte auf, und die Decke des Gewölbes erzitterte. Das Fundament der alten Abtei bebte wie ein angeschlagener Gong.
„Josef!“, brüllte einer der Männer, die in den Gang geeilt waren. Durch das Staubgewirr sahen sie nur die verschüttete Öffnung.
„Verdammt!“, fluchte der Vorarbeiter. „Er ist verschüttet. Holt Balken, wir müssen die Wände stützen, sonst stürzt uns die Decke auf den Kopf!“
„Josef! Hörst du uns?“ Doch keine Antwort drang aus der Finsternis.
Im Inneren herrschte lautlose Schwärze. Nur der Pressluftbohrer, noch immer kreischend, spie Funken wie ein sterbender Drache. Josef tastete sich hin, schaltete ihn aus und lehnte schwer atmend an der kalten Wand.
Da erklang ein Laut, der ihm das Herz stocken ließ: ein kehliges, höhnisches Gelächter, das von den Steinen zurückhallte.
Josef wirbelte herum!
Zwei gelbliche Punkte funkelten im Dunkeln. Augen. Stechende Augen. Sein Blut gefror. Ein kalter Hauch strich über seinen Nacken. Er drehte sich, breitete instinktiv die Arme, als könne er so das Unsichtbare fassen. Doch er berührte nur Luft. Wieder dieser eisige Zug.
„Ist da wer?“ Seine Stimme klang brüchig.
Rechts von ihm ertönte ein bösartiges Kichern.
„Da ist jemand“, stammelte er, versuchte, Mut zu sammeln. „Hallo? Bitte … geben Sie ein Zeichen.“
Die Augen rückten näher, leuchteten grell im Zwielicht. Ein fahles Schimmern umhüllte eine Gestalt, die nun vor ihn trat: ein Mann in Mönchskutte, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, nur die unnatürlich strahlenden Augen sichtbar.
„Sind … sind Sie einer der Brüder?“, fragte Josef, doch erhielt nur Antwort in Form eines hallenden Lachens, das ihm den Magen umdrehte.
Das Wesen trat heran. Es hob skelettartige Hände, knochig, weiß wie Kalk, und griff nach ihm. Josef stieß einen Schrei aus, taumelte zurück, Schweiß brach ihm aus.
Der Dämon fletschte die Zähne, Hände wie Krallen, die nach ihm schnappten. Eine riss den Overall auf. Josef schrie panisch, so laut, wie er es noch nie in seinem Leben getan hatte. Das Gelächter schwoll an, füllte den Raum, dröhnte hinter uralten Steinen.
Nach Jahrhunderten des Wartens war die Stunde gekommen. Der Hunger des Wesens war erwacht.
Josef wich zurück, doch die Wand im Rücken nahm ihm jede Flucht. Gelbe Augen starrten ihn an, Krallen schnellten vor.
Er spürte, wie sich Haut und Fleisch an seinem Hals öffneten, warmes Blut über die Brust rann. Mit dem letzten Blick sah er das furchtbare Antlitz, das ihn in den Tod begleitete.
Ein zweiter Hieb, und sein Kopf rollte auf den Boden des Gewölbes.
„Der Schreckliche“ war frei.
Nicht länger gebannt, nicht länger eingemauert.
Sein Ziel: Rache.
Und die Suche nach einer neuen Seele, da ihm seine eigene genommen worden war.
1
Cedric Vogt schlich auf Zehenspitzen den langen, dunklen Korridor des alten Hauses seiner Großmutter entlang. Die Dielen knarrten unter seinem Gewicht, als wollten sie ihm bei jedem Schritt verraten. Mit beiden Armen balancierte er eine Tüte Kartoffelchips, eine große Flasche Cola und zwei Gläser, seine kleine Beute gegen die träge Langeweile, die wie ein bleierner Mantel über den Tagen hing.
„Das sind die langweiligsten Ferien, die ich je erlebt habe“, murrte er, als er ins Esszimmer trat.
Am Tisch saß bereits sein jüngerer Bruder Henri, der gerade die abgegriffenen Skip-Bo-Karten mischte. Er verdrehte demonstrativ die Augen und nickte zustimmend.
„Sag das nicht mir. Sag’s dem Wetter.“
Draußen peitschte der Regen an die Fensterscheiben, unermüdlich, gleichmäßig, wie seit drei Tagen. Ein grauer Vorhang, der die Welt verschluckte.
Cedric ließ sich mit einem tiefen Seufzer auf den Stuhl sinken und griff nach seinen Karten.
„Das ist heute schon das zehnte Spiel.“
„Und wir haben noch nicht mal Mittag“, fügte Henri trocken hinzu.
Drei Tage Regen.
Drei Tage, in denen sie wie Gefangene im Haus der Großmutter hockten.
Morgen würde sie fünfundsiebzig werden, und aus diesem Grund hatten die Eltern beschlossen, eine ganze Woche in Schönthal zu verbringen, in der alten Familienvilla am Rand des Bayerischen Waldes. Bei Sonnenschein hätte man Spaziergänge machen, die Hügel erkunden, vielleicht sogar zum See fahren können. Aber das Wetter machte jede Hoffnung zunichte: Regen, Regen und nichts als Regen.
„Wenn wenigstens Simon schon hier wäre“, murmelte Cedric. Sein älterer Bruder arbeitete in München und konnte erst morgen anreisen.
Der Vater, Geschichtslehrer am Max-Born-Gymnasium, hatte die Ferien für sein Herzensprojekt reserviert: er schrieb an einem Buch. Dafür verlangte er eiserne Ruhe im Haus, und alle mussten Rücksicht nehmen. Cedrics Mutter und Großmutter hatten die Tage mit Besuchen bei Verwandten gefüllt, um dem Hausherrn die Stille zu garantieren.
Für Cedric bedeutete das: Alleinsein mit Henri. Karten. Chips. Cola. Wieder Karten.
Am schlimmsten aber war das Handy. Kein Empfang, nicht mal ein Balken. Keine SMS, kein Facebook, kein Chat mit Freunden. Cedric fühlte sich abgeschnitten von der Welt, als hätte man ihn auf einer einsamen Insel ausgesetzt.
Blöde Einöde! dachte er. Wer lebt schon freiwillig im Bayerischen Wald ohne Netz? Kann man noch überleben ohne Smartphone?
In Wahrheit war es nur eine bestimmte Person, die ihm fehlte: Laura Bertani.
Seit er das erste Mal in die grünen Augen des Mädchens aus der Nebenklasse gesehen hatte, war er verloren. Sie wusste nichts von seinen Gefühlen, doch das störte ihn nicht. In seinen Gedanken malte er sie sich so oft aus, dass er beinahe glaubte, sie säße neben ihm. Lange, mittelbraune Haare, sportliche Figur, diese leuchtenden Augen, sie war für ihn das schönste Mädchen der Schule.
Ein weiterer Seufzer entwich ihm, tiefer als zuvor.
„Hey, Cedy!“ Henri grinste schelmisch. „Du bist dran.“
Cedric blinzelte, verscheuchte Lauras Bild aus seinem Kopf und legte eine Karte. „Sorry, ich war … abgelenkt.“
„Bei der Hübschen aus deiner Schule?“ Henri grinste so breit, dass Cedric sofort rot anlief.
„Das geht dich nichts an.“
„Wieso nicht? Ich find, sie sieht auch großartig aus. Willst du mit ihr gehen?“
„Henri!“ Cedric funkelte ihn an. „Das ist meine Sache!“
„Aber ich hab doch gesehen, wie dein Kopf knallrot wurde, sobald sie in deine Nähe kam.“
„Du kleines Ekel!“ Cedric schnappte sich einen Chip und warf ihn nach seinem Bruder.
Henri kicherte, fing den Treffer ab und feuerte mit einem Chip zurück.
In Sekundenschnelle flogen die Chips wie kleine goldene Scheiben durch die Luft. Henri lachte schallend, Cedric duckte sich hinter dem Stapel Skip-Bo-Karten, die schon halb durchnässt von Cola Spritzern waren.
„Treffer!“ Henri jubelte, als ein Chip Cedric an der Stirn erwischte.
„Das wirst du bereuen!“ Cedric warf zurück, diesmal eine ganze Handvoll.
Die salzigen Scheiben segelten quer über den Tisch, prallten an Stuhllehnen, zerbrachen auf dem Boden. Bald war die Schlacht im vollen Gange. Beide Brüder warfen, lachten, kreischten, ihre Stimmen füllten den Raum mit einer Energie, die sie drei Tage lang zurückgehalten hatten.
Noch während er Chips nachlud, wurde Cedric bewusst, wie albern das Ganze eigentlich war. Aber die Langeweile, die endlosen Runden Skip-Bo, die ständige Rücksichtnahme auf den Vater, all das hatte sich in ihnen gestaut wie ein Damm, der nun brach.
Gerade als der Lärm seinen Höhepunkt erreichte, flog die Tür des Esszimmers auf.
„Cedric! Henri!“
Die Stimme ihres Vaters donnerte wie ein Kanonenschlag durch den Raum.
Henri fuhr erschrocken hoch, stieß dabei mit dem Fuß gegen den Tisch. Das Glas Cola kippte, kenterte, und die braune Flüssigkeit ergoss sich wie ein kleiner Wasserfall über die Karten, die im Nu aufweichten und klebrig zusammenklebten.
„Was soll das hier?“, brüllte Thomas Vogt. Seine Augen blitzten, die Stirnadern traten hervor, und allein seine Präsenz genügte, um die Brüder erstarren zu lassen.
Noch ehe Cedric antworten konnte, tauchte auch ihre Mutter auf. Anna Vogt blieb in der Tür stehen, erfasste mit einem einzigen Blick das Chaos: Chips auf dem Boden, Cola auf dem Tisch, zwei schuldbewusste Söhne und ein Vater kurz vorm Explodieren.
Sanft legte sie ihre Hand auf den Arm ihres Mannes. „Thomas, lass mich das übernehmen. Geh du zurück in dein Arbeitszimmer und konzentrier dich auf dein Buch.“
„Mein Buch?“ Er fuhr herum, fassungslos. „Wie soll man bei diesem Krach ein einziges Wort zu Papier bringen? Ein bisschen Rücksicht, ist das zu viel verlangt?“
Er schnaubte, drehte sich mit einer heftigen Bewegung um und stapfte zornig aus dem Zimmer, die Tür knallte hinter ihm ins Schloss.
„Tut mir leid, Mutti …“ Cedric hob die Hände wie zur Kapitulation. „Wir wollten nicht … es ist einfach über uns gekommen.“
Anna Vogt seufzte, doch ihre Stimme blieb fest. „Räumt erst einmal hier auf. Danach reden wir im Wohnzimmer.“
Cedric ließ die Schultern sinken. Seine Mutter war wütend, aber er wusste: sie war nicht nachtragend. Vielleicht würde die Strafe milder ausfallen, wenn sie sich beeilten.
Er sah zu seinem Bruder hinüber. „Na los. Fangen wir an.“
Die beiden holten Papiertücher, einen Eimer Wasser und machten sich daran, das Chaos zu beseitigen, schweigend, jeder in seine Gedanken versunken.
Später, als die Cola weggewischt, die Karten notdürftig getrocknet und die Chips Reste entsorgt waren, versammelte sich die Familie im Wohnzimmer. Der Regen trommelte nach wie vor gegen die Scheiben, draußen war die Welt grau und verschwommen.
Die Großmutter saß im Lehnstuhl, eine Wolldecke über die Knie gelegt, und sah die beiden Jungen mit einem traurigen Lächeln an.
„Ich fürchte, das alles ist meine Schuld. Es tut mir leid. Dabei wollte ich doch nur, dass wir meinen Geburtstag alle gemeinsam feiern.“
Cedric konnte es nicht mit ansehen, wie sie sich Vorwürfe machte. „Oma, bitte! Das war doch nicht deine Schuld.“
Anna Vogt, die sich neben ihre Mutter gesetzt hatte, legte sanft ihre Hand auf die runzlige, aber kräftige Hand der alten Dame. „Ach was. Es war genau richtig, uns einzuladen. Thomas ist nur schlecht gelaunt, weil er mit seinem Buch nicht vorankommt. Das Wetter schlägt uns allen aufs Gemüt.“ Sie schwieg einen Augenblick, dann fügte sie hinzu: „Vielleicht sollten wir uns überlegen, was die Kinder Sinnvolles mit ihrer Zeit anfangen könnten.“
„Ich bin fünfzehn. Ich bin kein Kind mehr“, protestierte Henri sofort und verschränkte die Arme.
Anna lächelte. „Natürlich, mein Schatz. Du bist schon ein junger Mann.“ Ihr Blick war warm, beinahe stolz.
Doch dann glitt er zu Cedric, der abwesend am Fenster stand. Draußen goss es in Strömen, die Tropfen liefen wie endlose Fäden an den Scheiben hinab. Cedric fühlte sich, als säße er eingesperrt in einem Aquarium, unfrei und abgeschnitten von der Welt.
Es ist nicht fair, dachte er bitter. Jeder hier hat seinen Grund. Oma mit ihrem Geburtstag, Papa mit seinem Buch. Nur ich habe gar nichts.
Und unweigerlich tauchte das Bild von Laura wieder vor seinem inneren Auge auf. Diese grünen Augen, die ihn beim ersten Blick gefangen genommen hatten. Sein Herz schlug schneller.
„Wie wär’s mit Kino?“, schlug die Großmutter plötzlich vor, als wolle sie die Schwere im Raum vertreiben. „Im Ort läuft ein neuer Film.“
„Den haben wir schon gesehen“, murrte Henri.
„Und? War er gut?“, fragte sie mit leiser Hoffnung.
„Nein.“
„Oh.“ Ihre Stimme sank, fast ein Flüstern. Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, und Henri sah sie erschrocken an. Ein Hauch von Schuld huschte durch seine Miene.
„Nun hört mir zu, ihr Lieben.“ Anna verschränkte die Hände und sprach mit ruhiger Stimme. „Ich weiß, bei diesem Wetter hier festsitzen ist nicht angenehm. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Niemand, der ein bisschen Fantasie hat, muss sich langweilen. Man kann lesen, schreiben, zeichnen …“
„Eine Woche lang?“ Henri hob ungläubig die Brauen.
„Eine Woche ist lang, ja“, räumte Anna ein. „Aber wir müssen das Beste daraus machen. Euer Vater wartet seit Jahren auf die Gelegenheit, dieses Buch zu schreiben. Er war immer für euch da. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr euch erkenntlich zeigt.“
Cedric spürte, wie die Worte ihn trafen. Ein schlechtes Gewissen stieg in ihm auf.
„Du hast recht, Mutti“, sagte er kleinlaut. „Von heute an benehmen wir uns. Wirklich. Wir wollten keinen Aufstand machen. Es ist einfach passiert.“
Das Gesicht seiner Mutter entspannte sich, und ein Lächeln huschte über ihre Lippen. „Ich weiß, wie sehr ihr euch langweilt. Aber schaut euch Oma an, sie verbringt ihre Tage hier ganz zufrieden.“
„Was machst du eigentlich immer so, Omi?“, fragte Cedric neugierig.
Die Großmutter blinzelte überrascht, als hätte sie mit der Frage nicht gerechnet.
„Oh, verschiedenes“, begann sie. „Ich gehe gerne ins Kino, so einmal pro Woche. Ich höre Radio, treffe Freunde, wir spielen Gesellschaftsspiele.“ Ein verschmitztes Lächeln huschte über ihr Gesicht. „Früher haben wir sogar Séancen gemacht.“
„Séancen?“, Henri richtete sich neugierig auf.
„Ja. Ein paar Leute sitzen um einen Tisch, legen die Hände zusammen und bitten die Geister, Kontakt aufzunehmen.“
„Das hast du wirklich gemacht, Oma?“ Henri sah sie an, als hätte sie sich eben als Abenteurerin geoutet.
Die alte Dame lachte herzlich. „Nun ja, wir haben es versucht. Damals war das hier in der Gegend der letzte Schrei. Inzwischen ist es etwas in Vergessenheit geraten.“
„Können wir das auch machen?“, rief Henri begeistert, die Augen leuchteten ihm.
„Wenn eure Mutter einverstanden ist.“
Anna nickte nach kurzem Zögern. „Von mir aus. Bereite alles vor, Mutter.“
Die Großmutter strahlte. „Das wird euch gefallen, ihr werdet sehen.“ Geschäftig erhob sie sich, als sei sie wieder zwanzig Jahre jünger. „Cedric, mach bitte die Jalousien runter. Henri, hilf mir, den kleinen runden Tisch in die Mitte des Zimmers zu schieben. Anna, bring ein paar Stühle aus der Küche.“
Cedric musste schmunzeln. Seine Großmutter benahm sich so aufgeregt wie ein Kind, das auf ein Spiel wartet. Eifrig huschte sie hin und her, stellte Dinge zurecht, ordnete, rückte, als hinge das Gelingen der Geisterbeschwörung von der perfekten Symmetrie im Zimmer ab.
„So!“, sagte die Großmutter schließlich und trat einen Schritt zurück. Zufrieden ließ sie den Blick durch das Wohnzimmer schweifen. „Das sieht gut aus. Also setzen wir uns.“
Alle nahmen Platz am kleinen runden Tisch, die Kerze flackerte in der Mitte und warf lange, zittrige Schatten an die Wände.
„Wer möchte es zuerst versuchen? Cedric?“ Sie sah ihn erwartungsvoll an.
Cedric zuckte die Schultern. „Von mir aus.“
„Gut. Henri, mach das Licht aus.“
Henri sprang auf, lief zum Schalter und drückte ihn. Schlagartig wurde der Raum dunkel, nur die Kerze blieb. Das Wohnzimmer, eben noch vertraut, wirkte plötzlich fremd, geheimnisvoll, als gehörte es nicht mehr ihnen.
„Na ja, wenigstens kein Skip-Bo“, murmelte Henri, während er sich setzte. „Ich hatte es schon satt, ständig gegen Cedric zu verlieren. Obwohl er dauernd an dieses Mädchen aus seiner Schule denkt.“
„Pst! Sei still, du Verräter!“ Cedric stieß ihm den Ellenbogen in die Seite. Er wollte nicht, dass seine Mutter davon erfuhr.
Die Großmutter stellte die Kerze so, dass das Licht auf den Block fiel, den sie Cedric hinhielt.
„Cedy, leg das vor dich auf den Tisch. Und halt diesen Kugelschreiber locker in der Hand. Nicht festzudrücken. Lass die Finger locker.“
Cedric tat, wie ihm geheißen. Die Flamme der Kerze spiegelte sich in der glänzenden Spitze des Stiftes.
„Jetzt schließ die Augen“, befahl sie sanft.
Er gehorchte. Sofort kribbelte es ihm im Nacken. Eine Mischung aus Erwartung und Nervosität kroch durch seinen Körper. Ihm war plötzlich unheimlich, obwohl er wusste, dass er nur mit seiner Familie am Tisch saß.
„Henri und Anna, reicht mir eure Hände. Die freien legt ihr an Cedrics Ellbogen. So schließen wir den Kreis.“
Cedric spürte die Fingerspitzen seines Bruders auf seiner Haut, die Hand seiner Mutter am anderen Ellbogen. Der Kontakt fühlte sich seltsam tröstlich an, und zugleich unheimlich verbindlich.
„Nun schließt ihr auch die Augen und konzentriert euch“, fuhr die Großmutter fort.
Für einen Moment herrschte Stille. Nur der Regen trommelte draußen gegen die Fenster, begleitet vom tiefen Grollen des Donners in der Ferne.
Dann erklang die Stimme der alten Frau, feierlich, beschwörend: „Oh, ihr Geister aus dem Jenseits … wenn einer von euch mit uns in Verbindung treten will, dann ist jetzt die Zeit gekommen. Sendet uns eure Botschaft!“
Ein Schauder lief Cedric über den Rücken.
Da hörte er, wie Henri neben ihm mühsam ein Kichern unterdrückte. Cedric hätte schwören können, er spürte gleichzeitig den strengen Blick seiner Mutter, obwohl seine Augen geschlossen waren.
„Henri!“, zischte die Großmutter scharf. „Konzentrier dich!“
Cedric hielt den Stift locker, die Hand auf dem Block ruhend. Alles in ihm war angespannt.
Plötzlich zuckte er zusammen. Eine Kälte legte sich um seinen Hals, eiskalt, so als habe jemand eine unsichtbare Hand auf ihn gelegt.
Dann ein dumpfes Pochen. Wie ein Schlag auf den Tisch.
Cedric wollte die Augen öffnen. Doch er konnte nicht. Als wären seine Lider fest verschlossen.
Der Tisch begann zu vibrieren, ruckte vor und zurück. Seine Hand bewegte sich. Nicht er selbst führte den Stift, etwas anderes zwang ihn dazu. Striche, Linien, Bögen entstanden.
„Es funktioniert!“ Henri jubelte, seine Stimme überschlug sich vor Aufregung. „Omi, schau nur, es funktioniert!“
„Oma!“ Cedric keuchte. „Mach, dass es aufhört!“
Doch der Tisch ruckte erneut. Cedric fühlte sich schwach, wie weit fort, als würde er von allem abdriften. Von fern hörte er seine Mutter: „Cedy! Cedy, mach die Augen auf!“
Ihre Stimme klang seltsam gedämpft, als spräche sie durch eine dicke Wand oder ein Kissen.
Verzweifelt versuchte er, ihrem Befehl zu gehorchen. Doch seine Augen blieben geschlossen.
Ein fremder Druck legte sich auf seine Hand. Hart, sehnig. Es war die Hand seiner Großmutter, die sein Handgelenk packte. Ein kurzer Kampf entbrannte: seine Finger wollten weiterschreiben, während ihre ihn festhielten.
„Cedric! Öffne sofort deine Augen!“
Die Stimme der Großmutter drang durch den Nebel. Mit aller Kraft riss er sich zusammen. Ein Schauer durchfuhr ihn, dann gelang es ihm.
Er riss die Augen auf.
Cedric keuchte, als er die Lider aufriss. Seine Hand lag schlaff auf dem Tisch, das Handgelenk noch immer fest in den Fingern seiner Großmutter. Der Kugelschreiber war zerbrochen, die Spitze verbogen, und schwarze Tintenspritzer klecksten über das Papier.
Er hob den Blick.
Die Gesichter ringsum spiegelten eine ganze Palette von Gefühlen: Entsetzen, Unglauben, Faszination. Seine Mutter starrte ihn mit nervöser Anspannung an, als fürchte sie, er könne im nächsten Moment ohnmächtig werden. Henri dagegen glühte vor Aufregung, seine Wangen waren gerötet, die Augen leuchteten, als habe er gerade den spannendsten Film seines Lebens gesehen.
Und die Großmutter … Cedric stockte der Atem. Auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck, den er noch nie bei ihr gesehen hatte. Eine Mischung aus tiefer Sehnsucht und nackter Furcht. Ihre Augen waren scharf und durchdringend, als wollten sie ihn durchbohren, als suchten sie in ihm eine Antwort, die er selbst nicht kannte.
Mit zitternden Fingern sah er auf den Block hinunter.
Dort, wo er eben noch unkontrolliert geschrieben hatte, zog sich ein Rahmen aus kunstvollen Schnörkeln über den Rand des Blattes. Linien, verschlungen und regelmäßig, wie er sie mit offenen Augen niemals hätte zustande bringen können. Fast ornamental, als sei das Werk eines Künstlers über seine Hand geflossen.
In der Mitte des Rahmens standen, in großen, festen Druckbuchstaben:
Wollt ihr mit mir spielen?
Ein Schauer jagte Cedric durch den ganzen Körper. Die Worte waren eindeutig nicht seine. Sie fühlten sich fremd an, und doch waren sie von seiner Hand geschrieben.
Kaum hatte Cedric die Worte gelesen, flackerte das Licht im Raum. Die Lampe an der Decke sprang an, erlosch wieder, sprang erneut an. Drei Mal hintereinander, als würde ein unsichtbarer Finger mit dem Schalter spielen.
Dann erfolgte ein dumpfer Knall. Der Raum versank in Dunkelheit, nur die kleine Kerze auf dem Tisch kämpfte gegen die Finsternis.
Henri sprang auf, rannte zur Tür und drückte hastig den Lichtschalter. Nichts. Er betätigte ihn mehrmals, doch die Dunkelheit blieb.
„Ein Abschiedsgruß von unserem Besucher“, sagte die Großmutter und lachte, ein kurzes, gezwungenes Lachen, das sofort in der Stille erstickte.
Damit war der Bann gebrochen.