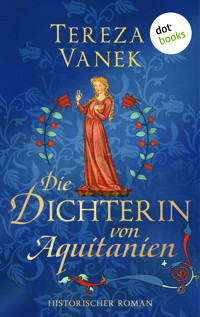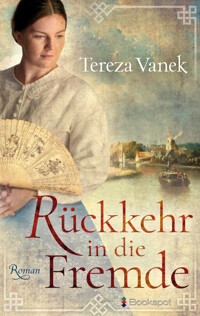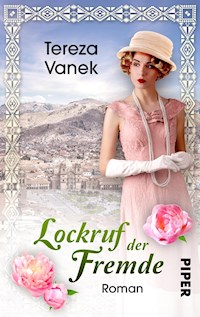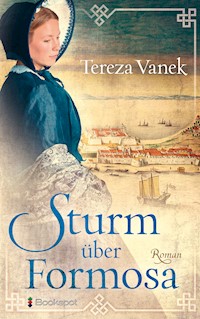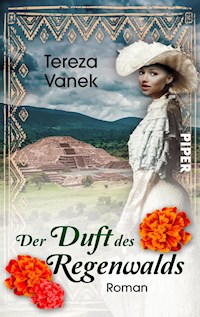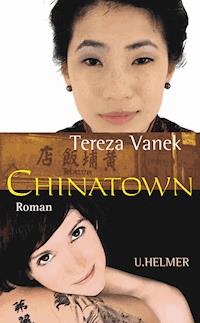7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Formosa, 1663: Während die Holländerin Emma im Dorf der Ureinwohner versucht, mit der gewaltsamen Landenteignung durch die chinesischen Machthaber zurechtzukommen, wird ihre Schwester Sophie zu einer Heirat mit dem Feind gezwungen. Doch beide wollen nur eines: nach Europa zurückkehren. Wider Erwarten entwickelt Sophie starke Gefühle für ihren Ehemann Bai Jun. Nun muss sie sich zwischen einem gemeinsamen Leben mit Emma in ihrer alten Heimat und ihrem Herzen entscheiden. Unterdessen verliebt sich der Gelehrte Pieter auf dem Festland entgegen aller Regeln in das wissensdurstige Dienstmädchen Lanfang. Als Lanfang zum Tode verurteilt wird, scheint eine gefährliche Flucht der einzige Ausweg für die beiden zu sein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elek-tronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffent-lichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.
Alle Akteure dieses Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind von der Autorin nicht beabsichtigt.
Copyright © 2022 bei EditionCarat, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH
1. Auflage
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München
Lektorat: Andreas März
Korrektorat: Susanne Döllner
E-Book-Herstellung: Jara Dressler
Made in Germany
ISBN 978-3-95669-175-1
www.bookspot.de
Formosa (heute Taiwan), um 1640, Maßstab o. A.
Die Kartendarstellung ist nicht, wie heute üblich, nach Norden ausgerichtet. In dieser Abbildung zeigt der Nordpfeil nach unten.
© Wikipedia/Wikicommons
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel,
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Nachwort
Über der*die Autor*in
1. Kapitel
Tayouan, Formosa, 1663
Sie hat Füße so groß wie ein Mann«, hörte Sophie die erste Frau von Zheng Jing, dem ältesten Sohn Zheng Chenggongs, sagen und blieb regungslos über ihre Stickerei gebeugt sitzen. Noch ahnten die meisten hier nicht, dass sie die chinesische Sprache mit jedem Tag besser verstehen konnte. Sie hatte sich an ihren Lieblingsort in der Palastanlage zurückgezogen, eine kleine, schmucklose Pagode hinter dem Gebäude, wo ihr eine kleine Kammer zugewiesen worden war. Meist blieb sie dort unbehelligt, da die anderen Frauen, mit denen sie sich ihr Haus teilte, stets versuchten, dem neuen Herrscher oder seinen Familienmitgliedern zu begegnen und deren Aufmerksamkeit zu wecken.
Sophie, der es nach einem Jahr Gefangenschaft immer noch schwerfiel, sich in dieser chinesischen Welt zurechtzufinden, genoss hingegen jede Möglichkeit, eine Weile unbeobachtet zu sein. Nun war sie durch das unerwartete Auftauchen von drei Frauen, die sich sonst niemals hierher verirrten, in ihrer Ruhe gestört worden. An den kunstvoll verzierten Seidenroben hatte sie gleich erkennen können, dass es sich um Mitglieder der Herrscherfamilie handeln musste. Von der letzten großen Feier im Palast, an der sie hatte teilnehmen müssen, wusste Sophie sogar, welche Rolle diese drei in der weitverzweigten Familie Zheng einnahmen, auch wenn sie ihre Namen nicht kannte.
Zheng Jings Gemahlin war klein und zerbrechlich wie eine Porzellanfigur. Die erste Nebenfrau hatte mehr weibliche Rundungen und trug viel Schminke im Gesicht, als wollte sie sich hinter einer Maske verstecken. Die jüngste Frau in der Runde war auch die unscheinbarste. Zheng Jings Schwester verzichtete auf auffälligen Schmuck und Farben. Ihr Körper war so mager, dass Sophie bei ihrem Anblick Mitleid verspürte.
Aber durfte jemand, der wie eine seltene Tierart begafft wurde, überhaupt etwas empfinden? Falls doch, dann waren diese Gefühle unwichtig.
Sophie versuchte, die drei Eindringlinge zu ignorieren, doch ihre Hoffnung, sie würden wieder gehen, erfüllte sich nicht. Die Frauen nahmen auf der Bank in der Pagode Platz, als sei dies ihr bevorzugter Aufenthaltsort.
»Das gelbe Haar ist unnatürlich«, sagte die Konkubine nun. »Kein gewöhnlicher Mensch hat so eine Haarfarbe. Sie muss eine Dämonin sein.«
Sophie hatte sich in den letzten Monaten oft nach eben jenen übersinnlichen Kräften gesehnt, die ihr immer wieder unterstellt wurden.
»Die Ozeanbarbaren hatten rotes Haar, heißt es«, mischte sich nun die Schwester des neuen Herrschers ein. »Vielleicht hat die Sonne auf dieser Insel es ausgebleicht. Ich glaube, sie ist eine ganz gewöhnliche Frau. Sonst wäre sie schon längst in ihre Heimat geflohen. Eine Dämonin kann man nicht einsperren.«
»Vielleicht will sie gar nicht weg«, wandte die Konkubine ein. »Vielleicht …« Sie beugte sich vor und redete leise weiter: »Vielleicht bleibt sie hier, weil sie uns schaden möchte.«
Drei Augenpaare bohrten sich in Sophies Rücken. Sie zog entschlossen den Faden durch das in einen Rahmen gespannte Baumwolltuch. Das Sticken war eine der wenigen Freuden, die sie in ihrem neuen Zuhause gefunden hatte. Sie vermochte inzwischen schöne Bilder von Blumen und Tieren anzufertigen. Jener griesgrämige Alte mit Fistelstimme, der alle Frauen hier schikanierte, mochte Sophies Arbeiten und konnte sogar ein klein wenig freundlich werden, wenn er ein neues Werk an sich nahm. Wohin er die Stickereien brachte, wusste Sophie nicht. Aber sie ahnte, dass ihr Geschick mit der Nadel der Grund war, warum sie noch nicht als Dienstmagd eingesetzt worden war wie einige andere gefangene Holländerinnen.
»Was auch immer sie ist«, sagte nun die Gemahlin und winkte eine Dienstmagd heran, um sich ein Tablett mit Leckereien bringen zu lassen. »Sie ist hässlich. Ich verstehe nicht, warum unser edler Herr Zheng Chenggong sie unbedingt in seinem Haus haben wollte.«
»Als Zeichen seines Sieges«, meinte das magere Mädchen. »Sie war die Tochter seines Feindes. Deshalb ist sie jetzt hier.«
Wieder wandten mehrere Augenpaare sich in Sophies Richtung. Sie duckte sich instinktiv. Manchmal war sie von den Frauen der Familie Zheng angeschrien oder gar mit faulem Obst beworfen worden, weil sie irgendeine der zahllosen, ihr unbekannten Regeln verletzt hatte, nach denen das Leben in dieser hierarchisch gegliederten Gemeinschaft ablief. Sophie war daher meist bemüht, sich wie eine Statue ohne Gedanken und Gefühle zu verhalten. Jene Trophäe, als welche sie gerade bezeichnet worden war. Vielleicht würden die Frauen ihre Existenz mit der Zeit einfach vergessen.
»Su Fei!«, rief die Schwester des neuen Herrschers aber nun. Es klang, als rufe sie nach einem der Schoßhunde. Sophie zögerte einen Moment, dann beschloss sie, dass sie sich wohl oder übel zu der Rednerin würde umdrehen müssen.
Das junge Mädchen hatte ein schmales Gesicht mit so kleinen Augen, dass sie an bloße Striche erinnerten. Der Mund hingegen war ein breiter, grob gezeichneter Balken. Die Proportionen passten nicht, alles wirkte wie willkürlich zusammengeworfen. Obwohl Sophie nicht wusste, welche Frauen bei den Chinesen als schön galten, ahnte sie, dass diese nicht dazugehörte.
»Was wünscht Ihr?«, fragte Sophie leise. Mit den Bediensteten hatte sie schon manchmal auf Chinesisch gesprochen und war zu ihrem Erstaunen verstanden worden. Nun landete die Teetasse der Konkubine klirrend auf dem Tisch, den die Bedienstete aufgestellt hatte. Die erste Gemahlin stieß einen Schreckenslaut aus, als hätte sie eine Statue oder einen der Hunde reden hören.
»Möchtest du Tee?«, fragte die Schwester des Herrschers sehr langsam. Als Einzige in der Runde schien sie nicht völlig fassungslos, dass eine Holländerin des Chinesischen mächtig sein konnte. Sophie bejahte und war überrascht, als ihr von der Rednerin selbst eine Tasse entgegengehalten wurde. Sie hatte keinen Henkel und war aus sehr dünnem, fast durchscheinendem Porzellan. Sophie bedankte sich und führte sie vorsichtig an ihre Lippen. Bisher hatte sie nur in Gegenwart von Dienstmägden zu essen oder zu trinken gewagt, aus Angst, dabei irgendeine falsche Bewegung zu machen.
Sie wurde von den Frauen weiter angestarrt wie eine Geistererscheinung. Allein die unansehnliche Schwester des Herrschers wies recht entspannt auf ihre Stickerei.
»Das ist eine sehr schöne Arbeit.«
Sophie lächelte, biss sich gleich darauf auf die Lippen. Sie hatte vergessen, dass vornehme Chinesinnen niemals ihre Zähne zeigen durften.
Aber sie war keine Chinesin. Auch nicht vornehm.
»Blumen im Garten«, sagte Sophie in der Hoffnung, erneut verstanden zu werden. Es gab in dieser Palastanlage, die aus um verschiedene Höfe gruppierten Holzhäusern bestand, wunderschöne Teiche mit Seerosen und blühende Gartenanlagen.
Nun hielt das magere Mädchen Sophie eine Schale mit frischem Obst hin. Die frisch geschnittenen Mangostücke waren zu verführerisch, um sie ablehnen zu können. Sophie genoss den weichen, süßen Geschmack auf ihrer Zunge.
»Weißt du, wer ich bin? Kennst du meinen Namen?«, fragte die Schwester des Herrschers nun. Sophie versteinerte vor Schreck. Nun steckte sie in einer Falle.
»Ihr seid die Schwester des Herrn Zheng Jing«, brachte sie mühsam hervor. Nur wusste sie den Namen dieser Schwester nicht. Chinesische Namen klangen für sie immer noch alle sehr ähnlich.
»Ich bin Fenzhi«, sagte das Mädchen unerwartet freundlich. »Du kannst heute Abend in meinem Haus mit mir speisen. Ich würde gern mehr über die Ozeanbarbaren erfahren.«
Sophie neigte ergeben den Kopf, denn sie wusste, dass diese Einladung einem Befehl gleichkam. Ehefrau und Konkubine von Zheng Jing machten nun so völlig verblüffte Gesichter, dass Sophie kurz Triumph verspürte.
»Es schadet nicht, mehr von der Welt zu wissen«, sagte Fenzhi zu ihren Gefährtinnen. Beide lächelten auf jene den Chinesen eigene Art, hinter der alle möglichen Gefühle verborgen werden konnten.
Sophie wusste nicht, ob diese Einladung ihr weiteres Leben verbessern konnte oder ob sie gar Gefahr lief, es bald schon zu verlieren. Hinrichtungen waren im Palast keine Seltenheit. Gerade Untergebene konnten wegen eines geringen Vergehens zum Tode verurteilt werden. Dennoch durfte sie sich nicht weigern, die Wünsche der Schwester des Herrschers zu erfüllen. So wusch sie sich mit einer Karaffe Wasser, die in ihr winziges, fensterloses Gemach am hinteren Ende eines Hofes getragen worden war. Sie besaß einen einzigen, bodenlangen Rock aus Leinen, den sie schon bei ihrer Gefangennahme nach dem Sieg Zheng Chenggongs getragen hatte. All ihre anderen Kleidungsstücke aus dem früheren Leben waren mittlerweile völlig zerschlissen, sodass ihr zwei chinesische Blusen mit weiten Ärmeln gegeben worden waren. Sie wurden um die Taille gewickelt und zu einem Knoten gebunden, wiesen weiße Blüten auf blauem Untergrund auf. Sophie wechselte sie regelmäßig. Eines ihrer wenigen Privilegien bestand darin, dass sie Schmutzwäsche einem Dienstmädchen zur Reinigung übergeben konnte.
Die blauen Samtpantoffeln hatte sie selbst bestickt und war nun stolz, sie vorführen zu können. Ihr Haar band sie im Nacken fest, denn jene verspielten, mit Schmucksteinen verzierten Frisuren, die von den Konkubinen getragen wurden, waren ohne fremde Hilfe kaum fertigzustellen.
Eine Dienstmagd erschien, um Sophie abzuholen. In ihrer Hand lag eine jener roten Papierlaternen, die hier abends überall angezündet wurden. Sophie stand auf, um ihr mit einem flauen Gefühl im Magen durch die verwinkelte Palastanlage zu folgen. Die Mitglieder der Herrscherfamilie lebten am anderen Ende. Ihr wurde erst jetzt bewusst, wie groß dieser ganze Komplex war. Es mussten etliche Verwandte des neuen Herrschers hier untergebracht sein, die nun mit ihren Vertrauten in den verschiedenen Höfen speisten. Dort, wo Sophie hingebracht wurde, sah der Hof besonders prächtig aus und gewährte Ausblick auf einen riesigen Garten. Sie bemerkte außerdem eine kunstvoll mit exotischen Vögeln bemalte Pagode und eine goldene Statue, vor der Räucherstäbchen schwelten, die einen beißenden Geruch verbreiteten.
Die Dienstmagd brachte Sophie in einen Raum voll filigraner Vasen und Malereien auf Wänden und Möbelstücken. Alles hier schien kostbar, sodass Sophie bei jedem Schritt Angst hatte, ungewollt Zerstörung anzurichten. Die Gastgeberin saß an einem runden Tisch und winkte sie ungeduldig herbei.
»Ich hoffe, du bist inzwischen unser Essen gewöhnt.«
Sophie bejahte. Das Essen im Herrscherpalast war besser als alles, was sie jemals gekostet hatte.
»Nun, dann setz dich jetzt«, ordnete das magere Mädchen an. Sophie vollführte zunächst eine tiefe Verbeugung, dann gehorchte sie.
Fenzhi trug nun eine Robe mit weiten Ärmeln aus hellblauer Seide. Das Haar war zu einem kunstvollen Geflecht auf ihrem Kopf geformt, doch konnte all diese Mühe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ihrem Gesicht an äußeren Reizen mangelte. Doch Sophie bemerkte nun den klugen Blick der winzigen Augen. Vielleicht war Verstand auch bei einer Frau wichtiger als Schönheit.
»Es freut mich, dass du meine Einladung angenommen hast«, begann Fenzhi. Wusste sie nicht, dass kaum jemand in diesem Palast gewagt hätte, diese abzulehnen?
»Ich fühle mich geehrt, dass Ihr mich sehen wolltet«, sagte Sophie mühsam auf Chinesisch.
»Warum sollte ich nicht?«, erwiderte Fenzhi. »Du bist ungewöhnlicher als die anderen Frauen hier. Männer darf ich ja nicht sehen, nur meinen Bruder, und der ist jetzt sehr beschäftigt.«
Sie lud sich etwas Reis und ein Fleischgericht auf ihre Schale. Sophie musterte etliche Schüsseln mit verschiedenen Speisen. Von allen ging ein starker, oft verführerischer Geruch aus. Sie hatte Angst, etwas falsch zu machen, daher beschränkte sie sich auf Reis und Fisch. Im Umgang mit Stäbchen hatte sie inzwischen genug Übung.
»Stimmt es, dass Holländerinnen frei herumlaufen dürfen?«, plapperte Fenzhi weiter. »Dass sie ihren Gemahl sogar vor der Hochzeit sehen dürfen?«
Sophie bejahte zögernd.
»Wir müssen nicht ständig im Haus leben. Natürlich gehen vornehme Frauen nicht allein nach draußen, sondern nehmen Begleitschutz mit. Den Ehemann dürfen wir vor der Trauung sehen, aber meistens nicht frei wählen.«
Zum ersten Mal nach langer Zeit überlegte sie, was wohl ihr Los gewesen wäre, wenn Zheng Chenggong die Holländer nicht aus Formosa vertrieben hätte. Wäre sie dann schon eine verheiratete Frau? Hätte ihr Vater ein Mitglied der Garnison ausgewählt oder einen anderen Missionar?
Kurz verspürte sie Erleichterung, diesem Los entkommen zu sein.
»Dann habe ich ja Glück.« Fenzhi schlürfte geräuschvoll, während sie Suppe aus einer kleinen Schüssel trank. Sophie war bereits aufgefallen, dass dies unter Chinesen nicht verpönt war.
»Wer mich einmal gesehen hat, wird mich nicht unbedingt zur Frau wollen«, fuhr Fenzhi fort und lachte laut. Sophie wusste nicht, ob sie einstimmen sollte. Obwohl Fenzhis Tonfall nicht bitter gewesen war, klangen ihre Worte so.
»Ihr seid mit dem Herrscher der Insel verwandt«, wandte Sophie ein. »Viele Männer werden Euch zur Gemahlin wollen.«
»Ja. Dann stecken sie mich in ein Haus, das sie fast nie besuchen, und amüsieren sich mit ihren bildschönen Konkubinen.«
Fenzhi nippte an einem Becher Reiswein.
»Aber es hat keinen Sinn, zu klagen. So ist eben unsere Welt. Sag mir, Su Fei, wie gefällt es dir bei uns?«
Sophie musterte die kunstvolle Einlegearbeit auf der Tischfläche. Vögel und Landschaften hatten es den Chinesen wohl besonders angetan. Im Haus ihres Vaters in Davilo hatte ein holländisches Bild gehangen, das einen Wald mit Hirschen zeigte. Die Farben waren dunkler gewesen, die Darstellung breitflächiger. Mit Erschrecken merkte Sophie, dass sie viele Details davon bereits vergessen hatte. Bald würde sie nicht mehr genau wissen, woher sie eigentlich stammte.
»Es ist eine Ehre für mich, im Palast des Herrschers in Formo-, ich meine, in Taiwan leben zu dürfen«, murmelte sie in ihrem sicher nicht fehlerfeien Chinesisch.
Ihre Gastgeberin runzelte die Stirn.
»Des Herrschers, der deinen Vater hinrichten ließ?«
Sophie fuhr wie nach einem Hieb zusammen. Zu ihrem Entsetzen verspürte sie Tränen in den Augen. Wahrscheinlich wurde sie von diesem merkwürdigen Mädchen einer Art Prüfung unterzogen. Die erste Kunst, die selbst die niedersten Bediensteten in diesem Haushalt lernen mussten, war vollkommene Gefühlsbeherrschung.
Sie lief gerade Gefahr, in bewusst aufgestellte Fallen zu treten.
»Es herrschte Krieg zwischen Chinesen und Holländern«, erwiderte sie nach ein paar Atemzügen. »Da müssen Menschen manchmal sterben.«
Die wenigen gefangenen Holländer, mit denen sie im Herrscherpalast hatte reden können, hatten ihr erzählt, dass man ihren Vater als Helden verehrte, weil er den Tod der Unterwerfung vorgezogen hatte.
Aber Sophie verspürte manchmal Bitterkeit, wenn sie an den großen, lauten Antonius Hambroek dachte, den wichtigsten aller holländischen Missionare. Warum hatte er ihre Schwester Emma und sie in dem kleinen Ort Davilo zurückgelassen, um sich in politische Fragen einzumischen? Warum war er später nicht wenigstens bei ihr in Fort Zeelandia geblieben, als es schon belagert wurde? Er hatte seine Töchter ihrem Schicksal überlassen, weil seine Missionsarbeit und die Sicherung der holländischen Herrschaft über Formosa ihm wichtiger gewesen waren.
»Wir Frauen können selten über unser Leben bestimmen«, redete Fenzhi weiter. »Mein Vater brachte mich auf diese Insel, weil er sie erobert hatte. Dabei liebte ich unseren Palast in Xiamen. Hier leben sehr viele Wilde, die Menschen ihre Köpfe abschneiden. Ich weiß auch nicht, wen ich eines Tages heiraten werde, wenn wir doch mit den neuen Herrschern von China zerstritten sind. Aber ich habe alles hingenommen, wie es sich gehört. Du tust es auch. So anders können Holländer also nicht sein.«
Zufrieden, eine so kluge Schlussfolgerung gezogen zu haben, trank sie nochmals Reiswein. Erst dann fiel ihr auf, dass Sophies Becher leer war. Sie schenkte ihr persönlich ein.
Sophie überlegte, dass sie selbst hier aber eine Gefangene war und nicht die Schwester des neuen Herrschers. Aber Fenzhi verhielt sich so freundlich, dass die Fesseln der Rangordnung auf einmal weniger stark in Sophies Fleisch schnitten.
Sie leerte ihren Becher Reiswein. Im Haus ihres Vaters hatte sie beim Abendmahl manchmal Wein zu trinken bekommen, doch seitdem sie in diesem Palast lebte, waren ihr nur Wasser oder Tee vergönnt.
Nun erleichterte eine wohlige Berauschtheit ihr Gemüt.
»Ich weiß nicht einmal, welche Rolle ich hier habe und warum man mich gefangen hält«, sagte sie frei heraus. »Ich sollte die Geliebte des Siegers werden, aber ich bekam ihn niemals zu Gesicht. Seit seinem Tod lebe ich in einer kleinen Kammer und sticke Bilder, weil ich keine andere Aufgabe habe.«
»Nun, so geht es vielen Konkubinen und auch manchen Ehefrauen«, erwiderte Fenzhi unbeirrt. »Bei euch Holländern muss das anders sein, sonst würdest du dich nicht wundern.«
»Bei uns hat ein Mann nur eine Frau. Sie führt den Haushalt und dort wohnen keine anderen Frauen außer Verwandte oder Bedienstete«, erklärte Sophie. Das Gespräch begann, ihr unerwartete Freude zu bereiten.
»Das heißt, der Mann kann keine andere Frau haben?«, fragte Fenzhi erstaunt. »Selbst wenn er eine wie mich hat, die ihm nicht gefällt?«
Sophie versicherte, dass dem so wäre. Auch ungeliebte Ehefrauen konnten nicht einfach ausgetauscht werden. Dann fiel ihr wieder ein, wie wichtig es in diesem Palast war, den richtigen Leuten angemessen zu schmeicheln. Sie durfte sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, nur, weil ihre plötzliche Freundlichkeit gezeigt wurde.
»Ich seid eine ausnehmend kluge Frau. Euer späterer Gemahl wird darüber sicher erfreut sein«, sagte sie und war stolz auf ihren Einfallsreichtum.
»So. Das meinst du.«
Fenzhi nagte nachdenklich an einem Hühnerknochen.
»Von einem Mann, der die Klugheit seiner Frau schätzt, habe ich bisher noch nichts gehört. Es ist stets von Schönheit oder Gehorsam oder dem Gebären von Söhnen die Rede. Darauf kommt es bei Frauen an. Ist das vielleicht bei euch Holländern anders?«
Die junge Chinesin sah fast hoffnungsvoll aus, als wünsche sie sich, von einer Welt zu hören, die nicht nach diesen Regeln ablief.
Nun erkannte Sophie, dass sie sich selbst eine Falle gestellt hatte. Der Vater hatte die Unterstützung seiner älteren Tochter Emma bei seiner Missionsarbeit befürwortet, jede ihrer Eigenwilligkeiten aber mit Missfallen betrachtet. Von einer Ehefrau hätte er vor allem erwartet, dass sie sich seinen Weisungen fügte. Wenn sie ihm Söhne geboren hätte, die er von seiner ersten, früh verstorbenen Gemahlin nicht bekommen hatte, wäre er ausnehmend froh gewesen.
»Ich fürchte, bei uns ist es nicht wesentlich anders«, gab sie zu. »Aber ich glaube … ich hoffe, es gibt dennoch Männer, denen eine kluge Frau gefällt. Meine Schwester hatte in Davilo … also dem Dorf, wo wir früher lebten, einen Verehrer aus dem Volk der Siraya. Der mochte sie so, wie sie war, und Emma, also meine Schwester, die hatte schon immer ihren eigenen Kopf.«
Vielleicht gab es bei den Siraya jene andere Welt, nach der Fenzhi sich sehnte. Nur betrachtete sie die Ureinwohner als Wilde und würde sicher keinen von ihnen heiraten. Emma war nicht nur klug, sondern auch verrückt gewesen. Die Sehnsucht nach ihrer Schwester wurde plötzlich so heftig, dass Sophie Tränen wegblinzeln musste.
Es erstaunte sie, auf Fenzhis Gesicht plötzlich Mitgefühl zu erkennen.
»Du vermisst deine Schwester, nicht wahr?«
Sophie nickte.
»Wir standen uns immer sehr nahe. Ich … ich würde sie so gern wiedersehen. Sie unterrichtet in dem Dorf der Siraya.«
Ob die Schwester des neuen Herrschers ihr eine Reise dorthin ermöglichen konnte? Sie wagte es kaum zu hoffen, wollte aber wenigstens einen Versuch wagen.
Fenzhi lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und schob mit ihren Essstäbchen Reiskörner auf ihrer Schale herum.
»Ich verstehe, dass du mich um einen Gefallen bittest, aber ich weiß nicht, ob ich ihn erfüllen kann«, sagte sie dann. »Die Schulen der Holländer sollen geschlossen werden. Mein Bruder will sich um diese Insel kümmern, statt den Krieg gegen die Qing in China weiterzuführen, denn der ist verloren. Nun soll hier das letzte Reich der Ming entstehen. Euch Holländer braucht er da nicht.«
Enttäuscht senkte Sophie den Kopf. Wenn keine Holländer gebraucht wurden, weshalb war sie dann noch hier?
»Aber ich habe auch gute Nachrichten für dich«, fuhr Fenzhi fort. »Mein Bruder will auch die Geschäftsbeziehungen zu den Ozeanbarbaren erneuern. Er verhandelt gerade mit den Holländern in Batavia über den Freikauf von Gefangenen.«
Eine Welle der unterschiedlichsten Gefühle rollte durch Sophie und erschwerte es ihr, eine gefasste Miene zu wahren. Auf Freude, Hoffnung und Erleichterung folgte auch Angst. Was wäre, wenn sie nicht zu den Auserwählten gehörte? Oder wenn sie ihre Schwester für immer auf Formosa zurücklassen musste?
»Werde ich deshalb hier festgehalten?«, fragte sie mit mehr Offenheit, als sie bisher gewagt hatte. »Es braucht mich doch niemand in diesem Palast.«
»Dieser Palast ist voller Leute, die niemand wirklich braucht«, erwiderte Fenzhi. »Aber du hast wohl recht. Mein Bruder liebt seine Aufgaben als Herrscher dieser Insel. Aus Frauen macht er sich nicht viel. Auch deine gelben Haare beeindrucken ihn nicht. Er hofft, dich gegen Zugeständnisse eintauschen zu können. Würde es dir gefallen, wieder von hier wegzukommen?«
Sophie bejahte ohne Zögern. Seit sie denken konnte, war ihr Traum eine Rückkehr nach Holland gewesen und die Ehe mit einem Mann aus ihrer Heimat.
»Dann werde ich dir sofort Bericht erstatten, wenn ich etwas Neues weiß. Mein Bruder unterhält sich gern mit mir. Er sagt, ich habe mehr Verstand als seine Gemahlinnen. Aber das liegt wohl nur daran, dass ich ihm keine Söhne gebären muss. Sonst hätte ich auch andere Sorgen, als mir seine Reden über die Verwaltung dieser Insel anzuhören.«
Fenzhi sah dennoch stolz aus, so wichtige Neuigkeiten weitergeben zu können.
»Ihr habt mir einen großen Gefallen getan«, sagte Sophie. Zum ersten Mal an diesem Abend redete sie mit völliger Ehrlichkeit.
»Das freut mich«, erwiderte Fenzhi. »Ich war mir nicht sicher, ob du wirklich gehen willst, denn viele Frauen träumen von einem Leben im Palast des Herrschers. Aber ihr Holländer seid wohl anders.«
Von dieser Vorstellung schien sie regelrecht besessen. Sophie erhielt einen weiteren Becher Reiswein, den sie mit Genuss leerte. Auf einmal hatte sie Lust, zu singen und zu tanzen, wie es die Siraya in Davilo gerne taten. Die Aussicht, nach Holland zurückkehren zu können, riss sie aus der Gleichgültigkeit, in die sie in diesem Palast verfallen war. Auf einmal hatte ihr Leben wieder ein Ziel.
»Kennst du Holland?«, fragte Fenzhi.
Sophie verneinte nach kurzem Überlegen.
»Ich wurde dort geboren, aber als ich ein kleines Kind war, fuhren wir nach Batavia und später hierher. Dennoch ist Holland meine Heimat.«
»Eine Heimat, die du also nicht kennst«, stellte Fenzhi fest. »Ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht sein, wenn du dort bist. Aber ich habe eine Bitte an dich.«
Sophie lauschte ungläubig. Was konnte die Schwester des Herrschers von ihr haben wollen? Sie würde dieser unansehnlichen Chinesin sogar ihre Seele versprechen, wenn sie dafür erfahren konnte, wann sie nach Holland heimkehren durfte.
»Schicke mir Briefe, wenn du in deiner Heimat bist«, forderte Fenzhi. »Es wird dauern, bis sie ankommen, aber da mein Bruder den Handel zwischen unseren Nationen wieder aufleben lassen will, werde ich sie irgendwann bekommen. Dadurch erfahre ich etwas mehr von der Welt, obwohl ich sie nicht sehen darf.«
Sie beugte sich wieder über ihren Teller und sortierte die Reiskörner. Auf einmal schien sie Sophie bemitleidenswert, denn für sie gab es keine Möglichkeit, dem Gefängnis zu entkommen, in das Chinesen ihre Frauen sperrten.
»Es wird nicht leicht sein, von Holland aus Briefe nach Formosa zu schicken, aber ich werde es versuchen«, versprach sie. Ihr war klar, dass sie dies tatsächlich tun würde, auch wenn Fenzhi noch zu Beginn dieses Tages eine seltsame Fremde für sie gewesen war.
Dann überlegte sie weiter. »Ich beherrsche die chinesische Schrift nicht. Könnt Ihr die unsere?«
»Ich würde sie gern kennenlernen«, erwiderte Fenzhi. »Und dir zeige ich unsere Schriftzeichen. Wir fangen morgen damit an. Meine Dienstmagd wird dich holen, halte dich bereit.«
Mit einer Handbewegung forderte sie eine der Bediensteten auf, nun den Tisch abzuräumen. Sophie stand auf, verbeugte sich nochmals und sprach angemessene Dankesworte für die Einladung aus.
Als sie durch die bereits von Laternen erleuchtete Anlage wieder in ihre kleine Kammer zurücklief, überkam sie zum ersten Mal seit ihrer Gefangennahme ein Gefühl der Zuversicht.
Diese merkwürdige Fenzhi war wie ein Stern am Horizont, an dem sie sich orientieren musste, wenn die Schwermut sie niederdrückte.
Am nächsten Tag wurde sie tatsächlich zum Unterricht abgeholt. Fenzhi erwies sich als sehr gründlich und hartnäckig in den Versuchen, ihr die eigenartige Zusammensetzung chinesischer Schriftzeichen zu vermitteln. Die Pinselstriche mussten in einer vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt werden, manchmal erinnerten sie sie vage an den Gegenstand, den sie darstellten, oft aber nicht. Die Kunst des Schreibens wurde durch stetes Kopieren der Zeichen erlernt, eine monotone Aufgabe, die aber viel Aufmerksamkeit erforderte. Sophie bemühte sich, eine fleißige Schülerin zu sein, musste aber immer wieder daran denken, wie viel besser Emma einer solchen Aufgabe gewachsen wäre. Nach einer kurzen Unterbrechung, um Tee zu trinken und an Sesamgebäck zu knabbern, sollte nun der Unterricht in holländischer Sprache beginnen.
Sophie beschränkte sich darauf, Fenzhi einige Sätze nachsprechen zu lassen. Das schaffte diese recht schnell und viel besser, als Sophie es mit der chinesischen Sprache vermocht hatte. Ihre winzigen Augen funkelten wie schwarze Edelsteine vor Begeisterung, eine neue Sprache meistern zu können. Das spornte auch Sophie an. Sie malte das lateinische Alphabet auf eine Papierrolle und gab sich Mühe, der Chinesin das Prinzip dieser Schrift verständlich zu machen. Nun dauerte es länger, bis sich der erste Erfolg einstellte, aber Sophie ahnte, dass dies eher an ihrem mangelnden Talent als Lehrerin lag denn an Fenzhis Begriffsvermögen.
Emma hätte es besser gemacht. Eine solche Aufgabe hätte sie als Herausforderung gesehen.
»Es sind Laute«, rief Fenzhi schließlich aufgeregt. »Die Zeichen haben keine Bedeutung, man muss nur ›Ah‹ machen wie ein Esel oder ›Schschsch‹ wie eine Schlange. So setzt sich das Wort zusammen!«
»Ihr habt recht«, stimmte Sophie erstaunt zu und begriff, dass sie auf eben diese Weise bei der Erklärung hätte vorgehen müssen. Aber nun hatte Fenzhi das Prinzip erfasst, also konnte ihr Unterricht so völlig schlecht nicht gewesen sein.
»Ihr macht das Schreiben einfacher«, sagte die Chinesin, als die Bediensteten ihnen ein Abendessen gebracht hatten. »Diese wenigen Zeichen, das kann fast jeder recht schnell lernen. Und man kann sogar eine Sprache, die man nicht versteht, aufschreiben, indem man die Laute wiedergibt.«
Wieder aßen sie zusammen und tranken Reiswein. Fenzhi erzählte von ihrer Kindheit als Tochter Zheng Chenggongs. Die ständigen Kriege und daher notwendigen Ortswechsel hatten in ihr den Wunsch nach einem dauerhaften Zuhause geweckt.
»Ich dachte manchmal, dass wir eines Tages im Kaiserpalast in China leben. Aber nun sitze ich auf dieser Insel, wo laut meinem Vater nur Gras wächst. Aber so schlecht ist es hier nicht, mein Bruder hat es begriffen. Wo nichts ist, kann man Neues erbauen.«
Sophie musste an die Menschen in Davilo denken, ihre Hütten, Götterstatuen und alten Traditionen. Es gab durchaus mehr als nur wild wachsendes Gras auf Formosa, doch wer sein Leben hinter Palastmauern zubrachte wie Fenzhi, konnte nichts davon mitbekommen.
Eine Weile später trat sie vom Reiswein wohlig berauscht den Rückweg in ihre Behausung an. Inzwischen bewegte sie sich recht gelassen in dieser chinesischen Welt, denn ihre Bekanntschaft mit der Schwester des Herrschers verlieh ihr ein Gefühl der Sicherheit. Sie erreichte den kleinen Hof, den sie bewohnte, betrat ihr Haus und sah zu ihrem Erstaunen alle vier Mitbewohnerinnen versammelt vor der Schwelle zu ihrer Kammer sitzen. Für gewöhnlich hatten sie irgendwelche Aufgaben zu erledigen oder vertrieben sich die Zeit mit gemeinsamem Tratschen oder Würfelspielen.
Sophie kannte die Gesichter dieser Frauen, nicht aber ihre Namen. Sie war ihnen bisher weitmöglichst aus dem Weg gegangen und sie hatten ebenfalls kein Bedürfnis gezeigt, ihre Bekanntschaft zu machen.
»Speist du nun jeden Abend mit der Dame Fenzhi?«, fragte die älteste Mitbewohnerin des Hauses, die bereits ergrautes Haar hatte und füllig um die Hüften war.
»Wie hast du unsere Sprache gelernt? Ihr Barbaren könnt doch nur grunzen wie Schweine!«, fügte eine jüngere Frau dicht neben ihr hinzu.
Sie lachte. Die rundliche Alte stimmte mit ein, die drei anderen Frauen schwiegen. Sophie brach der Schweiß aus, aber sie wusste inzwischen, wie wichtig Selbstbeherrschung bei den Chinesen war. Höflich verbeugte sie sich.
»Ich habe mich, seit ich hier lebe, bemüht, eure Sprache zu lernen. Die Dame Fenzhi hilft mir nun.«
Die Alte runzelte die Stirn.
»Unser Herrscher mag dein gelbes Haar nicht. Der Dame Fenzhi gefällt es«, sagte sie und spuckte aus. Ihre jüngere Gefährtin lachte böse. Sophie hatte den Eindruck, dass die drei anderen Frauen verlegen aussahen, aber es fiel ihr immer noch schwer, chinesische Gesichtsausdrücke zu deuten.
»Ich weiß nicht, ob es mein Haar ist«, erwiderte Sophie. »Die Dame Fenzhi ist sehr gütig. Aber jetzt bin ich müde. Ich wünsche euch eine gute Nacht.«
Sie wollte an den Frauen vorbeikommen, um in ihre winzige Kammer zu flüchten, doch die füllige Alte versperrte ihr den Weg.
»Ich bin Shu Ma, eine Tante des Herrschers. Du schuldest mir Gehorsam. Ich sage, wann du schlafen gehst.«
Mühsam schluckte Sophie ihren Zorn herunter. Es wäre ungeschickt gewesen, sich aufzulehnen. Daher verbeugte sie sich nochmals.
»Ich bitte um die Erlaubnis, in meine Kammer zu gehen. Die Dame Fenzhi will mich morgen wiedersehen.«
Shu Ma stand auf, packte eine Strähne von Sophies Haar und roch daran.
»Es stinkt!«, rief sie. »Die Dame Fenzhi hat einen seltsamen Geschmack.«
Dann versetzte sie Sophie einen Stoß, der sie zu Boden fallen ließ. Eine kleine Götterfigur, vor der die Frauen regelmäßig Räucherstäbchen anzündeten, fiel ebenfalls um. Sophie vernahm einen Schreckenslaut, wusste aber nicht, welche Frau ihn ausgestoßen hatte. Während sie so schnell wie möglich wieder aufsprang, stellte sie auch die Figur wieder gerade hin.
»Ich möchte schlafen gehen«, wiederholte sie so gefasst wie möglich. Vorwürfe wegen der Art, wie sie behandelt worden war, konnte sie sich nicht erlauben.
Shu Ma musterte sie spöttisch. Ihre junge Gefährtin grinste. Die anderen Frauen hatten nun den Blick abgewandt.
»Sie sollte in Zukunft unsere Nachttöpfe leeren«, schlug die Freundin von Shu Ma vor. »Wenn sie doch schon danach riecht.«
Verzweifelt überlegte Sophie, welche Gründe sie vorbringen konnte, um dieser Aufgabe zu entgehen, als plötzlich eine der bisher schweigenden Beobachterinnen vortrat.
»Vergib mir, Shu Ma, aber wenn die Schwester unseres Herrschers diese Barbarin regelmäßig sehen will, sollten wir ihr keine anderen Aufgaben geben. Ihr Haar mag für uns übel riechen, aber es steht uns nicht zu, das Urteil der Dame Fenzhi anzuzweifeln.«
Shu Ma stieß ein Knurren hervor, aber zu Sophies Erleichterung entfernte sie sich ohne Widerspruch, gefolgt von ihrer jüngeren Gefährtin, die sich wie ihr Hündchen verhielt. Die anderen hier lebenden Frauen huschten schnell davon, als seien sie ebenfalls froh, dass es zu keinem größeren Konflikt gekommen war. Sophie wandte sich ihrer noch verbleibenden Retterin zu und bedankte sich.
»Shu Ma macht sich gern wichtig«, erwiderte die kleine, stämmige Frau leise. »Niemand weiß, ob sie wirklich die Tante unseres Herrschers ist. Sie behauptet es nur.«
Sophie fragte sich, wie diese alte Frau sonst in den Palast gekommen war. Aber ganz hatte sie die Regeln hier noch nicht begriffen.
»Ich bin Gushe. Wir haben bisher nicht miteinander gesprochen«, fügte die Retterin hinzu.
»Dann freue ich mich, dass wir es jetzt tun«, erwiderte Sophie.
»Niemand wusste, dass du reden kannst«, fuhr Gushe fort und musterte Sophie neugierig. »Es heißt, die Ozeanbarbaren schreien oder knurren nur.«
»Wir haben unsere Sprache. In der reden wir miteinander. Die eure beherrschen wir meistens nicht«, erklärte Sophie nachsichtig. Nicht jede Chinesin konnte über Fenzhis Verstand verfügen und diese Dinge ohne solche Ausführungen begreifen.
Gushe nahm diese Worte ohne Staunen hin.
»Möchtest du noch für eine Weile in meine Kammer kommen?«, bot Sophie ihr an. »Dort können wir ungestört reden.«
Sie hatte nicht mit sofortiger Zustimmung gerechnet, doch Gushe folgte ihr bereitwillig. In einer Kanne war noch Tee, den die Bedienstete Sophie morgens gebracht hatte. Er musste inzwischen kalt sein, aber mehr konnte sie Gushe nicht anbieten.
Sie setzten sich zusammen auf Sophies Schlafmatte und tranken aus schlichten Tontassen.
»Bist du zusammen mit Zheng Chenggong auf diese Insel gekommen?«, fragte Sophie.
Gushe, die breitbeinig dasaß, zog ein belustigtes Gesicht.
»Zunächst kamen vor allem Soldaten. Erst nachdem Taiwan erobert war, holten sie ihre Frauen. Mein Vater war ein unbedeutender Hauptmann. Er fiel in der Schlacht, angeblich als Held. Daher wurde ich in den Palast aufgenommen, denn sonst gab es keinen Ort für mich, wo ich leben konnte. Alle sagten, es sei eine Ehre. Ich hoffte, der Herrscher findet bald einen Mann für mich. Aber ich glaube, er weiß nicht mehr, dass es mich gibt.«
Vielleicht hatte Zheng Chenggong es noch gewusst, aber sein Sohn hatte andere Sorgen.
»Kannst du es der Dame Fenzhi morgen sagen?«, bat Gushe frei heraus. »Dass ich nicht in diesem Haus bleiben möchte, bis ich alt und biestig geworden bin wie Shu Ma. Zheng Jing will mich sicher nicht in seinem Bett. Aber vielleicht hat er einen Diener, der mit mir zufrieden wäre. Ich wünsche mir eine Familie.«
Es kam Sophie allzu ungerecht vor, dass ein so schlichter, natürlicher Wunsch unerfüllt bleiben sollte.
»Ich werde die Dame Fenzhi bitten, darüber mit ihrem Bruder zu reden«, versprach Sophie. Gushes Gesicht strahlte vor Freude, bevor sie sich entfernte. Als Sophie sich schlafen legte, überkam sie ein fast vergessenes Gefühl der Zufriedenheit. Vielleicht würde sie von nun an anderen Menschen helfen können, wenn schon nicht sich selbst.
So wie ihre Schwester Emma es in Davilo getan hatte, wo sie die rechte Hand ihres Vaters gewesen war und sich während seiner häufigen Abwesenheit um alle Bewohner gekümmert hatte.
2. Kapitel
Eine einfache Konkubine wünscht sich also einen Ehemann!«, meinte Fenzhi, während sie einen ihrer geliebten Melonenkerne knackend zerbiss. »Man merkt, dass du nicht bei uns aufgewachsen bist, Su Fei. Sonst würdest du mir das nicht erzählen. Es ist etwa so ungewöhnlich wie eine Ente, die in den Teich kackt!«
Sie zeigte beim Lachen nun ihre Zähne, die schief gewachsen waren. Sophie senkte den Blick. Sie hatte Fenzhi für klug und gütig gehalten, doch dieses Verhalten schien ihr boshaft.
»Es ist vielleicht gewöhnlich, aber dieses Mädchen … sie lebt in unserem Haus, wo sie für niemanden wichtig ist, und hat nichts zu tun. Warum kann sie nicht heiraten?«
»Weil sie im Palast lebt«, erwiderte Fenzhi. »Sie ist eine der Frauen meines Bruders, auch wenn sie ihn wahrscheinlich niemals sehen wird. Er findet es schon anstrengend genug, seiner ersten Gemahlin Kinder zu machen. Seine große Liebe war die Amme seines jüngeren Bruders. Mein Vater duldete diese Beziehung nicht. Er ließ die Frau und das gemeinsame Kind töten, um Jing Gehorsam zu lehren. Das hat mein Bruder nie wirklich verwunden. In seiner Jungend hatte er viele Liebschaften, aber jetzt zieht er andere Beschäftigungen vor. Die neue Nebenfrau hat er nur genommen, um ihren Vater zu ehren. Obwohl sie wunderschön und kultiviert ist, durfte sie noch niemals sein Lager teilen.«
Sophie bediente sich an ihrer Reisschüssel. Das hervorragende Essen bei Fenzhi hatte ihrem Leben ein wenig Würze verliehen.
»Wozu soll ein Mann so viele Frauen haben, die er nicht einmal will?«, fragte sie. »Bei uns gilt es als Sünde, wenn ein Mann mehr als nur eine hat.«
»Ein merkwürdiger Brauch«, erwiderte Fenzhi nachdenklich. »Männer wollen so viele Nachkommen wie möglich zeugen. Da ist es besser, wenn sie mehr Frauen haben als nur eine.«
Sophie dachte an die Sitte der Siraya, die es Männern erst nach vollbrachter Leistung als Krieger erlaubte, überhaupt Vater zu werden. Die Welt war vielfältiger, als Fenzhi annahm.
»Aber das allein ist es nicht«, redete Fenzhi weiter. »Frauen müssen versorgt werden, da sie allein schutzlos sind. Auch aus diesem Grund ist es von Vorteil, wenn mächtige, reiche Männer mehr als nur eine Gemahlin haben. Deine Freundin Gushe wurde hier aufgenommen, weil ihr Vater im Dienst von meinem Vater starb. Sie hat ein Zuhause, genug zu essen und muss nicht hart arbeiten. Welchen Grund hat sie denn zu klagen?«
Im ersten Moment wusste Sophie keine Antwort. Alles, was ihr einfiel, war das Empfinden von Leere, das sie geplagt hatte, bevor der Unterricht mit Fenzhi begonnen hatte. Ein Leben, das kein Ziel und keinen Mittelpunkt hatte, weckte irgendwann den Wunsch, es schlafend zuzubringen. In der Hoffnung auf schöne Träume.
»Gushe möchte eine Familie, wie die meisten Menschen eine haben. Ich glaube, dann wäre sie auch bereit, manchmal hart zu arbeiten«, erklärte sie.
Fenzhi nagte nun wieder einen Hühnerknochen blank.
»Ich verstehe, dass sie es möchte. Aber ich kann ihr nicht helfen, es zu bekommen.«
»Aber könntet Ihr nicht …«, begann Sophie, wurde aber mit einer ungeduldigen Handbewegung zum Schweigen gebracht.
»Nein. Ich kann ihr keinen Mann herbeizaubern. Das könnte ich nicht einmal für mich selbst tun, wenn ich wollte. Ich werde auch nicht mit meinem Bruder darüber reden, weil ich ihn nicht langweilen möchte. Dieser Palast ist voller Frauen wie Gushe, die für den Rest ihres Lebens keine andere Aufgabe haben werden, als es hier irgendwie miteinander auszuhalten. Aber sie sterben nicht an Hunger wie manch anderer Mensch.«
Sollte man allein dafür dankbar sein?, überlegte Sophie. Sie wusste nicht, ob sie dazu fähig wäre.
»Kommt es denn niemals vor, dass Frauen aus dem Palast vermählt werden?«
»Doch, es kommt vor«, erwiderte Fenzhi. »Manchmal werden sie Männern, die sich im Dienst des Herrschers hervorgetan haben, als Geschenk überreicht. Doch dabei handelt es sich entweder um Verwandte des Herrschers oder um besonders schöne, junge Frauen.«
Eine weitere Ausführung erübrigte sich. Gushe würde niemals als ein solches Geschenk ausgewählt werden, doch Sophie graute es davor, ihr diese niederschmetternde Botschaft überbringen zu müssen. Vielleicht würde sie mit der Zeit doch etwas ausrichten können, wenn sie immer wieder bei Fenzhi nachfragte. Es musste auch unbedeutende Männer geben, denen manchmal ein Gefallen erwiesen wurde.
»Was dich betrifft, so hat mein Bruder übrigens eine Nachricht nach Batavia geschickt«, sagte Fenzhi nun. »Du gehörst zu den bedeutenden holländischen Gefangenen, weil dein Vater ein wichtiger Mann war. Du siehst, es kommt immer auf die Väter an. Sie bestimmen unser Schicksal, auch wenn sie nicht mehr leben.«
Mit diesen Worten ging Fenzhi dazu über, wieder lateinische Buchstaben zu üben.
»Sie sagte, es wird nicht einfach sein«, teilte Sophie Gushe am Abend mit. »Aber sie wird es versuchen.«
Kurz schämte sie sich, weil sie die Wahrheit allzu sehr beschönigt hatte. Doch das Leuchten auf Gushes Gesicht versöhnte Sophie mit ihrer Lüge. Falls sie tatsächlich bald nach Batavia fahren konnte, würde sie darum bitten, Gushe mitzunehmen. Für den Palast wäre es kein Verlust und sie selbst konnte sich in der holländischen Niederlassung nach einem Ehemann für die kleine Chinesin umsehen.
Ihr Leben hatte sich erstaunlich schnell verändert, seit sie als Favoritin der Dame Fenzhi galt. Shu Ma und ihre Freundin, die Zhuni hieß, warfen ihr finstere Blicke zu, wenn sie ihnen über den Weg lief, hatten aber keine weiteren Anfeindungen gewagt. Vermutlich hatte sie das Gushe zu verdanken, die damit gedroht hatte, es der Dame Fenzhi mitzuteilen. Wichtiger als dieser Schutz aber war der Umstand, dass Gushe sie zu mögen schien, lächelte, wenn sie ihrer ansichtig wurde, und gern mit ihr sprach. Fast ein Jahr lang hatte Sophie sich in dieser chinesischen Welt aus Pagoden, Höfen und Götteraltären wie ein Straßenköter gefühlt, der sich möglichst klein und unauffällig machen musste, damit niemand ihn zornig zur Seite trat. Jetzt gab es zumindest zwei Menschen, denen sie wichtig war.
»Ach ja, da ist noch etwas«, redete Gushe weiter. Sie saßen wieder in Sophies kleiner Kammer. Diesmal gab es noch etwas Fischsuppe, die Fenzhi ihr mitgegeben hatte und die Gushe nun erfreut schlurfte.
Erst als ihre Schüssel völlig leer war, fuhr Gushe mit ihrer Rede fort.
»Ich habe dir doch gesagt, dass es hier noch Bedienstete gibt, die auch Ozeanbarbaren sind. Ich kenne ein paar von ihnen, weil ich früher in der Küche mithalf. Also eine von ihnen, eine ältere Frau, möchte gern mit dir reden.«
Sophie schüttelte verwirrt den Kopf.
»Ich lebe ein Jahr hier. Warum will sie jetzt mit mir reden?«
Gushe sah angesichts dieser Frage überrascht aus.
»Es ist nicht so einfach. Jeder überwacht hier jeden und ihr seid Gefangene. Du warst als Einzige keine Dienstmagd, sondern Konkubine. Sie durften nicht mit dir reden.«
All diese Dinge hatte Sophie nicht begriffen, weil sie die Welt der Chinesen nicht kannte.
»Aber wieso kann sie mich jetzt treffen?«
Gushe lachte.
»Weil ich euch helfen werde. Morgen früh, wenn alle noch schlafen, zeige ich dir, wo du die Holländerin findest.«
Ihr Gesicht drückte Stolz aus, sich derart nützlich zeigen zu können. Sophie ahnte, dass ihr ein Gefallen erwiesen wurde, weil sie selbst einen versprochen hatte. Sie würde sich wirklich anstrengen, Gushe zu helfen, beschloss sie.
Am nächsten Morgen wurde sie von Gushe geweckt, bevor die Sonne aufgegangen war. Sie schlichen gemeinsam nach draußen, durchquerten mehrere Höfe, wo Diener bereits den Boden kehrten, und gelangten schließlich zu einer großen Hütte an der Palastmauer.
»Hier wohnen die einfachen Diener. Die meisten sind schon wach«, flüsterte Gushe ihr zu. »Gehe zu dem kleinen Tempel neben dem Eingangstor an der Mauer. Dort ist jetzt niemand. Hinter dem Altar ist ein kleiner Lagerraum. Krieche dort hinein. Ich bringe die andere Ozeanbarbarin, sobald es geht.«
Sophie gehorchte. Sie trat über die hohe Türschwelle, mit der Chinesen Geister fernhalten wollten, und gelangte in das Tempelgebäude, wo es nach Rauch und verfaultem Obst stank. Man merkte, dass hier die einfachen Arbeitskräfte des Palastes beteten, denn in Fenzhis Hof hatten auch die grell bemalten, grimmigen Götterstatuen der Chinesen frische Luft und ein sauberes Zuhause. Sophie kroch schnell hinter die hölzerne Statue und bemühte sich, dabei keine der davor aufgebauten Schalen und Bretter umzuwerfen. Tatsächlich entdeckte sie eine Tür, die sich mühelos aufschieben ließ.
Finsternis tat sich vor ihr auf, denn der kleine Vorratsraum verfügte über keinerlei Fensteröffnungen.
Zum Glück traf Gushe sehr bald ein, gefolgt von einer anderen Frau, deren Gesichtszüge im Dunkeln schwer zu erfassen waren. Dennoch erkannte Sophie das gelockte Haar und die großen, runden Augen einer Europäerin.
Ihr Herzschlag überschlug sich vor Freude.
»Bist du wirklich die Tochter von Antonius Hambroek?«, flüsterte eine heisere Stimme auf Holländisch. Sophie schossen Tränen in die Augen. Sie hatte nicht einmal gewusst, wie sehr die Muttersprache ihr gefehlt hatte.
»Die bin ich«, erwiderte sie. »Mein Vater ist leider tot.«
»Das wissen wir.«
Die Frau setzte sich neben sie. Gushe blieb im Tempel, bestand aber darauf, die Tür offen zu lassen. So hatten sie wenigstens ein wenig Licht.
»Ich bin Cornelia Barts«, stellte die Holländerin sich vor. »Mein Mann stand im Dienst von Valentyn, dem Gouverneur von Fort Provintia. Er wurde getötet und ich geriet in die Sklaverei.«
»Wir hörten während der Belagerung von dem Unglück«, erzählte Sophie. Erinnerungen stürzten auf sie ein. Sie dachte an Griet und deren kleine Stieftochter Lies und alle anderen Menschen, mit denen sie in Fort Zeelandia eingesperrt gewesen war, während die Flotte von Zheng Chenggong sie belagert hatte. Damals war sie noch unter ihren Landsleuten gewesen und hatte gehofft, eines Tages in die holländische Heimat segeln zu können.
»Wie wirst du behandelt?«, fragte sie Cornelia, die bitter auflachte.
»Nicht schlechter, als sie mit den chinesischen Dienern umgehen. Wer sich richtig verhält, dem geschieht nichts. Aber Fehler werden streng bestraft.«
Das mochte in holländischen Fürstenhäusern ähnlich sein.
»Musst du zu chinesischen Göttern beten?«, bohrte Sophie weiter nach. Für ihren Vater wäre es das größtmögliche Unglück gewesen, sich vor den heidnischen Statuen verneigen zu müssen.
Wieder schüttelte Cornelia den Kopf.
»Nein. Wir dürfen sogar christliche Gebete sprechen. Den Chinesen ist das egal, wir sollen nur unsere Arbeit verrichten. Aber ich hatte einen Mann und ein Kind. Beide habe ich verloren, denn meine Tochter erlag vor zwei Monaten einem Fieber. Mir bleibt nur ein einziger Wunsch. Ich möchte meine Familie in Holland wiedersehen, anstatt irgendwann unter diesen fremden Menschen zu sterben.«
Diese Worte kamen wie aus Sophies Herz. Zwar fand sie das Leben im Herrscherpalast erträglicher, seit sie Fenzhi kannte, aber sie wollte nicht auf ewig in diesem Zustand verharren.
»Vielleicht werden wir nach Verhandlungen ausgetauscht«, sagte sie, um Cornelia Hoffnung zu machen. Aber die Holländerin lachte nur bitter auf.
»Das mag für die Tochter eines bekannten Missionars gelten. Nicht für mich.«
Tröstend griff Sophie nach ihrer Hand.
»Ich werde darauf bestehen, dich mitzunehmen.«
»Ach Mädchen, sie werden nicht fragen, was du willst«, entgegnete Cornelia. »Nutze deine Chance, nach Batavia zu kommen, wenn sie sich bietet. Aber Menschen wie ich müssen andere Fluchtwege finden.«
»Gibt es die denn?«
Sophie war hellhörig geworden. Lange hatte sie gedacht, dass die Mauern, die sie nun umgaben, unüberwindlich wären.
Cornelia warf einen vorsichtigen Blick Richtung Tür.
»Gushe versteht kein Holländisch«, beruhigte Sophie sie.
»Also«, flüsterte Cornelia. »Es gibt chinesische Händler, die uns gegen eine entsprechende Entlohnung nach Batavia schmuggeln. Chinesen sind geborene Geschäftsleute. Das sagte bereits mein verstorbener Mann. Man muss ihnen nur ein passendes Angebot machen, dann bekommt man alles, was man braucht.«
Nun drückte sie Sophies Hand fest zusammen.
»Durch dich könnten wir vielleicht genug Geld oder Wertgegenstände auftreiben, um diese Händler zu bezahlen. Du bist eine Konkubine von Zheng Chenggong gewesen, heißt es.«
»Ich bekam ihn niemals zu Gesicht, wurde nur im Palast eingesperrt«, erklärte Sophie. »Aber ich werde sehen, was ich tun kann, um dir den Weg in die Freiheit zu ebnen.«
Stürmisch schloss Cornelia sie in die Arme.
»Vergiss deine Landsleute nicht!«, flüsterte sie ihr ins Ohr. »Erweise dich deines Vaters würdig.«
Eben dies hatte Sophie sich früher niemals zugetraut. Doch nun, als sie mit Gushe in ihr Haus zurückging, verspürte sie plötzlich die Ahnung von Stärke in sich.
3. Kapitel
Davilo, Formosa
In dieser Nacht sah Emma ihren Vater wieder. Er wirkte noch größer und wuchtiger, als sie ihn in Erinnerung hatte, trug einen schwarzen Mantel und einen Hut mit breiter Krempe. Sein Bart war seit ihrer letzten Begegnung deutlich ergraut, wucherte bis zu seiner Brust hinab wie auf den bildlichen Darstellungen der Apostel. In seiner linken Hand hielt er die Bibel, in der rechten einen Rohrstock, den er aber nicht auf sie niedergehen ließ, obwohl sie sich furchtsam duckte.
»Vergiss niemals deine Pflicht, Tochter«, donnerte seine Stimme. »Verkünde das Wort Gottes auf dieser von Hexen beherrschten Insel, kämpfe gegen heidnische Sitten und rette die Seelen der Unschuldigen vor dem Fegefeuer. Allein dir kann ich diese Aufgabe anvertrauen. Du besitzt die Kraft, mein Erbe fortzuführen.«
»Bist du krank?«, flüsterte Emma fassungslos. Sie hatte ihn immer als furchteinflößend stark erlebt, ein Fels, dem selbst die Stürme und Erdbeben Formosas nichts anhaben konnten.
Nun bemerkte sie plötzlich tiefe Falten auf seinem Gesicht, Adern, die rot und blau unter kreidebleicher Haut schimmerten. Er fiel langsam in sich zusammen wie eine Hütte, deren Holz morsch wurde. Sie streckte die Hand aus, um ihn zu stützen, doch griff sie ins Leere.
»Vergiss mich nicht!«, flüsterte er. »Vergiss niemals, wofür ich mein Leben gab.«
Auf einmal krochen Würmer über seine Wangen, fraßen seine Augen und schlichen unter den Hut, der zur Seite rutschte und glatten, hellen Knochen freigab.
Emma schrie. Angst und Entsetzen ließen sie wild um sich schlagen. Doch gleichzeitig ergriff ein anderes Gefühl von ihr Besitz. Sie hatte ihren Vater lange bewundert, später gefürchtet und manchmal verabscheut. Nun, da er vor ihren Augen zu Staub wurde, spürte sie eine tiefe, gewaltige Kraft der Liebe, die wie eine Welle über sie hinwegrollte. Sie blieb erschöpft und mit schmerzenden Gliedern zurück, doch empfand sie auf einmal Erleichterung.
»Wach auf!«, hörte sie eine junge Frau rufen. Ihre Stimme klang ängstlich und Emma öffnete verwirrt die Augen. Sie sah das hölzerne Dach der Hütte über sich, blickte in drei besorgte Gesichter und bekam etwas Wasser eingeflößt.
Die Frau, in deren Hand der Becher lag, hieß Anna, wie Emma nun einfiel. Eine der zahlreichen Verwandten der Inib. Sie gehörte zu den wenigen Leuten in Davilo, die dem christlichen Glauben noch nicht ganz abgeschworen hatten.
Langsam richtete Emma sich auf. Durch die Ritze in den Balken der Hütte drang Sonnenlicht. Sie erkannte die zwei anderen Mädchen hinter Anna, ebenfalls Angehörige der Sippe der Inib, doch um einiges jünger. Oki und Dika wurden sie genannt. Falls sie jemals christliche Namen bekommen hatten, so waren diese unwichtig geworden.
»Dein Mann Frans ist zurück«, flüsterte Anna ihr nun zu. »Er ist im Haus der Krieger, wie es sich gehört. Aber wenn es dunkel wird, kann er zu dir kommen.«
Sie brachte Emma eine Schüssel mit einer Mischung aus gekochter Süßkartoffel und Gemüse.
»Hier, iss das bitte. Du warst drei Tage lang krank. Wir hatten Angst, dich zu verlieren. Sogar unsere Priesterin, die Inib, war hier, meinte aber, die Götter würden entscheiden, ob du lebst oder nicht.«
Wenigstens wollte sie meinen Tod nicht, dachte Emma erleichtert und begann zu essen. Unter dem Vorwand, ihr ein Heilmittel einzuflößen, hätte die Inib sie problemlos vergiften können. Nach dem Fortgehen von Frans, der mit anderen Männern des Dorfes aufgebrochen war, um Hirschfelle zu verkaufen, hatte Emma niemanden mehr in Davilo gehabt, der sich für sie eingesetzt hätte. Sie war das letzte Überbleibsel einer vergangenen Herrschaft.
»Ich danke euch für eure Hilfe«, sagte sie zu den drei Frauen. »Mir geht es gut, ich möchte mich nur noch eine Weile ausruhen.«
Ihre drei Begleiterinnen entfernten sich ohne Widerspruch. Die kleine Ecke in der Hütte gehörte nun ihr allein, auch wenn die Geräusche des Dorfes ständig an ihr Ohr drangen. Tagsüber war es in Davilo fast niemals still, da die Einwohner einander viel zu erzählen hatten, gern lachten und sangen. Nur nachts herrschte Ruhe, denn Lampen und Kerzen waren rar. Emma hatte gedacht, an dieses Leben gewöhnt zu sein, doch in den letzten Wochen war das Gefühl der Verlorenheit so stark geworden, dass es ihr den Lebensmut geraubt hatte. Die Folge war stete Erschöpfung gewesen, schließlich ein Fieber, das sie niederstreckte. Aber nun konnte sie spüren, wie Hoffnung durch ihre Adern floss.
»Frans ist zurück«, murmelte sie leise auf Holländisch, das sie manchmal allein übte, um es nicht ganz zu vergessen. Ihr Ehemann war wieder in Davilo. Mit ihm konnte dieser Ort sich in jenes Zuhause verwandeln, das es früher einmal für ihre ganze Familie gewesen war.
Als es dämmerte, hatte Emma sich in einem kleinen Bottich gewaschen und zu ihrer Leinenbluse einen jener bunt bestickten Wickelröcke angezogen, die im Dorf weiterhin getragen wurden. Er reichte nur bis zu ihren Waden. Ihr Vater hätte ihr niemals erlaubt, mit nackten Beinen und Sandalen an den bloßen Füßen das Haus zu verlassen. Bei der steten Hitze auf Formosa war es eine Wohltat, dem Körper nicht mehrere Lagen Stoff aufzubürden, aber dafür hatte Antonius Hambroek nie Verständnis gezeigt.
Sie war dennoch züchtiger gekleidet als die meisten Frauen des Dorfes, dachte Emma, um gegen Schuldgefühle anzukämpfen. Ihr Vater hatte die Eigenheiten dieser Insel niemals begriffen.
Da sie auch keine Haube mehr besaß, flocht Emma ihr Haar in zwei Zöpfe, bevor sie zum Ausgang der großen Hütte ging. Davor brannte ein Lagerfeuer, um das sich inzwischen etliche Frauen des Clans versammelt hatten. Sie brieten Fleischspieße, stillten Neugeborene und plapperten ununterbrochen. Die Stimmung war deutlich entspannter als zu der Zeit holländischer Herrschaft. Niemand hinderte Emma daran, aufzubrechen, obwohl es bereits dämmerte. Hier durften Frauen tun, was sie wollten – solange die Clansmutter keine Einwände hatte. Emma sah noch ein paar Kinder auf dem Dorfplatz he-rumtollen, sorglos und fröhlich. Das Haus, in dem sie mit ihrem Vater und der Schwester Sophie gewohnt hatte, gehörte inzwischen einem anderen Teil der weitverzweigten Verwandtschaft der Inib. Der Häuptling von Davilo lebte in der ehemaligen Kirche. Die Inib hatte gewusst, dass es seine Eitelkeit befriedigen würde, das Heim eines gestürzten Gottes zu beziehen. Die Eingangstür war nun bunt bemalt, den von einem heftigen Sturm beschädigten Turm hatte niemand repariert. Im Vorgarten bauten die Frauen aus dem Häuptlingsclan Gemüse an.
Die missionarischen Erfolge ihres Vaters wurden zurückgedrängt, so wie der Wald sich ein verlassenes Gebäude zurückholte. Würden die Kinder von Oki und Dika noch etwas vom christlichen Glauben wissen?
»Meine Aufgabe«, murmelte Emma leise, als sie in Richtung des Langhauses lief, wo nun die jungen Männer lebten. Anna hatte ihr später zugeflüstert, dass Frans ein Stück dahinter auf sie warten würde.
Dunkelheit empfing sie, sobald sie das Dorf verlassen hatte. Der Dschungel hatte seine eigene Musik, eine Mischung aus Zischen, Kreischen und Knirschen. Emma wurde mulmig zumute, denn hier konnte sie die heidnische Geisterwelt, vor der ihr Vater sie immer gewarnt hatte, einatmen. Als sie nicht mehr weiter ins Unbekannte einzudringen wagte, wurde sie plötzlich stürmisch umarmt.
»Es geht dir gut, ich danke dem Christengott!«, rief Frans auf Holländisch.
Er war kräftiger geworden. Auf seinen Armen waren die Rundungen der Muskeln zu sehen wie bei den Kriegern des Dorfes. Dabei hatte er Kampfübungen stets gehasst und die Bibelstunden bei ihrem Vater vorgezogen.
»Ich habe mich durchgeschlagen«, sagte Emma. »Aber es war nicht immer leicht. Die Menschen in Davilo vergessen alles, was die Missionare sie gelehrt haben.«
»So ist es überall«, erwiderte Frans und zog sie zu sich auf einen Baumstumpf. Er roch nach Schweiß und Arak. Emma spürte bis in die Tiefen ihres Unterleibs, wie sehr sie ihn vermisst hatte.
»Die Chinesen wollen, dass wir die Lehren der Holländer nicht mehr befolgen«, erzählte er.
»Bringen sie euch denn nun ihre chinesischen Götter?«, fragte Emma besorgt. Ihr Vater hatte die Einheimischen Formosas als harmlose Kinder betrachtet, die eine angemessene Erziehung brauchten. Den Chinesen hatte er jedoch misstraut, womit er am Ende recht gehabt hatte. Aber hinter seiner Skepsis hatte sich auch die widerwillige Anerkennung eines Gegners verborgen, der zur ernsthaften Gefahr werden konnte.
»Nein, sie wollen uns nicht missionieren«, erwiderte Frans zu ihrem Erstaunen. »Ich glaube, dazu sind wir ihnen zu unwichtig. Manche chinesische Herren holen sich unsere Frauen in ihre Häuser und schenken ihnen schöne Kleider und Schmuck. Ansonsten betrachten sie uns als ihre Diener.«
Er hatte bitter geklungen. Emma legte ihren Kopf an seine Schulter.
»Auch mein Vater hat viele Dinge falsch gemacht«, erinnerte sie ihn. Frans versteifte sich.
»Dein Vater wollte uns belehren und bevormunden, doch ging es ihm um unser Seelenheil. Die Chinesen wollen uns einfach benutzen.«
Emma staunte, wie sehr er den alten, grimmigen Missionar trotz allem schätzte.
»Hast du herausgefunden, was aus ihm geworden ist?«, flüsterte sie nun unruhig. Frans hatte sich der Gruppe von Händlern auch angeschlossen, um Neuigkeiten nach Davilo bringen zu können.
Nun schwieg er eine Weile und musterte das Geflecht der Baumwurzeln zu seinen Füßen.
»Dein Vater ist tot«, sagte er schließlich, weiterhin ohne Emma anzusehen. »Ich hatte mir wirklich gewünscht, dass es nicht so wäre, aber…«
»Ich weiß«, unterbrach sie. »Ich habe von ihm geträumt und sah, dass er nicht mehr lebt.«
Ein holländischer Mann hätte dies vielleicht Hexerei genannt, aber Frans war ein Enkel der Inib. Er nahm Emmas Aussage ohne Widerworte hin.
»Was ist mit Sophie?«, bohrte sie nun weiter nach. Die Schwester war ihren Träumen bisher ferngeblieben, was ihr Hoffnung schenkte.
»Sie konnte nicht mit den anderen Holländern Fort Zeelandia verlassen«, erwiderte Frans. »Deine Freundin Griet Maas und ihre Kinder sind fort. Aber Sophie wird im Palast von Zheng Chenggong gefangen gehalten.«
Emma versteinerte. Sie hatte befürchtet, von Sophies Tod zu hören, aber diese Neuigkeit ließ neue Ängste wie Würmer aus einem Loch kriechen.
»Ist sie eine Sklavin? Eine … eine …«
»Sie ist eine Konkubine«, beendete Frans seinen Bericht. »Doch der große Eroberer unserer Insel ist inzwischen tot und sein Sohn hat Sophie geerbt. Er macht sich nicht viel aus Frauen, heißt es. Deine Schwester hat wahrscheinlich ein sicheres und angenehmes Dasein im Palast, ohne von ihm behelligt zu werden.«
Es könnte Sophie gefallen, überlegte Emma. Sie hatte sich stets nach Sauberkeit, Ordnung und schönen Gewändern gesehnt. Ihr Traum war ein holländischer Ehemann gewesen, der sie in eine Heimat brachte, die ihnen beiden unbekannt war. Für Emma war Davilo zur Heimat geworden, aber die jüngere Sophie hatte sich nie wirklich mit den Hütten im Dschungel anfreunden können. Vielleicht war sie nun glücklicher, da die Chinesen ihr ein besseres Leben bieten konnten. Aber all das waren nur Vermutungen.
»Ich kann nicht mit meiner Schwester reden. Ich weiß nicht, wann ich sie wiedersehe«, flüsterte sie bedrückt.
Der Druck von Frans’ Armen um ihre Schultern wurde fester.
»Warte ab. Vielleicht ändert es sich.«
Oder vielleicht auch nicht. Emma hatte inzwischen begriffen, dass sie nicht alles in dieser Welt nach ihren Wünschen lenken konnte. Frans war wieder bei ihr, dafür allein musste sie dankbar sein.
»Werden wir jemals in Davilo zusammenleben können wie ein Ehepaar?«, fragte sie nun frei heraus. Vorher hatte der Vater es ihr verboten. Nun gab es andere Regeln, die ihnen im Weg standen.
»Ich muss mich bewähren«, erwiderte Frans nach einigem Zögern. »Dann erst darf ein Mann bei uns Kinder zeugen. Alles andere ist … erlaubt.«
Wieder vermied er es, Emma anzusehen. Die christliche Erziehung machte es ihm schwer, so zügellos zu sein wie andere Männer seines Volkes. Es gab bei den Siraya keine Verbote von Liebschaften und viele Paare trafen sich nachts am Rande des Dorfes, um ein geeignetes Versteck zu suchen. Nur die Fortpflanzung war strengen Regeln unterworfen. Inzwischen wusste Emma, dass die meisten jungen Frauen sich mit Kräutern vor unpassenden Schwangerschaften schützten. Aber diese halfen oft nicht. Die Prozedur einer erzwungenen Abtreibung flößte Emma zu viel Schrecken ein, um sich leichtfertig in die Arme ihres Geliebten zu stürzen.
Frans drängte sie nicht. Ein weiteres Zeichen, wie gut sie zusammenpassten.
»Ich tauge nicht als Krieger«, gab er schließlich zu. »Aber ich möchte meinen Leuten helfen, indem ich gute Handelsbeziehungen zu den Chinesen aufbaue. Sie sind die neuen Herren hier. Wenn ich unsere Felle und Schnitzereien verkaufe und begehrte Waren nach Davilo bringe, wird die Inib mir erlauben, eine Familie zu gründen.«
Er drückte Emmas Hand an seine Wange.
»Wir warten«, flüsterte er. »Bis es so weit ist.«
Sie verspürte Erleichterung, obwohl die Sehnsucht ihren Unterleib zusammenzog. Seit sie aufgehört hatte, ein Kind zu sein, hatte es für sie keinen Mann außer Frans gegeben, den Sohn des Häuptlings.
»Eines Tages leben wir zusammen in einer großen Hütte und haben mehrere Kinder«, erwiderte sie und schmiegte sich an seinen Körper, der ihr fast so vertraut war wie ihr eigener.
Selbst wenn sie einfach nur gemeinsam auf einem Baumstamm saßen, waren sie trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft Teil eines Ganzen. Kinder dieser Insel, die keine andere Heimat kannten.
Als der Morgen graute, machten sie sich auf den Weg ins Dorf. Frans ging zu der einstigen Kirche, die von seinem Vater, dem Häuptling, und seiner weitverzweigten Verwandtschaft bewohnt wurde. Emma wollte möglichst unauffällig in ihre Hütte gelangen. Auf dem Dorfplatz standen nun die zwei wichtigsten Gottheiten der Siraya, schlichte, aber dennoch kunstvoll geschnitzte Darstellungen eines Mannes und einer Frau. Emma hatte sich an diesen Anblick gewöhnt. Wenigstens lagen keine Schädel davor, der übliche Tribut nach Kriegen mit anderen Stämmen.
Ein Stück neben dem Opferplatz entdeckte Emma die Inib über einen Bottich gebeugt. Sie trug wie immer einen Wickelrock, der nur zu ihren Knien reichte. Der Rest ihres Körpers war nackt, mit einigen Tätowierungen verziert und für eine Frau, deren Haar bereits schlohweiß geworden war, erstaunlich sehnig. An den Schultern sah man jene Narben, die ihr auf Befehl von Emmas Vater durch Hiebe zugefügt worden waren.
Obwohl Emma sich bemühte, leise zu gehen, fuhr die Inib herum wie ein Tier, das auch in seinem Rücken jede Bewegung wahrnahm. Emma unterdrückte den Drang, wegzulaufen, und zwang sich, die alte Frau mit einer respektvollen Neigung des Kopfes zu grüßen. Nun, da die Holländer vertrieben waren und die Chinesen sich nicht mehr in Davilo aufhielten, war diese grimmige Heilerin die wahre Herrscherin des Ortes.
»Ich sehe, du bist wieder gesund«, sagte sie und musterte Emma aufmerksam. »Die Götter wollten dich für uns erhalten.«
Emma warf einen Blick auf die Holzstatuen. In letzter Zeit ertappte sie sich immer wieder dabei, ihnen tatsächlich besondere Kräfte zuzuschreiben. Der christliche Herrgott schien sich von dieser Insel zurückgezogen zu haben.
»Ich bin dankbar, dass ich noch leben darf«, erwiderte sie. »Du hast mich vor Jahren schon einmal mit deiner großartigen Heilkunst gerettet.«
Das Gesicht der Inib erhellte sich wie von Emma erwartet. Die Alte liebte Schmeicheleien.
»Ich wusste schon immer, dass du uns nützlich sein kannst«, erklärte sie nun etwas freundlicher. »Die holländischen Priester brachten nur Verderben, aber du bist anders. Eine Frau kann die Stimmen der Götter und Geister dieser Erde hören. Du bist keine Fremde mehr, sie haben dich angenommen.«