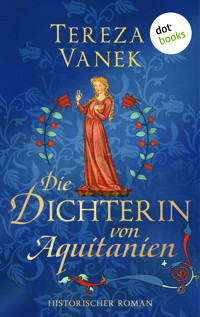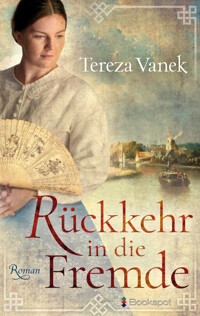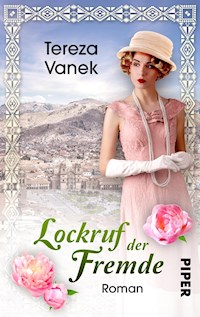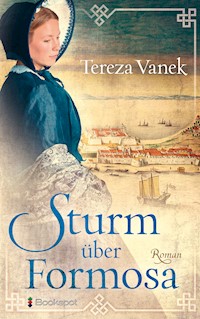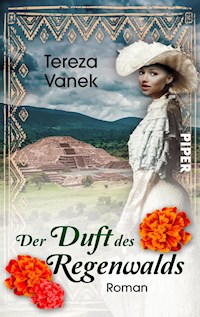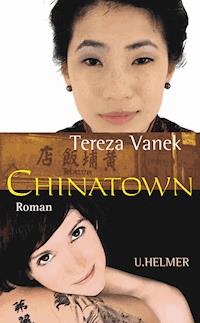5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Welten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Die goldenen 1920er Jahre und der Schrecken einer brutalen Diktatur. Eine schicksalshafte Geschichte über die Verbundenheit zweier Frauen und ihren Kampf für ein besseres Leben »Susan atmete die vom Regen reingewaschene Luft ein. Diese Stadt bestand aus riesengroßen grauen Gebäuden und wurde sehr häufig von schlechtem Wetter heimgesucht, aber sie versprach, ein Ort völlig ungeahnter Freiheit zu werden.« Die Berliner Cabarets in den 1920er Jahren – eine goldene, zügellose Welt, die zwei Frauen aus unterschiedlichen Welten magisch anzieht. Auch wenn Susan und Anna nur durch einen Zufall zusammengefunden haben, werden sie bald ein erfolgreiches Duo auf der Bühne. Sie genießen ihre Freiheit, bis sich über ihnen plötzlich die dunklen Wolken einer brutalen Diktatur zusammenbrauen. Ihr bisheriges Leben scheint nicht mehr möglich und sie müssen sich auf neue Wege begeben, um zu überleben. Vor allem Anna bangt um den Mann, an den sie ihr Herz verloren hat, denn er ist jüdischer Abstammung … »Dieses Buch beleuchtet wichtige Epochen der deutschen Geschichte anhand persönlicher Schicksale. Ich fand es sehr berührend und kann es nur weiterempfehlen.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Tereza Vaneks Schreibstil ist wieder einfühlsam und spannend.Sie versteht es wunderbar die verschiedenen Charaktere einzubinden. Ich war von diesem Werk wieder begeistert.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Die Handlung nimmt nach einem langsamen Anfang rasant an Fahrt auf, die sich zum Ende hin rapide steigert. Ein äußerst spannendes Buch, das ein Stück weniger bekannte deutsche Geschichte aufzeigt.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Tanz bis ans Ende der Welt« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Redaktion: Julia Feldbaum
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Nachwort
Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin.
Wo die Verrückten sind, da jehörste hin.
Berliner Gassenhauer
1. Kapitel
Frankfurt, Juni 1966
»Das sieht Anna wieder mal ähnlich, uns warten zu lassen«, sagte der Vater und entkorkte die Flasche Chianti. »Ich schlage vor, wir fangen jetzt mit dem Essen an. Warum sollten wir wegen meiner unzuverlässigen Schwester hungern?«
Klarissa warf einen Blick zur Uhr. Tatsächlich war es schon halb acht, und die Feier hätte um sieben beginnen sollen. Tante Anna wusste, wie viel Wert ihr Bruder auf Pünktlichkeit legte. Manchmal machte sie Witze darüber. Lothar würde von den Toten auferstehen und den Bestattern eine Standpauke halten, wenn der Leichenwagen sich zehn Minuten verspätete. Bei Familienfeiern gab sie sich normalerweise Mühe, seinen Ansprüchen gerecht zu werden, damit nicht gleich schlechte Stimmung aufkam.
»Vielleicht wurde sie aus beruflichen Gründen aufgehalten«, wandte Klarissa ein. »Sie wollte vorgestern aus Italien zurückkommen, wo sie neue Stoffe eingekauft hat.«
Geschäftliche Verpflichtungen wären eine Entschuldigung, die der Vater gelten lassen würde. Es bestand also Hoffnung, dass der Abend friedlich losgehen könnte. Wenn Tante Anna nur endlich eintraf! Klarissa wippte unter dem Tisch mit dem Fuß und trat unbeabsichtigt gegen ein Bein.
»Warum bist du denn so unruhig?«, fragte die Mutter vorwurfsvoll.
Klarissa entschuldigte sich, ohne eine Erklärung abzugeben.
Sie wartete seit gestern auf einen Anruf von ihrer Tante, die als Erste die große Neuigkeit hätte erfahren sollen. Zweimal hatte sie schon bei deren Sekretärin nachgefragt und war abgewimmelt worden. Anna Heyden sei aus beruflichen Gründen noch in Florenz.
Klarissa ahnte, dass es vor allem private Gründe waren. Anna hatte seit mehreren Jahren eine Liebschaft mit einem Italiener namens Massimo, der aus familiären Gründen nicht nach Deutschland umziehen wollte. Daher verbrachte sie so viel Zeit wie möglich bei ihm.
»Wenn Anna noch länger in Italien bleiben will, können wir doch getrost ohne sie essen«, wandte die Mutter schließlich ein. Dann begann sie, den Braten, Knödel und Sauerkraut auf die Teller zu verteilen.
Klarissa bedankte sich höflich, als sie ihre Portion erhielt, und zerschnitt das Fleisch in kleine Stücke. Wenn sie nichts aß, würde ihre Mutter sich gekränkt fühlen.
Die Enttäuschung war wie ein Geschwür, das ihr den Appetit verdarb. Dieser Abend, auf den sie sich seit zwei Wochen gefreut hatte, drohte völlig unplanmäßig zu verlaufen. Sie hatte ihre Tante neben sich haben wollen, wenn sie die große Neuigkeit verkündete. Niemand sonst würde verstehen, was es für Klarissa bedeutete, sich ihren Traum erfüllen zu können. Außerdem wollte sie Unterstützung haben, falls, wie befürchtet, nicht alle mit ihrem Entschluss einverstanden waren. Aber nun war Anna Heyden nicht hier.
Klarissa würgte ein paar Bratenstücke hinunter, um die Stimmung nicht zu verderben. Es sollte nicht an ihr liegen, wenn nicht jeder die Geburtstagsfeier ihres Vaters in guter Erinnerung behielt.
Zunächst verlief alles recht friedlich. Der Vater redete mit Klarissas Bruder Paul über dessen letztes Schulzeugnis, das nicht wie erwünscht ausgefallen war. Die Mutter hielt sich raus, musterte nur immer wieder Klarissa, als missfalle ihr irgendetwas an der Tochter. An dem Kleid konnte es nicht liegen, es war dunkel und schlicht, so wie Margarete Heyden sich selbst kleidete.
»Hast du schon irgendwelche Bewerbungen geschrieben?«, kam es schließlich, nachdem das Dessert aus der Küche geholt worden war. »Bei deinem guten Abitur hast du sicher bei vielen Firmen Chancen.«
Klarissa starrte auf ihre Nachspeise. Schokoladenpudding mit Kirschen mochte sie gern. Nun fühlte sie sich in der Lage, mit der erwünschten Begeisterung zu essen, doch zunächst musste sie die Frage beantworten. »Ich werde im September in München das Studium der Medizin beginnen«, erzählte sie ihrer Familie und hob das nun zum zweiten Mal aufgefüllte Weinglas. Vielleicht würden jetzt alle erfreut mit ihr anstoßen. Dann wäre alles so, wie sie es sich gewünscht hatte, nur dass Tante Anna fehlte.
Hoffnungsvoll betrachtete sie ein Gesicht nach dem anderen. Der Bruder grinste, ihr Vater sah völlig verblüfft aus, und die Mutter machte eine steinerne Miene. Alle schwiegen, als hätte ein Fluch ihnen die Sprachfähigkeit geraubt.
»Wer soll das denn bezahlen?«, fragte der Vater schließlich und räusperte sich. »Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?«
»Ich kann mir eine Nebentätigkeit suchen«, erwiderte Klarissa, denn auf diese Frage war sie vorbereitet gewesen. Ihr Vater hatte eine gute Stellung im Vorstand einer Firma, aber für das schöne Haus hatte er einen Kredit aufgenommen. »Außerdem hat Tante Anna … Also sie meinte, sie könne mich unterstützen, falls es nötig sei«, fügte sie daher hinzu. Mit einem leisen Seufzer lehnte sie sich zurück. Mit der Tante an ihrer Seite wäre es leichter gewesen, aber nun hatte sie es auch allein geschafft. Falls ein Sturm losgehen sollte, würde sie einfach ausharren, bis er sich wieder gelegt hatte.
»Anna hat dir das alles eingeredet, nicht wahr?«, sagte die Mutter leise. »Dass du lange Jahre in deine Ausbildung stecken sollst. So wie sie.«
»Sie hat mich ermutigt, mich um meine Ziele zu bemühen«, erwiderte Klarissa. »Außerdem hat sie selbst ja nicht studiert. Sie entwirft Kostüme, dazu braucht man lediglich eine Schneiderlehre.«
Diese hatte Tante Anna nicht einmal, aber das war es auch nicht, woran die Mutter sich störte. Klarissa ahnte, dass hier eine andere Drohung im Raum stand. Die Tochter könnte sich zu einem Wesen entwickeln, das andere Wege ging als die ihr von der Umwelt vorgegebenen. Ganz so wie die Schwägerin, mit der Margarete Heyden sich nie verstanden hatte.
»Irgendwann bist du allein, so wie Anna«, begann die Mutter auch schon. Der Chianti musste ihre Zunge gelöst haben, denn sie trank selten Alkohol. »Du wirst die Kinder deiner Freundinnen aufwachsen sehen, ohne eigene zu haben. Oder sie werden dir fremd sein, weil du zu wenig Zeit für sie hattest. Dann wirst du es bereuen, dass du deine Jugend verschwendet hast.«
»Ich habe nicht den Eindruck, dass Anna etwas bereut«, gab Klarissa sogleich zurück.
»Als ob sie jemals offen zugeben würde, dass sie Fehler gemacht hat!«, ereiferte die Mutter sich auch schon. »Dabei hat sie nichts außer ihrer Arbeit. Deshalb will sie anderen Leuten die Kinder wegnehmen!«
»Grete, bitte lass das jetzt!«, mischte sich der Vater ein, und Klarissa war ihm dankbar dafür.
»Ich will schon seit Jahren Ärztin werden«, warf sie ein. Sie hätte diesen Abend gern als ein Fest in Erinnerung behalten, bei dem auch ihr Erfolg gewürdigt worden war. »Am Arztberuf ist doch nichts Schlimmes«, fügte sie hinzu. »Es gibt auch schon seit längerer Zeit Frauen, die ihn ausüben.«
»Natürlich ist nichts Schlimmes daran.« Der Vater räusperte sich. »Es ist nur … ungewöhnlich. Wir dachten, du suchst dir einen Beruf, der keine so lange Ausbildung erfordert. Aber wenn du unbedingt willst …«
Er klang nicht gerade erfreut, doch Klarissa nahm sein unausgesprochenes Einverständnis erleichtert an. Feiern würde sie eben mit Tante Anna. Wenn die nur endlich aus Italien zurückkäme!
In dem Moment, da die Mutter ihnen allen noch Likör einschenkte, läutete das Telefon.
»Es ist unmöglich, Leute noch so spät zu stören«, murrte Margarete Heyden, aber der Vater stand gleichmütig auf.
»Grete, lass nur, vielleicht ist es ja wichtig.«
Er ging in den Korridor, wo der Telefonapparat stand. Die Mutter begann mit gerunzelter Stirn, die Dessertschüsseln einzusammeln.
»Wenigstens hast du alle von meinem Zeugnis abgelenkt, Schwesterherz«, flüsterte Paul Klarissa ins Ohr. »Also das hast du gut hingekriegt.«
»Sieh lieber zu, dass deine Noten besser werden«, erwiderte Klarissa und erhielt statt einer Antwort einen leichten Tritt unter dem Tisch.
Der Vater stand unerwartet lang draußen und redete. Sie konnte nur vereinzelte Worte verstehen. Er schien immer wieder nachzufragen, wie es denn dazu kommen konnte und was genau geschehen war. Seine Stimme klang aufgebracht.
»Hat Papa Probleme in der Arbeit?«, fragte sie ihren Bruder, der sich häufiger daheim aufhielt als sie.
Er zuckte nur mit den Schultern. »Keine Ahnung. Aber so spät rufen die aus der Firma normalerweise nicht an.«
Die Mutter kam zurück. Sie trug kein Geschirr mehr in den Händen, ihre Lippen waren so fest aufeinandergepresst, dass kein Laut durch sie hätte hindurchkriechen können.
»Ich glaube, es ist etwas passiert«, stieß sie nach einem Moment dennoch hervor, rückte den Stuhl zur Seite und setzte sich. »Mit … mit Anna.«
Klarissa schoss so schnell in die Höhe, dass sie gegen den Tisch stieß und eine der kleinen Kaffeetassen herunterwarf, die noch von der Großmutter stammten und wie Kostbarkeiten gehütet wurden. Doch nun war ihr das völlig egal.
Massimo war ein kleiner, drahtiger Mann in einem braunen Anzug. Sein gelocktes Haar wies ein paar graue Strähnen auf, doch er sah etwas jünger aus als Tante Anna. Klarissa wusste, dass er in Florenz ein Juweliergeschäft besaß, und unter anderen Umständen wäre sie neugierig gewesen, mehr über ihn zu erfahren. Da er Anna nun doch einmal in ihre Heimat begleitet hatte, war die Beziehung zwischen ihnen vielleicht ernster geworden. Doch er war kaum ansprechbar, saß völlig aufgelöst da und schluchzte in sein Taschentuch. Dadurch sorgte er für das einzige Geräusch in dem kahlen Warteraum des Krankenhauses.
»Was ist denn jetzt genau passiert?«, fragte Grete Heyden und musterte den weinenden Italiener missbilligend. Sein Arm steckte in einem Verband, und er hatte ein paar Schrammen im Gesicht. Mit einer Antwort von ihm war aber nicht zu rechnen, denn er schien kein Wort Deutsch zu verstehen.
»Ein Unfall, haben sie gesagt«, meinte der Vater, der mit dem Arzt gesprochen hatte. »Herrn Giordano ist jemand ins Auto gefahren, also er kann wirklich nichts dafür. Er hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Anna hingegen …«
Der Vater stieß einen Seufzer aus. Grete Heyden schluckte gequält. Paul kauerte in seinem Sitz, als würde er von einer unsichtbaren Last niedergedrückt.
Klarissa erinnerte sich an den Tag, da ein Fahrradfahrer sie auf dem Heimweg von der Schule gerammt und zu Boden geworfen hatte. Eine Weile war sie einfach nur dagelegen, völlig unfähig, sich zu rühren oder irgendetwas zu sagen. Genauso wie jetzt. Sie beneidete Massimo um seine Fähigkeit, den Schmerz einfach aus sich hinausfließen zu lassen, anstatt die eigenen Empfindungen in ein Gefäß zu packen und es zuzukorken, damit sie langsam im Inneren verfaulten.
»Sie werden Tante Anna doch retten können?«, fragte sie ihren Vater. Er würde sicher gleich nicken, nur mit betrübter Miene darauf hinweisen, dass es lange dauern könnte.
Ihr Vater schwieg. So lange, dass Klarissa das Gefühl hatte, die Erdkugel sei im Universum auf einmal zum Stillstand gekommen.
»Sie wissen es nicht«, murmelte er schließlich leise.
Klarissa musste sich vorbeugen, um ihn zu verstehen.
»Sie wissen nicht, ob meine Schwester diese Nacht überlebt.« Dann legte er die Hände vors Gesicht und weinte ebenfalls, nicht so hemmungslos wie Massimo, sondern haspelnd und mit Unterbrechungen, als müsse er sich dabei anstrengen.
Klarissa schloss kurz die Augen und bohrte sich die Nägel in ihre Handflächen. Wenn sie jetzt nichts spürte, dann war alles hier nur ein böser Traum. Doch leider fühlte sie den Druck, auch wenn er keinen echten Schmerz auslöste. Diesmal war sie nicht einfach von einem Fahrrad umgeworfen worden. Ein ganzer Zug ratterte über sie hinweg, lärmend und gewaltig. Sie vermochte sich weder zu regen noch irgendetwas zu empfinden außer der schlichten Weigerung anzuerkennen, dass ihr etwas Derartiges widerfahren konnte. Katastrophen standen in der Zeitung. Sie passierten immer nur anderen Menschen, die man persönlich nicht kannte.
»Sie hat dir ihr Haus vermacht«, sagte der Vater zwei Wochen später, nachdem er mit dem Notar gesprochen hatte. Klarissa, die lustlos auf ihr Frühstücksbrot starrte, nickte nur, während die Mutter fragte, wer denn die Kostümschneiderei bekommen sollte.
»Anna hat doch selbst eine Tochter, Sarah, die in der Schweiz lebt«, erzählte der Vater. »Die erbt natürlich den ganzen Rest.«
Grete Heyden nippte an ihrer Kaffeetasse. »Sarah hat sich kaum um ihre Mutter gekümmert. Ich glaube, seit wir verheiratet sind, habe ich das Mädchen vielleicht zweimal gesehen.«
Kinder, die keinen Umgang mit ihren Eltern hatten, kamen im Weltbild von Grete Heyden nicht vor. Das musste der Grund für ihren missbilligenden Tonfall sein.
»Gretchen, das ist jetzt unwichtig«, meinte der Vater. »Die Tochter ist die Haupterbin, und unsere Klarissa bekommt das Haus. Sie kann es vermieten und dadurch ihr Studium finanzieren. So hätte Anna es sicher gewollt.«
Er hatte sichtlich abgenommen und sah blass aus. Nach dem Tod seiner Schwester hatte er eine Nacht lang geweint, war am nächsten Tag jedoch aufgestanden und in die Firma gefahren.
»Ja, wahrscheinlich hätte Anna das so gewollt«, sagte die Mutter seufzend. »Sie hat unsere Tochter immer in allem unterstützt. Vielleicht weil sie mit ihrer eigenen nicht zurechtkam.«
»Kannst du dir nicht vorstellen, dass jemand mich einfach nur unterstützt, weil er mich mag und versteht?«, rief Klarissa aufgebracht.
Als der mahnende Blick ihres Vaters sie traf, zuckte sie zusammen. »Wir sollten uns jetzt nicht streiten«, erklärte Arthur Heyden. »Das hätte meine Schwester ganz sich nicht gewollt.«
Noch schändlicher als ihr kurzer Gefühlsausbruch schien Klarissa aber die Tatsache, dass sie tatsächlich erleichtert war, das Haus geerbt zu haben und erst einmal finanziell abgesichert zu sein. Aber vielleicht hätte Tante Anna sich ja auch gewünscht, dass sie dankbar für dieses Geschenk wäre.
»Wenn du weiter so wenig isst, wirst du im September im Krankenhaus liegen, anstatt nach München zu ziehen«, meldete die Mutter sich wieder zu Wort.
Klarissa fuhr nochmals auf. Woher kam nur der Wunsch, der Mutter das Brötchen ins Gesicht zu werfen? Seit Tante Annas Tod fühlte sie sich ständig reizbar und litt unter Stimmungsschwankungen. Manchmal glaubte sie, den Schock überwunden zu haben, doch dann reichte eine Kleinigkeit, um sie in Tränen ausbrechen zu lassen. So wie jetzt.
Drei tiefe Atemzüge halfen, ihre Gefühlswelt wieder etwas in den Griff zu bekommen.
»Ich werde mir mein Erbe heute ansehen«, beschloss sie. »Jemand muss den Nachlass von Tante Anna durchgehen und ein bisschen Ordnung machen.« Vor allem wollte sie eine Weile allein sein. Selbst wenn sie in ihrem Zimmer saß, klopfte die Mutter immer wieder an, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen und ihr Essen aufzudrängen.
»Du willst allein in Annas Haus gehen? Hältst du das für eine gute Idee?«, fragte Grete Heyden, und Klarissa nickte energisch. Der Vater würde wieder in seine Firma fahren, Paul hatte man während der Ferien mit Nachhilfeunterricht versorgt.
»Ich habe den Schlüssel«, erzählte sie. »Bis zum Abendessen bin ich sicher zurück.«
Der Vater sah zwar besorgt aus, widersprach aber nicht. Paul warf ihr einen neidischen Blick zu, denn er hasste Schule und alles, was damit zusammenhing. Die Mutter schwieg.
»Ich nehme den Bus«, rief Klarissa, während sie ihren Mantel anzog. Der Schlüssel steckte noch in ihrer Handtasche, wohin sie ihn geschoben hatte, als er ihr von Tante Anna anvertraut worden war. Sie hatte jeden Tag die Pflanzen gießen sollen.
Während sie zur Bushaltestelle lief, fiel ihr ein, dass sie das seit dem Tod ihrer Tante nicht mehr getan hatte. Vermutlich waren der Gummibaum und die vier Zimmerpalmen schon vertrocknet. Warum nur fühlte sie sich deshalb jetzt schuldig, als hätte sie ihre Tante im Stich gelassen?
Sie würde retten, was noch zu retten war, beschloss sie. Danach musste sie die Habseligkeiten ihrer Tante in Augenschein nehmen. Ein paar Dinge sollten vielleicht der ihr fast unbekannten Sarah übergeben werden, die den stärkeren Anspruch hatte. Dennoch wollte sie auch für sich selbst Erinnerungsstücke aussuchen, bevor das Haus leer geräumt werden musste.
Tante Annas kleines Reihenhaus lag am Rand von Frankfurt. Sie hatte es erst vor etwa fünf Jahren gekauft, als ihre Schneiderei wirklich erfolgreich geworden war und selbst die Filmindustrie Kostüme bei ihr in Auftrag gegeben hatte. Vorher hatte sie zwei Zimmer in der Innenstadt bewohnt.
Klarissa verspürte Enge in der Kehle, als sie durch den kleinen Garten zur Eingangstür ging. Früher war sie hier regelmäßig von ihrer Tante begrüßt worden, nun würde sie das Heim einer Toten betreten, wo Erinnerungen herumschlichen wie unberechenbare Gespenster.
Nach weiteren drei tiefen Atemzügen sperrte sie auf. Es erschreckte sie, wie wenig sich in diesem Haus verändert hatte. Hätte es sich anders angefühlt, wenn Anna Heyden auch an dem Ort gestorben wäre, den sie zuletzt bewohnt hatte? Die hellen Möbel, die Modefotografien an den Wänden, der Teppich aus dem Orientladen, all diese Dinge schienen nur auf die Rückkehr ihrer Besitzerin zu warten, ahnungslos und unschuldig. Allein die Zimmerpflanzen waren vertrocknet, wenn auch nicht aus Trauer.
Langsam trat Klarissa in die Küche. Alles hier schien noch nach der Frau zu riechen, die es nicht mehr gab.
Als Ärztin wirst du lernen müssen, mit dem Tod umzugehen, hatte die Tante ihr einmal gesagt. Früher und vor allem häufiger als die meisten Menschen deines Alters.
Kurz kamen Klarissa Tränen, die sie fließen lassen konnte, weil niemand zusah.
Dann machte sie sich an die Arbeit. Sie würde die Habseligkeiten ihrer Tante durchgehen und im Geiste eine Liste machen, was Sarah übergeben werden sollte, was sie selbst behalten wollte und was einfach entsorgt werden konnte.
Zwei Stunden später staunte Klarissa, aus wie vielen Kleinigkeiten sich die Existenz eines einzigen Menschen zusammensetzte, unbedeutende Gegenstände, die aber für jemanden wichtig gewesen waren und auf den Sperrmüll wandern konnten, sobald es diesen Menschen nicht mehr gab. Tante Anna hatte etliche Sachbücher über italienische Kunst und Geschichte angehäuft, denn sie hatte dieses Land geliebt. Eine gerahmte Aufnahme zeigte Anna Heyden gemeinsam mit ihrem Massimo vor einem historischen Gebäude. Sie hatten einander umarmt und lachten voll ausgelassener Lebensfreude. Klarissa musste sich für einen Moment setzen, denn sie Vorstellung, dass diese vor Energie sprühende Frau auf dem Bild nun nicht mehr existierte, zog ihr den Boden unter den Füßen weg. Dann beschloss sie, dieses Foto zu behalten, weil es ihre Tante so zeigte, wie sie in ihren besten Momenten gewesen war. Sie holte es aus dem hölzernen Rahmen und entdeckte einen Schriftzug auf der Rückseite: Ti amo. Massimo. Klarissas Lateinkenntnisse reichten, um die Bedeutung dieser Worte zu erfassen.
Sie erinnerte sich, dass der Italiener von der Familie ohne besondere Abschiedsworte heimgeschickt worden war. Bei der Beerdigung hatte man ihn nicht wirklich dabeihaben wollen. Erst jetzt wurde Klarissa die Härte und Ungerechtigkeit dieses Vorgehens bewusst. Sollte sie ihn nicht wenigstens auffordern, sich ein paar Erinnerungsstücke an seine Geliebte auszusuchen? Irgendwo hier musste Tante Anna seine Adresse oder Telefonnummer notiert haben. Mit dem nächsten Problem, nämlich ob ihr Schullatein für die Kommunikation mit einem Italiener reichte, würde Klarissa sich später auseinandersetzen.
Angetrieben von der Überzeugung, dass sie nun so handelte, wie ihre Tante es gewollt hätte, begann Klarissa, emsig alle Schubladen zu durchforsten. Sie fand Stapel von Geschäftsbriefen, Rechnungen, außerdem Fotoalben. Das Adressbuch war vielleicht in der Handtasche gewesen, die ihre Tante dabeigehabt hatte. War sie nach dem Unfall dem Vater übergeben worden? Sie würde ihn fragen, sobald sie zu Hause war.
Schließlich beschloss sie, sich erst einmal die Fotoalben vorzunehmen. Wenn es hier Aufnahmen von Anna und Massimo gab, würde sie ihm einige davon schicken.
Sie entdeckte tatsächlich Bilder von dem Liebespaar. Ein paar stammten aus Venedig, wo Klarissa auch schon einmal mit ihrer ganzen Familie gewesen war. Die anderen Orte konnte sie nicht zuordnen. Frustriert, aber hartnäckig blätterte sie weiter. Es folgten Aufnahmen von Familienfesten, auf denen sie sich selbst in verschiedenen Stadien des Heranwachsens erkannte. Sie konnte die Familiengeschichte in Bildern bis zur Hochzeit ihrer Eltern zurückverfolgen.
Klarissas Eltern hatten 1948 geheiratet, wann Annas Tochter geboren worden war, wusste sie nicht. Aber es musste noch vor Kriegsende gewesen sein, denn Annas Mann war gefallen, und das schon recht früh. Später hatte sie als Kostümbildnerin wieder ihren Mädchennamen angenommen, angeblich weil Heyden eleganter klang als Messerschmidt. Klarissa hatte stets das Gefühl gehabt, dass sich mehr dahinter verbarg als schlichter Pragmatismus.
Obwohl sicher kein Massimo mehr auftauchen konnte, blätterte Klarissa weiter rückwärts, angetrieben von einer plötzlich erwachten Neugier. Nun mussten allmählich Fotos aus der Kriegszeit kommen, über die niemand besonders gern gesprochen hatte. Es gab kein einziges Bild von der Tante als Ehefrau und Mutter, nur ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen ihrer heranwachsenden Tochter Sarah. Schließlich stieß sie auf das Bild von zwei jungen Frauen in einem Boot. Sie hielten einander in den Armen, während vor und hinter ihnen Männerarme ruderten. Die Kleidung wies eindeutig auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg hin. Tante Anna trug einen Badeanzug, der sittsam ihre Oberschenkel bedeckte, ihre Begleiterin hatte ihr knielanges Kleid anbehalten. Beide lachten herzlich und ausgelassen wie Menschen, die einfach glücklich über ihr Dasein auf dieser Welt waren, ohne sich mit dem zu befassen, was gewesen war oder noch kommen könnte.
Tante Anna hatte also eine besonders gute Freundin gehabt und deren Bild aufgehoben, während sie keines von ihrem Ehemann in ihre Alben geheftet hatte. Aber nicht nur das war ungewöhnlich. Diese kleine Frau neben ihrer Tante sah völlig anders aus als alle Menschen, denen Klarissa jemals persönlich begegnet war.
»Kannte deine Schwester eigentlich irgendwelche Asiaten?«, fragte Klarissa ihren Vater beim Abendessen.
»Aber woher sollte sie denn?«, mischte die Mutter sich ein, wurde aber von ihrem Mann nicht beachtet.
»Zwischen Anna und mir bestand ein großer Altersunterschied, sie war schon 16, als ich geboren wurde«, sagte er mit gerunzelter Stirn. »Daher war ich für sie immer der kleine Bruder, mit dem sie nicht über persönliche Dinge redete. Sie ging mit etwa 20 nach Berlin. Meine Eltern sagten immer, dass Anna ihren eigenen Kopf hatte und nicht so leben wollte wie alle anderen Leute bei uns daheim. Ich glaube, sie verurteilten sie dafür, daher meldete sie sich selten bei ihnen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was sie in Berlin alles getan hat. Darauf, etwas zu verdienen, hat sie sich immer verstanden. Angeblich arbeitete sie für ein Theater, nachdem sie als Verkäuferin aufgehört hatte, und hatte dort auch bessere Einnahmen. Also wen sie in Berlin so alles kennengelernt hat, kann ich dir nicht sagen.«
»Wie kommst du denn darauf, dass sie ausgerechnet eine Asiatin kannte?«, mischte sich nun die Mutter wieder ins Gespräch ein. Paul aß indessen ruhig seinen Rollbraten, sichtlich erleichtert, dass niemand ihn beachtete.
Klarissa erzählte von dem Foto, das sie entdeckt hatte.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor dem Krieg in Berlin irgendwelche Asiaten gab«, meinte Grete Heyden.
»Schatz, Berlin war damals eine Weltstadt«, erwiderte der Vater. »Dort lebten alle möglichen Leute.«
»Aber später, unter Hitler, dann sicher nicht mehr«, fuhr die Mutter trocken fort.
Klarissa wurde unwohl. »Man hätte Asiaten doch nicht in irgendwelche Lager gesperrt?« Sie ahnte, dass vielleicht genau das geschehen war, doch der Vater schüttelte den Kopf. »Ich denke, sie wären einfach ausgewiesen worden.«
»Auch nicht gerade nett«, sagte Klarissa spontan. »Ich meine, wenn sie bleiben wollten, dann …«
»Als der Krieg losging, hatten die Leute andere Sorgen, als auf irgendwelche Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen«, unterbrach ihre Mutter. »Es war auf jeden Fall vernünftiger, dort hinzugehen, woher man stammte.«
»Und wenn man es nicht wollte?« Klarissa attackierte ihren Knödel mit der Gabel. Sie konnte nicht einmal genau sagen, was sie in diesem Moment so wütend machte. Vielleicht die Selbstverständlichkeit, mit der Menschen herumgeschoben worden waren. Sowie der Umstand, dass ihre Mutter das völlig in Ordnung fand.
Auf dem Bild hatten Tante Anna und diese unbekannte Asiatin wie zwei Hälften eines Ganzen gewirkt. Mit welchem Recht wurde eine solche Verbundenheit analog zum Verlauf von Staatsgrenzen zerrissen?
»Manchmal ist es nötig, Dinge zu tun, die man nicht tun möchte«, erklärte ihr Vater völlig ruhig. »Wir können nicht immer nach unseren Wünschen handeln. Genau das kann sich aber als Segen erweisen.«
Das war wenigstens ein Gedanke, den sie akzeptieren konnte. Dennoch: Klarissa vermochte sich mit ihm nicht anzufreunden. »Ich möchte lieber freiwillig Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben«, erklärte sie. »Wenn etwas schiefläuft, weiß ich wenigstens, dass ich selbst schuld war.«
Ihre Familie schien willens, das hinzunehmen. Oder aber man wollte diese Unterhaltung nicht fortsetzen.
»Möchte jemand noch einen Likör?«, fragte die Mutter etwas lauter als notwendig.
Klarissa verneinte. Stattdessen sprach sie die nächste Frage aus, die sie seit gestern beschäftigte. »Wisst ihr, wo dieser Massimo jetzt ist?« Als mehrere staunende Augenpaare sie trafen, setzte sie zu einer Erklärung an. »Ich habe im Haus von Tante Anna ein paar Dinge gefunden, die ihm … gehören müssten.« Sie log nicht gern, aber manchmal schien es der sinnvollere Weg.
»Er hätte sie doch holen können, wenn sie ihm wichtig gewesen wären«, wandte die Mutter ein.
»Er ist wieder in Florenz«, sagte der Vater. »Ich habe seine Adresse und Telefonnummer.«
Klarissa sah ihn dankbar an. Das zumindest war nun erledigt. Sie musste sich nur mit dem Sprachproblem auseinandersetzen.
Eine ehemalige Mitschülerin, Berta, löste das Problem, denn ihr Bruder war mit einem Italiener befreundet, dessen Eltern in Frankfurt eine Pizzeria betrieben. Zu viert suchten sie nochmals Tante Annas Haus auf, weil Klarissa niemand anderen mit einer hohen Telefonrechnung belasten wollte.
Langsam begann sie, sich daran zu gewöhnen, dass Tante Anna nicht mehr sichtbar anwesend war, doch in jedem Winkel ihres früheren Heims spürbar blieb. Es tat sogar wohl, sich auf diese Weise noch mit ihr verbunden zu fühlen. Klarissa kochte Kaffee für ihre Gäste und zerschnitt den Kuchen, den sie in einer Konditorei geholt hatte.
Luigi, der Freund von Bertas Bruder, ließ sich bereitwillig den Hörer in die Hand drücken, während Klarissa die von ihrem Vater notierte Nummer wählte. Sie hatte noch niemals im Ausland angerufen und fühlte sich seltsam nervös. Der Klingelton am anderen Ende der Leitung war deutlich zu hören, dann erklang eine tiefe Frauenstimme. Luigi stellte sich in seiner Muttersprache, die selbst im Alltag wie Konzertgesang klang, vor und erklärte sein Anliegen. Die Frau musste den Hörer dann zur Seite gelegt haben, aber als sie nach Massimo rief, war es auch noch im fernen Vorort von Frankfurt zu hören. Anschließend schrien mehrere Stimmen durcheinander, als sei ein Streit ausgebrochen, doch letztendlich musste es wohl eine normale Unterhaltung sein. Tante Anna hatte diese Lebendigkeit der Italiener geschätzt, aber Klarissa überlegte, ob es nicht manchmal anstrengend sein konnte, ständig so viel Lärm um sich zu haben.
Schließlich meldete sich Massimo, sichtlich überrascht, einen Anruf aus Deutschland zu bekommen. Seine Stimme war aber glücklicherweise recht ruhig. Nein, er wolle Annas Haus nicht betreten, obwohl er sich höflich für die Einladung bedankte. Er hatte seine Erinnerungen, die ihm niemand würde nehmen können.
»Hat sie ihm jemals etwas von einer asiatischen Freundin erzählt? Aus der Zeit vor dem Krieg?«, fragte Klarissa.
Berta sah überrascht aus, aber Luigi übersetzte. Auf einmal wurde es am anderen Ende der Leitung still. Massimo schien nachzudenken.
»Sie hat tatsächlich manchmal eine Chinesin erwähnt«, kam es schließlich. »Sie war vor dem Krieg mit ihr befreundet. Sehr gut sogar. Aber sie redete nicht gern darüber. Irgendwie glaubte sie, diese Frau im Stich gelassen zu haben.«
Mehr konnte Massimo nicht sagen. Er bedankte sich für den Anruf und wünschte Klarissa alles Gute.
Luigi übersetzte. »Du warst wie ein Kind für sie. Ihre eigene Tochter hatte sich für den Vater entschieden und von ihr abgewandt. Sie war so dankbar, dich zu haben. So hat sie es mir immer wieder gesagt.«
Danach knackte es in der Leitung, weil Massimo aufgelegt hatte.
»Es tut mir so leid«, meinte Berta und legte ihren Arm um Klarissas Schulter. »Es klingt, als hättest du eine Mutter verloren.«
So fühlte Klarissa sich ebenfalls. Und sie schämte sich fast, weil sie Massimo beneidete, denn Tante Anna hatte ihm Geheimnisse aus ihrem Leben anvertraut, die ihr verschwiegen worden waren.
2. Kapitel
Berlin, September 1923
Endlich, dachte Zhang Penjun, als sie ihren Koffer auf dem Bahnsteig abgestellt hatte und die sogar am Bahnhof erstaunlich frische deutsche Luft einatmete. Endlich bin ich da.
Sie hatte fast zwei Wochen auf dem Schiff zugebracht, in der dritten Klasse, denn mehr hatte sie sich nicht leisten können. Dann war sie in Marseille angekommen und hatte noch fast ganz Europa durchqueren müssen, ohne sich irgendwo ein Hotelzimmer zu gönnen, weil sie unnötige Ausgaben hatte vermeiden wollen. Daher hatte sie auf Bahnhöfen geschlafen, wenn kein Nachtzug verfügbar gewesen war. Auf den harten Holzbänken hatte sie sich wenigstens ausstrecken können, während die sitzend in einem ratternden Zug verbrachten Nächte qualvolle Nackenschmerzen verursacht hatten. Glücklicherweise hatte niemand ihren Koffer oder gar ihre Handtasche gestohlen, obwohl sie nicht in der Lage gewesen war, ständig darauf aufzupassen. Es mochte daran liegen, dass man sie für eine mittellose Fremde auf der Suche nach irgendeiner Arbeit gehalten hatte, die selbst schlecht ausgebildete Europäer nicht annehmen würden. Manchmal hatten Leute versucht, Gespräche mit ihr zu beginnen. Sie war stolz auf ihr Englisch, das von Miss Emerson, der Gouvernante aus Liverpool, als exzellent bezeichnet worden war. Leider hatte aber keiner der Franzosen oder Deutschen, die mit ihr hatten reden wollen, diese Sprache beherrscht. Daher hatten sie sich auf Gesten beschränken müssen. Penjun hatte stets abgewunken, wenn jemand ihr etwas hatte anbieten wollen, egal wie freundlich diese Leute gewirkt hatten. Sie wusste aus ihrer Heimat, welche Gefahren einer jungen Frau in dieser Welt drohten, wenn sie allein und schutzlos war. Sogar die halbe Stange Weißbrot, die ein angetrunkener Mann am Bahnhof von Paris ihr grinsend hingehalten hatte, hatte sie ausgeschlagen, ohne auf das sehnsüchtige Knurren ihres Magens zu achten.
Von den Bediensteten im Haus ihrer Eltern hatte sie erfahren, dass ein Mensch Hunger längere Zeit ertragen konnte, ohne deshalb gleich zusammenzubrechen. Gelegentlich hatte sie sich einen heißen Kaffee gegönnt, der für eine Weile ihren Magen gefüllt hatte, und vor allem ihre Lebensgeister hatte erwachen lassen. Ab und an war ihr auch ein Apfel vergönnt gewesen, denn sie hatte in Marseille eine ganze Tüte davon als Reiseproviant erstanden. Jetzt war sie deutlich magerer als bei ihrer Abreise aus Shanghai, außerdem verschwitzt, schmutzig und schlecht frisiert, aber all diese Missstände würde sie wieder in Ordnung bringen können, wenn sie ihr endgültiges Ziel erreicht hatte.
Ihr Verlobter hatte eine Wohnung in Berlin, die seine Familie ihm großzügig bezahlte. Dort gab es sicher ein Bad mit fließendem Wasser, denn laut Miss Emerson hatten Europäer das alle, egal ob reich oder arm. Sie würde sich sattessen können, dann waschen und schließlich schlafen, solange sie wollte. Nach ein paar Tagen der Erholung wäre sie wieder die elegante junge Frau, die Jack Huang vor drei Jahren in Shanghai kennengelernt hatte.
Sie lief der Menge hinterher wie ein folgsames Hündchen. Inzwischen war sie es gewöhnt, von Menschen umgeben zu sein, die fast alle deutlich größer waren und ihr manchmal neugierige Blicke zuwarfen, als sei sie eine vom Himmel herabgestürzte Außerirdische. Hier hielt sich das glücklicherweise in Grenzen, da alle es eilig hatten, an irgendein Ziel zu kommen.
Als Penjun ins Freie trat und erleichtert feststellte, dass auch in Berlin eine milde Frühjahrssonne schien, fiel ihr plötzlich ein, dass sie den Weg an ihr eigenes Ziel nicht wirklich kannte.
Sie stellte den Koffer ab, lehnte sich an die Außenwand des Bahnhofsgebäudes und begann, aufgeregt in ihrer Handtasche herumzuwühlen. Sie hatte den letzten Brief ihres Verlobten in ein Seitenfach gesteckt, zusammen mit dem Rest jener Dollars, die sie in Shanghai mit ihrem Chinesischunterricht verdient hatte. Außerdem hatte sie noch den Goldschmuck – Geschenke ihrer Familie, die sie eigentlich gern behalten wollte. Im Notfall würden die Juwelen zum Pfandleiher wandern müssen, aber so, wie es jetzt aussah, wäre das erst einmal nicht notwendig.
Penjun bemühte sich, die Adresse auf dem Umschlag zu entziffern. Wielandstraße 36. Würden die Berliner sie verstehen können, wenn sie den Namen so vorlas, wie Miss Emerson es getan hätte? Sie musste es darauf ankommen lassen.
Jack hatte geschrieben, dass seine Wohnung recht zentral lag. Vielleicht wäre es möglich, dort vom Bahnhof aus zu Fuß hinzulaufen. Penjun wollte ihre finanziellen Reserven nicht gleich aufbrauchen, und außerdem wäre es wohl notwendig, die Dollars in deutsches Geld umzutauschen. Bereits in Frankreich hatten nicht alle Händler sie akzeptieren wollen.
Sie atmete tief durch. Ihr Magen knurrte gierig, sodass sie den nächsten Apfel aus der Tasche zog. Drei waren noch übrig, aber nun würde sie bald nahrhafteres Essen bekommen.
Penjun überlegte, einen Stadtplan zu erwerben, aber ihre Sparsamkeit sowie die Angst, nicht mit Dollars zahlen zu können, brachte sie wieder davon ab. Sie würde jemanden fragen. In Shanghai war das der einfachste Weg, sich zurechtzufinden, nur musste man aufpassen, nicht in eine Falle gelockt zu werden. Aber Europäer waren anders. Miss Emerson hatte immer von der Anständigkeit und moralischen Aufrichtigkeit ihrer Landsleute geschwärmt. Deutsche mussten ähnlich sein. Daher gab es keinen Grund, ihnen zu misstrauen.
Sie ergriff den Koffer, fasste ihren ganzen Mut zusammen und ging auf einen etwa sechzehnjährigen Jungen zu, der die Straße entlangschlenderte. Seine Kleidung war sauber, aber nicht so edel, dass er das Gespräch mit einer zerknautschten, übermüdeten Fremden für unter seiner Würde halten könnte. Wahrscheinlich war er ein Schüler oder ein Facharbeiter. Sie stellte sich ihm mutig in den Weg.
»Sorry. Can you help?«
Sein Gesicht verriet nur allzu deutlich, dass er nicht in den Genuss von regelmäßigem Englischunterricht gekommen war. Dennoch lächelte er freundlich und sagte irgendetwas. Penjun hielt ihm den Umschlag mit Jacks Adresse unter die Nase.
»Where is that? Can you show me? I will give you money.«
Sie holte einen Dollarschein heraus und zeigte ihn dem Jungen. Sein Blick wurde schlagartig aufmerksamer. Er las kurz die Adresse und winkte ihr zu, ihm zu folgen.
So einfach also war es, dachte Penjun erfreut.
Gemeinsam liefen sie los. Der Junge machte lange Schritte, und sie musste manchmal rennen, um ihm zu folgen. Aber das war gut, sagte sie sich. So käme sie schneller ans Ziel.
Während Berlin zunächst sehr sauber, weitflächig und wohlhabend gewirkt hatte, gerieten sie nun in enge und deutlich schmuddeligere Straßen. Diese Gegend war nicht ganz so dreckig wie manche Teile von Shanghai, entsprach aber nicht dem Bild jener besseren Welt, das Miss Emersons Europa gewesen war. Dieser Umstand beruhigte Penjun sogar ein wenig, denn sie musste sich hier nicht wie eine Kreatur von minderwertiger Herkunft fühlen. Dennoch hoffte sie, dass Jack in einer etwas schöneren Gegend wohnte. Immerhin besaß sein Vater in Shanghai mehrere Juweliergeschäfte.
Aber je tiefer der Junge sie in die Gassen Berlins eintauchen ließ, desto mehr Gestank und Schmutz nahm sie wahr. Zerlumpte Gestalten hockten am Straßenrand, Mülltonnen quollen über und einige der Fensterscheiben waren mit Zeitungspapier ausgebessert worden, weil jemand sie eingeschlagen haben musste. Penjun hatte schon Schlimmeres gesehen. In Shanghai gab es Orte, wo man über die Leichname ausgesetzter weiblicher Säuglinge stolperte und mitbekam, wie ältere unerwünschte Töchter an Bordelle verkauft wurden. Aber wohlhabende Leute lebten in anderen Vierteln. Jacks Familie hatte ein hübsches Haus ein Stück vom Bund, der Uferpromenade in Shanghai, entfernt, wo auch Amerikaner und Europäer sich niedergelassen hatten.
Offensichtlich lebten Deutsche nicht alle so. Penjun musterte die heruntergekommenen Fassaden der Häuser und sah graue Wäsche an Leinen baumeln. Viele Chinesen hätten es wahrscheinlich als Luxus empfunden, hier einzuziehen, denn immerhin waren die Mauern aus Stein, und vielleicht gab es auch fließendes Wasser. Aber Jack war Besseres gewöhnt. Schickte sein Vater ihm so wenig Geld? Sie fürchtete, dass er das in seinen Briefen unerwähnt gelassen hatte, um sich keine Blöße zu geben.
»Where is it? Is it far?«, fragte sie ihren jugendlichen Führer ohne echte Hoffnung, verstanden zu werden. Der Junge blieb kurz stehen und musterte sie unschlüssig. Erst jetzt fiel ihr auf, wie fahl seine Gesichtsfarbe war. Aber waren weiße Menschen nicht immer blass? Miss Emerson hatte wenigstens keine so dunklen Schatten unter den Augen gehabt, obwohl sie deutlich älter gewesen sein musste.
»Komm, komm …«, rief der Junge.
Diese Worte verstand sie und lief ihm daher weiter hinterher. Es ging nun in eine kleine Seitengasse, wo Penjuns Schuhe im Schmutz versanken und sie mehrfach über Unrat stolperte. Drei halbwüchsige Mädchen lungerten rauchend an einem Hauseingang herum. Bei Penjuns Anblick begannen sie zu glotzen, als hätten sie einen Geist erblickt. Eine von ihnen, deren Gesicht von einem großen blauen Fleck entstellt war, kicherte.
»Tschingtschangtschong«, rief sie.
Penjun drehte sich ratlos zu ihr um. »I do not understand«, erklärte sie höflich, denn sie hatte dieses Wort noch nie gehört.
Alle drei Mädchen krümmten sich plötzlich vor Lachen. Der Junge rief ihnen etwas zu, das sie verstummen ließ, packte auf sehr unhöfliche Weise Penjuns Arm und zerrte sie weiter. Sie stolperte ihm hinterher, denn sie war erleichtert, in dieser feindseligen Umwelt nicht völlig allein zu sein. Sobald sie Jack endlich gefunden hatte, würde sie ihn fragen, was dieses seltsame Wort bedeutete.
Es ging ein Stück weiter die Straße entlang. Ein halb verfallenes Haus tauchte auf, dessen Eingangstür zur Hälfte eingeschlagen war. Penjun vermutete, dass Bettler darin lebten, denn leere Flaschen und Lumpen lagen davor herum. Gleich dahinter tat sich eine Gasse auf, in der deutlich kleinere, aber ähnlich heruntergekommene Gebäude standen. Bis auf ein paar magere Hunde war dort niemand zu sehen. Als der Junge sie hineinziehen wollte, weigerte Penjun sich kurz, denn es kam ihr vor, als entfernte sie sich mit jedem Schritt von ihrem Ziel, anstatt ihm näher zu kommen.
Der Junge ließ ihren Arm los, sah sie ungeduldig an. »Komm! Komm!«
Penjun überlegte, wohin sie sonst noch laufen konnte. Sie hätte allein nicht einmal mehr den Weg zurück zum Bahnhof gefunden, und es gab hier auch niemanden, der besonders hilfsbereit gewirkt hätte. Ihr blieb kaum etwas anderes übrig, als diesem Führer weiter zu vertrauen. Vielleicht wohnte Jack tatsächlich in einem dieser Häuser und hatte es nicht gewagt, ihr darüber zu schreiben.
Sie war schon an drei der niedrigen Gebäude vorbeigelaufen, als der Junge sich plötzlich umdrehte und sie mit an einem Schubs gegen die Wand einer hölzernen Hütte drückte.
»Money!«, rief er. Ein wenig Englisch konnte er also doch.
»Ich gebe dir Geld, wenn wir am Ziel sind«, erklärte Penjun ebenfalls auf Englisch und musterte ihn vorwurfsvoll.
Er senkte verlegen den Blick. Die ganze Lage schien ihm ebenso unangenehm wie ihr selbst. Er deutete mit dem Finger auf ein größeres Haus weiter geradeaus.
»Money!«, wiederholte er hartnäckig.
Penjun beschloss, ihm drei ihrer Dollarscheine zu überlassen. Falls Jack tatsächlich dort wohnte, wäre sie dem Jungen Dank schuldig. Falls nicht, wollte sie ihn wenigstens loswerden, denn die Art, wie er sie jetzt unter Druck setzte, gefiel ihr nicht.
Leider schien er nicht zufrieden mit den Dollarscheinen, denn er stieß weiter unverständliche Worte hervor und klang dabei vorwurfsvoll. Penjun überlegte, was sie ihm noch geben sollte, da packte er plötzlich ihre Handtasche und riss sie mit einem Ruck an sich. Sie hörte das Knirschen seiner Schuhe auf dem Kies, als er davoneilte.
Penjun war das erste Mädchen in ihrer Familie gewesen, das von der qualvollen Prozedur des Füßebindens verschont worden war. Vielleicht hatte dieses Wissen sie dazu gedrängt, so oft und lang wie möglich zu laufen, um auszukosten, was ihr dank westlicher Modernisierung vergönnt war. Ihre Mutter hatte es nicht gemocht, dass ein Mädchen auf dem Landsitz der Familie mit seinen drei Brüdern über Stock und Stein um die Wette rannte. Sogar Miss Emerson hatte manchmal darauf hingewiesen, wie undamenhaft dieses Herumtollen im Freien war. Aber niemand hatte es geschafft, Penjuns Beine zum Stillstand zu zwingen.
Das erwies sich nur als vorteilhaft, denn sie hatte den Dieb eingeholt, noch bevor er um eine Ecke biegen konnte. Wütend packte sie ihr Eigentum und zerrte daran. Der Junge war schwächer als angenommen, und bald schon konnte Penjun ihre Handtasche wieder an sich drücken. Heftig atmend stand sie eine Weile da. Die Erinnerung an den verzweifelten Blick des Jungen, als sie ihm die Beute entrissen hatte, löste unsinnige Schuldgefühle in ihr aus.
Es gab überall arme Menschen. Offenbar auch in Berlin. Aber sie hatte ihr Geld, ihren Reisepass und ihren Schmuck wieder. Der Verlust dieser Dinge wäre eine völlige Katastrophe gewesen, der sie knapp entgangen war, und das schenkte ihr neue Zuversicht. Jetzt musste sie nur zu dem Gebäude gehen, das der Junge ihr gezeigt hatte, und hoffentlich fand sie dort Jack. Falls nicht, würde sie eben Geld in einen Stadtplan investieren, was von Anfang an die bessere Idee gewesen wäre.
Entschlossen kehrte sie an die Stelle zurück, wo der Junge sie hatte zurücklassen wollen. Dann wich plötzlich alle Energie aus ihrem Körper, sie schnappte nach Luft und musste sich an der Hauswand abstützen, um nicht umzukippen.
Dort, wo sie ihren Koffer abgestellt hatte, um dem Jungen hinterherzurennen zu können, war jetzt nichts außer ein bisschen Schlamm und einer zerbrochenen Bierflasche, die sie vorhin schon gesehen hatte. Jemand musste ihre kurze Abwesenheit genutzt haben, um das Gepäckstück an sich zu reißen.
Ruhig bleiben, ermahnte sie sich. Wer auch immer den Koffer hatte, musste sich noch in der Nähe befinden. Sie sah sich um, erblickte aber keinen einzigen Menschen. Der Dieb hatte sich wieder in jenem Unterschlupf verkrochen, aus dem er nur kurz herausgekommen war, um seine Beute zu holen.
»Bitte, ich brauche meine Sachen!«, rief sie auf Englisch. »Ich … ich werde dafür zahlen. Zwei Dollar. Oder drei!«
Es blieb still, nur auf einem Baum in der Nähe krächzte ein Vogel, als wolle er Penjun auslachen. Berliner Kriminelle hatten sicher keine Gouvernante wie Miss Emerson gehabt. Davon abgesehen war es wohl keine gute Idee, zu viel Aufmerksamkeit auf das Geld in ihrer Handtasche zu lenken.
Sie tat ein paar Atemzüge, bis wieder Klarheit in ihren Kopf kam. Der Koffer war weg, daran konnte sie nichts ändern. Ihr Lieblingskleid aus Crêpe de Chine hatte sich darin befunden, ein Geburtstagsgeschenk ihres Vaters. Außerdem der rote Qipao, in dem sie Jack hatte heiraten wollen. Aber deshalb ging die Welt nicht unter, sie würde in Berlin neue Kleidung kaufen können. Geld und Papiere zu behalten war wichtiger gewesen. Nun galt es einfach, Jack zu finden, und alles käme wieder in Ordnung.
Kurz fühlte sie sich besser, aber dann ging eine neue Erkenntnis wie ein Fausthieb auf sie nieder. Sie hatte den Brief mit Jacks Adresse am Bahnhof unter einen Halteriemen ihres Koffers gesteckt, um nicht ständig in der Handtasche herumwühlen zu müssen, wenn sie ihn brauchte. Nun also war er ebenso weg wie ihre geliebten Kleider. Sie hatte nur eine unklare Erinnerung an den seltsamen Straßennamen und so, wie sie ihn aussprach, würde sie ohnehin niemand verstehen. Ihr blieb nur die Hoffnung, dass Jack tatsächlich in dem Haus wohnte, das der Junge ihr gezeigt hatte.
Sie lief entschlossen auf ihr Ziel zu. Die Straße wurde wieder breiter und belebter. Wahrscheinlich hatte der Junge sie deshalb vorher zur Zahlung aufgefordert. Niemand sollte es mitbekommen, wenn er auch noch ihre Handtasche stahl. Sie blieb vor dem Haus stehen, das er ihr aus der Ferne gezeigt hatte. Es sah recht heruntergekommen aus, aber nicht ganz so schlimm wie einige, an denen sie hier schon vorbeigelaufen war. Wahrscheinlich wurde Jack von seinem Vater zu Sparsamkeit gezwungen, daher diese eher bescheidene Behausung. Zu ihrer Erleichterung entdeckte sie Namensschilder an der Eingangstür und las sie konzentriert durch. Keiner der Namen klang auch nur ansatzweise chinesisch. Penjuns böse Ahnung, dass der Junge ihr einfach nur irgendein beliebiges Gebäude gezeigt hatte, wurde auf unerfreuliche Weise bestätigt. Wieder fühlte sie sich, als hätte jemand plötzlich einen Sack voller Steine um ihren Hals gehängt, und sie musste sich an der Hauswand abstützen, um nicht zu fallen. Sie war ohne größere Schwierigkeiten um die halbe Welt gekommen und nun, da sie am Ziel ihrer Reise war, taten sich plötzlich unüberwindliche Hindernisse auf.
Irgendwie musste es möglich sein, Jacks Adresse herauszufinden. Es gab sicher eine chinesische Botschaft in Berlin, nur wusste Penjun nicht, wo. Doch Jack hatte ihr geschrieben, dass hier viele Chinesen lebten, Studenten wie er, aber auch einfache Arbeiter. Wenn sie lang genug herumlief, musste sie irgendwann ein asiatisches Gesicht erblicken, und dann konnte sie versuchen, sich irgendwie zu verständigen. Wer wusste besser, wo Chinesen hier wohnten, als deren Landsleute?
Sie trat wieder auf die Straße, blickte nach links und nach rechts, sah aber nur Europäer. Vielleicht verstanden einige von ihnen Englisch, doch nach der Erfahrung mit den böse kichernden Mädchen und dem Dieb konnte Penjun sich nicht überwinden, sie um Hilfe zu bitten. Sollte sie die laute Straße entlanglaufen, ohne zu wissen, wohin diese führte, oder versuchen, wieder irgendwie zum Bahnhof zu kommen? Die Erinnerung an die mit dem Jungen durchquerte Gegend war ihr zu unangenehm, daher wählte sie die andere Richtung. Überall kamen ihr Menschen mit weißen Gesichtern entgegen, viele schmutzig, einige sichtlich angetrunken. Als ein nach Schnaps stinkender Mann versuchte, sie mit sich zu zerren, kämpfte Penjun sich mit allerletzter Kraft frei. Es hatte einige Zuschauer gegeben, die den Vorfall aber nur lustig fanden, und ihr Lachen stach in Penjuns Ohren. Schließlich entdeckte sie eine Bank zwischen zwei kümmerlichen Bäumen und setzte sich hin, um sich ein wenig auszuruhen. Ihr Arm tat weh, weil der betrunkene Mann ihn sehr kräftig umklammert hatte. Wahrscheinlich würde als Erinnerung ein blauer Fleck bleiben.
Penjun schloss vor Erschöpfung kurz die Augen. Sie hatte Hunger, wusste aber nicht, wo sie hier etwas zu essen bekäme. Sie brauchte vor allem auch ein Zimmer für die Nacht, denn bald schon konnte es dunkel werden. Aber auf einmal fühlte sie sich zu schwach, um noch irgendetwas zu schaffen, außer einfach dazusitzen und die an ihr vorbeieilenden Menschen anzuschauen, die so völlig anders aussahen als sie selbst. In Shanghai hatte sie in die Menge eintauchen können wie ein Fisch in den Fluss. Hier blieb ihr sogar dieser Schutz verwehrt.
Das alles ist deine gerechte Strafe, verkündete eine strenge Stimme in ihrem Kopf. Eine Tochter hatte den Eltern zu gehorchen und den Mann zu nehmen, den sie für sie ausgesucht hatten. Änderten sie plötzlich ihre Meinung, hatte sie auch das hinzunehmen. Aber Penjun war aufsässig genug gewesen, um einfach davonzulaufen und zu tun, was ihr gefiel.
Ihre Eltern mussten den Brief, den sie ihnen als Erklärung hinterlassen hatte, schon längst gelesen haben. Ob sie wohl um die flüchtige Tochter trauerten und sich Sorgen machten? Oder hatten sie einfach beschlossen, sie wegen ihres Ungehorsams aus ihren Herzen zu verbannen? Auch Jack musste inzwischen wissen, dass sie zu ihm unterwegs war. Leider hatte er schon seit ein paar Monaten nicht mehr auf ihre Briefe reagiert, obwohl sie ihm erzählt hatte, dass ihre Eltern auf eine Lösung der bereits bestehenden Verlobung zwischen ihnen drängten, da sie einen besseren Kandidaten für die Tochter gefunden hatten. Auch für einen modern denkenden Mann wie Jack war es wohl kaum vorstellbar, dass ein Mädchen sich einfach widersetzen konnte.
Penjun hatte aber genau das getan und saß nun völlig allein in dieser elenden Gegend, umgeben von feindseligen Fremden. Es begann zu regnen, was sie erleichterte, denn wenigstens würden nun die Tränen auf ihrem Gesicht nicht mehr auffallen.
Als sie allmählich fröstelte, vernahm sie plötzlich den Klang einer warmen, tiefen Frauenstimme. Erschrocken fuhr sie auf und presste die Handtasche an sich.
Drei Frauen waren vor ihr stehen geblieben und starrten sie neugierig an. Alle trugen Kleider, die so bunt waren wie das Gefieder von Papageien. Auch ihre Gesichter waren ausgiebig bemalt, und schon dadurch wären sie in Shanghai unschwer als Prostituierte zu erkennen gewesen. Penjun fielen die Warnungen ihrer Mutter ein, sich von solchen Frauen fernzuhalten wie von Aussätzigen. Aber wohin sollte sie hier flüchten?
Wieder sagte eine von ihnen irgendetwas. Die grauen Augen drückten Mitgefühl aus, sodass Penjun langsam den Klammergriff um ihre Handtasche lockerte. Ihre Erziehung gewann die Oberhand über alles Misstrauen. Sie durfte jetzt nicht unhöflich sein.
»I am sorry but I do not understand German«, erklärte sie langsam. Prostituierte hatten normalerweise keine Gouvernanten, aber sie lernten Fremdsprachen von ihren Freiern.
Die Frau mit den grauen Augen setzte sich zu ihr auf die Bank. »Help?«, fragte sie. »You need help?«
Penjun schämte sich, weil ihr vor Erleichterung neue Tränen in die Augen schossen. Sie wischte sie mit dem Handrücken weg, während sie nickte.
Die Frau lächelte und zeigte dabei ihre Zähne, was sich für Damen nicht gehörte. Wenigstens nicht in China. Hier war es vielleicht anders. Miss Emerson hatte genauso gelächelt, wie Penjun jetzt einfiel.
»Anna«, sagte die Frau bemüht deutlich und wies mit dem Finger auf sich selbst. »I am Anna Heyden.«
Penjun begriff, dass sie sich ebenfalls vorstellen sollte. Ihren chinesischen Namen würde man hier wahrscheinlich nicht verstehen, daher nannte sie sich so, wie Miss Emerson es getan hatte.
»Susan Zhang.«
Die Frau hielt ihr die Hand hin. Penjun zögerte einen winzigen Moment, dann schlug sie ein. Der Himmel über ihr schien sich ein klein wenig aufzuhellen.
»Also … wir haben hier wirklich keinen Platz für eine neue Untermieterin«, klagte Leni, nachdem Anna der Chinesin ein Wurstbrot und ein Glas Wasser hingestellt hatte.
Susan bedankte sich höflich auf Englisch und verschlang ihr Brot so schnell, dass Anna ihr gleich ein weiteres machte.
»Ich weiß wirklich nicht, wo du sie unterbringen willst«, redete Leni störrisch weiter. »Wir steigen uns doch schon zu dritt ständig gegenseitig auf die Füße.«
»Wer sagt denn, dass sie hier einzieht?«, fragte Anna. Dann lächelte sie Susan an, die etwas verstört dreinblickte. Zwar konnte die Chinesin kein Deutsch, aber Lenis unzufriedener Tonfall musste ihr aufgefallen sein.
»So, wie sie da auf der Bank hockte, sah sie aus wie eine herrenlose Katze«, meldete nun Käthe, die rauchend am Tisch saß, sich zu Wort. »Und ihretwegen verbringen wir jetzt den Abend hier. Wir wollten doch ausgehen!«
»Das kannst du immer noch tun. Ich bleibe mit ihr zu Hause«, erwiderte Anna.
»Na, dafür kommst du garantiert in den Himmel«, sagte Käthe grinsend und füllte ein weiteres Glas mit dem Weinbrand, den ihr Bruder ihr geschenkt hatte. Gleichmütig schob sie es in Susans Richtung.
»Sag der Kleinen, dass sie sich besser fühlt, wenn sie das getrunken hat. Die sieht doch aus, als würde sie gleich umkippen.«
»Thank you«, kam es nun mechanisch von Susan, wieder mit einem braven Lächeln. Dann leerte sie das Schnapsglas, hustete, lief rot an und stieß mühsam ein »Sorry!« hervor.
»Na, das hat ja wirklich geholfen«, kommentierte Leni. »Wahrscheinlich gibt es bei den Chinesen keinen deutschen Weinbrand.«
»Irgendwelchen Alkohol werden die schon kennen«, sagte Anna und lächelte die immer noch dunkelrot leuchtende Susan mitfühlend an. »Aber ich schätze, es ist so wie bei uns: Vornehmen Mädchen gibt man nichts davon.«
»Vornehm?«, murrte Käthe und zog die linke Augenbraue hoch. »Die sieht doch aus, als wäre sie aus einem Kanal gekrochen.« Sie lachte herzlich, ohne jede Bosheit.
Susan verzog trotzdem verärgert das Gesicht.
»Sie spricht besseres Englisch als sonst jemand, den ich kenne«, erwiderte Anna. »Meinst du, das hat sie in einem Kanal gelernt?« Mit Genugtuung nahm sie die überraschten Blicke ihrer Mitbewohnerinnen zur Kenntnis.
»Na ja, vielleicht ist das eine von denen, die fremde Seemänner beglücken«, überlegte Käthe laut. »Aber du hast recht. Danach sieht unser verschrecktes fernöstliches Mäuschen nicht aus.« Sie gähnte ausgiebig, ohne sich eine Hand vor den Mund zu halten. Dann stand sie langsam auf und streckte sich. »Also ich haue mich für ein Stündchen aufs Ohr und dann ziehe ich noch mal los. Mädels, morgen ist Sonntag, und wir können ausschlafen!«
Sie stolzierte gemächlich in ihre kleine Kammer. Leni, der sie diese Wohnung zu verdanken hatten, weil ihr Vater die Vermieterin kannte, beanspruchte das größte Zimmer für sich. Anna gehörte der Raum neben der Küche. Er roch modrig und hatte nur ein winziges Fenster zum meist verdreckten Hinterhof, sodass sie wegen des Gestanks kaum lüften wollte. Dennoch war sie froh, in Berlin eine bezahlbare Bleibe gefunden zu haben, wo sie in Ruhe Englisch lernen und Tanzschritte üben konnte. Nun würde sie Susan erst einmal auf dem Boden schlafen lassen. Als längerfristige Lösung kam das aber kaum infrage, nicht nur wegen der räumlichen Enge. Sobald die Vermieterin mitbekam, dass hier eine weitere junge Frau lebte, würde sie sicher einen Grund finden, die Miete zu erhöhen.
Aber soweit musste es ja nicht kommen. Es gab sicher irgendeinen Ort, den die Chinesin in Berlin suchte. Sie hatte sich nur auf dem Weg dorthin verlaufen.
Als auch Leni weggegangen war, um die Nachbarsfamilie zu besuchen, schenkte Anna sich ebenfalls ein Glas Weinbrand ein.
»Warum bist du in Berlin?«, fragte sie Susan auf Englisch.
Das Gesicht der jungen Frau erhellte sich, dann sprudelten Wörter aus ihrem Mund. Anna verstand nur wenige davon und fragte sich erneut, woher dieses tadellose Englisch stammte. Sie begriff, dass es um irgendeinen Mann ging, den die Chinesin hier suchte. Auch das war also in Asien nicht anders.
»Fiance«, wiederholte Susan immer wieder mit Nachdruck, als wolle sie gegen den Verdacht ankämpfen, eine missachtete Geliebte zu sein, die ihrem Angebeteten wie ein Hund hinterherlief. Leider sah sie in ihrem zerknitterten, abgemagerten Zustand eben danach aus.
Anna nippte geduldig an dem Weinbrand, ließ den bitteren Geschmack auf ihrer Zunge zergehen, bevor sie die Flüssigkeit schluckte. Susan beobachtete sie aufmerksam, als wollte sie lernen, wie man das Getränk ohne Hustenanfall konsumieren konnte.
»Du hast also einen Verlobten, der hier lebt?«, brachte Anna mühsam auf Englisch hervor.
Susan nickte wie eine eifrige Schülerin. »Jack Huang.«
Das war nun leicht zu verstehen. »Engländer?«, fragte Anna, denn der Vorname klang danach.
Susan versicherte ihr, dass ihr Jack Chinese war wie sie selbst. Er studierte hier, irgendetwas Technisches, und hatte eine Wohnung.
»Aber warum weißt du dann seine Adresse nicht?«, wollte Anna wissen. Ganz klar war ihr nicht, was sie von dieser Geschichte halten sollte. Während ihrer nächtlichen Streifzüge durch Tanzhallen begegnete sie etlichen Frauen, die in angetrunkenem Zustand Geschichten von glühenden Verehrern und reichen Verlobten erzählten – meistens nur aus unerfüllter Sehnsucht oder Geltungsdrang entsprungene Fantasiegebilde. Diese Chinesin wirkte aber vernünftig.
Susan sagte, dass sie die Adresse verloren hätte, und fügte eine recht wirre Erklärung hinzu. Es hatte wohl einmal einen Koffer gegeben, der ihr gestohlen worden war.
»Vielen«, stammelte sie auf Englisch. »So hieß die Straße.«
Anna zuckte mit den Schultern. »Ich hole den Stadtplan«, sagte sie auf Deutsch. Dann fiel ihr ein, dass Susan sie nicht verstehen konnte, aber das war egal. Als sie der Chinesin das erwähnte Büchlein entgegenhielt, begann deren Gesicht hoffnungsvoll zu leuchten.
Anna las langsam alle Straßennamen des Verzeichnisses vor, die ein wenig wie der von Susan mühsam herausgepresste Name klangen. Es ging unerwartet schnell. »Wielandstraße also! Das ist in Charlottenburg.« Anna faltete zufrieden den Plan wieder zusammen. »Fällt dir die Hausnummer noch ein?«
Susan runzelte angestrengt die Stirn. »Dreißig und noch etwas«, murmelte sie auf Englisch.
»Na, das klingt doch schon mal gut!«
Anna schenkte ihnen beiden noch mal Weinbrand ein. Sie würde Käthe irgendwie entschädigen müssen, aber darüber konnte sie morgen nachdenken.
»Morgen ziehen wir los und sehen uns die Häuser an«, sagte sie. Je mehr sie Englisch redete, desto leichter schien es ihr zu fallen. »Es sind ja nur zehn. Wir suchen den Namen Huang.«
Sie hob ihr Glas und stieß mit Susan an, die nun auch vorsichtiger trank und nicht mehr hustete. Dann führte sie die junge Frau in ihr Zimmer und rollte die Matte aus, auf der sie selbst geschlafen hatte, bevor sie auf dem Sperrmüll ein Bett aufgetrieben hatte. Sie rechnete damit, Susan Zhang morgen schon bei ihrem Jack Huang abgeben zu können, daher waren keine Probleme mit der Vermieterin oder auch mit Leni zu befürchten.
Am nächsten Tag versorgte sie den ungewohnten Gast mit Kaffee und Marmeladebroten. Susan war weiterhin hungrig, hielt sich jedoch mit dem Essen zurück, als wäre ihr der unersättliche Appetit peinlich. Sie hatte ihr Kleid am vorigen Abend noch im Waschbecken geschrubbt und zum Trocknen aufgehängt, sodass sie darin etwas präsentabler aussah. Dennoch machte sie einen so unglücklichen Eindruck, als sie sich im Spiegel musterte, dass Anna ihr noch einen Hut in passend blauer Farbe und ein paar Spitzenhandschuhe übergab. Susans Wunsch, auf den Verlobten nach längerer Trennung einen guten Eindruck zu machen, war verständlich.
Noch bevor Leni und Käthe aufgestanden waren, zogen sie los. Anna hatte auf dem Stadtplan den Weg vom Wedding nach Charlottenburg herausgesucht und lotste die Chinesin zur nächsten Trambahnhaltestelle. Susan sah nun deutlich frischer aus als am Vortag, klebte unterwegs mit der Nase an der Fensterscheibe und fragte immer wieder, wo sie sich gerade befanden. Es war Anna manchmal peinlich, dass nicht genau sagen zu können. Sie lebte zwar schon zwei Jahre in Berlin, kannte aber nur das Schuhgeschäft, in dem sie arbeitete, und die Tanzlokale, die sie mit Käthe gern aufsuchte. In Charlottenburg war sie bisher nicht gewesen.
»Warum sind so viele Leute in Deutschland arm?«, fragte Susan plötzlich. »Ihr seid doch Europäer.«
Anna verstand den Sinn der Fragestellung nicht.
»Weil wir den Krieg verloren haben, geht es uns schlecht. Unser Geld ist immer weniger wert. Im Moment ist es besser, mit Lebensmitteln zu zahlen«, erklärte sie. Dann erzählte sie noch, dass ihr Arbeitgeber ihr letzten Monat statt des Lohnes fünf Paar Schuhe geschenkt habe, weil das eine allemal bessere Bezahlung war als Geldscheine, die noch innerhalb von Stunden rapide an Wert verloren. Mit zwei Paar hatte Anna ihre Monatsmiete beglichen, den Rest gegen Lebensmittel und andere Notwendigkeiten eingetauscht. Es war vor allem Käthe zu verdanken, dass sie nicht verhungerten, denn die bekam ständig Geschenke von Verehrern. Ganz verstand Anna die Gründe für die extreme Inflation selbst nicht. Das Leben war hart gewesen, seit sie denken konnte, und sie glaubte nicht wirklich an eine gnädige Wendung des Schicksals zum Besseren. Wer vorankommen wollte, musste selbst mit Zähnen und Klauen darum kämpfen, doch auch dann gab es keine Garantie auf Erfolg.
»Ich dachte, in Europa geht es allen Menschen gut«, erwiderte Susan sichtlich verwirrt.
Anna fragte sich, woher diese merkwürdige Vorstellung kam. »Manchen Leuten geht es gut«, versicherte sie. »Dein Verlobter führt hier sicher ein schönes Leben.« Falls dem nicht so war, sollte es nicht ihre Sorge sein. Sie würde Susan dort hinbringen, wo sie sein wollte, und dann ihr eigenes Leben weiterführen. An diesem einzigen freien Tag der Woche hatte sie neue Tanzschritte üben wollen, um sich bald wieder in einem Cabaret vorstellen zu können. Irgendwann würde es ihr schon gelingen, Auftritte zu bekommen, wenn sie nur nicht aufgab.
»Jack will Ingenieur werden«, erzählte Susan stolz. »Er möchte helfen, dass mein Land mehr Eisenbahnen bekommt.«
»Wie schön«, meinte Anna brav. Diese junge Frau würde also einen Mann mit gutem Verdienst heiraten und mit ihm irgendwann in die Heimat zurückkehren. Sie schien sich darauf zu freuen, also war es gut so.
»Wir sind da!«, rief sie schließlich, als sie die richtige Haltestelle erreicht hatten. Zum Glück hatten sie die ganze Strecke zurücklegen können, ohne von Kontrolleuren behelligt zu werden. Auch Trambahnfahrkarten hatten astronomische Preise erreicht. Nun erhellte Susans Gesicht sich hoffnungsvoll, da sie elegante Häuserfassaden musterte.
»Haben bei euch alle Häuser Nummern?«, wollte sie nach dem Aussteigen wissen.
Als Anna nickte, schien sie zum ersten Mal wirklich beeindruckt. Gemeinsam machten sie sich an die Arbeit, gingen von Haus zu Haus und sahen sich die Namen der Bewohner an. Anna bemerkte als Erste einen elegant wirkenden Chinesen, der in einem grauen teuer aussehenden Anzug die Straße entlangging, als würde er sich hier bestens auskennen.
»Ist das dein Jack?«, fragte sie Susan, die verneinte, aber dennoch vor Freude zu strahlen begann. Rasch lief sie auf den Landsmann zu, wechselte ein paar Worte mit ihm und kehrte gleich darauf mit einem frohen Leuchten im Gesicht zurück.
»Haus Nummer 26«, sagte sie. »Da wohnt Jack Huang. Ich danke Ihnen, Sie waren wirklich sehr nett.«
Anna begann zu ahnen, dass sie auf diese Weise verabschiedet werden sollte.
»Den Hut und die Handschuhe schicke ich natürlich zurück«, redete Susan weiter. »Schreiben Sie mir nur die Adresse auf.«
Anna stimmte zu, aber eine genauere Untersuchung ihrer Handtasche zeigte, dass sie keinen Stift dabeihatte.
»Jack hat sicher einen«, sagte Susan. »Kommen Sie mit. Er wird sich freuen, dass jemand mir geholfen hat, und Sie sicher gern kennenlernen.«