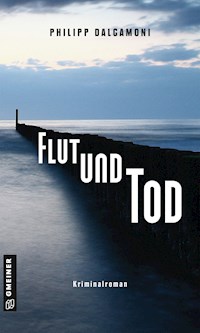
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Narzisst, seine unter der zerbrochenen Ehe leidende Frau und eine undurchschaubare Psychologin - drei Personen, schicksalhaft miteinander verbunden und Figuren eines teuflischen Spiels, an dessen Ende sich erst offenbart, wer Täter und wer Opfer ist … Ankes Ehe mit Erik ist am Ende. Hinter seiner charmanten Fassade verbirgt sich nichts als Kälte und Berechnung. Doch sie ist von den Bildern ihrer Liebe gefangen, die an einem Wochenende in einem einsamen Haus an der Nordsee begann. Um die romantischen Erinnerungen in ihrem Kopf zu entzaubern, fasst Anke den Entschluss, jenes Wochenende zu wiederholen - nicht ahnend, dass Erik plant, sie dort zu töten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philipp Dalgamoni
Flut und Tod
Kriminalroman
Zum Buch
Wie du mir … Ankes Ehe mit dem erfolgreichen Unternehmensberater Erik ist am Ende. Sein Charme, seine Eloquenz und seine Manieren sind bloß Mittel zum Zweck für den Narzissten, der nur eines im Blick hat: sich selbst. Emotional ausgelaugt will Anke die Scheidung, doch sie schafft es nicht, sich endgültig von ihrem Mann zu lösen. Mit der Hilfe einer Psychologin erwächst in Anke schließlich die scheinbar rettende Idee: Sie möchte jenes Wochenende wiederholen, an dem sie sich einst in Erik verliebt hatte, um so die romantischen Erinnerungen in ihrem Kopf zu entzaubern, die sie noch an ihn fesseln.
So treffen sie sich in einem einsamen Haus in den Dünen, umgeben von stiebendem Sand und im Wind wogenden Gräsern. In der Nähe das Meer, pendelnd zwischen Ebbe und Flut. Während Anke das wahre Wesen von Erik zu ergründen versucht, ahnt sie nicht, dass scheinbar fehlende Gegenstände und vermeintliche Missgeschicke zu einem tödlichen Spiel gehören: Denn Erik will keine Scheidung durch das Familiengericht, er will die Scheidung durch ihren Tod …
Hinter dem Pseudonym Philipp Dalgamoni verbirgt sich ein deutscher Autor. 1964 in Dortmund geboren, lebt er mit seiner Familie in Dorsten. Nach Jurastudium und Promotion an der Ruhr-Universität in Bochum begann er 1993 seine Tätigkeit als Rechtsanwalt in Essen. Der Autor ist zugleich Fachanwalt für Familien- sowie Verwaltungsrecht und referiert zudem häufig über Fachthemen bei Unternehmen und Verbänden.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © sunset man / stock.adobe.com
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6086-9
Widmung
Für Anke und Erik
1
Der Weg zu Miriams Praxis war Anke vertraut. Mehrmals war sie in den letzten Wochen bei der Therapeutin gewesen, hatte dabei manchmal nur in Miriams Sprechzimmer gesessen und still einen Tee getrunken, während sie sich in Gedanken über Gewesenes verloren und sich dann wieder in die Gegenwart gezwungen hatte. Miriam hatte ihr vorgegeben, sich ihrer Aufgabe zu stellen, diese Forderung immer wieder wie einen gezahnten Speer in Ankes Herz gestoßen und ihn gedreht, bis die Stille riss und sie zu weinen begann. Doch es hatte nicht lange gedauert, bis sich Anke aus Miriams Händen zu lösen begonnen hatte. Sie war auf dem Weg zu sich selbst zurück, und intuitiv spürte sie, dass sie Miriam heute das letzte Mal sehen würde. Einziger Zweck ihrer Fahrt in Miriams Praxis war, dem Mann zu begegnen, dem Anke verfallen gewesen war und der sie beinahe zerstört hatte. Er war die Liebe und zugleich der Teufel ihres Lebens gewesen.
In ihrer gemeinsamen Zeit mit Erik war Anke still und zu einem Schatten ihrer selbst geworden. Er hatte sie von ihrem eigenen Leben abgeschnitten. Vor einigen Tagen waren ihr beim Aufräumen die Liebesbriefe in die Hände gefallen, die sie während ihrer Schulzeit reichlich bekommen, in einer Schachtel aufbewahrt und erst wiederentdeckt hatte, als sie sich von Erik getrennt und eine kleine Wohnung auf dem Land bezogen hatte. Es waren Erinnerungen an eine Zeit, als sie das Leben und die Welt um sie herum zu entdecken begann. Die meisten dieser Briefe stammten von Moritz Schiblewski, einem Schüler aus der Parallelklasse, der mit erwachsenen Worten von ihrer Schönheit, ihren leuchtenden Augen, ihrer Zartheit, ihrem Lachen und ihrer Klugheit geschrieben hatte. Es waren Liebesbriefe gewesen, die zu früh geschrieben waren. Der blässliche und dickliche Moritz mit seinem bubenhaften Gesicht hatte Anke damals nicht erreichen können. Er hatte gegen die gut aussehenden Verehrer verloren, die Anke umgarnten. Von ihnen zog sich ein schicksalhafter, fast 20 Jahre langer, Faden, der ihr buntes und glückliches Leben verband, bis hin zu Erik, hin zu ihrem Unglück.
Miriam war bei den Sitzungen oft am Flipchart mit gezücktem Stift stehengeblieben, während sie ihre Patientin angesehen und mit wortlosem Druck weitere Stichworte eingefordert hatte. Liebe war das Wort, um das sich alles drehte.
Die Liebe schmerzte, und sie steckte in Anke wie ein giftiger Stachel.
»Liebe nur als Wort?«, hatte Miriam ungerührt gebohrt und stets hinterfragt: »Bist du wirklich schon so weit?«
Immer wieder hatte diese Frage Ankes Wunde aufgerissen und sie wie eine geplatzte überreife Frucht ausbluten lassen, doch die Therapeutin hatte Anke leiden lassen, während sie die Antwort auf die Frage suchte, warum sie sich an Erik verschenkt hatte.
Wenn sich Anke dabei zu verlieren drohte, war Miriam in die Rolle der Freundin geschlüpft. Dann gab sie sich wohlwollend und ermutigend, weich und liebevoll. Sie hatte sich vorgebeugt, war vor ihr niedergekniet und hielt mit ihren Händen diejenigen Ankes umschlossen.
So war es gegangen, bis Anke erkannt hatte, dass Miriam nicht ihre Freundin war.
2
Wie automatisch fand Anke zu Miriam. Es war der gewohnt gewordene Weg vom Land in die Stadt. Jetzt – im Frühling – war es eine Fahrt durch die in einem Farbenmeer aufbrechende Natur. In kraftvoller Blüte stehende Bäume säumten die Landstraße. Zarte weiße und rosafarbene Blüten klebten wie Hauben auf den knorrigen Stämmen. Wiesen und Weiden sprossen in sattem Grün. Es duftete frisch und voller Kraft.
Die Straße führte um sanfte Hügel herum. Gehöfte thronten wie steinerne Trutzburgen in den weiten Feldern. Getreidesilos glänzten silbern in der Sonne. Die Welt hier draußen war heil, die Fahrt auf der in Kurven schwingenden Straße Therapie. Wie bunte Punkte flitzten die Autos durch die Harmonie. Anke fuhr durch ein Spielzeugland. Ihr war nach Spielen. Sie wollte Erik spielend besiegen.
Auf Miriams Rat hatte sie eine Wohnung auf dem Land bezogen. Damit hatte sie die Abkehr zu ihrem Leben mit Erik in der Stadt. Alles war anders, roch anders und fühlte sich anders an. Das Neue sollte das Alte fremd werden lassen.
Sie raste die Straße entlang, als wollte sie die Beschaulichkeit der Bilder überwinden, nach denen sie sich sehnte. Sie war noch lange nicht am Ziel. In ihr pochte das Leben mit Erik. Die Erinnerung zerrte das Schöne hervor und pflanzte Erik in das Bild vor der Frontscheibe ihres Autos. Eine gemeinsame Autofahrt mit Erik war der Beginn ihrer glücklichsten Zeit gewesen. Eine Zeit von nur knapp drei Tagen Dauer, doch lang genug, ihre Liebe zu ihm in ihr Herz zu meißeln. Statue, Maske, Rolle – dürre Begriffe, die das Richtige beschrieben und doch nicht halfen.
3
Ihre gemeinsame Wohnung war an einer Hauptverkehrsstraße inmitten der Stadt gelegen. Es war eine noble Unterkunft im ersten Stock eines Jugendstilhauses gewesen, geschmückt mit hohen stuckverzierten Decken und einem großen, durch weiß lackierte Flügeltüren in Wohn- und Essbereich teilbaren Salon, dessen geschliffenes Parkett sich im Schein zweier Kronleuchter spiegelte. Im Wohnzimmer hatte es einen gekachelten Kamin und ihm gegenüber große Fenster gegeben, die auf den geräumigen Balkon mit seinem Mosaikboden hinausgingen. Das Badezimmer hatte mit kostspielig restaurierten Armaturen und einer Emaillewanne auf gusseisernen Füßen verwöhnt. Der Architekt hatte im Bestand geplant und mit Hightech hochgerüstet. Licht und Musik hatten sich auf Zuruf ein- und ausgeschaltet. Jedes Detail war abgestimmt gewesen und hatte sich in das Ganze eingefügt.
Nach Ankes Auszug war Erik in der Wohnung geblieben. Sein Leben blieb unverändert. Anke hatte nichts in die Wohnung eingebracht. Das Mobiliar, das sie vor ihrer Ehe mit Erik besessen hatte, war verbraucht gewesen, und es hatte keiner Überwindung bedurft, sich von diesen Dingen zu trennen, als Erik mit groben Skizzen die Vorlagen schuf, aus denen der Architekt seine Detailplanung zauberte. Anke war in Eriks Leben eingezogen, hatte sein Leben gelebt und dabei ihr eigenes nicht einmal vermisst. Erik war der Mensch gewesen, dem sie sich hingegeben hatte und jenes Bild von einem Mann zu sein schien, der ihr alles wert war. Bei ihrer Flucht von ihm hatte sie nichts mitgenommen außer sich selbst. Ihre wenigen persönlichen Gegenstände hatte Erik sorgsam in Kartons gepackt und ihr nachschicken lassen, nachdem sie aufs Land gezogen war. Er hatte einen Zettel beigefügt, auf dem er den Inhalt der Kartons sorgsam aufgelistet und jede einzelne Position abgezeichnet hatte. Das war im Herbst des letzten Jahres gewesen und nun über ein halbes Jahr her.
Als Anke bei Erik auszogen war, hatte sie in Eriks Leben keine Spuren hinterlassen.
4
Mit dem Abstieg ins Tal verengte sich die Straße. Unvermittelt tauchte Anke mit ihrem Auto in hoch aufragende Häuserzeilen ein, als habe sich die um den Fluss drängende Stadt auf den Kuppen der sie einschließenden Hügel eine Grenze gezogen, die sie nun zu sprengen schien. Es war der obere Rand des Kessels, auf dessen Grund der Fluss träge die Stadt teilte.
An der nördlichen Uferstraße lag das Haus, in dem Anke drei Jahre mit Erik gelebt hatte. Im Sommer hatten sie häufig auf dem Balkon gesessen, Wein getrunken und auf den Fluss geschaut, der hier und da zwischen den dichten Kronen der knorrigen Platanen an der Promenade durchschimmerte und im Sonnenlicht funkelte.
Das Leben in einem der schönen Häuser am Fluss, vom Wasser nur durch Promenade und Uferstraße getrennt, war stets Eriks Ziel gewesen. An der nördlichen Uferstraße lebte es sich besser als an der südlichen, denn im Winter erhellte die Sonne die sonst vom Laub der Bäume beschatteten Wohnungen bis in den frühen Nachmittag.
Erik liebte es, auf dem Balkon der Wohnung zu sitzen. Dann blickte er wie aus einer Loge auf die Spaziergänger, die auf der Promenade am Fluss entlang liefen, und auf die Autos, die sich über die Uferstraße zwängten. Erik sah gern auf das Leben unter sich herab.
Es war ein Nachmittag im April des letzten Jahres gewesen, als die milde Witterung schon einen längeren Aufenthalt in leichterer Kleidung auf dem Balkon gestattete. Erik hatte sich bereit gemacht, mit einer Flasche Grauburgunder die von ihm so genannte Saison zu eröffnen, in der er – wie jedes Jahr – nach der Arbeit mit Anke hier sitzen und genießen wollte, was ihn beseelte: Er hatte es geschafft!
Anke hatte sich eine Strickjacke übergeworfen, weil ihr trotz der frühlinghaften Temperatur fröstelte und mit der Handfläche grob den Schmutz von den Edelholzstühlen gestrichen, während Erik eine eigentümlich steife Pose einnahm, nachdem er eingeschenkt und feierlich sein Glas erhoben hatte.
Doch genau in dem Moment, als er seine ersten Worte sprach, entlud sich unter ihnen auf der Uferstraße wie eine schrille Sirene ein Hupkonzert der im Stau stehenden Autos. Und genau in diesem Augenblick, als Eriks Worte im Lärm ertranken, hatte Ankes Lachen begonnen. Es war ein langes Lachen gewesen, das sich immer wieder selbst ansteckte und aus den Widrigkeiten ihres Lebens mit Erik speiste, in dem das Licht dunkel, die Ruhe laut, das Leben tot und die Leichtigkeit schwer geworden waren.
Erik hatte sie angesehen, als hätte sie ihren Verstand verloren. Dann war er stumm in die Wohnung gegangen.
Dieses Lachen war der Wendepunkt in Ankes Leben mit Erik gewesen.
Das Lachen hatte sie ins Laufen gebracht, als liefe sie einen Berg hinab, ohne anhalten zu können. Das Lachen hallte in ihr nach, trieb sie von ihm fort und kämpfte mit dem Bild von Erik, in das sich Anke verliebt hatte. Das war ihr Leiden. Das Lachen war eine Antwort auf Erik. Es hatte sie aufgeweckt, aber ihr selbst keine Antwort gegeben.
In ihren Sitzungen bei Miriam hatte Anke das Bild vom Aufwachen gefallen. Sie hatte dabei an eine auf Grün schaltende Ampel gedacht, die den Weg in ihr neues Leben freigab und wollte die Worte Schlaf, Illusion, Täuschung auf die eine und die Worte Aufwachen, Loslassen und Zukunft auf die andere Seite des Flipcharts schreiben. Das war der Zeitpunkt gewesen, als Anke sich aus den Fesseln der Therapie zu befreien begann.
»Du musst tiefer denken«, hatte Miriam gefordert. »Schicht für Schicht abtragen. Du musst dich Erik stellen. – Besser gesagt: Du musst ihn stellen.« Wie ein Mantra hatte Miriam ihr diesen Satz vorgehalten. Von Anfang an war es Miriams Wille gewesen, dass Anke und Erik in ihrer Praxis aufeinandertreffen. Heute sollte es soweit sein. Dieses Ziel war das einzige, was Anke noch mit Miriam verband. Ihre Praxis sollte den Rahmen bieten, in dem sie das erste Mal wieder auf Erik treffen würde, seit sie ihn verlassen hatte.
5
Einige Wochen nach dem Hupkonzert der Autos unter dem Balkon ihrer Wohnung hatte Anke begonnen, abends allein wegzugehen. Erik selbst war es gewesen, der sie zu diesem Schritt drängte, nachdem er Anke zunächst für ihr Lachen auf dem Balkon mit Schweigen gestraft hatte.
Er hatte seine Worte auf das Nötigste beschränkt, wenn er abends aus dem Büro kam, und ihre aus heutiger Sicht unbegreiflichen demütigen Versuche, ihm ein Gespräch zu entlocken, mit kühler Ablehnung pariert. Anke hatte die Nähe zu Erik umso mehr gesucht, je tiefer er den Graben zwischen ihnen zog.
Jetzt wusste sie um die Wechselwirkung seiner giftigen Fesseln und seiner wie eine lebensrettende Infusion wirkenden Worte, mit denen er ihr einen Ausweg eröffnet hatte, ohne sie zu entlassen. Er hatte Atemluft gespendet, in dem er eine Lanze aus dem Vakuum der Wohnung nach außen stieß. Doch in Wirklichkeit hatte er nur die Blase vergrößert, in der sie gefangen war.
Während ihrer gemeinsamen Zeit mit Erik war sie nie allein ausgegangen und hatte sich ohne Not ihm unterworfen, als er ihr vorlog, seine wenige freie Zeit lieber mit ihr als mit Menschen zu verbringen, die er für ihr gemeinsames Leben für unwichtig hielt.
Stets war sie an seiner Seite gewesen, wenn sie Kontakte pflegten, die aus Eriks Sphäre stammten und ihm beruflich nützten. Erik suchte seine sozialen Kontakte nach pragmatischen Gesichtspunkten aus. Ansonsten war er bindungslos. Dies zu erkennen war nur im Nachhinein leicht gewesen. Erik hatte ihre Lebenslust erdrückt, ihre Freundschaften madig und ihre Interessen unbedeutend gemacht. Anke hatte es geschehen lassen, weil sie sich einem Menschen hingegeben hatte, der ihrer nicht wert war. Sie hätte ihn durchschauen können, doch sie hatte sich in ihn verliebt.
6
Anke stellte ihr Auto in einem Parkhaus ab. Miriams Praxis lag auf der anderen Seite südlich des Flusses an einer der hinteren Straßen, deren angrenzende Häuser nicht schön und verziert waren wie jene an der Promenade. Hier standen die Häuser eng aneinandergepresst. In einige der Hinterhöfe zwängten sich aus Backstein errichtete Hallen- und Bürogebäude. Die Anlagen waren alt und die früheren Gewerbebetriebe zumeist aufgegeben. In den Dellen der Teerpappen auf den Dächern sammelte sich Regenwasser. Die gekalkten Innenwände waren rissig. Unkraut schoss aus den gepflasterten Innenhofflächen und aus den Mauerfugen. Einige Makler bewarben die leer stehenden Einheiten mit dem Charme der Gründerzeit. Sie zeichneten das Gemälde eines aus dem Verfall erblühenden Kreativviertels. Auch die Planer redeten neue urbane Impulse herbei. Es wirkte wie die Verheißung einer Auferstehung.
Jenseits der beiden Flusspromenaden begann die Stadt in den Hinterhöfen zu faulen. Ihre Bausubstanz war zu jung, um historisch und zu alt, um modern zu sein. Sie war zu dicht, um das Leben auf den Straßen lebendig sprudeln zu lassen und zu zerklüftet, um mit Atmosphäre Heimat zu stiften. Das Leben klebte an der Flussader und wucherte seitlich an den Wänden des Kessels hinauf. Dazwischen waberte eine übelriechende Geschwulst des Verfalls. Jenseits der Promenaden stank es.
Miriams Praxis war seit sechs Jahren in einem der Hinterhöfe ansässig. Sie hatte die Räumlichkeiten billig von einem Ingenieurbüro angemietet und die Wände orange und gelb gestrichen. Das Mobiliar war einfach und gebraucht erworben. Es waren schlichte Sessel mit speckig glänzenden Kunstlederbezügen. Blumenkübel füllten die zu großen Flächen im Flur. An drei Nachmittagen in der Woche saß eine Studentin als Praxisassistentin am Empfang, begrüßte die Patienten, geleitete sie in eines der beiden Wartezimmer und nahm Telefonate entgegen.
Miriam wusste das übermäßige Raumangebot ihrer Praxis werbewirksam zu nutzen: Ihre Patienten warteten in getrennten Zimmern. Sie verkaufte dies als ihr Konzept und garantierte Vertraulichkeit und Anonymität.
Miriam und ihr Patient saßen sich an den Längsseiten eines furnierten Tisches gegenüber, der von seinem Ausmaß ein Esstisch für acht Personen sein könnte. Es gab keine Couch und keine tiefen Sessel. Sie rechtfertigte die aus finanzieller Not karg gebliebene Einrichtung mit dem Vorzug der klaren Struktur. Ihre Worte waren knapp und direkt. Wenn sie in der Seele bohrte, begründete sie, es der Heilung des Patienten wegen tun zu müssen. Mittlerweile wusste Anke, dass auch dies gelogen war. Miriam wollte die Tränen der Patienten, weil jedes Weinen der anderen ihr eigener Erfolg war.
Miriam war allein.
7
Als Anke den Torbogen zu dem Hof passierte, in dem sich Miriams Praxis befand, zitterten ihre Knie. Nach rund acht Monaten würde sie das erste Mal wieder auf Erik treffen.
Rechts und links des Praxiseingangs hatte Miriam Plastikimitate von Terrakottatöpfen mit Narzissen und Osterglocken aufgestellt. Anke widmete sich diesen Details, denen sie bisher keine Beachtung geschenkt hatte. Ihre Aufmerksamkeit ankerte im Bedeutungslosen und suchte so den Gedanken zu entrinnen, in die sie sich verstrickte, je näher die Begegnung mit Erik rückte.
Sie hatte das Zusammentreffen mit ihm wie ein Rollenspiel zu üben versucht, war ihm im Spiegel gegenübergetreten, hatte sich mit ihm gestritten und geschrien. Heute schämte sie sich ihrer Liebe zu ihm. Auf Anke reimte sich Kranke. Erik hatte ihr diesen platten Reim aus dem Schweigen heraus an den Kopf geworfen. Ihre sich selbst gestellte Aufgabe war paradox: Sie musste zersetzen, was sie über Jahre blind verteidigt hatte.
Anke hatte die Fragen aufgeschrieben, die sie Erik stellen wollte, Vorhalte gesammelt, ausformuliert und Vorwürfe in Rangfolgen gegliedert und wieder verändert. Ihre theoretische Vorarbeit war vollkommen. Alles hing zusammen und bedingte sich wechselseitig. Wenn sie nur ein Detail hinwegdachte, war alles weg.
Dies waren die Augenblicke, in denen sie aus der Vergangenheit huschen und sie einfach wie ein Licht auslöschen wollte. Ihr Denken war wirres Gestrüpp und klebte in der Angst, dass sie ihre Liebe zu Erik weder erklären noch aus ihrem Leben verbannen konnte.
»Du wirst wie ein im Platzregen stehender Kübel überlaufen«, hatte Miriam im letzten Gespräch prophezeit. Sie wollte Lust auf die Konfrontation mit Erik machen. Doch Anke wusste, dass ihr nicht gelingen würde, all das ans Tageslicht zu zerren, was nachvollziehbar begründen könnte, warum Erik über die Jahre alle Kraft aus ihr gezogen und sie hatte verhungern lassen. Ihr Lachen auf dem Balkon war wie der überlaufende Tropfen in einem gerade zerberstenden Glas. Es passte weder in ihr Leben mit Erik noch in ihr Leben vor Erik. Das Lachen war wie ein alberner und deswegen schriller Solitär, als gehörte es nicht zu ihr. Doch es war ihr Lebensschrei und immer mehr spürte sie die Kraft zurückkehren, sich ihres Peinigers entledigen zu können.
Ankes Trennung von Erik würde formal vor dem Familiengericht besiegelt werden. Sie würde die Scheidung einreichen, wenn sie ein Jahr voneinander getrennt lebten. Der staatliche Akt war nicht wichtig und heilte ihre Seele nicht. Aber sie würde die Scheidung mit Lust und Freude einreichen. Anke hatte ihm dies mit genau diesen Worten mitgeteilt und genossen, ihm die erlösende Genugtuung zu vermitteln, die sie mit diesem Schritt verband: Mit dem Scheidungsbeschluss würde sie das rechtliche Symbol in Händen halten, das äußerlich das Band zwischen ihnen zerriss. Erik hatte auf ihren Brief nicht geantwortet.
8
Als Anke zögernd die Praxis betrat, waren ihre Hände feucht. Alle Gedanken darüber, wie sie Erik gegenüber auftreten und was sie ihm wie mit welchen Worten sagen wollte, vermengten sich in einem diffusen Gemisch widerstreitender Gedanken und Empfindungen. Ihr Gehirn griff nach den sich verflüchtigenden Strategien wie nach Papieren, die in einer Windböe forttrieben. Anke konnte nichts festhalten. Kaum, dass sie glaubte, eines der Gedanken habhaft geworden zu sein, entschwanden zwei weitere.
Als sie an der Rezeptionstheke ankam, fühlte sie sich ausgeliefert. Erst heute – bei ihrem achten oder neunten Besuch – begegnete sie erstmals Miriams Assistentin, der sie sich vorstellte, als habe sie noch nie diese Praxis betreten. Bislang hatte Anke nur vormittags Termine bei Miriam gehabt.
Anke erklärte, dass sie um 15 Uhr einen Termin bei Miriam habe, doch die Assistentin schüttelte nach einem Blick in den Terminkalender den Kopf. Anke hörte sich sagen, dass sich die Assistentin irren müsse. Es war eine willkommene Gelegenheit, ins Reden zu kommen.
Als Anke erneut ansetzte, erschien Miriam in der Tür ihres Sprechzimmers. Erstaunt zog sie die Augenbrauen hoch und blickte Anke verwundert an.
»Sie sind zu früh …!«, stellte sie fest.
Sie hatten das wechselseitige Siezen vorher vereinbart. Weder die Assistentin noch Erik sollten wissen, dass Anke und Miriam einander kannten, und noch viel wichtiger war, dass beide nicht bemerkten, dass Anke und Miriam sich einander näher gestanden hatten als es Therapeutin und Patientin sollten. Sie hatten verabredet, sich jeweils mit dem Vornamen anzureden und beim »Sie« zu bleiben. Es war der von Miriam mit ihren Patienten bevorzugte Umgang in der Kommunikation. Sie pflegte ein Gemenge aus Nähe und Distanz, wechselte spielend die Ebenen und konnte ihren Patienten stets so begegnen, wie sie sie am besten treffen und steuern konnte.
»Der Termin ist erst um sechzehn Uhr«, sagte Miriam fest.
Anke schüttelte den Kopf.
»Ganz sicher!«, lächelte Miriam. »Ich kenne meinen Terminkalender. – Sie werden bei unserem Telefonat die 6 unsauber notiert haben«, war sie sich sicher. »Fünfzehn statt sechzehn Uhr und umgekehrt sind die häufigsten Terminmissverständnisse. – Aber …«, sie schob die Zweifel mit einer Handbewegung beiseite, »machen Sie sich keine Gedanken! Wir kriegen das Stündchen schon rum. Darf ich Sie in das Wartezimmer 1 bitten?«
Miriam ging voran. Sie trug schwarze Stiefel und ein knielanges graues Wollkleid, das sich wie eine zweite Haut eng an ihren Körper schmiegte. Ihre dunklen schulterlangen Haare waren offen, wie sie sie immer getragen hatte, wenn sie sich mit Anke außerhalb der Praxis getroffen hatte.
Anke folgte zögernd, noch immer darüber grübelnd, ob sie die Uhrzeit falsch notiert hatte. Ihre Erinnerung konzentrierte sich auf ihr letztes Gespräch mit Miriam, in dem sie die heutige Begegnung mit Erik vorbereitet und den Termin abgestimmt hatten. Der Rückblick griff in eine wie zufällig ausgewählte Szene. Die Wortwechsel mit Miriam spulten vor ihrem geistigen Auge wie eine technische Aufnahme ab. Wie eine unbeteiligte Zuschauerin verfolgte Anke den Film über das Gespräch mit Miriam, aber als sie zu der Sequenz kam, in der sie über die Uhrzeit gesprochen hatten, stockte der Bildlauf.
Miriam öffnete die Tür zum Wartezimmer 1. Es war ein kleiner weiß getünchter Raum, in den sie Anke bat, ausgestattet nur mit zwei Schwingsesseln und einer Ablage für Zeitschriften. Anke atmete den Geruch aggressiver Desinfektionsmittel und abgestandene Luft ein. Es roch nach schmutziger Reinlichkeit.
»Wir hatten fünfzehn Uhr vereinbart«, beharrte Anke. Eigentlich war die Uhrzeit unbedeutend, aber sie wollte die Lücke gefüllt wissen, die sich in ihrem Kopf auftat.
Miriam nickte und lächelte verständnisvoll. Es war ein mildes Lächeln, das sie wie ein Beruhigungsmittel einzusetzen verstand, wenn Argumente sinnlos schienen.
»Vielleicht hast du recht und ich habe mich geirrt«, half sie. »Ist es wichtig, Anke?«
»Nein, es ist nicht wichtig. Aber du lügst mich an. Warum?«
»Was ich hier leiste, ist ein Dienst für dich«, entgegnete Miriam. »Es ist meine Hilfe als Freundin, deklariert als ein Therapiegespräch für ein Paar, das einen Weg aus der Krise sucht. Du hast meinen Rückhalt, und ich gewähre dir für das Gespräch mit Erik einen geschützten Raum. Ich bin bei dir und bewahre dich vor Übergriffen. Gleichwohl verletze ich Grenzen. Allein aus Freundschaft, Anke! – Mit Professionalität hat das nichts zu tun! Ich verstoße gegen alle Berufsgrundsätze. – Also nerve mich bitte nicht mit einem möglichen Versehen bei der Vereinbarung der Uhrzeit. Du wirst hier eine Stunde eine Stunde sitzen und dich entspannen, okay? Ich werde in der Zeit noch ein paar Telefonate führen. Okay?«
Jedes »Okay« saß wie ein Hieb. Miriam drückte Anke mit sanftem Druck in einen Sessel.
»Ich helfe dir«, setzte sie nach. »Das weißt du.« Sie redete mit Anke wie mit einem Kind, beugte sich zu ihr herunter, nahm ihre Hand und streichelte sie. Die elektrisierende Berührung ließ Ankes Hand zurückzucken.
»Kommt wahrscheinlich vom Teppich«, meinte Miriam. Wieder griff sie nach Ankes Hand und Anke ließ es geschehen. Es war das Streicheln, das schmerzte. Die Nähe tat weh. Der Raum war eng. Er schützte nicht; er erstickte. Miriam war jetzt nah bei ihr, die schmale Hand eine geschmeidige Fessel.
»Du bist dir für nichts zu schade, Miriam!«
»Du willst dich entziehen!«, sagte Miriam und streichelte weiter, bis sich ihre Finger unvermittelt wie der Bügel eines aufspringenden Schlosses lösten. Anke dachte an Krakenarme, die durch einen elektrischen Impuls emporschnellten. Der Würgegriff löste sich, aber war es nicht Erik, der sie würgte?
Anke wusste um die Täuschungen, denen sie erlag. Es waren wirre Bilder, die in bizarren Fetzen durch ihr Gehirn strömten. Das Gehirn pochte. Miriam stand so nah vor ihr, dass Anke ihre Körperwärme fühlte. Das graue Wollkleid saß so eng, dass sich Miriams kleine Brust deutlich darunter abzeichnete. Anke stach der Gedanke in den Kopf, dass Miriam unter ihrem Kleid nackt sein könnte. Sie konnte nicht anders denken. Es war die Erinnerung an jenen einen Abend bei Miriam, an dem sie irritiert geflüchtet war. Sie konnte den verstörenden Abend nicht verdrängen und suchte an und in sich die Signale, die sie gesetzt haben könnte. Als sie aus Miriams Wohnung geflüchtet war, hatte sich die Welt gedreht. Anke war durch die Straßen gerannt, bis ihr die Lungen brannten. Als sie endlich keuchend stehengeblieben war, hatte sie Blut gespuckt.
»Du musst ruhig bleiben!« Miriam lächelte.
Sie kam ihr noch näher. Ihre Haare fielen Anke vor das Gesicht, die Haarspitzen kitzelten ihre Wangen. Anke versuchte sie mit der Hand wie eine lästige Fliege wegzuwischen, doch Miriam fing ihre Hand und hielt sie fest. Sie eröffnete das Spiel. Ankes Hand folgte Miriams ruderndem Arm. Ein Kreisen und Kreuzen. Hand fing Hand, es war das Freundschaftsband.
»Du wirst es schaffen!« Miriams Lippen waren denen von Anke nah. Sie schürzte sie spitz wie zum Sektgenuss. Ein spitzer Schnabel in der Luft.
Anke roch den Lavendel. Es war der Duft der Nacktheit. Es war der Duft, den sie verabscheute.
Sie drückte sich tiefer in den Sessel. Miriam war über und neben ihr, ein filigraner, dürrer Körper. Ein Federgewicht, das Gegenteil des Vollweibs, jetzt bleiern schwer, das Wollkleid rieb an ihr. Anke widerstand.
»Du bist ekelhaft!«
»Kindchen!«, sagte Miriam sanft.
Sie hielt Ankes Hand in der Luft umschlossen wie zum Tanz, drehte händeringend Pirouetten in der Luft. Es sah aus wie ein ästhetisches Ringen. Anke fürchtete den Kuss.
»Miriam …!«, schrie sie.
Miriam strich mit dem Zeigefinger ihrer freien Hand über Ankes Nasenspitze. Sie liebkoste verspielt eine unschuldig erogene Zone, als sei sie Nichts und Alles. Dann löste sie sich und stand auf.
»Lass’ es!«
»Es ist dein Weg«, gab Miriam zurück.
Anke atmete in heftigen Stößen. Sie wollte nicht abbrechen. Aufgeben galt nicht. Miriam hatte es ihr immer wieder gesagt. Mal launig, mal ernsthaft. Anke hatte sich für den Weg nach vorn entschieden. Die Alternative bedeutete Feigheit, Aufgabe, Verleugnung. Die wachsende Abneigung gegenüber Miriam beflügelte sie.
Miriam zog sich in den Türrahmen zurück. Augenblicklich war der Lavendelduft weg.
»Du bist ein Teufel!«
Miriam lächelte. »Du solltest die Zeit besser nutzen, um dich gegen Erik zu wappnen.« Dann ging sie. Ihre Lippen spitzten sich im Weggehen zu einem Kuss. Er flog Anke mit einem Augenzwinkern zu.
Sie hörte, wie Miriam ihre Assistentin anwies, Erik nach seiner Ankunft in das Wartezimmer 2 zu führen. Dann schlug eine Tür zu. Miriam war in ihrem Sprechzimmer, und es war still.
9
Anke musste herunterkommen, um für Erik bereit zu sein. Rund 40 Minuten blieben ihr noch. Die Gedanken kreisten um ihn, hinkten und verloren sich in einem Strudel. Im Geiste sah sie ihren Hirnströmen zu: Blaue glänzende Zylinder in einem Gewirr gläserner Röhren, ein Dickicht von oben nach unten und von rechts nach links. Sie blitzten auf und entschwanden. Dann drehte sich alles. Die Zentrifuge begann. Immer schneller kreisten die blauen Blitze und flogen an den Rand eines sich öffnenden Schlundes. Im Zentrum dieses Schlunds schweifte sie zurück zu jenem Abend, als sie Miriam kennengelernt hatte.
Erik bediente sich eines feinsinnig angewandten Systems, um seine Gegner zu lähmen. Anke hatte erst später verstanden, dass sie als seine Frau dieses Schicksal mit allen teilte, die sich ihm entgegenstellten oder von ihm nur als Feinde empfunden wurden. Erik war ein Mensch, der stets gewappnet war. Wenn er Anke kritisierte, wurde er niemals laut. Stets blieb er leise und wählte seine Worte mit Bedacht, wenn er ihr Denken und Handeln der Korrektur unterzog. Anke und er hatten nie miteinander gestritten. Wenn sie unterschiedlicher Ansicht waren, versandete ihre Meinung mit ihrer Wut im Strom seiner Gegenargumente. Er variierte fließend seine Positionen und konnte virtuos die eigene Ansicht mit der gegenteiligen begründen.
Mit der Zeit war Anke darüber still geworden.
Ankes Alleingänge waren das Wiedererlernen von Selbstverständlichem, geübt in kleinen Schritten, die anfangs kaum mehr schafften als die Luft zu schmecken, die ihr von Erik im Laufe der Zeit abgeschnürt worden war.
Am ersten Abend war Anke ziellos durch die Straßen gelaufen. Mit immer schnelleren Schritten war sie gegangen, bis sie rannte und den Schweiß auf ihrer Stirn und lebendig an ihrem ganzen Körper fühlte, bevor sie heimkehrte.
Erik saß meist bis in die Nacht an seinem Computer, der auf dem antiken Sekretär stand. Der bläulich schimmernde Bildschirm blieb dann das einzige Licht in dem dunklen Wohnzimmer. Er beanspruchte für seine Arbeit volle Konzentration und ertrug keine ablenkenden Geräusche und Lichtquellen. Schnell hatte sich Anke angewöhnt, sich zum Fernsehen in das Schlafzimmer zurückzuziehen. Anfangs hatte sie dies aus Liebe zu ihm getan, um ihm mit ihrer Ferne gut zu tun.
Heute wusste sie, dass jedes Leiden umso weniger quälte, je selbstverständlicher es aus einem ihm zugedachten Sinn gelebt wurde.





























