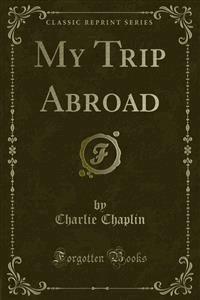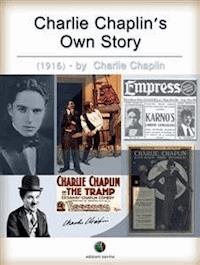23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der sensationelle Fund: Charlie Chaplins einziger
Roman, erstmals veröffentlicht
Über sechzig Jahre lang ruhte der Kurzroman Footlights, Charlie Chaplins einziges literarisches Vermächtnis, in den Archiven. Die Geschichte des alternden Clowns Calvero, der die lebensmüde Tänzerin Thereza bei sich aufnimmt, diente Chaplin als Grundlage für sein melancholisches Spätwerk Rampenlicht aus dem Jahr 1952. Der renommierte Chaplin-Biograf David Robinson hat dieses Werk nun erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In dem opulenten Bildband mit zahlreichen unveröffentlichten Fotos entwirft Robinson zudem ein faszinierendes Szenario rund um die Entstehung des Rampenlicht-Drehbuchs und zeigt auf, wie sehr sich Chaplin durch seine Kindheitserlebnisse im Umfeld der Londoner Music Halls und Varietés inspirieren ließ und dass er in der Figur des Clowns Calvero auch seine eigene Rolle als alternder Künstler reflektierte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014
unter dem Titel »Footlights with The World of Limelight« bei Edizioni Cineteca di Bologna.
1. Auflage
Copyright © 2014 by Edizioni Cineteca di Bologna
The World of Limelight © 2014 by David Robinson,
Footlights by Charlie Chaplin, Calvero’s Story by Charlie Chaplin
© 2014 The Roy Export Company Establishment
Photographs from Limelight © Roy Export S.A.S.
Images and documents from the Chaplin Archives © and/or Property of the Roy Export Company Establishment
Photograph 4, 132 © by Florence Homolka
Published by arrangement with Marco Vigevani & Associati Agenzia Letteraria
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
beim C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlag: buxdesign, München
Satz und Layout: Sabine Hüttenkofer, Straßlach-Dingharting
ISBN 978-3-641-14983-3
www.cbertelsmann.de
Für Claire Bloom
Inhalt
VORWORT
Charlie Chaplin FOOTLIGHTS
Die Entwicklung einer Geschichte
Footlights
Calveros Geschichte
David Robinson DIE WELT CHARLIE CHAPLINS
Den Baum schütteln
Vom Drehbuch zur Leinwand
Die Stadt London in Rampenlicht
Die Music-Hall-Zeit der Chaplins
Die Ballette am Leicester Square
Ein Familienporträt
EPILOG
Dank und Bildnachweis
Anhang
Anmerkungen
Credits
Zeittafel
Bibliografie
Personen- und Namensregister
Chaplin im Schneideraum mit Jerry Epstein und Joseph Engel.
VORWORT
Am 2. August 1952 veranstaltete Charles Chaplin eine Voraufführung seines neuen Films Rampenlicht (Originaltitel: Limelight) im Paramount Studio Theatre in Hollywood. Alle zweihundert Plätze waren besetzt. Die Liste der Eingeladenen existiert nicht mehr, aber es handelte sich ganz offenbar um Leute, die er in diesen schwierigen Zeiten immer noch als seine Freunde betrachtete, darunter David Selznick, Ronald Colman, Humphrey Bogart, Mrs. Clark Gable (die Witwe von Douglas Fairbanks) sowie die Berühmtheiten Doris Duke, »das reichste Mädchen der Welt«, und Richter Ferdinand Pecora, »der Höllenhund der Wall Street«. Anwesend waren auch »mehrere ältere Damen und Herren, die mit Chaplin seit Goldrausch 1924 zusammengearbeitet hatten«. Zuvorkommend führte Chaplin die Gäste in den Saal und betätigte dann während der Vorführung den Lautstärkeregler. Als der Film zu Ende war, erhoben sich alle und riefen begeistert: »Bravo!« Chaplin war sichtlich erleichtert und dankte ihnen: »Ich hatte große Angst. Sie sind die Allerersten, die diesen Film gesehen haben. Er hat zwei Stunden und dreißig Minuten gedauert. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Aber ich möchte Ihnen danken …« Weiter kam Chaplin nicht, schrieb der Kolumnist und Produzent Sidney Skolsky.
Eine Frau im Publikum rief: »Nein! Nein! Wir danken Ihnen«, andere folgten ihrem Beispiel … Manchmal glaube ich, dies ist der Schlüssel zu Rampenlicht. Es spielt keine Rolle, ob gewisse Leute denken, der Film sei gut, und andere, er sei großartig. Die Abstufungen sind belanglos. Es handelt sich nicht um einen normalen Film, der von einem normalen Sterblichen gedreht wurde, sondern um ein wesentliches Stück Zelluloidgeschichte und Emotion, und ich glaube, dass jeder, der sich wirklich für den Film interessiert, Danke sagen wird.
Niemand, der an diesem Tag zugegen war, konnte wissen, dass es sich dabei um Chaplins Abschied von Hollywood handelte. Sechs Wochen später schiffte er sich nach Europa ein. Er wusste selber nicht, dass er sein Zuhause, sein Studio und das Land, dem er sich geistig und beruflich vier Jahrzehnte lang zugehörig gefühlt hatte, für immer verlassen würde.
Skolsky schrieb seinen Bericht direkt nach der Vorführung, hatte jedoch bereits die Einzigartigkeit von Rampenlicht erkannt, als er von einem »wesentlichen Stück Zelluloidgeschichte und Emotion« sprach. Es war aber noch viel mehr. Chaplins persönliche Situation und öffentliche Ausgrenzung in den USA zu Zeiten des Kalten Krieges, gerade als er sich wieder mit Freude dem Familienleben zuwandte, hatte die drei Jahre, die er dem Film widmete, sehr introspektiv gestaltet. Er kehrte zu alten geliebten Ideen zurück, die er ein Jahrzehnt lang beiseitegeschoben hatte, um sich in einer Welt, die von einem Krieg und einem darauffolgenden Kalten Krieg zerrissen wurde, in den Filmen Der große Diktator und Monsieur Verdoux dringlicheren Fragen zu widmen.
Für das Setting dachte er sich in das London seiner ersten Berufsjahre mit den Music Halls zurück, eine verzauberte Zeit, in der er die Armut seiner Kindheit abgeschüttelt hatte und sukzessive seine einzigartige Begabung als Entertainer und Vermittler entdeckte. Dieser Rückblick rief aber auch Erinnerungen an die quälende Unsicherheit eines ungebildeten, unkultivierten Jungen wach, der sich plötzlich in der Welt des Erfolgs wiederfindet. Er verglich seine Situation mit den Misslichkeiten seiner Eltern, die mit derselben jungen, leuchtenden Hoffnung die Bühnen der Music Halls betreten hatten, dann aber Krankheiten und dem Alkoholismus erlegen waren. Diese Überlegungen veranlassten ihn dazu, Spekulationen über ihre enge Beziehung zueinander anzustellen und die überlieferten Familiengeschichten über Untreue und Aufbruch neu zu überdenken und sie mit seiner eigenen zwiespältigen Situation in den USA Mitte des 20. Jahrhunderts zu vergleichen. Seine Ehe mit einer sechsunddreißig Jahre jüngeren Frau und die rasch wachsende Familie erstaunte und beglückte ihn. Gleichzeitig sah er sich mit dem denkbar größten Albtraum eines Künstlers, nämlich mit dem Verlust seines Publikums, konfrontiert.
Das ist an sich noch nichts Außergewöhnliches. Jedes kreative Werk entsteht aus der einzigartigen Persönlichkeit des Künstlers, aus seinen Erfahrungen, Beziehungen, Erinnerungen. Chaplins unfassbare Erfolgsgeschichte vom armen Schlucker zum Millionär hatte ihm einen größeren Fundus beschert als den meisten anderen Sterblichen. Aber in seinem Fall besteht für den Historiker oder Kritiker ein entscheidender Unterschied. Wenn wir versuchen, die Geschichte eines Kunstwerkes, sei es eines Buches, Bildes, Schauspiels, Filmes oder Musikstückes, zu analysieren, dann müssen wir uns in der Regel auf das Kunstwerk und biografische Umstände seines Schöpfers beschränken. In Chaplins Fall, und das ist vielleicht einzigartig, existieren detaillierte Angaben aus erster Hand über den Entstehungsprozess und die langwierige Zusammenführung unterschiedlichster Ideen und Gefühle zu zwei sauberen, publikumstauglichen Filmstunden. Chaplin hamsterte Ideen, einer seiner Mitarbeiter beschrieb sein Gehirn einst als einen Speicher, in dem »alles, das sich als brauchbar erweisen konnte, aufbewahrt wurde«. Unablässig machte er sich − nicht immer lesbare − Notizen. Wenn er mit einem Projekt begonnen hatte, diktierte er seine neuesten Ideen den leidgeprüften Sekretärinnen, die mit seinen ständigen Änderungen, Streichungen, Ergänzungen und Abschweifungen Schritt halten mussten.
Zugegeben, die meisten Autoren entwickeln ihre Texte auf eine ähnlich kreative Art und Weise, jedoch mit dem Unterschied, dass sie einen Papierkorb benutzen. Chaplin selbst, heißt es, war zwar nicht daran interessiert, alte Papiere und verworfene Filmsequenzen aufzuheben, und hätte vermutlich gerne alles Belanglose weggeworfen. Aber stets gab es Leute, ihm ergebene Sekretärinnen, seinen Bruder Sydney oder seinen Halbbruder Wheeler, die Chaplins Einfällen sehr viel Bedeutung beimaßen und fleißig alles retteten. Auf diese Art häufte sich stapelweise Papier in Form von Manuskriptentwürfen, maschinengeschriebenen Notizen und diversen handschriftlich veränderten und kommentierten Manuskriptfassungen in den Studioarchiven neben den besser geordneten Geschäftsakten an. Wunderbarerweise überdauerten diese Unterlagen die Schließung des Hollywoodstudios und wurden in die Schweiz transportiert. Dort wurden sie ordentlich in braune Pappkartons verpackt, wo sie Chaplins hervorragende Assistentin Rachel Ford gebündelt in Packpapier einschlug, verschnürte und fein säuberlich etikettierte. Über ein halbes Jahrhundert lang lagen sie im Herrenhaus Manoir de Ban in Corsier-sur-Vevey in der Schweiz, ohne von der Feuchtigkeit des dortigen Kellergeschosses allzu sehr beschädigt zu werden. In diesem Keller durfte ich das Archiv zum ersten Mal in Augenschein nehmen. Das Archiv war aufregend, stellte aber auch angesichts Miss Fords vorbildlicher Pfadfinderknoten und ihrer etwas weit gefassten Klassifizierung eine gewisse Herausforderung dar.
Der Glaube der Studio-Eichhörnchen und die Hingabe Miss Fords haben sich durch die Schaffung der Charlie Chaplin Archives, wobei die Association und die Cineteca di Bologna zusammenarbeiteten, großartig ausgezahlt. Die Dokumente gelangten aus dem Keller in die Hände der besten Konservatoren in Montreux und wurden digitalisiert, sodass überall und rasch auf sie zugegriffen werden kann. Die gegenwärtigen Hüter dieses phänomenalen Erbes, unter der wohlwollenden Aufsicht der Familie Chaplin, sind Kate Guyonvarch von der Association Chaplin und Cecilia Cenciarelli, die Chefin des Chaplin Projects.
Diese unvergleichliche Quelle und die durch den digitalen Zugang geschaffene Möglichkeit, alles genauestens zu kontrollieren, befähigten uns auf bislang unvergleichliche Weise, Chaplins kreativen Prozess nachzuvollziehen. Wir können ihn dabei beobachten, wie er seine Erinnerungen ausschlachtet, mit der Endauswahl kämpft, die Vorfälle und Ideen auswählt, formt und in eine Reihenfolge bringt, um eine zusammenhängende Geschichte entstehen zu lassen. In dieser Hinsicht war Rampenlicht für ihn ein einzigartiges Unterfangen, da es sich um eine tiefschürfende Ausgrabung lebenslanger Erinnerungen, Gefühle und historischer Wirklichkeit handelte. Aus diesem Grund verarbeitete er diesen Stoff vermutlich nicht zuerst zu einem Drehbuch, sondern zu einer langen Erzählung, Footlights, mit der Ergänzung Calveros Geschichte, die beide hier zum ersten Mal veröffentlicht werden und den Hauptgrund für die Entstehung dieses Buches darstellen. Aus diesen Erzählungen destillierte Chaplin ein Drehbuch, das mehrere Stadien durchlief, ehe es endlich verfilmt wurde. Erst nach Beendigung der Dreharbeiten fügte er in Stummfilmmanier drei Zusatztitel hinzu, die elegant das ihm gelungene Fazit zusammenfassen:
Der Glamour des Rampenlichts, den das Alter aufgeben muss, wenn die Jugend die Bühne betritt.
Die Geschichte einer Ballerina und eines Clowns …
London, ein Spätnachmittag des Sommers 1914
Der Begleitkommentar dieses Buches untersucht die dokumentarische Wirklichkeit der Welt, die Chaplin aus seiner Erinnerung auferstehen ließ und für die Nachwelt festhielt: London und die Music Hall am Ende einer Ära, direkt vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
David Robinson
Chaplin als Monsieur Verdoux, eine eindrucksvolle Kulissenaufnahme aus der Sammlung Robert Floreys und vermutlich von diesem selbst aufgenommen.
DIE ENTWICKLUNG EINER GESCHICHTE
In Chaplins Filmografie folgt Rampenlicht auf Monsieur Verdoux, einen Film, der ihn von der ersten Idee im November 194 2 bis zur Weltpremiere am 11. April 1947 beschäftigte. Während dieser Jahre verschlechterte sich seine Beziehung zu seiner Wahlheimat anlässlich der Nachkriegsparanoia des Kalten Krieges und der beginnenden McCarthy-Verfolgungen drastisch. Chaplin, der prominente Ausländer, geriet bereits früh ins Fadenkreuz des Federal Bureau of Investigation, dessen Chef J. Edgar Hoover eine besondere Abneigung gegen ihn hegte. Im Namen Chaplins psychisch kranker ehemaliger Freundin Joan Barry inszenierte das FBI einen hässlichen Vaterschaftsprozess. Der Fall zog sich über zweieinhalb Jahre (1943−1945) mit einer Reihe von Prozessen hin. Der letzte endete damit, dass die Bluttests, die eindeutig belegten, dass Chaplin unmöglich der Vater von Barrys Kind sein konnte, nicht als Beweismittel akzeptiert wurden. Die daraus resultierende Publicity beeinträchtigte Chaplins Beliebtheit bei den Durchschnittsamerikanern außerordentlich und schuf ein günstiges Klima für politische Angriffe, die sich Bahn brachen, als Monsieur Verdoux in die Kinos kam. Auch diese waren vom FBI angefacht worden, das schon seit Jahren beobachtete, dass sich Chaplin großer Beliebtheit bei linken Intellektuellen erfreute, und daher mit großem Eifer − aber ohne Erfolg − versuchte, Chaplin nachzuweisen, dass er kommunistische Projekte finanziell unterstützte. Zwar war die Suche nach unerwünschten politischen Verbindungen nicht von Erfolg gekrönt, das FBI gab jedoch Neuigkeiten wie eine positive Rezension aus der Prawda, die allerdings bereits 1923 erschienen war, bevorzugt an rechte Klatschkolumnisten wie Walter Winchell und Hedda Hopper weiter.
Erst bei der Pressekonferenz am Tag nach der Premiere von Monsieur Verdoux erkannte Chaplin, wie erfolgreich diese Kampagne gewesen war. Die Veranstaltung wurde von James W. Fay, einem Vertreter der Catholic War Veterans, dominiert, der sich weigerte, über den Film zu diskutieren, und Chaplin stattdessen einem Kreuzverhör über seine politischen Sympathien und seinen Patriotismus unterzog und Chaplins Anspruch, er sei »ein Patriot der gesamten Menschheit, ein Bürger der Welt«, heftig widersprach. Fays Angriff wurde von seinen Anhängern, die im Publikum verteilt waren, aufgegriffen, und obwohl Chaplin geschickt und ehrlich antwortete und leidenschaftlich, wenn auch etwas unzusammenhängend von dem Kritiker James Agee verteidigt wurde, war der Schaden nicht abzuwenden. Der Kongressabgeordnete John Rankin forderte daraufhin die Abschiebung Chaplins. Chaplin wurde vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe geladen, aber diese Vorladung wurde wiederholte Male aufgeschoben und schließlich fallen gelassen. Das Komitee hatte zweifellos erkannt, dass Chaplin ein zu wohlartikulierter Zeuge gewesen wäre. Ende 1947 hinderten die Catholic War Veterans das Publikum am Besuch seiner Filme und drängten darauf, dass das Justiz- und das Außenministerium gegen Chaplin ermittelten und ihn auswiesen.
In der Überschrift dieses Presseberichts über Chaplins Botschaft an das Komitee für unamerikanische Umtriebe wird dieser in böser Vorausahnung als »ehemaliger Filmstar« bezeichnet.
Diese für Chaplin schwierigen Jahre wurden zumindest durch sein Privatleben ausgeglichen, das sich erfüllender gestaltete als alle seine bisherigen Verbindungen und noch dazu von Dauer war. Gerade als der Joan-Barry-Prozess begann, lernte er die sechsunddreißig Jahre jüngere, achtzehnjährige Oona O’Neill, Tochter des amerikanischen Dramatikers Eugene O’Neill, kennen und heiratete sie. Ihr erstes Kind, Geraldine Leigh, kam 1944, ihr zweites, Michael John, 1946 zur Welt.
Oona Chaplin mit den Kindern Geraldine (7, links), Michael (5), Josephine (2) und (in Oonas Armen) Victoria, Sommer 1951.
Zudem spendete ihm die Arbeit Trost. Chaplin dachte sich unablässig Geschichten aus. Die Wahl eines Sujets aus der Welt des Theaters seiner Jugend, der Music Halls, in denen seine Familie und er gearbeitet hatten und die ihn berühmt gemacht hatten, ehe das Kino ihn entdeckte, mag zu diesem Zeitpunkt als nostalgische Abwendung von der bedrohlichen Gegenwart gedeutet werden. Aber der Plot wies auch dunklere Seiten auf. Der Clown Calvero, der Protagonist, hat die Fähigkeit verloren, sein Publikum zu begeistern. Dieser zurückgewiesene, übermäßig in sich gekehrte Mann verfällt in eine Depression, spricht dem Alkohol zu und erkrankt. Chaplin wurde damals, zu Zeiten des Kalten Krieges, schmerzlich bewusst, dass sich ein wesentlicher Teil seines Publikums von ihm abwandte. Diese Einsicht muss ihm wie ein Déjà-vu des albtraumhaften 23. Dezember 19071 vorgekommen sein, als er achtzehnjährig voller Zuversicht vor einem hauptsächlich jüdischen Publikum in der Foresters Music Hall in Bethnal Green eine Nummer als »Sam Cohen: der jüdische Komiker« ausprobiert hatte. Das Music-Hall-Publikum konnte sehr aggressiv sein:
»Nach den ersten Witzen begann das Publikum, Apfelsinenschalen und Münzen zu werfen, zu trampeln und zu buhen. Anfänglich merkte ich gar nicht, was vorging. Dann wurde mir langsam das Grauenhafte bewußt. […] Als ich abtrat, wartete ich erst gar nicht auf das Urteil des Direktors; ich ging schnurstracks in die Garderobe, wischte das Make-up ab und verließ auf Nimmerwiedersehen dieses Theater. Sogar meine Noten holte ich nicht mehr ab.«2
Ein feindseliges Publikum auf dem dritten Rang einer Londoner Music Hall um 1890.
Bis an sein Lebensende befiel ihn trotz seiner großen Bühnenerfolge mit der Fred Karno Company immer ein großes Unbehagen, wenn er vor einem Publikum auftreten musste. Rampenlicht ist eine oftmals qualvolle Studie der Beziehung zwischen Performer und Publikum, zwischen Künstler und Kunst. Als Thereza Calvero fragt: »Aber du hast doch gesagt, dass du das Theater hasst«, erwidert dieser: »Das tue ich auch. Und ich hasse den Anblick von Blut, obwohl es in meinen Adern fließt.« Untrennbar mit dieser Sichtweise auf seinen Beruf verknüpft ist die persönliche Geschichte der Liebe zwischen diesem Mann Anfang sechzig und der unschuldigen, deutlich jüngeren Tänzerin. Chaplin hat sicher persönliche Überlegungen über seine Ehe in den Film miteinfließen lassen.
Obwohl Rampenlicht heute Chaplins persönliche Situation speziell in den späten 1940er-Jahren zu reflektieren scheint, hatte er diese Geschichte doch schon jahrzehntelang im Hinterkopf. Den ersten Anstoß könnte seine Begegnung mit Vaslav Nijinsky gegeben haben, die bei beiden jungen Männern einen tiefen Eindruck hinterließ (Chaplin war siebenundzwanzig und somit nur fünf Wochen jünger als der Tänzer).3 Chaplin widmet diesem Treffen zwei Seiten seiner Memoiren Die Geschichte meines Lebens:
»Nijinsky kam, von Mitgliedern des Russischen Balletts begleitet, ebenfalls ins Atelier. Er war ein ernster Mann, sah sehr schön aus, hatte stark hervortretende Backenknochen, traurige Augen und wirkte wie ein Mönch in bürgerlicher Kleidung. Wir drehten gerade ›The Cure‹. Er setzte sich hinter die Kamera und sah mir bei der Arbeit an einem Auftritt zu, den ich komisch fand, doch er lächelte nicht ein einziges Mal. Die anderen Zuschauer lachten, doch Nijinskys Ausdruck wurde immer trauriger. Ehe er ging, verabschiedete er sich von mir, sagte mit hohler Stimme, es habe ihn sehr gefreut, mir bei der Arbeit zuzusehen, und fragte, ob er wiederkommen dürfe.
Im Gegensatz zu Nijinskys unbeschwerter Erscheinung auf dem Studiogruppenbild (rechts) lässt dieses seltene Foto, das aus der Zeit stammt, als er sich Diaghilews Truppe anschloss, jene Eigenschaften erahnen, die Chaplin verzauberten, »hypnotisch … göttlich … Stimmungen aus anderen Welten [vermittelnd]«.
›Selbstverständlich‹, sagte ich. Zwei Tage lang saß er nun da und betrachtete mich kummervoll. Am letzten Tag sagte ich dem Kameramann, er solle keinen Film einlegen, weil ich wußte, Nijinskys trauernde Erscheinung würde jeden meiner Versuche, komisch zu erscheinen, zum Scheitern bringen. Nijinsky pflegte mich jeden Abend zu beglückwünschen. ›Ihre Komödien sind balletique: Sie sind ein Tänzer‹, sagte er.4
Bis dahin hatte ich weder das Russische Ballett noch irgend ein anderes Ballett gesehen. Am Ende der Woche wurde ich dann zur Matinee eingeladen.
Im Theater begrüßte mich Diaghilew, ein sehr vitaler, enthusiastischer Mensch. Er entschuldigte sich dafür, daß er nicht das Programm vorführen könne, das mir am besten gefallen würde.
Vaslav Nijinsky (Mitte) besucht das Chaplin Studio am 27., 28. oder 29. Dezember 1916. Chaplin und Eric Campbell (der große Mann links neben Nijinsky) tragen die Kostüme für Easy Street.
›Zu dumm, daß wir nicht L’Après-midi d’un Faune geben können‹, meinte er. ›Das hätte Ihnen bestimmt gefallen.‹ Dann sagte er entschlossen zu seinem Bühnenmeister: ›Sage Nijinsky, wir wollen den Faun nach der Pause für Charlot geben.‹
Das erste Ballett war Scheherezade. Darauf reagierte ich mehr oder weniger negativ […] Die nächste Nummer war ein Pas de deux mit Nijinsky. Vom Augenblick seines Auftretens an war ich wie elektrisiert. Ich habe in meinem Leben wenige Genies gesehen, Nijinsky gehörte dazu. Er zog einen in einen fast hypnotischen Bann, war göttlich, und seine Düsterkeit ließ den Zuschauer Stimmungen empfinden, die aus anderen Welten kamen; jeder Augenblick war erfüllt von Poesie, jeder Sprung eine Flucht in fremde, phantastische Welten.«
Nijinsky hatte Chaplin in seine Garderobe gebeten. Laut Chaplins Bericht führten sie nur eine belanglose Unterhaltung, während sich Nijinsky für den Faun umkleidete, aber trotzdem wollte er Chaplin nicht gehen lassen. Es kümmerte ihn nicht, dass er das Publikum warten ließ. Chaplin bestand schließlich darauf, zu seinem Platz zurückzukehren, und L’Après-midi d’un Faune nahm seinen Anfang.
»Niemand hat sich je mit Nijinsky … messen können. Mit einigen wenigen schlichten Gebärden und ohne sichtbare Mühe schuf er eine mystische Welt, wo in den Schatten ländlicher Lieblichkeit das Tragische lauerte, während er, ein Gott leidenschaftlicher Traurigkeit, sich durch dieses Mysterium bewegte.«
Es ist leicht zu verstehen, welche Sympathien diese beiden Künstler verbunden haben müssen, aber schwer verständlich, warum Chaplins Erinnerung, die normalerweise unheimlich genau ist, bei dieser Gelegenheit so versagt. Die Ballets Russes wurden in der Weihnachtswoche 1916 in Los Angeles gezeigt, die erste Vorstellung fand am Abend des Weihnachtstages statt. Chaplin sagt, er habe gerade The Cure (dt. Die Kur) gedreht, was jedoch nicht der Fall war. Die Fotos, die Nijinsky im Studio zeigen, beweisen, dass gerade Easy Street (dt. Leichte Straße) produziert wurde. Chaplin beschreibt, dass er Diaghilew im Theater Clune’s Auditorium begegnet sei. Zu Beginn des Jahres 1916 hatte dieser mit der Truppe eine Tournee ohne Nijinsky in Amerika unternommen. Nachdem die Truppe jedoch anlässlich einer Wintertournee zurückgekehrt war, weigerte sich Diaghilew, nochmals während des Krieges zu verreisen. Nijinsky wurde zum künstlerischen Direktor der gesamten Tournee ernannt.5 Solch grobe Ungenauigkeiten erschüttern das Vertrauen in die übrigen Berichte. Konnte Nijinsky, der die Hauptverantwortung für die Tournee trug, das Theater wirklich drei Tage lang verlassen, um das Studio zu besuchen? Noch unwahrscheinlicher wirkt, dass die Truppe auf diese Weise improvisieren und plötzlich, Chaplin zu Ehren, ein zusätzliches Ballett einfügen konnte.
Gewisse Indizien untermauern jedoch andere Teile von Chaplins Bericht. Er erwähnt ausdrücklich, er sei zu einer Wochenendmatinee eingeladen worden, und tatsächlich fand auch nur eine einzige Matinee statt, Ende der Woche, am Samstag, dem 30. September, um 14.30 Uhr. Dem gedruckten Programm ist zu entnehmen, dass das spektakuläre Ballett Scheherazade zuletzt aufgeführt wurde und nicht, wie er sich erinnert, als Erstes. (Es gibt eine hübsche Referenz in Rampenlicht, wo im Empire Theatre ein Ballett getanzt wird, das stark an Scheherazade erinnert.) Es war der letzte Auftritt der Truppe, denn es gab keine Abendvorstellung, es könnte also ausnahmsweise tatsächlich möglich gewesen sein, dass nach dem Ende des Programms noch ein zusätzliches Ballett getanzt wurde. Wenn das tatsächlich der Fall war, dann würde das erklären, warum Nijinsky Chaplin mit banalem Small Talk hinhalten musste, um die zusätzliche Pause zu überbrücken, in der die anderen Tänzer und Bühnenarbeiter alles vorbereiteten.
Nijinsky in Scheherazade (1911).
Chaplin fuhr fort: »Ein halbes Jahr später fiel Nijinsky in geistige Umnachtung. Erste Anzeichen dafür gab es bereits an jenem Nachmittag in seiner Garderobe, als er das Publikum warten ließ.« Nach abgeschlossener Amerikatournee wurde bei Nijinsky Schizophrenie diagnostiziert, die dann innerhalb eines Jahres seine Karriere als Tänzer beendete. Zweifellos berührte Nijinskys Zusammenbruch Chaplin, der als Kind mit Geisteskrankheit in ungemütlich nahe Berührung gekommen war. Zwei Jahrzehnte später arbeitete er mit gewissenhafter Genauigkeit daran, die Magie und Tragödie der Geschichte des Tänzers in ein Drehbuch zu verwandeln. Ein langer, aber logischer Entstehungsprozess resultierte schließlich und endlich in Rampenlicht.
Sunnyside (1919), Chaplins Parodie auf Nijinskys L’Après-midi d’un Faune.
Nach der Erstaufführung von Moderne Zeiten (Originaltitel: Modern Times) und der darauffolgenden sechzehnwöchigen Welttournee mit Paulette Goddard kehrte Chaplin am 3. Juni 1936 nach Kalifornien zurück und begann unverzüglich, sich ein neues Projekt mit Paulette in der Hauptrolle auszudenken. Offenbar wollte er ihr damit dasselbe Kompliment machen wie seinerzeit Edna Purviance, für die er 1923 die Titelrolle in A Woman of Paris (dt. Die Nächte einer schönen Frau) geschrieben hatte. Bereits auf der Rückreise hatte er das 40 Seiten umfassende Skript zu Stowaway verfasst, welches von einer weißrussischen Gräfin im Exil handelt, die in Shanghai als Eintänzerin arbeitet. Diese Geschichte tauchte dreißig Jahre später im Film Die Gräfin von Hongkong wieder auf. Im darauffolgenden Jahr machte er sich weitere Gedanken über sein lang gehegtes Napoleon-Projekt, legte dieses dann aber beiseite, um mit Ronald Bodley6 an einer Filmfassung von D. L. Murrays Roman Regency zu arbeiten. Am 25. Mai 1937 informierte Chaplin seine Sekretärin Miss Hunter, dass er nun auch Regency ruhen lasse, da ihm eine moderne Geschichte für den Goddard-Film eingefallen sei. Vermutlich arbeitete er von diesem Zeitpunkt an an dem Tänzerprojekt. Die Faszination, die Nijinsky auf ihn ausgeübt hatte, war zweifellos durch Romola Nijinskys Biografie über ihren Ehemann aus dem Jahr 1934 und eine bearbeitete Version seiner Tagebücher im Jahr 1937 wiedererweckt worden. Beide Bücher erhielten in der Presse viel Aufmerksamkeit, und es war daher unvermeidlich, dass Chaplin von ihnen wusste. Viele Vorfälle, die in seinen verschiedenen Notizen und Fassungen Erwähnung finden, lassen sich auf diese beiden Werke zurückführen, während das anhaltende Thema der sozial höherstehenden Tänzergattin möglicherweise Chaplins eigenen Eindruck der adeligen Romola De Pulszky widerspiegelt, die Nijinsky 1913 geheiratet hatte, was zu einem irreparablen Zerwürfnis zwischen dem Tänzer und Diaghilew geführt hatte.
Aus einem Schnappschussalbum Chaplins: Mit Paulette Goddard auf ausgedehnter Tournee 1936 in Singapur.
Chaplins sich entwickelnde Tänzergeschichte ist als Manuskript erhalten geblieben. Einzelne Seiten fehlen, vielleicht wurden sie bei der Überarbeitung absichtlich einer anderen Fassung zugeordnet. Wir sind Kate Guyonvarch und Lisa Stein Haven sehr zu Dank verpflichtet, weil sie bändeweise Chaplins schwierige Handschrift transkribiert und Ordnung in die zahlreichen Fassungen und Fragmente gebracht haben. In diesen Fassungen ändern sich die Namen der Personen, teilweise sogar innerhalb derselben Geschichte. Einige Entwürfe bestehen nur aus notierten unfertigen Zusammenfassungen, andere enthalten fertige Dialoge. Die Hauptperson, immer der geniale Tänzer, taucht in verschiedenen Fassungen mit unterschiedlichen Namen auf: Neo, Tamerlain, Tamerlan, Tamerlin, Kana, Najinsky, Naginsky und sogar Nijinsky. In der Fassung, in der der Protagonist Neo heißt, erhält der Lehrer und Meister den Namen Tamerlin.
An Bord der SS President Coolidge.
Bestimmte Themen und Szenen überdauern alle Variationen der Geschichte. Der Held ist immer ein berühmter Tänzer, der ein Alter erreicht hat (um die fünfunddreißig), in dem er fürchtet, dass ihn sein Genie möglicherweise verlässt. Normalerweise hat er auch eine Frau aus der High Society, die ihn seiner Berühmtheit wegen geheiratet hat, von seiner Hingabe an die Kunst jedoch bald gelangweilt ist und ihm untreu wird. Er befindet sich in den Händen eines ausbeuterischen Impresarios, der sich über das Temperament des Tänzers aufregt und insgeheim plant, ihn durch einen jungen, vielversprechenden Star zu ersetzen. In der Regel ist der Vertraute des Tänzers sein Garderobier, ein ehemaliger Tänzer oder Sänger, mit dem er sich offener unterhalten kann als mit Außenstehenden (diese Rolle war für Chaplins getreuen Nebenrollen-Schauspieler Henry Bergman maßgeschneidert).7 Der Protagonist ist ausnahmslos zu vertrauensvoll, zu freigiebig und angesichts der Untreue seiner Frau zu nachsichtig. Ehemaligen Künstlern, die in Schwierigkeiten geraten sind, begegnet er immer mit Großzügigkeit. Die Besessenheit von seiner Kunst grenzt in den Augen der ihn umgebenden Menschen schon fast an Wahnsinn. Für seine Genialität muss er mit Vereinsamung und Isolation von den Menschen, die seine Kunst und seine Besessenheit nicht teilen können, bezahlen. Die für Paulette vorgesehene Rolle ist die der jungen Frau, die ihm die selbstlose Liebe und das Verständnis, dessen er bedarf, entgegenbringen kann. Obwohl dies nun der perfekte »Goddard-Film« werden sollte, war der dominante Charakter in allen Versionen der phänomenale Tänzer.
Auch wenn es einiges an Aufwand erfordert, lohnt es sich, die Entwicklung der Tänzergeschichte nachzuvollziehen, da sie belegt, wie Chaplin mit seinen kreativen Einfällen rang und wie er die Geschichte schließlich bis zu Rampenlicht weiterentwickelte. Der vermutlich früheste Entwurf beginnt ohne weitere Umschweife folgendermaßen: »Es war einmal ein wunderbarer Tänzer, der ein sehr schönes Mädchen auf einer Party traf, das sich unbedingt seinem Ballettensemble anschließen wollte. Er versprach, sie vortanzen zu lassen.« Sie schließt sich dem Ensemble an, und der Tänzer, der hier nur als T. bezeichnet wird, verliebt sich in das Mädchen, D. Dieser Umstand erfüllt eine andere Tänzerin, Ann, die insgeheim in T. verliebt ist, mit großer Trauer. Wenig später wird T. von der gesellschaftlich aufsteigenden D. verlassen. Ann hat sich inzwischen in einen »netten, ordentlichen jungen Mann« verliebt. T. erkennt auf einmal, dass er Ann liebt, was ihn in wechselhafte und streitsüchtige Laune versetzt. T. und Ann tanzen zusammen und bieten eine inspirierte Liebesszene dar. T. verlässt die Bühne mit einem großartigen Sprung und steht plötzlich Anns Verlobtem, der hinter den Kulissen wartet, gegenüber. T. packt seine Kehle mit mörderischem Griff, der sich nur mit Mühe lösen lässt, während das nichts ahnende Publikum ekstatisch applaudiert. T. begibt sich wieder auf die Bühne, um sich zu verbeugen. »Nachdem der Vorhang gefallen war, kehrte er wortlos in seine Garderobe zurück.«
Über die genaue Chronologie der Weiterentwicklung der Geschichten, die auf diesem schlichten Anfang aufbauen − einige liegen nur fragmentarisch vor −, lässt sich lediglich mutmaßen.
1. Die Neo-Geschichte
Neo ist der herausragende Star des kaiserlichen Balletts. Seine Frau organisiert sein Leben und führt seine Rede. Sein Lehrer Tamerlin, einst Tänzer im Russischen Kaiserreich, bittet ihn eines Tages, Dorothy, die aus einer reichen Familie stammt und das Ballett liebt, vortanzen zu lassen. Anfangs findet Neo, dass sie zu schön ist und von ihrer gesellschaftlichen Position allzu sehr in Anspruch genommen wird; aber nachdem er ihr begegnet ist und gemerkt hat, wie engagiert sie ist, erwacht sein Interesse …
2. Die erste Tamerlain-Geschichte
Tamerlain, der Solotänzer des National Ballet, ist mit Viola verheiratet, einem energischen Mitglied der High Society, die ihre reichen Freunde dazu überredet, »die Hochkultur der modernen Welt« zu fördern. Eine ihrer reichen Freundinnen kommentiert ihre Liaison folgendermaßen: »Die arme Viola, es ist eine Sache, mit dieser Art von Leuten Umgang zu pflegen, aber etwas ganz anderes, sie zu heiraten.« Ihre Liebe ist ohne Passion − denn beide sind zu sehr an seiner Karriere interessiert …
Paulette Goddard nimmt eine Tanzstunde bei Theodore Kosloff (1882−1956), der neben Nijinsky premier danseur in Diaghilews Ballets Russes war. Kosloff zog später in die Vereinigten Staaten und gründete seine eigene Truppe. Goddards Ballettkarriere wurde stark von Kosloff beeinflusst, der zu einem gefragten Charakterdarsteller in Stummfilmen avancierte.
3. Die zweite Tamerlain-Geschichte
Hier wird erstmals angedacht, dass Tamerlain asexuell ist. Seine Frau ist frustriert, weil er nur platonische Zuneigung sucht:
Tamerlain versuchte seiner Frau zu erklären, dass er sich nur nach Zärtlichkeit und Verständnis sehne und unter diesen Umständen bereit sei, ihrem Glück jedes Opfer zu bringen. Sie müsse einfach einsehen, dass Sex nichts mit der höheren, spirituellen Liebe einer Mutter für ihren Sohn oder eines Vaters für seine Tochter zu tun habe.
Er versuchte ihr zu erklären, dass seine Liebe zu ihr so groß sei, dass er ihr alles opfern würde: Sie könne tun, was immer ihr beliebe, solange sie diskret sei.
Die Ehefrau stellt ihre Untreue offen vor der Welt zur Schau, was ihn melancholisch stimmt. Als ihm seine Freunde raten, sich von ihr zu trennen, erwidert T.: »Das ist leichter gesagt als getan. […] Ohne sie wäre das Leben sehr einsam. Ich kann mit ihr noch nicht brechen. Ich brauche Zeit, um mich an die Einsamkeit zu gewöhnen.«
Chaplins handschriftliche Notizen, offenbar ein Entwurf für die dritte Tamerlain-Geschichte. Statt »important« in der dritten und vierten Zeile muss vermutlich »impotent« gelesen werden, ein Hinweis auf Tamerlains Asexualität.
4. Die dritte Tamerlain-Geschichte
Dies ist, soweit es zuverlässig wiederhergestellt wurde, das längste und ausgereifteste Treatment und enthält ausführliche Dialoge, die gelegentlich in verschiedenen Versionen vorliegen. Tamerlain, der Star des Balletts, geht ganz in seiner Kunst auf. Seiner Begabung zum Trotz fühlt er sich sozial und intellektuell unterlegen, denn er ist der Sohn eines Schusters.8
In bescheidene Umstände hineingeboren, verfügte er nicht über die Vorteile einer akademischen Ausbildung. Dieser Umstand stellte seiner Meinung nach ein unüberwindbares Hindernis dar … Tragisch war, dass er sein intensives Lebensgefühl und sein ausgeprägtes Liebes- und Schönheitsbedürfnis nur im Tanz ausdrücken konnte. Im wirklichen Leben war er scheu, hatte Mühe, sich auszudrücken, und wurde von Launenhaftigkeit geschüttelt, die jene, die ihn missverstanden, als künstlerisches Temperament und künstlerische Exzentrik abtaten. Aber er war ein einfacher Mensch und im Grunde seines Herzens nett, liebevoll und sanft und besaß gute Gründe für sein Temperament.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!