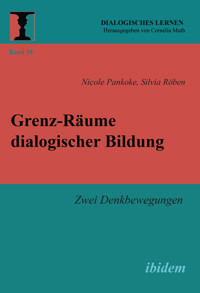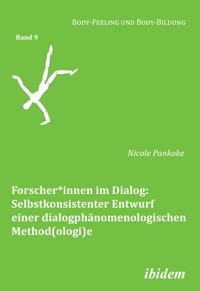
Forscher*innen im Dialog: Selbstkonsistenter Entwurf einer dialogphänomenologischen Method(ologi)e E-Book
Nicole Pankoke
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Bildung
- Serie: Body-Feeling und Body-Bildung
- Sprache: Deutsch
Das selbstkonsistente Verfahren dieser Monographie ist geleitet von der Suche nach einer Forschungsmethod(ologi)e – ein von Paul Mecheril geprägter Begriff –, die das Subjekt nicht ausklammert, sich einer machtsensiblen und verantwortungsvollen Wissensproduktion verschreibt und sich zugleich jeglicher Methodenfixierung widersetzt. Dabei stellt sich die grundlegende Frage, ob es überhaupt eine Vorgehensweise geben kann, die eine solche Forschungshaltung ermöglicht, so dass heroische Forschungspositionen vermieden, Grenzen von Erkennen akzeptiert und diese in ihrer Bescheidenheit transparent dargelegt werden können. Denn jedes Forschen steht im Zwiespalt zwischen dem wissenschaftlichen Anspruch an Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit und Objektivität auf der einen Seite und andererseits der Tatsache, dass Forschen eine menschliche Tätigkeit ist und bleibt. Doch wie mit der Subjektivität in Forschungsbeiträgen umgegangen werden soll, ist hart umkämpft. Der dialog-phänomenologische Beitrag wird weder ein formvollendeter noch ein in sich geschlossener Diskurs sein. Mithilfe des Gestaltansatzes, der Erfahrungsphänomenologie sowie der Bewusstseinsphänomenologie und der Dialogphilosophie kommt Nicole Pankoke dem (Nicht-)Erleben, (Nicht-)Erkennen sowie (Nicht-)Erfassen innerhalb des Forschungsprozesses auf die Spur. Neben dem Erarbeiten eines selbstkonsistenten Vorgehens bei der Entwicklung und Durchführung des Method(ologi)e-Ineinandergreifens setzt sie sich mit Grenzen des Sagbaren auseinander, mit Phänomenen von Scham und Schutz sowie mit der Angst vor dem Scheitern im Kontext von Forschung. Pankokes Monografie ist geprägt von der Hoffnung, dass Sie als Leser*in sich in den beschriebenen Schwierigkeiten wiedererkennen sowie von der Art und Weise, wie sie den skizzierten Erkenntnisprozess transparent macht, dazu angeregt werden, die dialog-phänomenologische Method(ologi)e weiterzudenken. Nicht zuletzt dadurch macht sie uns bewusst, dass wir uns immer auf der Suche nach Erkenntnis befinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Vorwort
Als Herausgeberinnen dieser Reihe freuen wir uns sehr über die phänomenologische Publikation von Nicole Pankoke. Mit ihrem Werk gibt es endlich eine Monographie, die unsere bisherigen Forschungswege methodologisch-konzeptionell begreifbar macht; obwohl es paradoxerweise nicht möglich ist, das phänomenologische Forschungsabenteuer in logischen Schritten umzusetzen. Denn gemäß Lévinas gilt auch hier: Erst kommt das Leben und dann die Erkenntnis!
Nicole Pankoke hat sich dem Dialogischen Forschen auf Augenhöhe leidenschaftlich und experimentell hingegeben. Dabei riskiert/e sie ihre Subjektivität als Forscherin. Mit Knorr-Cetina beschreibe ich diesen Prozess folgendermaßen:
„Will man (eine Person) über den Rand eines Erfahrungsraumes hinwegblicken, so muß man (diese) sich an dessen Rand bewegen“ (Knorr-Cetina 1988, S. 95 nach Muckel 1996, S. 63 in Breuer: Qualitative Psychologie – Klammeranmerkungen von CM).
Damit macht die Autorin das, was seit Devereux’s Standardwerk zur Angst von Forscher*innen erwartet werden könnte, sichtbar: Die Person der Forschung! Nicole Pankoke gibt der „Perfektionierung der Vogelperspektive“ (ebd. S. 64) eine klare Absage und zeigt ihre persönlichen Erfahrungen in Hinblick auf die Forschungsfragestellung: „Das kann unangenehm, bedrohlich und beschwerlich sein“ (ebd. S. 73). Die hiesige Forscherin hat diese Mühen nicht gescheut, und ihr Werk spiegelt eine kreative „Emergenz von Problemlösungen“ und „Kunstfertigkeit“ wider, die beispielhaft in der dargelegten Transparenz liegt.
Wir wünschen diesem Buch nicht nur phänomenologisch geneigte Leser*innen!
Für die Herausgeberinnen,
Cornelia Muth, Bielefeld, im April 2020
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I Die unvermeidliche Mitgestaltung von Wirklichkeiten
II Ziel: der Erkenntnisprozess soll nicht im Schreibprozess aufgeben werden
III Struktur der vorliegenden Arbeit
Teil 1 Eine dialog-phänomenologische Forschungsmethod(ologi)e
1.1 Gestaltansatz als eine ganzheitliche Art des Fühlens, Denkens und Handelns
1.1.1 Wie Gestalten entstehen
1.1.2 Kontaktaufnahme und Abgrenzung als eine Aufgabe des Organismus
1.1.3 Die Gestalt als Teil eines Ganzen: das Phänomen brüchiger Gestalten
1.1.4 Auswahl für mein Vorgehen: Gewahrsein, ein Zugang zu unserem Erleben
1.2 Phänomenologie, die Lehre von den Erscheinungen
1.2.1 Was bedeutet „phänomenologisch erkennen“?
1.2.2 Husserls Phänomenologie: Epoché, die Kunst der Zurückhaltung
1.2.3 Merleau-Pontys Leibphänomenologie: ausgehend von Husserls Lebenswelt
1.2.4 Auswahl für mein Vorgehen: Eine Haltung des erkennenden Denkens
1.3 Was ist Haltung?
1.4 Das dialogische Prinzip als Lebenspraxis
1.4.1 Die Welt ist dem Menschen zwiefältig: Das Wortpaar ICH-DU und ICH-ES
1.4.2 Der Raum ist voll von Scheingestalten
1.4.3 Der radikale Respekt der Anderheit
1.4.4 Situationsgerecht zu Handeln als ein Prinzip
1.4.5 Auswahl für mein Vorgehen: Eine dialogische Haltung für meine Forschungsgespräche
1.5 Zusammenführung der drei Ansätze
1.5.1 Datenerhebung: Das Gespräch und Haltung des dialogischen Prinzips
1.5.2 Datenauswahl: Gewahrseinsübung/– protokolle
1.5.3 Datenauswertung: Phänomenologie der Erfahrung und Bewusstseinserweiterung
1.5.4 Der zirkuläre Charakter des Forschungsprozesses
1.5.5 Gewahrseinsübung und –protokolle als Instrumente dialog- phänomenologischer Forschung
1.5.6 Die Werkstatt
Teil 2 Im Gespräch mit den Forscher*innen
2.1 Kriterien für das Sampling
2.1.1 Vorstellung meiner Gesprächspartner*innen
2.2 Umsetzung der Method(ologi)e und Ablauf der Forschungsgespräche
2.2.1 Phase 1: Der Beginn einer langen, intensiven Zeit: Sechs Erhebungsgespräche und die Gewahrseinsübungen als Ritual
2.2.2 Phase 2: Auswertungsphase, Versuchscharakter, Annäherung an die Themen
2.2.3 Phase 3: Werkstattbeteiligte, Rückbezüglichkeit und das Abschlussgespräch
2.2.4 Phase 4: Zurückgeworfen auf mich, jetzt gehe ich die letzten Schritte alleine, lasse mich leiten vom Material
2.3 Auswertung: Der Umgang mit gesprochenen Wirklichkeiten
2.3.1 Durch welche Linse schauen Forscher*innen beim Erheben und Auswerten (Teil 1)
2.3.2 Gewahrwerdung von Scham (Teil 2)
2.3.3 Was ist Reflexion, wenn nicht Selbsterkenntnis? (Teil 3)
2.4 Extraktion: Die Phänomene Scham und Schutz
2.5 Mein Werden in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen Schutz
Teil 3 Analyse meines Forschungsprozesses: Was passiert hier eigentlich?
Schluss: Kann das Unsagbare sagbar werden?
Anhang
Transkriptionsregeln
Literaturverzeichnis
Einleitung
Ziel von sozialwissenschaftlicher, qualitativer Forschung ist es, „von innen heraus“ (Flick/von Kardorff/Steinke 2010: 16) Lebenswelten zu beschreiben, also aus der Perspektive der an der Forschung Beteiligten. So wird versucht, mit Hilfe qualitativer Forschung ein Verständnis von sozialen Wirklichkeiten zu zeichnen. Die Mittel dazu sind häufig Abläufe zu beobachten, soziale Muster zu erkennen und zu deuten, sowie Strukturmerkmale herauszuarbeiten. In den letzten Jahren hat sich das Feld der qualitativen Forschung zu einer unübersichtlichen Menge von vielfältigen Methodologien und Methoden entwickelt:
„Research has never before had so many paradigms, strategies of inquiry, and methods of analysis to draw upon and utilize“ (Denzin und Lincoln 2003: 28).
Durch die vielen unterschiedlichen Paradigmen zeichnet sich kein Konsens darüber ab, welche dieser unterschiedlichsten Methoden als qualitative Forschung gelten. Im Gegenteil: Es werden harte Kämpfe darüber geführt, welchen Ansätzen gefolgt werden soll. Dass dieses Feld hart umkämpft und diskutiert ist, ist für den wissenschaftlichen Diskurs wesentlich. Denn durch den Kampf können Forderungen nach einfacher „anwendungsbezogener Nützlichkeit, evidenzbasierter Konzeption, nach einfacher Operationalisierung und Erlernbarkeit von Forschung sowie nach zeitnaher Resultatsproduktion“ (Schwerde/Langer/Kühner 2013: 7f.) kritisch1 reflektiert und debattiert werden. Indem aktive Forscher*innen2 solche Diskurse führen und sich positionieren, werden sie angehalten, ihrer eigenen wissenschaftlichen, forschenden Haltung, also ihremForschungsethos3 zu begegnen, diesen bewusst wahrzunehmen und ihm gerecht zu werden (vgl. ebd.). Doch was bedeutet es, seinem eigenen Forschungsethos zu begegnen und ihm gerecht zu werden?
Diese Frage markiert einen Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit. Für mich ist es für einen qualitativen Forschungsethos wesentlich, dass die Wissensproduktion machtsensibel und verantwortungsvoll gegenüber den Beteiligten geschieht. Doch mir scheint – und das werde ich im nächsten Abschnitt ausführlich begründen, dass jede festgelegte Methode an der einen oder anderen Stelle notwendigerweise gegen diese forschungsethischen Forderungen verstößt. Deswegen möchte ich ein qualitatives Forschungsparadigma entwickeln, das auf die in konkreten Situationen auftretenden Schwierigkeiten reagiert.
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es von Anfang an die Offenheit geplante Schritte umzugestalten und so an die im Konkreten gegebenen Verhältnisse anzupassen. Somit bleibt bis zum Schluss eine Ungewissheit, wie genau das entwickelte Paradigma dieser Forschung sein wird und ob diese Forschung vollendet werden kann.
Klar ist, dass keine feste Methode im Sinne einer engen Schrittfolge dieses Ziel erreichen kann, sondern lediglich eine gewisse Forschungshaltung und Method(ologi)e4 im Sinne des griechischen methodología (μεθοδολογία), was soviel heißt wie “Lehre über die Vorgehensweise“ oder des englischen „approach“ als „Annäherungsweg“ oder „Zugangsweg“, die einen Weg zu den aufkommenden Problemstellungen aufzeigen (vgl. Danner 2006: 11). Die dafür grundlegende Feststellung – durch mein Studium – ist, dass Subjekte jede Form von Forschung durchführen. Dabei ist zu beobachten, dass umso weniger Forscher*innen sich dieses Subjektsein innerhalb von Forschung zugestehen bzw. vermeiden wollen, desto mehr findet eine Methodenfixierung statt, die ein Ausklammern kritischer Anwendung und Reaktionsmöglichkeiten auf Unstimmigkeiten bedingt.
In der vorliegenden Arbeit stelle ich deshalb das Subjekt in den Mittelpunkt, indem ich mich sowohl empirisch als auch theoretisch auf die Suche nach einer Forschungshaltung begebe, die eine kritische Anwendung und Reaktionsmöglichkeiten auf Unstimmigkeiten ermöglicht. So versuche ich dem Ziel einer machtsensiblen und verantwortungsvollen Wissensproduktion näher zu kommen. Auf der einen Seite steht für mich die Beschäftigung mit theoretischen Ansätzen und allgemeinen Method(ologi)en, die die Subjektivität der Forscher*in in den Vordergrund rücken. Auf der anderen Seite möchte ich im Feld, also mit erfahrenen Forscher*innen über die qualitative Forschung selbst lernen und meine Ideen immer wieder neu hinterfragen. Dabei entsteht ein selbstkonsistentes Vorgehen, bei dem Method(ologie)entwicklung und Method(ologi)edurchführung ineinander greifen und Hand in Hand fortschreiten. So entwickelt sich die Methodologie während des gesamten Forschungsprozesses unter Einbeziehung der Erfahrungen aus ihrer eigenen Anwendung in Gesprächen und Auswertungen weiter, bis sich eine konsistente und bewährte Vorgehensweise ergibt. Mit meiner spiralförmigen Herangehensweise versuche ich, mich drei problematischen Prinzipien quantitativer/qualitativer Forschung zu widersetzen. Das erste Prinzip ist das Ausklammern von Forscher*innensubjektivität, das zweite liegt in der Tendenz zur Methodenfixierung und das dritte Prinzip liegt in der Veröffentlichung formvollendeter Beiträge.
Im Sinne der Grundelemente eines Forschungsethos sollen folgende Kriterien bei der Auswahl theoretischer und empirischer Ansätze als gemeinsame Basis der Forschungsmethod(ologi)e erfüllt werden.
Keiner der Ansätze soll lediglich als Methode verstanden werden, sondern als ein handlungsorientierter Denkstil, der sich in einem bestimmten Haltungsverständnis zeigt. Dadurch soll der Mensch in der Forscher*innen-Rolle zumNachdenken5, Handeln und Fühlen gebracht werden und seine*ihre Schritte sinnhaft begründen können.
Forscher*innen sind keine unabhängigen, neutralen Betrachter*innen und sind somit genauso viel am Prozess beteiligt. So müssen sich Forscher*innen selbst mit in diesen Prozess einbeziehen, ebenso wie dieForschungsbeteiligten. Damit widersetzen sie sich auch der Utopie von „Objektivität“.
Alle Ansätze sollen einen bewussten Umgangen mit subjektiver Lebenswelt haben und sich mit den Fragen beschäftigen, was es bedeutet, in den Kontakt zu gehen, sich auf das Gegenüberliegende einzulassen, einen Prozess selbst zu durchleben und das Durchlebte erfassen zu können. So soll eine gewisse Grundhaltung und ein Verständnis von subjektivem Wahrnehmen, Kontakt und Beziehung vorliegen. Auch sollen alle Ansätze sich mit den Grenzen von Erkennen und Bewusstsein auseinandersetzen. Denn sowohl Erkennen als auch Bewusstsein sind durch den Leib begrenzt.
Alle Ansätze sollen als Aufbruch des dualistischen Denkens/Wissenschaftsverständnis und einer hermeneutischer Denkstruktur verstanden werden.
Zunächst sind die Fragen zu klären, ob Forscher*innen Phänomene so beobachten und beschreiben können, dass ein Umgang mit pluralistischen Wirklichkeiten sowie den dabei entstehenden Empfindungen möglich ist. Wenn Forscher*innen mithilfe von Methoden zum Erkenntnisgewinn kommen, welche Rolle spielen dann Forscher*innen und die an der Forschung Beteiligten selbst? Inwieweit brauchen Forscher*innen Beziehung bzw. Kontakt zu den Beteiligten, die den Forscher*innen zum Erkennen verhelfen? Welche ethischen Grenzen sind in dem Forschungsprojekt zu beachten, egal welche Neugierde und welches Erkenntnisinteresse vorliegt. Schlussendlich bleibt es eine zentrale Frage dieser Arbeit, ob es überhaupt eine Vorgehensweise oder Method(ologi)e geben kann, die eine solche Forschungshaltung ermöglicht, so dass heroische Forschungspositionen vermieden, Grenzen von Erkennen akzeptiert und diese in ihrer Bescheidenheit transparent dargelegt werden können.
Entsprechend der aufgeführten Fragen und Kriterien wähle ich drei theoretische Ansätze aus der Phänomenologie, Dialogphilosophie und dem Gestaltansatz für mein Forschungsprojekt aus. Der erste Ansatz ist die Leibphänomenologie von Maurice Merleau-Ponty (1966) sowie die Wahrnehmungsphänomenologie von Edmund Husserl (1913), die als eine Erkenntnistheorie zu verstehen ist, im Sinne einer Theorie die zum Erkennen führt. Die Dialogphilosophie von Martin Buber (1923), die eine Lebenspraxis ist, soll es mir ermöglichen, eine dialogische Haltung einzunehmen, die eine besondere Form von Forschungsgesprächen ermöglicht und für unterschiedliche Qualitäten des Kontaktes sensibilisiert. Der dritte Ansatz ist der Gestaltansatz von Reinhard Fuhr und Martina Gremmler-Fuhr (1995), den ich vor allem als methodisches Hilfsmittel in der Konfrontation mit dem Erkennen selbst, sowie als Hilfsmittel im Umgang mit schwierigen Forschungsphasen, Erkenntnisprozessen und der Verstrickung aller Beteiligten anwende. Unter Verwendung dieser drei Ansätze werde ich den Versuch wagen, eine dialog-phänomenologische Method(ologi)e zu entwickeln6.
MeineErfahrungals Forscher*in wird im Forschungsfeld selbst zum method(ologisch)en Gegenstand. Diese Erfahrung soll sich auf meine Bewusstseins (-erweiterung/-grenzen) beziehen. Vom ersten Gedanken, solch eine Forschung durchzuführen, bis zum letzten Satz dieser Arbeit, geht es mir um die kritische Auseinandersetzung mit meiner eigenen wissenschaftlichen und forschenden Haltung sowie darum, meinen eigenen Forschungsethos wahrzunehmen und diesem zu begegnen. Die letztendliche Auswahl meiner dialog-phänomenologischen Method(ologi)e wird durch ein inneres Leitbild bestimmt, denn durch das ständige Suchen nach einer sinnhaften Forschungsdurchführung, einem Vergleichen, Abwägen und Positionieren der unterschiedlichen Forschungsverfahren, können meine Forschungshaltung und ethische Ansprüche sichtbar werden. So wird meine Forschungshaltung leitend für diesen erfahrenden selbstkonsistenten Entwurf, den ich in Form eines spiralförmigen Prozesses niederschreibe.
Grundsätzlich dient die Einleitung – die hier aus drei Teilen besteht – dazu, meine Beweggründe darzustellen, warum ich versuche eine Method(ologi)e zu entwickeln, zu praktizieren und diesen erfahrenden selbstkonsistenten Entwurf in Form eines spiralförmigen Prozesses darzustellen.
So werde ich im ersten Teil der Einleitung (I) problematische Aspekte von qualitativen Forschungsmethoden aufführen. Die Auseinandersetzung damit impliziert generelle Fragen wie welche Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen sozialwissenschaftlicher Forschung überhaupt möglich sind. Dieser Abschnitt dient letztendlich dazu, dass ich Ihnen als lesende Person meine subjektive Perspektive in Bezug auf empirische Forschung greifbarer machen möchte. Nach dem ersten Eindruck und skizzenhafter Darstellung problematischer Aspekte empirischer Forschung spitzt sich dann im zweiten Abschnitt (II) alles auf ein Problem zu, das sich in der Veröffentlichung bzw. dem Repräsentieren von Forschungsbeiträgen aufzeigen lässt. Durch eine kritische Darstellung von formvollendeten Beiträgen begründe ich zugleich, warum es mir so wichtig ist, diese Arbeit in ihrem derzeitigen Zustand abzubilden, ohne bewusst brüchige Stellen, ungeklärte Fragen und unvollendete und nicht funktionierende Gedankengänge auszuklammern. So werden im II Teil Motivation und Ziel dieser Arbeit begründet, sowie der Versuchscharakter und die Wichtigkeit von Verstehensprozesse und Unwissenheit thematisiert. Die Einleitung schließt dann mit dem dritten Abschnitt (III), in dem ich die eigentliche Arbeit vorstellen werde.
Sollte Ihnen als Leser*in Gefühle der Unklarheit, Unvollendung von „wo dieser Weg meiner Forschung hingehen wird“ aufkommen, dann transportiert die Einleitung das, was mein Ausgangspunkt bzw. mein ständiges Zurückgeworfensein auf mich gewesen ist.
I Die unvermeidliche Mitgestaltung von Wirklichkeiten
Die zu beschreibenden Problematiken, die durch den Umgang von Forscher*innensubjektivität und Methodenfixierungen entstehen, werden anhand von Interviews, Bilden von Lesarten und an Regieanweisungen für das Verhalten der Forscher*innen dargestellt. Mir ist bewusst, dass ich diese Darlegung nur skizzenhaft und unvollständig leiste. Auch unterstelle ich in der Darlegung nicht, dass die einzelnen Aspekten nicht schon bekannt sind. Denn wie schon beschrieben, dient der kurze Umriss dazu auszuprobieren, kritische Aspekte empirischer Forschung zu formulieren. Meinen Standpunkt transparent zu machen, kann als mein Grundstein der Arbeit gesehen werden.
Es erscheint mir wichtig zu betonen, dass meine kritische Darstellung nicht in folgendem Sinne ausgelegt werden soll: Das Ziel von Forschung sollte sein, das Subjektsein der Forscher*innen auszuklammern. Im Gegenteil: die folgende Darstellung wird u.a. zeigen, dass ein Thematisieren und ein verantwortungsvoller Umgang mit dem subjektiven Betrachten, Erfassen und Repräsentieren notwendig ist. Forscher*innen die als Ziel haben, Subjektivität in Forschungsprozessen zu überwinden und eine vermeintliche „Objektivität“ ihrer Forschung unterstellen, laufen meines Erachtens einem Trugschluss hinterher. Denn jede Forschung, auch quantitative Forschung, ist mit der menschlichen Subjektivität konfrontiert. Jedes Erstellen von Fragebögen, jeder Aufruf zur Teilnahme an Studien und jeder menschliche Kontakt lässt Sprache und Leiblichkeit von Forscher*innen sichtbar werden, die wiederum Wirkungen auf die Teilnehmenden haben. Jede anzuwendende Methode wurde irgendwann vom Menschen erschaffen und jede Anwendung, Programmierung und Messung bleibt eine menschliche Tätigkeit.
„Warum ist es so schwer, möglichst präzise und für andere nachvollziehbar ‚von uns selbst‘ – von unseren Vorannahmen und Wahlen, von unserem Erleben und Handeln im Forschungsprozess – zu sprechen? Es ist so schwer, weil die Forderung nach dem Ausschluss der Subjektivität der Forschenden einer der zentralen Imperative der wissenschaftlichen Neuzeit ist, der sich durch Wissenschaftstheorien in die methodische Praxis der Einzeldisziplinen, in wissenschaftspolitische Steuerungs- und Sanktionsprozeduren und schließlich auch in unsere Köpfe, Herzen und Körper durchzusetzen vermocht hat.“ (Mruck und Breuer 2003).
So werde ich im Folgenden Fragen und Hinterfragungen aufführen, die den Umgang mit Subjektivität, der Transparenz von Subjektivität und dem Eingestehen des eigenen Forscher*innendaseins in Forschungskontexten beleuchten werden.
Beginnen möchte ich mit dem Bilden von Lesarten als Methode. Gegenstand der Betrachtung wird der Stellenwert der Erfahrungswelt der Forscher*innen sein. Das Bilden von Lesarten ist zentraler Bestandteil des Verfahrens der objektiven Hermeneutik von Ulrich Oevermann (1979). Dieses Verfahren hat zum Ziel die latenten Sinnstruktur (unbewussten Sinn) zu erfassen (vgl. Oevermann 2013: 79). Um die latente Sinnstruktur zu erfassen, wird der Fokus auf der gesprochenen Struktur der Teilnehmenden gelegt (vgl. Oevermann 2013: 73–75). Oevermanns Verfahren geht davon aus, dass ein Herausbilden latenter Sinnstrukturen notwendig dafür ist, um Zugriff auf subjektive Erfahrungswelten zu erlangen (vgl. Depraz 2012: 79). Dabei wird von einer logischen und hermeneutischen Kohärenz ausgegangen, die innerhalb des Verfahrens sichergestellt werden soll (vgl. ebd 11). Zu beachten ist, dass solch eine Kohärenz impliziert, dass der Sinn im Material liegt und unabhängig von der Lebenswelt der jeweiligen Forscher*innen herausgearbeitet werden kann.
Doch wie beeinflussen der sozial geprägte Blick der Forschenden die zu bildenden Lesarten? Denn der Blick ist durch historische und soziale Bedingungen gegeben (vgl. Hametner 2013: 139). Wie sollen Forscher*innen eine latente Sinnstruktur erfassen, die unabhängig von der eigenen Lebenswelt gebildet wird? Ist die Pluralität von Lesarten nicht begrenzt durch jede einzelne Erfahrungswelt der Forschenden? Welche Forscher*innen sprechen über das Sprechen der Subjekte? Welche Relevanz spielen die latenten Sinnstrukturen der Forschenden in der Auswertung und wie kann ein verantwortungsvoller Umgang mit Machtverhältnissen und Subjektpositionen von Forscher*innen gefunden werden?
Eine zentrale Bedeutung in diesen Fragen haben die Phänomene der „Deutungsmacht“ und des „hegemonialen Zuhörens“. Denn was am Ende bei der Forschenden ankommt, ist in einen Zusammenhang zu bringen, mit dem was gehört und dem was überhört wird. Auch wenn Gehörtes Lücken und Brüche aufweist und diese von den Forschenden vollendet bzw. in ihrem zu verstehenden Sinn verändert werden, wird von hegemonialem Zuhören gesprochen (vgl. Spivak 2008: 60). Wie kann in Forschungsbeiträgen sichtbar werden, dass jedes gesprochene Wort in Verbindung zu etwas Gesprochenem und Gehörtem steht?
Denn jedes Nachdenken, jedes Im-Denken-Orientieren, zeigt „daß das Denken selbst schon Achsen und Orientierungen voraussetzt, denen gemäß es sich entwickelt, daß es über Geographie verfügt, noch bevor es Systeme entwirft.“ (Deleuze 1993: 162)
Also kann auch keine Forscher*in dieser zur Verfügung stehenden Geographie entkommen. Jede Auswahl von Lesarten impliziert, dass gewisse Lesarten hinzugezogen und andere ausgeklammert werden.
Durch diese kurze Hinterfragung möchte ich zeigen, wie schwierig es ist, eine latente Sinnstruktur zu erfassen, die unabhängig von der Forscher*innensubjektivität gesehen werden kann. Denn beim Herausarbeiten des latenten Sinnes spielt immer auch die Leiblichkeit der Forscher*innen eine Rolle. Dadurch zeigt sich in der Herausarbeitung immer auch die erfahrene Welt der Forscher*in zu einem bestimmten Grad. Phänomenologisch gesprochen, sind wir immer bezogen auf die Welt. Alles was mir erscheint, erscheint mir als etwas und somit gibt es keinen objektiven Tatbestand, sondern alles erfahre ich als etwas gehörtes, gelesenes, gespürtes und/oder gedachtes (vgl. Stieve 2015: 38). Schließlich ist jede „Wissenschaft [.] nicht Abbildmalerei oder Fotografieren der Wirklichkeit, sondern (Mit-)Gestalte[n] der Wirklichkeit“ (Matt-Windel 2014a: 121 (Klammerangaben NP)).
Das (Mit-)Gestalten von Wirklichkeit ist eine wechselseitige Tätigkeit und beginnt nicht erst in der Auswertung, sondern sobald ich an einen Gegenstand denke, ver-halte ich mich zu diesem Gegenstand. Der Begriff „Interview“ ist ein hervorragendes Exempel dafür, inwiefern allein der Gedanke an ein Interview Vorstellung und Erwartung bei den Beteiligten und Forscher*innen hervorruft. Im Folgenden werde ich jeweils eine mögliche Wirkungskette von den Forscher*innen und den Beteiligten durchexerzieren. Dadurch soll deutlich werden, dass: „ein Interview [.] nicht lediglich als Geben bzw. Gewinnen themenbezogener Auskünfte anzusehen [ist], sondern als – umfängliche – soziale Interaktion“ (Breuer 2010: 63(Klammerangaben NP)).
Vor dem Auge des Beteiligten zeigen sich bei dem Begriff „Interview“ Bilder von prominenten Menschen oder Expert*innen, die eine bestimmte Expertise haben oder von dem adressierten Publikum gehört werden wollen. Die Wirkung, die diese Assoziationen auf die zu erhebende Interviewsituation haben könnten, sind z.B. dass die Beteiligten einen Erzähldruck im Interview verspüren, da sie etwas Besonderes erzählen wollen. Auch können diese Bilder ein Gefühl hervorrufen, dass sie nichts Bedeutendes zu erzählen haben, was wiederum dazu führen kann, dass die Beteiligten sich die ganze Zeit auf einer Vogelperspektive beobachten und versuchen werden, bewusst Entscheidungen zu treffen, was und wie sie etwas erzählen wollen. Auf Seiten der Forschenden werden bei dem Begriff „Interview“ Bilder einer „heroischen“ Forscher*in hervorgerufen, die in Verbindung mit heldenhaften „Idealen“ einer*eines „objektiven“ Wissenschaftler*in*s gebracht werden – der*die Wissenschaftler*in, der über den Dingen steht und letztendlich erklären kann, wie die Welt zu sehen und verstehen ist. Konkret könnte sich das in der zu erhebenden Situation wie folgt zeigen: Die Forscher*innen nehmen eine distanzierte, zurückhaltende und wissende Position im Interview ein (vgl. Breuer 2010: 63).
An dieser Stelle kann durch die beispielhaften Wirkungsketten festgehalten werden, dass Vorstellungen und Erwartungen, wie ich im Interview gesehen werden will oder was von mir erwartet wird, eine nicht außer Acht zulassende Rolle spielen. Diese Bilder schwingen schon beim Erstellen und somit vor dem Durchführen von Interviews mit. Welche Fragen möchte ich stellen und wie antworte ich auf das Gesprochene? Das Mitgestalten kann als Ko-konstruktion von Wirklichkeiten beschrieben werden und zeigt sich als eine wechselseitige Interaktion. Abschließend konnte mit Hilfe Breuers beispielhafter Wirkungsketten gezeigt werden, dass allein durch den Gedanken an ein zu führendes „Interview“ offene, intensive und empathische „Gespräche“ mit flexiblen Verlaufskurven schwer zu erreichen sind (vgl. ebd.).
Das zeigt, dass die Idee, Momente des Dialogs in den Erhebungsgesprächen entstehen zu lassen, sehr schwierig zu erreichen sein wird. Allein dass ein Interview als Mittel für Erkenntnisse genutzt wird und dass das Ziel solcher Erhebungsformen ist, dass das Gesprochene verwertet wird, widerspricht dem dialogischen Prinzip:
„Ich habe keine Prinzipien. Es gibt Dinge, die wir tun müssen – hier und jetzt. Ich habe keine Prinzipien, nur einen Orientierungssinn und handle je nach der gegebenen Sachlage. […] Ein Prinzip ist etwas, das dich zwingt, immer auf eine vorgeschriebene Weise zu handeln. […] jede Situation muß von neuem betrachtet werden. […] Halte deine Augen offen- daß ist alles, was ich dir zu sagen habe, denn ich kann dir kein Prinzip nennen“ (Buber in Muth 2011: 7 f.).
Das bedeutet, um dialogische Momente in Erhebungsgesprächen zu ermöglichen, braucht es ein Gespräch, das sich im konkreten Kontakt entwickelt. Die Beteiligten und Forscher*innen müssen sich gegenwärtig hinwenden und einlassen. Um einander zuzuhören, um zu antworten und um eine gemeinsame Sinnsetzung der jeweiligen Situation mitsprechen zu lassen, braucht es den Dialog. Die Idee ein solches Gespräch in einer Erhebung anzustreben, hebt sich von vorhandenen Interviewmethoden ab. Denn oft bestimmen genaue Prinzipien den Ablauf eines Interviews, wie die jeweiligen Gesprächsanteile verteilt sind, wie und wann welche Fragentypen gestellt werden.
So wird es im letzten, dritten Aspekt um eine kritische Auseinandersetzung mit vorgeschriebenen Prinzipien innerhalb der Gruppendiskussion nach Bohnsack (2013) und dem Narrativen Interview nach Fritz Schütze (1983) gehen. Für die Betrachtung eignen sich beide Verfahren, da sie eine genaue Vorstellung vermitteln, wie Forscher*innen sich in der Erhebungssituation zu verhalten haben. Gegenstände bei der Betrachtung sind erstens die Forderung nach Distanznahme und zweitens die Gestaltung einer offenen Gesprächsatmosphäre, die Teil beider Methoden sind. Die folgende Betrachtung wird aufzeigen, welche Utopien, Gefahren und Grenzverletzungen aufgrund von exakten Regieanweisungen in Interviews entstehen können. Die Gegenstandbetrachtung einer offenen Gesprächsatmosphäre wird die schwierigste aller bisherigen Betrachtungen für mich sein. Denn das Streben nach einer solchen Gesprächsatmosphäre erfordert von der Forscher*in, Beteiligten auf eine Art und Weise zuzuhören, die auf eine Art und Weise Raum entstehen lässt, die dem dialogischen Prinzip nah kommt. Gerade aufgrund der Ähnlichkeit zwischen narrativem Interview und dialogischem Prinzip, sehe ich die Notwendigkeit, die Forderung eine offene Gesprächsatmosphäre in Interviews herzustellen, kritisch zu betrachten.
Es ist nicht von mir vorgesehen und würde auch den Rahmen der Einleitung sprengen, auf Ähnlichkeiten und Abgrenzung des dialogischen Prinzips zum narrativen Interview näher einzugehen. Mehr soll Ihnen als Leser*in bewusst werden, dass es mir um einen verantwortungsvollen Umgang geht, der sich darin ausdrückt, die Balance zu halten zwischen wissenschaftlicher und reflexiver Selbstaufklärung. Das herausfordernde ist, dass die Grenzen dabei fließend sind (vgl. Muth/Nauerth 2010: 28). André Green weist darauf hin, dass die Kunst darin liegt, „zwischen hinreichender Selbstbehauptung, ohne die Bindung zum Erkenntnisobjekt zu beeinträchtigen, und befristeter Fürsorge für die Anderheit, die ein mittel- und langfristiges Loslassen verlangt“ (2001: 372) . Wie dieses möglich ist, bleibt zu diesem Zeitpunkt wage und wird erst in der konkreten Darlegung der Arbeit sichtbar.
Als Forscher*innen selbst keine Position zu beziehen und im besten Fall auch keine Äußerungen gegenüber den Beteiligten zu tätigen sind u.a. Aufforderungen des Narrativen Interviews nach Fritz Schütze (1983) und derGruppendiskussion nach Bohnsack (2013). Bei beiden Verfahren werden erst im letzten Drittel der Erhebung immanente und anschließend exmanente Fragen gestellt (vgl. Bohnsack 2010: 380f.; Hopf 2010: 349-358). Die darin enthaltende Forderung nach Zurückhaltung der Forscher*innen, verfolgt das Ziel, dass die Beteiligten möglichst „unvoreingenommen“ und „frei“ erzählen können. Impliziert wird in diesem Ziel, dass die Forscher*innen sich der Interaktionsdynamik entziehen können (vgl. Hopf 2010: 352). Um dieses Ziel so gut wie möglich zu verfolgen, wird dazu geraten, vorab das genaue Thema der Forschung nicht zu nennen (vgl. Rosenthal und Loch 2002: 2). Bohnsack betitelt das als „demonstrative Vagheit“ (vgl. Bohnsack 2010: 381). Zu hinterfragen ist, ob Beeinflussung der Beteiligten hin oder her, den Beteiligten nicht zusteht, vorab zu wissen, welches (Erkenntnis)-interesse die Forscher*innen mitbringen? Denn eine genaue Aufklärung über das Forschungsvorhaben ist eine ethische Regel (vgl. von Unger 2014: 25ff.), die durch die demonstrative Vagheit meines Erachtens nur bedingt erfüllt wird. Durch solche Versuche – selbst keine Aussagen zu tätigen, Positionen zu beziehen oder keine Suggestivfragen zu stellen (vgl Hermanns 2010: 367; Hopf 2010: 359) – wird einer Utopie des „objektiven Forschens“ hinterhergelaufen. So wird durch eine gesetzte Norm der Distanzierung der Trugschluss aufrecht gehalten, dass Forscher*innen sich dem Feld durch genaue „Regieanweisungen“ (Hermanns 2010) enthalten können bzw. ihre Subjektivität im Feld kontrollierbar sei. Ich verweise auf die schon oben beschriebene Gegebenheit, dass Forscher*innen immer Teil einer sozialen Wirklichkeit, somit auch Teil einer konkreten Interviewsituation sind. Leiblichkeit und Lebenswelt können von niemandem im Interview ausgeklammert werden. Der Mensch ist immer schon vor der Bezugnahme auf Welt bezogen (vgl. Merleau-Ponty 1966: 492). Nach Arendt entsteht Welt zwischen den Menschen (vgl. 2000: 116). Das bedeutet so viel wie: zwischen den Menschen entstehen soziale Welten und diese Welt zeigt sich nur durch wechselseitige dialogische Bezugnahme aufeinander.
Das Forscher*innen sich an Methoden festhalten um ihr Subjektsein in Forschungsprozessen auszuklammern und zu kontrollieren versuchen, kritisiert schon Georges Devereux (vgl. 1967: 18). Er warnt ausdrücklich vor einer Methodenfixierung. Denn kein Fixieren an Methoden hilft den Forscher*innen dabei, Verstrickungen ihrer selbst im Datenmaterial abwehren zu können.
Eine Möglichkeit, diese Methodenfixierung teilweise zu umgehen, ist die Forderung einer offenen Gesprächsatmosphäre. Die Idee hinter dieser Forderung kann wie folgt beschrieben werden: Forscher*innen müssen in der Situation auf die Beteiligten gegenwärtig reagieren. Demnach müssen in der Situation Entscheidungen getroffen werden, die nicht vorab durch Methoden vorstrukturiert werden können, um eine offene Gesprächsatmosphäre in Erhebungssituation aufrecht zu erhalten. Im narrativen Interview (Fritz Schütze) spiegelt sich diese Forderung schon im Element der Eingangsfrage wider, die so gestaltet wird, dass die Beteiligten eine umfassende und detailreiche Stegreiferzählung persönlicher Erlebnisse erzählen. Ziel des „freien“ Erzählens erlebter Ereignisse ist es, subjektive Bedeutungsstrukturen herauszuarbeiten. Das Charakteristikum von narrativen Interviews ist, dass die Forscher*innen sich in ein aktives Zuhören begeben, ohne zu unterbrechen (vgl. Rosenthal und Loch 2002: 1).
Im Folgenden werde ich weniger zeigen, dass das Element eine offene Gesprächsatmosphäre zu gestalten, die Gefahr verringert, sich an Methoden zu fixieren. Vielmehr geht es darum, dass das Element der offenen Gesprächsatmosphäre nicht unproblematisch als Regieanweisung verfolgt und unkritisch angewendet werden darf. Meine Kritik setzt daran an, dass die besondere Form die Beteiligten ins narrative Erzählen zu leiten, Gesprächsettings wie Beratungs- und Therapiegesprächen ähnelt. So äußert sich mein Unbehagen insofern, dass die Beteiligten in ein Erzählen geleitet werden, das sie in die Tiefe ihrer persönlichen Erlebnisse führt (vgl. Hornung 2011; Rosenthal und Loch 2002: 1). Zu beachten ist allerdings, dass es ein großer Unterschied ist, ob Menschen im Interview oder im psychoanalytischen Gespräch auf biografische Erinnerungen zurückgreifen. Denn erstens haben Forscher*innen in der Regel selten eine entsprechende Ausbildung, um die Beteiligten bei aufkommenden schwierigen Erinnerungen ausreichend zu unterstützen und des Weiteren wird das Material der Beteiligten in Forschungsprojekten im Gegensatz zu therapeutischen Settings ausgewertet. Sprich zweitens, selbst wenn sie durch die Form des narrativen Interviews gewisse Sachverhalte erzählen, die sie der Forschung jedoch eigentlich nicht zur Verfügung stellen wollten, sie aber aufgrund der besonderen Stimmung, die in der Interviewsituation entstanden ist, erzählt haben, müssen Beteiligte nach dem Interview aktiv ihr Gesagtes zurückziehen. Abgesehen davon, dass es mir unmöglich zu sein scheint, Gesprochenes und möglicherweise sogar zu Papier Gebrachtes zurück zu nehmen, ist die Forderung Erzähltes zurückzunehmen mindestens eine schwierige Herausforderung. Denn strukturelle Machtverhältnisse zwischen Forscher*innen und Beteiligten sind gegeben. Außerdem wissen Beteiligte vielleicht selber nicht exakt, was und welche spezifische Passage es ist, die die möglicherweise unangenehmen Gefühle erzeugen. Dass die Beteiligten ihr Unbehagen nicht direkt zuordnen können, könnte auch mit dem dritten Punkt in Zusammenhang gebracht werden, nämlich, dass die Öffnung der Beteiligten eine einseitige Öffnung bleibt. Im Gegensatz zu den Forscher*innen die ein Teil der Innenwelt von den Beteiligten gesehen haben, wissen die Beteiligten weder etwas von den Forscher*innen persönlich, noch – beim Anwenden der demonstrativen Vagheit – das genaue Thema der Forschung. Alle drei Punkte können dazu führen, dass Gefühle nach der Erhebung entstehen, die ein Unbehagen hinterlassen.
Sollte einer der Punkte zutreffen, dann haben Beteiligte sich dazu verleiten lassen, über ihre Grenzen zu gehen, mehr zu erzählen, weiter zu gehen, als sie eigentlich wollten. Eine nachträglich aufkommende Scham ist ein Indiz dafür, dass die Beteiligten über ihre Grenzen gegangen sind (vgl. Fuhr, Gremmler-Fuhr 1995: 229).
„Scham hält mich davon ab, überall transparent sein zu wollen. Scham hält mich und meine Mitmenschen auf stimmige Distanz. Insofern ist Scham für mich ein gefühlsmäßiges Regelwerk in der Kommunikation unter Menschen.“ (vgl. Muth 2010: 126)
So bedeutet eine offene Gesprächsatmosphäre gestalten zu wollen auch, eine Sensibilität gegenüber den Wirkungen von narrativen Erzählstrukturen im Blick zu behalten, sowie vorhandene Machtverhältnis nicht außer Acht zulassen.
Mit der kurz umrissenen Kritik an Lesartbildungen, Interviewführungen und durch das Hinterfragen von Rollen und Auswirkungen des Forscher*innendaseins, wurde die Transparenz von Subjektivität und dem Eingestehen des eigenen Forscher*innendaseins beleuchtet und thematisiert. Abschließend kann festgehalten werden, dass der Umgang mit der Forscher*innensubjektivität verantwortungsvoll genommen und methodenfixierter Sozialforschung stets problematisch gesehen und stets im Diskurs gehalten werden muss. Durch die kritische Darlegung einzelner Aspekte kristallisiert sich mehr und mehr heraus, welche Ziele noch nicht zur Genüge erfüllt sind und welchen Anspruch ich mit der zu entwickelnden dialog-phänomenologischen Method(ologi)e verfolge. Diese Ziele sind, in der vorliegenden Arbeit Grenzen von Erkenntnissen transparent und Lernprozesse als intersubjektive zirkuläre Prozesse darzustellen, sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit aufkommenden Brüchen und Widersprüchlichkeit zu finden. Die Forschung verfolgt das Ziel eine Method(ologi)e zu erarbeiten, durchzuführen und kritisch zu analysieren. Auszuloten gilt, ob und wenn ja, wie eine verantwortungsvolle Haltung von Forscher*innen eingenommen werden kann, so dass der Anspruch nach einer machtsensiblen7