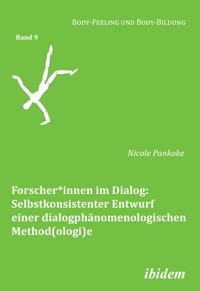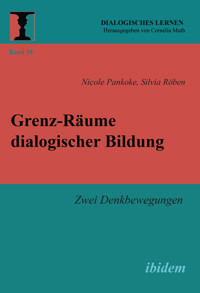
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Bildung
- Serie: Dialogisches Lernen
- Sprache: Deutsch
„Im Anfang ist die Beziehung: als Kategorie des Wesens, als Bereitschaft, fassende Form, Seelenmodel; das Apriori der Beziehung; das eingeborene Du." (Buber 1983, S. 27) Welche Haltung von PädagogInnen kann persongerechte Bildung wahrhaftig ermöglichen? Silvia Röben und Nicole Pankoke charakterisieren eine solche Haltung, indem sie sich anhand von subjektiven Theorien des Einzelnen mit den Prozessen pädagogischer Praxis auseinandersetzen. Martin Bubers Dialogphilosophie bildet das Fundament dieser Auseinandersetzung. Laut Buber ist die Grundfeste einer Lern- und Entwicklungsraum schaffenden pädagogischen Haltung die echte Beziehung. Macht darf in ihr keinen Raum finden, deswegen gilt es, gleichzeitig Grenzen zu wahren und sie auszuschöpfen. Nicole Pankoke stellt pädagogische Praxis als Beziehungsarbeit und als Bewusstseinserweiterung dar. Professionelles Handeln braucht sowohl Vertrauen und das echte Gespräch als auch die Grenzanerkennung, -bildung und -veränderung. Pankoke setzt sich mit dem Aushalten von Dualismen, Polaritäten und dem Akzeptieren von Paradoxien innerhalb der Beziehungsarbeit auseinander. PädagogInnen brauchen nicht nur eine hohe Reflexionskompetenz, sondern vor allem den Mut, die Grenzen ihrer eigenen Erkenntnisse und Handlungen kritisch anzuerkennen. Hier liegt die Schnittstelle zu Silvia Röbens Ansatz. Sie verfolgt den Leitgedanken, diese jeder Person eigenen Grenzen wahrzunehmen und anzuerkennen – mit Blick sowohl auf die Person selbst als auch auf das in Beziehung tretende Gegenüber. Daraus folgt die Verantwortung des Einzelnen: Antworten auf das eigene (professionell pädagogische sowie persönliche) Handeln und Werden zu entwickeln. Es ist an der Zeit, sich darüber bewusst zu werden, wer wir sein wollen: Humankapital oder verantwortungsbewusst Gestaltende der Gegenwart. Ein Appell dieses Buchs besteht darin, dass PädagogInnen für sich selbst immer wieder Beziehungsräume brauchen, um sich ihren unbewussten Motiven zu stellen und so verantwortungsbewusst dialogisch handeln zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeberin
Der vorliegende Bandderibidem-ReiheDialogisches Lernenvereint zwei Studienunter dem Titel „Grenz-Räume dialogischer Bildung“.Die Autorinnen,Nicole Pankoke und Silvia Roeben, haben sich mit der Dialogphilosophie Martin Bubersintensivauseinandergesetzt,praktisch wie theoretisch.
Dabei sindsieeinenindividuellen Reflexionsweg gegangenund bringen sodie gegenwärtige Dialogikeinen Schritt weiter.Nicole Pankokezeigt phänomenologische Grenzen der an Bildungsprozessen beteiligten Subjekte auf.Silvia Roebenbeschäftigt sich mit der Frage,wie Menschen in einer neoliberalen Gesellschaft noch echte Persönlichkeitsbildung erfahren können.
Die entstandenen dialogischen Denkprozesse beweisen, wie wichtig es ist, an den zwischenmenschlichen Raum zu erinnern, der notwendig ist, um eigenständiges Urteilen als gesellschaftliche Subjekte zu erlangen. Dass dies kein einmaliger Prozess ist, machen beiden Autorinnen mit ihren dialogischen Positionen deutlich.
Cornelia Muth
Berlin,imMai2015
Teil1
Nicole Pankoke
ÜberBeziehungen und Grenzen beim pädagogischen Handeln
1.Einleitung
„Das Ich stellt sich selbst keine Fragen und damit sich selbst nicht in Frage, es hat in sich selbst kein Gegenüber,dasdas ständige weiter so behindern würde.“ (Arendt in Thümer- Rohr 2003, S.128)
Damit der MenschWerden[1]kann, braucht er ein Gegenüber. Für Martin Buber (1878-1965) ist es dieBegegnung, die auf die Menschen wirkt. Es ist wie die Nahrung, die wir zum (Über-)Leben brauchen, die uns eine Lebenskraft gibt und uns wachsen lässt. Dasbedeutet, dass für den Menschen auch die Qualität der Beziehung entscheidend ist.Begegnungeninnerhalb Beziehungen sind Wesensakte, die uns den Sinn des Lebens vermitteln. DerSinn kann allerdings nicht verallgemeinernd beschrieben werden. SolcheBegegnungengeschehen in der Gegenwärtigkeit, inderder Mensch mit seinem ganzen Wesen in Beziehung tritt. Solche Berührungen gehen in die Tiefe des Wesens und bewegen uns dazu, zu lernen, wie wir uns im Leben bewähren können oder sogar müssen (vgl. Buber nach Muth/Nauerth 2008, S.21).
In einem Moment, in dem der Raum einer Begegnung zwischen Menschen von diesen benannt wird, ist der Zustand „Begegnung“ vergangen und kann zumWerdennicht mehr beitragen.Diese Benennung kann nurnochMittel sein, umdie alte Situationin der gegenwärtigen neu zu verstehen. Eine erlebte Situation kann so zu einer Geschichte werden. Das bedeutet also, dass rückblickend Erlebtes zwar verstanden werden kann, aber es nicht mehr möglich ist,dieseszu leben oder zu verändern. Das wirkliche Leben kann also nur in der Gegenwart gelebt und verändert werden, und den Menschen und seine Lebensrichtung prägen (vgl. Buber 1983, S.12f.).
Dieser Ansatz von Martin Buber begegnete mir als Teil seiner Dialogphilosophie in einem Seminarals Teilmeines Studiums und wird in dieser Arbeit das Fundament bilden. Sein VerständnisderWesenslehreund seine Auffassung, dass der Mensch durch seinen Gegenüber zum Ich wird, ist für mich eine sehr bewegende Vorstellung. Sie unterstreicht meine Haltung, dass die Arbeit unddie Lehre mit Menschen mehr istals nur eine bloße Inhaltsvermittlung. So ist auch mein heutiges Verständnis der Dialogphilosophie nicht alleine durch die Schriften von Martin Buber entstanden. Auch haben Gründe aus meiner Vergangenheit dazu beigetragen, dass ich mich demdialogischenPrinzip zugewendet fühle. MeineBegegnungenwaren es, mit deren Hilfe ich in die tiefe Auseinandersetzung mit der Materie gehen konnte. All das lässt mich zu dem MenschenWerden, der Ich zum heutigen Zeitpunkt bin.
„Wisse, woher du kamst und wohin du gehst und vor wem du dich zu verantworten hast.“ (Buber; zit. n. Muth 2011, S.53)
Die Verantwortungsübernahme und das Bewusstsein darüber,dass ichim LebenEntscheidungenzu treffenhabe, spielen eine große Rollein meinem Leben –auch inmeinerRollealsPädagogin. Deswegen wird dieses einen Hauptteil meiner Arbeit ausmachen. Dafür bedarf es einer Bewusstseinserweiterung über meine eigene Person und Umwelthinaus. Die Notwendigkeitdazuwerde ich mit Hilfedes Gestaltansatzes[2]und der Dialogik begründen, denn meines Erachtens kann erst aus diesem Bewusstsein eine Verantwortungsübernahme entstehen. Allerdings erfährt sie auch ihre Grenzen. Meiner Auffassung nach ist es die Grenzenlosigkeit inBegegnungen, die den Menschen zur Entscheidungslosigkeit in den Interaktionen bringt.
Bubers Erklärung, Beziehung zu leben und Beziehungsräume für die Wesenslehre zu öffnen, habe ich nie als moralische Belehrung verstanden. Denn das Besondere an der Dialogik ist es, dass es keine Methode sein will, die ein Regelwerk verfasst, sondern nur eine Haltung von PädagogInnen voraussetzt, um verantwortungsbewusst in dieInteraktion in Beziehungsräumentreten zu können. Das Vertrauen, dass dieser Ansatz mit sich bringt, durfte ich u.a. inBegegnungenmit einer dialogorientierten Professorin erfahren. Durch sie und andere Menschen, die eine solche Haltung leben, und demnach Lehre gestalten, konnte mir ein Verständnis der für mich schwierigen Texte näher gebracht werden. Doch der Ansatz der Dialogik brachte mich in ein Dilemma. Ich war begeistert von dem Ansatz und verzweifelte zugleich daran.
PädagogInnen, die eine Wesenslehre wie Buber führen wollen, müssen erkennen, dass es ihrEigenwesenist und nicht die Institutionen, die Entscheidungen zu treffen haben. Sie entscheiden und treffen somit eine Auswahl aus der Umwelt, um es im Begegnungsraum Inhalt werden zu lassen. Außerdem müssen sie die „Kräfte der Ur-Wirklichkeit“ aufnehmen, damit die TeilnehmerInnen[3]sich mit der Wirklichkeit auseinander setzen können. Dieses fordert ein „radikales Engagementals personhafte Verantwortung“(vgl. Muth 2011, S.97).
Das zuvor Erwähnte werde ich in dieser Arbeit vertiefen. Die Basis meiner Arbeit bestehtaus drei Bausteinen:
·Der erste Baustein ist gewesen, als ich mir das Thema ausgesucht habe über Beziehungen und Grenzen beim pädagogischen Handeln zu schreiben.
·Der zweite Baustein ist die Auswahl der Literatur: zum einen die der Dialogphilosophie und zum anderen die des Gestaltansatzes
·Der dritte Baustein, ist das prozessorientierte Verfassen, dass sich durch die Literatur, durch die Auseinandersetzung mit dem Inhalt dieser Arbeit, sowie der Offenheit, den Aufbau vorab nicht festzuschreiben, sondern nur rückblickend aufzuführen ist.
Wie weit ich in die Tiefe der Thematik eintauchen werde, ist vorab durch die Begrenzung der Zeit, sowie der Seitenanzahl bestimmt und hängt mit dem Prozessverlauf und meinem Verständnis zusammen.
Ich möchte diese Arbeit mit einer kleinen Geschichte beginnen, die mir im Studium begegnete und die zur Einleitung derzwiefältigen Haltungvon Buber dienen wird, die für mich eine der Kernpunkte für das Leben der Beziehung darstellt:
Eines Abends erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkelsohn am Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt.
Er sagte: „Mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen.“
Einer ist böse.Er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego.
Der andere ist gut.Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube.
Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach, und fragte dann:
Welcher der beiden Wölfe gewinnt?
Der alte Cherokee antwortete: „Der, den du fütterst.“ (Hrsg.,1)
2.Dialogphilosophie
2.1Dasdialogische Prinzip
In der Wissenschaftstheorie wird dasdialogische Prinzipals Sozialphilosophie mit einer eigenen Richtung betrachtet (vgl. Werner 1994, S.13). Diese neue Richtung ist eine Form von lebenspraktischer Haltung, die nicht auf Rationalität verzichten muss (vgl. Muth 2011, S.47). Dieser Erkenntnisprozess handelt von dem sich „Innewerden, Gewahrwerden, Merken und Spüren“und das ohne eine strenge Kategorieausrichtung (vgl. Muth/Nauerth 2008, S.19). Laut Werner geht es Buber um:
„[...] eine Lebenshaltung, die wohl theoretisch reflektiert werden kann, die sich aber im Leben selbst zu bewähren hat, eine Lebensrichtung, die für die Konzipierung seiner eigenen dialogischen Philosophie entscheidend war.“ (Werner 1994, S.14)
Seine Gedanken sind nicht nur für die Philosophie, sondern auch für die Entwicklung der Wissenschaften Theologie, Pädagogik, Psychologie und der Gestalttherapie[4]von Bedeutung gewesen. Werner (vgl. 1994, S.18). sieht die Begeisterung für Bubersdialogisches Prinzipaufgrund der darin enthaltenen Beschreibung von Lebensmöglichkeiten. Diese Faszination läge nicht allein an denschriftstellerischen Kompetenzen von Buber, sondern sei darüber hinaus auch in seiner Person begründet. Buber suchte anscheinend immer wieder Gespräche zur jüngeren Generation und hat diese mit „Geduld und Hingabe“ geführt.
Dasdialogische Prinzipkann nicht mit strukturellen Merkmalen erklärt werden. Beim verfassen der Schriften versetzt sich Buber in dieIch-DuPerspektive (2.3) und versucht Unmittelbarkeit aufzuführen. Dieses ist ein Widerspruch, denn Buber erkennt selbst:
„[...]'das seinem Wesen nach Unbegriffliche' muß in allgemeine Begriffe gefaßt werde, so daß plötzlich von 'dem' Du, 'dem' Ich usw. gesprochen wird. Das heißt aber: 'Ich mußte aus demIch-Esund als Ich-Du Erfahrene ein Es machen.“ (Buber in Werner 1994, S.20f.)
2.2Keine bruchlose Zuordnung der Phänomenologie
Bei der Auseinandersetzung mit dem Verständnis desdialogischen Prinzips, sind mir gemeinsame Züge der phänomenologischen Methode aufgefallen. Sie untersucht alles Seiende.
Bei der philosophischen Analyse geht es Buber vor allem um das Aufführen derUnmittelbarkeit,Plötzlichkeit und Unvorhersehbarkeitdes Untersuchungsgegenstands (vgl. Werner 1994, S.10). Phänomenologie thematisiert den Ort und die Art und Weise, wo und wie Welt begründet und konstruiert wird. Des Weiteren setzt diese Methode sich damit auseinander, wo und wie Welt für Menschen entsteht und besteht. Hierbei geht es darum, wie die Welt in unserem Bewusstsein entsteht und unser Wesen berührt wird. Husserl[5]versteht die Phänomenologie alsWesenslehre(vgl. Danner 2006, S.139). Buber schreibt:
„Die Erfahrung gehört dem GrundwortIch-Eszu. Das Grundwort Ich-Du stiftet die Welt der Beziehung.“ (Buber 1983,S.6)
Wenn es um das Verstehen der Erfahrungen und um die Erfahrung mit der Welt geht, ist man im Buberischen Sinn im „Ich-EsVerhältnis“. Husserl fand einen grundlegenden Gedanken von Descartes, den Husserl radikaler als alle Anderen zuvor durchführte (2.3).
„cogigito ergo sum - ich denke, also bin ich" (Danner 2006, S.140).
Im dialogischen Denken ist das Gleichsetzen von Leben und Erkennen essentiell und macht für mich hier den Unterschied zur phänomenologischen Methode aus. Muth widerspricht in der Hinsicht Descartes mit:
„Vivo ergo cogito.“ („Ich lebe, also denke ich.“) (Muth/Nauerth 2008, S.19)
Der lebensweltbezogene Erkenntnisprozess geschieht indem „Erkenntnis Suchende“und„Erkenntnisgegenstand"übereinstimmen und das unvermeidbare Einbeziehen des Gegenübers. Somit kann der Mensch grundsätzlich als soziales Wesen gedacht werden (ebd.)
„Leben geschieht nur in menschlichen Beziehungen.“ (ebd.)
Ein wichtiges Merkmal vom Verständnis des dialogischen Prinzips ist, dass „der Mensch in der sozialen Interaktion wird“(ebd.). Dieser Kerngedanke begleitet den weiteren Teil meiner Arbeit. Es wird u.a. um die Auseinandersetzung dieser sozialen Interaktion gehen.
2.3MartinBubers Werk „Ich und Du“(Erstausgabe 1923)
Um die Dialogphilosophie von Martin Buber in ihrer Komplexität verständlicher darzulegen, werde ich in diesem Kapitel, die eben schon einmal erwähnten Grundworte von Martin Buber, dasIch-DuundIch-Es,sowie die dazuzwiefältige Haltungzur Welt und dem Gegenüber beschreiben. Diese beiden Grundwörter wurden zuvor schon einmal benutzt, als es darum ging, den Unterschied zwischen dem gegenwärtigen Erleben und dem nachhaltigen Verstehen der Erfahrungen aufzuzeigen (2.2). Meine Absicht ist es, indem ich diese Begriffe ausführlicher erkläre, dem Leser das dialogische Prinzip verständlicher zu machen. So möchte ich Martin Bubers Auffassung von Wesenslehre verdeutlichen, auch wenn dieses ein hohes Maß an Reduktion der Materie bedeutet.
Das Ich steht laut Buber (vgl. 1983, S.4) immer in einem Zusammenhang, denn der Mensch ist immer Ich und spricht es deshalb unmittelbar. Dieses Ich steht bei Buber allerdings nie alleine.
Wenn der Mensch ein Etwas zum Gegenstand hat, dann befindet er sich imIch-Es,in einem Subjekt-Objekt-Verhältnis. Ist das Ich des Menschen im Reich des Es, dann hat er ein Etwas zum Gegenstand. „Ich nehme etwas wahr. Ich empfinde etwas. Ich stelle etwas vor. Ich will etwas. Ich fühle etwas. Ich denke etwas“ (ebd.).
Für Buber besteht das Leben aber nicht nur aus dem Etwas. Auch Erfahrungen allein können demMenschendie Welt nicht verständlich machen. Der Mensch braucht Beziehungen und somit einDu. EinDukann der Mensch allerdings nicht besitzen. Er kann dasDunur sprechen und so mit dem Gegenüber, demDu, in Beziehung treten(vgl. Buber 1983, S.4f.) Beim GrundwortIch-Duwird allerdings nicht von einem „Ich-Du-Verhältnis“ (Muth/Nauerth 2008, S.21) gesprochen, sondern von einer „Ich-Du-Beziehung“ (ebd.). Ein Verhältnis hat nämlich einen objektiven Charakter, während Beziehung in eine Subjekt-Subjekt-Begegnung geschieht.
DieBegegnungist der Momente, indem der Mensch dasDuspricht. So kann einechtesWir, einDialogentstehen. Diese Begegnungen sind es, die der Mensch braucht um Werden zu können und die ihn den Bezug zur Welt finden lassen. Wenn beide, dasIchund dasDu, in der Beziehung stehen, entsteht einZwischen. Damit ist die Entstehung eines zwischenmenschlichen Raums gemeint. Hierfür bedarf es die Sprache. Denn sie ist es, die Menschen eine„welthafte Beziehung zu einander und[..] den Weg zu einer Gemeinschaftsbildung bis hin zu einem 'echten Wir'“(Muth 2011, S.103) ermöglicht. Indem sie mit einander kommunizieren, können Menschen erleben und dadurch erkennen, dass ein Zusammenleben als Selbsterkennung nicht in der Einsamkeit, sondern nur mittels desDusmöglich ist (ebd.).
„Das echte Wir in seiner objektiven Existenz ist daran zu erkennen, daß, in welchem auch seiner Teile es betrachtet wird, stets eine wesenhafte Beziehung zwischen Person und Person, zwischen Ich und Du sich als aktuell oder potentiell bestehend erweist. Denn das Wort entspringt immer nur zwischen einem Ich und einem Du, das Element aber, aus dem das Wir sein Leben hat, ist die Sprache, das gemeinschaftliche Sprechen mitten im Zueinander-sprechen anhebend“ (Buber, nach Muth 1998, S.103)
Solch einDialog, einWirund einZwischenentsteht nur bei Abwesenheit von Macht. Das bedeutet, dass die Beziehung auf einer Wahrhaftigkeit, Wechselseitigkeit, Gleichwertigkeit und auf Authentizität des aktuellen Geschehens angewiesen ist(vgl. Muth/Nauerth 2008, S.20 f.).
Beziehung kann nur in der Gegenwart erlebt werden und die daraus entstanden Erfahrung, ist Vergangenes und gehört somit zum Gegenstand (vgl. Buber 1983, S.13). Sobald mir also gewahr wird, dass ich mich in einem Dialog befinde, ist der Moment schon Vergangenheit und ich befinde mich in der Welt desIch-Es. Dass dasIch-Duals etwas besonderes angesehen wird, dass solche Momente noch nicht einmal im Bewusstsein der Menschen passieren müssen und dass das in der Beziehung stehen, nicht als ein Dauerzustand erreicht werden kann zeigen mir die folgende Worte:
„Erfahrung ist Du-Ferne. Beziehung kann bestehn, auch wenn der Mensch, zu dem ich Du sage, in seiner Erfahrung es nicht vernimmt. Denn Du ist mehr, als Es weiß. Du tut mehr, und ihm widerfährt mehr, als Es weiß. Hierher langt kein Trug: hier ist die Wiege des wirklichen Lebens. […] Die Gestalt, die mir entgegentritt, kann ich nicht erfahren und nicht beschreiben; nur verwirklichen kann ich sie. Und doch schaue ich sie, im Glanz des Gegenüber strahlend, klarer als alle Klarheit der erfahrenen Welt. Nicht als ein Ding unter den »inneren« Dingen, nicht als ein Gebild der »Einbildung«, sondern als das Gegenwärtige. Auf die Gegenständlichkeit geprüft, ist die Gestalt gar nicht »da«; aber was wäre gegenwärtiger als sie? Und wirkliche Beziehung ist es, darin ich zu ihr stehe: sie wirkt an mir wie ich an ihr wirke. Schaffen ist Schöpfen, Erfinden ist Finden. Gestaltung ist Entdeckung. Indem ich verwirkliche, decke ich auf. […] Das Du begegnet mir von Gnaden–durch Suchen wird es nicht gefunden. […] So ist die Beziehung Erwähltwerden und Erwählen, Passion und Aktion in einem. […] Die Einsammlung und Verschmelzung zum ganzen Wesen kann nie durch mich, kann nie ohne mich geschehen. Ich werde am Du. Ich werdend spreche ich Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ (Buber 1983, S.9ff.).
Das Zitat umfasst noch einmal das Vorangestellte, dass der Dialog nicht erzwungen werden und also nur in Abwesenheit von Macht geschieht. In diesem Zitat tauchtimmer wieder auf, dass der Mensch in der Beziehung mit seinem ganzen Wesen stehen muss.Sowird der Unterschied zwischen Beziehung und Erfahrung noch einmal hervor gehoben und verdeutlicht. Das WortGnade, ist dabei als ein „Geschenk“ zu verstehen. DennIch-Dukann nicht produziert werden, sondern ausschließlich empfangen werden (vgl. Muth 2004, S.94).
Bei dem detaillierten Herausarbeiten, wie die beiden Grundwörter von Martin Buber zu verstehen sind, erscheint es mir wesentlich, die zwiefältige Haltung ebenfalls genauer darzustellen. Denn auch wenn ich die Wichtigkeit des Ich-Dus für das Werden des Menschen darstellen konnte, so darf es nicht als das Einzige aufgefasst werden, das Menschen brauchen um Werden zu können. Der Leser soll hier nicht den Eindruck bekommen, dass Buber das Ich-Es als schlechte Materie hinstellen möchte. Im Gegenteil: Buber schreibt, dass der Mensch beide Pole braucht (vgl. 1983, S.31). Erst wenn der Mensch beide Pole lebt, Das Ich-Es als Struktur und die Bewegung als Ich-Du, erst dann zeigt sich das geschichtliche Werden des Menschen (vgl. Muth/Nauerth 2008, S.22). Im Kapitel (6.3) werde ich mich mit der Wichtigkeit des Lebens der beiden Pole noch einmal genauer auseinander setzen. Ich möchte im nächsten Kapitel kurz Bezug auf die Phänomenologie und ihre Methode nehmen. Husserls Verständnis und Auffassung von Wesenslehre, fehlt meiner Erachtens eine solch zwiefältige Haltung.
2.4 Waskennzeichneteine Wesenslehre?
Die eben aufgeführte Phänomenologie (2.2), die sich auch als Wesenslehre versteht und eine Wesensforschung (vgl. Danner 2006, S.155) aufzeigen möchte, ist wie oben schon gesagt, im Buberischen Sinne im Reich des Ich-Es, denn sie ist eine Methode. Diese Methode kann „[..] die Erlebnisse des erkennenden Denkens zum Thema“ (Janssen zit. n. Danner 2006, S.140) machen.
Nach Husserl ist der Kern der phänomenologischen Methode die eidetische Reduktion. Ziel der eidetischen Reduktion ist das Erfassen und Beschreiben des Wesens und des Objektes im Vordergrund.
Es bedarf einer Abwendung vom Einzelnen, um den gesamten Bedeutungszusammenhang des Objektes denEidos[6],einer Sache zu begreifen. Dazu nähert sich der Phänomenologe intuitiv einer Sache an: sie soll „sich zeigen“. Das bedeutet aber nicht, dass das Wesen isoliert oder das Etwas als Tatsache an sich zu betrachten ist (vgl. Schrage 2009, S.39).
Die dabei stattfindende Abwendung vom Einzelnen oder Distanzierung davon dient dazu, das Wesen einer Sache herauszustellen. Diese Wesensanschauung von der Husserl (vgl. Danner 2006, S.147 f.) spricht, wird als „[...] nüchterne und harte Reflexionsarbeit (bezeichnet); sie ist aktives, schöpferisches Denken“ (nach Diemer, nach Janssen, nach Landgrebe, Danner 2006, S.148 Klammerangaben von NP). Bei dieser Reflexionsarbeit geht es allerdings darum, sich gewahr über sein eigenes Bewusstsein zu werden. Diese Bewusstwerdung geschieht im Ich-Es-Modus. Auch das Fokussieren auf Dinge gehört dem Reich des Ich-Es an, dieses kann auch die Konzentration auf den Prozess (als Gegenstand) als solches sein. Solch eine Methode ist nicht mit der Bewegung des Ich-Dus zu verwechseln, das bedeutet auch, dass der Mensch nicht durch die Wesensanschauung in Beziehung treten kann. Wie eben beschrieben kann der Mensch für Buber nicht nur in der Analyse Werden, es bedarf der zwiefältige Haltung der ExpertIn. Es muss ein Bewusstsein entstehen, dass in der Analyse keine Berührung stattfindet.Für mich ergibt sich folgende Schlussfolgerung daraus: Als Expertin kann ich keine Wesenslehre leisten, wenn ich mich hinter der Wesensanschauung verstecke. Ich kann als ExpertIn, durch mein Wesen, meine subjektive Wahrnehmung der Welt annehmen, zum Berühren und Werden meines Gegenübers beitragen und mein Gegenüber in ein Zwischen einladen. Denn Ich-Du-Beziehungen berühren uns in der Gegenwart und zeigen, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit zu finden hat. Hierbei ist es wichtig zu erkennen, dass das Denken eines Menschen nicht instrumentalisiertwerden kann (vgl. Wulf 1994 in Muth/Nauerth 2008, S.20).
„Ich zeige Wirklichkeit, ich zeige etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder wenig gesehen worden ist. Ich nehme ihn, der mir zuhört, an der Hand und führe ihn zum Fenster. Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus. Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.“ (Buber; zit. n. Muth/Nauerth 2008, S.19)
Dieses Zitat soll als ein Weg verstanden werden, wie lebensweltbezogene Erkenntnisprozesse entstehen können und die Notwendigkeit aufführen, dass Menschen ein Gegenüber brauchen, um Werden und um Wirklichkeit erfahren zu können. Damit der Mensch wachsen kann, lebt er in einer Pendelbewegung, der zwischen der oben genannten zwiefachen Haltung, der Beziehung, also dem Ich-Du und der Distanzierung, dem Ich-Es, wechselt. Denn im pädagogischen Feld kann die Dialogik eine Grundhaltung für PädagogInnen sein. Auch das Einbeziehen von Inhalten (Ich-Es), dient zur Orientierung und ist für die Erziehung notwendig. Denn um Kindern die Welt zu zeigen, brauchen PädagogInnen auch Sachorientierung (vgl. Werner 1994, S.44f.).