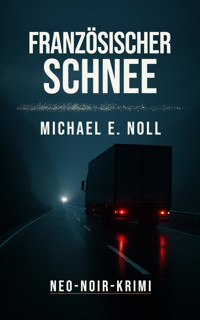4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MNbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Oberbayern im tiefsten Winter. Der Alltag der K13-Ermittler Lars Bergener und Alex Rindler scheint in Routine zu versinken, bis ein längst abgeschlossener Fall erneut auf ihrem Tisch landet: Eine Frau sitzt seit Jahren in der Psychiatrie – verurteilt für die Tötung ihres Mannes. Die Beweislage schien damals eindeutig. Doch was die beiden Polizisten in den alten Akten und am Tatort entdecken, passt nicht in dieses Bild. Blutspuren, die Fragen aufwerfen. Verletzungen, die sich nicht erklären lassen. Und ein anonymer Notruf, der nie hätte verschwinden dürfen. Während Alex in den verschneiten Tälern Oberbayerns den Spuren nachgeht, führt Lars’ Weg weiter – bis in ein abgelegenes Dorf am Mittelmeer, wo der Winter längst dem Frühling gewichen ist. Ein Ort, an dem das Meer unruhig gegen die Felsen schlägt und die Vergangenheit nicht vergessen ist. Hier stößt er auf die Schatten eines alten Tauchunfalls, auf Menschen, die mehr wissen, als sie sagen, und auf eine Witwe, die sich weigert, ihre Geheimnisse preiszugeben. Je tiefer die Ermittler graben, desto klarer wird: Hinter der scheinbar klaren Schuld verbirgt sich ein Netz aus Macht, Verrat und Systemversagen. Manche Geheimnisse sind so schwer, dass sie selbst nach Jahrzehnten nicht im Meer versinken. Und die Fracht der Vergangenheit droht, auch Lars und Alex mit in die Tiefe zu reißen. Der dritte Fall für Lars Bergener und Alexander Rindler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Fracht der Finsternis
Der Fall Helene F.
Mystery-Krimi
von
Michael E. Noll
Erstausgabe im Dezember 2025
Alle Rechte bei Michael E. Noll
Copyright © 2025
MNbooks – Michael Noll
c/o IP-Management #6681
Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
https://mnbooks.de
ISBN 978-3-912186-05-5
Transparenzhinweis: Das Coverbild dieses Buches wurde mit Hilfe des KI-Tools Midjourney (Midjourney, Inc.) erstellt und vom Autor nachbearbeitet. Die übrigen in diesem Buch verwendeten Abbildungen wurden mit Hilfe des KI-Tools DALL·E (OpenAI) erstellt und vom Autor nachbearbeitet. Bei der orthografischen und typografischen Korrektur des Textes wurde, neben einem menschlichen Korrektorat, auch das KI-Tool ChatGPT (OpenAI) eingesetzt.
Hinweise
Markennamen und Produktbezeichnungen werden ausschließlich beschreibend verwendet. Sie sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber; die Nennung impliziert keine Kooperation oder Billigung.
Dieses Werk ist fiktional. Namentlich erwähnte reale Personen erscheinen nur beiläufig; alle übrigen Figuren sowie einige Schauplätze sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Sprache & Darstellung: Dieses Buch enthält explizite Sprache, Gewaltbeschreibungen sowie diskriminierende Begriffe in Figurenrede. Sie dienen der authentischen Milieudarstellung und spiegeln nicht die Haltung des Autors wider.
Korsika, April 1945
Der Himmel brannte in einem grellen Blau, so rein, dass es fast in seinen Augen schmerzte. Unter dem Frachtflugzeug breitete sich das Meer aus wie ein endloser Spiegel – karibisch-türkis an den Küsten, dunkelblau dort, wo die Tiefe begann. Schroffe Bergketten fielen fast senkrecht in die Fluten ab, am Übergang brachen sich Wellen in weißer Gischt. Zacken aus Granit, steil und unbezwingbar, erhoben sich wie eine Mauer aus Stein, die die Insel gegen Eindringlinge beschützte – Eindringlinge, wie er einer war. Majestätisch, wunderschön – und zugleich von einer Wildheit, die ihm für einen Herzschlag den Atem raubte.
Die Hände an den Steuerknüppel gekrampft, konnte er den Anblick dieses Idylls kaum genießen. Schweiß rann ihm unter der Fliegerhaube in den Nacken, während das Flugzeug in der klaren Frühlingssonne vibrierte. Die Fracht hinter ihm – eine stählerne, mit Bolzen verschlossene Kiste – wog schwerer als jede Verantwortung, die er je getragen hatte. Sie wirkte, als verschluckte sie das Licht mit einer Kälte, die alles um sie herum einnahm. Man hatte ihm nicht viel darüber gesagt. Er wusste nur, dass das Projekt streng geheim war und höchste Priorität genoss – der Befehl kam direkt aus dem Führerhauptquartier. Die letzte Rettung für das untergehende Reich. Deshalb hatte man ihn beauftragt: Hauptmann Julius Brenner, Fliegerass, einer der erfahrensten und kühnsten Kampfpiloten, die die Wehrmacht je gesehen hatte.
Er glaubte nicht mehr an den Sieg. Aber er glaubte daran, dass der Feind diese Fracht niemals in die Hände bekommen durfte. Und in einem kurzen, schmerzhaften Bild sah er vor sich das Gesicht seiner Frau, seines kleinen Sohnes, weit weg. Würde er sie jemals wiedersehen?
Ein schwarzer Schatten schoss kreischend von der Seite ins Sichtfeld, ein zweiter hinterher. Britische Jäger – schnell, effizient, tödlich. Kugeln hämmerten in die Tragflächen, Holz splitterte, Blech wurde zerfetzt wie Papier. Der rechte Motor fing Feuer, eine schwarze, dichte Rauchsäule stieg empor und trübte das malerische Blau. Splitter flogen durch die Kabine, ein beißender Gestank von verbranntem Öl füllte den Raum. Die Maschine vibrierte im Feuerhagel, Alarme schrillten dumpf im Cockpit. Erbarmungslos zerriss das Rattern der MG-Salven seine letzte Hoffnung.
Die Junkers Ju 52 sackte ab. Sein Magen hob sich – ein kurzer Moment der absoluten Schwerelosigkeit. Der Höhenmesser drehte sich, der große Zeiger fiel im Sekundentakt – zweitausend Meter, achtzehnhundert, fünfzehnhundert – als wolle er den Sturz herunterzählen. Verzweifelt riss er am Steuerknüppel, während er spürte, wie das Flugzeug nach rechts abdriftete. In der Ferne erhoben sich zerklüftete Küsten mit schäumender Brandung und grünen Wäldern, die sich bis an die Felsabbrüche klammerten. Eine Landschaft wie ein Gemälde – schön und gnadenlos.
»Bleib hier! Wir müssen Höhe halten!«, rief er seinem Co-Piloten zu. Doch Leutnant Meissner – jung, zäh, der Blick weit vor Zorn – hörte nicht. Mit einem wütenden Aufschrei riss er die MG-Klappe auf, fasste nach den Griffen, legte an – als könne er das Schicksal mit bloßen Händen wenden. Kugeln ratterten aus dem Lauf, zerrissen den Himmel, ohne das Ziel zu treffen. Ein letztes, verzweifeltes Aufbäumen, das in der Leere verhallte. Dann krachte eine Salve durch die Kanzel, Glas splitterte, das Maschinengewehr verstummte, Blut spritzte ihm ins Gesicht – warm und metallisch, brennend in seinen Augen.
Berge, wie Dolche gegen den Himmel, spiegelten sich im zerbrochenen Cockpit – wundervoll, gefährlich, gleichgültig. Ein letztes Bild, das sich in seinen Kopf brannte. Das Variometer zitterte, die Nadel schlug tief ins Negative, das Flugzeug nur noch ein fallender Sarg aus Stahl und Holz. Der rechte Drehzahlmesser zuckte noch, dann sank er abrupt; die Nadel fiel auf null, während der Motor draußen im Flammenmeer erstickte.
»Nicht hier … nicht jetzt …« Er zog am Steuerknüppel, versuchte, das brennende Ungetüm über die Küste hinauszuschleppen. Das Wasser glitzerte wie Glas – verheißungsvoll und tödlich.
Ein letzter Gedanke schoss ihm durch den Kopf: Wenn ich falle, soll die Tiefe sie verschlingen. Besser im Schlamm des Meeres als in Feindeshand.
Der Aufprall riss ihn aus allem Denken: ein Krachen, ein Schrei aus Metall, dann Wasser – eiskalt, blau, allumfassend. Der Rumpf zerbrach, die Fracht rutschte nach hinten, riss durch die Wand und stürzte ins Meer. Sie wirkte im Sog nach unten wie ein schwarzes Herz, das in die Tiefe sank.
Unter der schillernden Oberfläche zog es die Maschine Richtung Meeresgrund, bis das letzte Licht von der Tiefe verschluckt war.
Er rang nach Atem, seine Lungen voller Wasser, in seinem Kopf nur das Bild seines Sohnes.
Dann Dunkelheit. Sein Schicksal war besiegelt – und damit auch das Schicksal eines Reiches, dessen Untergang er nicht mehr erleben würde.
Altes und Neues
Die Kaffeemaschine röchelte, hustete und spuckte schließlich ein paar dunkle Tropfen in die Glaskanne, als wolle sie selbst am liebsten Feierabend machen. Pauline stand daneben, die Hände in die Hüften gestemmt, und sah dem Schauspiel zu. Die Neonröhre an der Decke flackerte trüb, als würde sie im Takt des Elends pulsieren.
»I versteh des gar ned. Wir ham die Maschin doch no gar ned so lang«, sagte sie schließlich.
»Das liegt an dem kalkhaltigen Wasser. Hier in der Gegend ist das wirklich extrem.«
»Da kanntst recht ham. I besorg morgen lieber an Essig, bevor des uns Ding no verreckt.«
»Das wäre die Apokalypse ...«, murmelte Lars trocken, ohne vom Bildschirm aufzublicken.
Ein kurzer Gedanke traf den Kaffeeautomaten im Gemeinschaftsraum, der die Menschen dieses Dienstgebäudes regelmäßig mit seiner ungenießbaren Brühe folterte. Trotz sinkender Nachfrage hatte die Aufstellfirma erst letzte Woche wieder einmal die Preise um zehn Cent pro Tasse erhöht – das letzte Zucken eines sterbenden Geschäftsmodells, das nur noch existierte, weil der Staat in diesem Punkt für seine Diener nichts übrig hatte. Wie in so vielen Punkten.
Draußen lag ein bleierner Himmel über Kiefersfelden, graues Licht, Schneematsch an den Gehwegen. Im Büro des Kommissariats 13 liefen die alten Heizkörper auf vollen Touren, aber das machte die Stimmung nicht heller. Routinearbeit, alte Akten, verschwundene Menschen, gescheiterte Hoffnungen. Und nervtötende Presseanfragen zu seinen letzten beiden Fällen – direkt an ihn gerichtet, statt an die Pressestelle. Irgendein Schmierenjournalist hatte offenbar seine dienstliche E-Mail-Adresse herausgefunden, die nun in diesen Kreisen zu kursieren schien. Oder ein Neider hatte sie preisgegeben. Genervt löschte er die Mail, die einen Fragenkatalog enthielt, mit einem Klick. Die Anzeige des Programms für die Vorgangsverwaltung stand auf dem 25. Januar 2015.
Er streckte den Arm und massierte sich den Nacken. In Gedanken schweifte er ab, zurück in seine Kufsteiner Stadtwohnung. Bettina war wieder da. Nicht mit Pauken und Trompeten, sondern schleichend, fast still. Erst ein paar Nächte, dann ein Koffer, dann stand ihre Zahnbürste wieder im Bad. Er hatte sich nicht gewehrt, es einfach geschehen lassen. Lange, dunkle Winternächte, die Einsamkeit, die vertraute Wärme – er konnte nicht anders. Eine alte Liebe, neu erfunden, so vertraut und doch fremd, beinahe aufregend. Ob das eine kluge Idee war? Er wusste es nicht. Offiziell waren sie noch verheiratet; die Scheidung hatte er nie eingereicht.
»Du redst ja heut noch weniger als sonst«, sagte Pauline und stellte eine dampfende Tasse vor ihm ab. »Probleme dahoam?«
»Nein, alles bestens.« Lars nahm den ersten Schluck. Heiß. Bitter. Genau richtig.
Aus dem alten Küchenradio im Vorzimmer dröhnte eine Nachrichtensendung herüber: Krise in Griechenland, Streiks in Athen, Neuwahlen, ein Minister trat zurück. Dazwischen Wetterwarnungen – Frost, Glätte, Staus auf den Autobahnen, ein neues Tief kündigte sich an.
»Als wär’s hier nicht schon kalt genug. Ist ja schlimmer als an der Küste«, murmelte Lars.
Pauline grinste. »Des is Bayern. Eigentlich solltest di doch scho langsam mal dran g’wohnt ham.«
»So wie sich die bayerischen Autofahrer an den Schnee gewöhnen? Das werd ich wohl nicht mehr erleben.«
»Woast eigentlich was Neues zwecks am Alex?«, fragte sie mit besorgtem Unterton, ohne auf die Spitze einzugehen.
Sein Blick fing sich am leeren Schreibtisch gegenüber. Er dachte an Alex, der sich die kalten Tage vermutlich beim Kartenspielen oder Darten in der Dorfkneipe vertrieb und sein Herz mit einer Halben Bier erwärmte. Er war noch immer suspendiert – wegen eines Streits vor einem Bierzelt auf dem Münchner Oktoberfest. Angefangen mit einer vergessenen Jacke, geendet auf dem Boden, mit einem Türsteher im Schwitzkasten. Als die Kollegen der Wiesnwache anrückten, hatte er mitten im Getümmel seinen Dienstausweis gezückt. Der vermeintliche Freifahrtschein mündete im Desaster: Strafanzeige, Disziplinarverfahren und Zwangsurlaub.
»Nein, leider nicht. Da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Unsere Mühlen mahlen ja bekanntlich langsam.«
»Des war wieder so a typische Alex-Aktion. Der lernts einfach ned ...«
»Immerhin, volle Bezahlung ...«
Lars schwieg und ließ die Szene, die er nur aus Erzählungen kannte, in seiner Vorstellung ablaufen: Alex, mit rotem Kopf, Bieratem, störrisch wie ein Ochse, während die Kollegen der Wache ihn mit drei Mann von einem Security-Mitarbeiter zerrten. Er erinnerte sich an einen von Alex’ legendären Vorträgen, in dem er darüber sinniert hatte, dass der Job grundsätzlich von Ex-Knackis mit Machtkomplex ausgeübt werde. Als Qualifikation würde ein tätowierter Hals reichen. Und am Ende dieser triumphale Griff in die Innentasche – der Dienstausweis, schief in den dicken Fingern, den Kollegen mit einem feisten Grinsen präsentiert.
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus? Vielleicht in Alex’ Welt. Nicht bei der bayerischen Polizei.
Das brummende Faxgerät riss ihn aus den Gedanken. Ein vergilbter Kasten, der sonst nur Elektrosmog verströmte, stieß klackernd eine Seite aus. Routine. Papier, Zahlen, Namen. Er dachte an ihre letzten beiden Fälle – ein Hauch von Gerechtigkeit, der seinen Namen bekannt gemacht hatte. Letzteres zu seinem Leidwesen.
»Das Ding hätte man vor zehn Jahren schon verschrotten oder dem Deutschen Museum spenden sollen«, murmelte er in Richtung des Faxes, das auf einem Rollcontainer thronte, als würde es den gesamten Staatsapparat überdauern. Sein Bürostuhl ächzte, als wolle er ihn bestätigen. Er hatte vor geraumer Zeit drei neue Stühle für das Büro beantragt – vergebens. Aus haushalterischen Gründen zurückgestellt war die Antwort vom zuständigen Sachgebiet für Liegenschaften gewesen. Die Wahrheit war vermutlich: Sie hatten panische Angst davor, sich aus ihren eigenen Stühlen zu erheben. Er würde nie wieder etwas davon hören, da war er sich sicher. Nein, er wusste es.
Pauline blätterte in einer Akte. »So vui Papier. Werd irgendwie ned weniger.«
»Nein. Papier vermehrt sich wie Karnickel – mit dem Unterschied, dass Akten nie sterben ...«
»Werd mal wieder Zeit für an spannenden Fall, oder?«, sagte sie und sprach damit seinen Gedanken aus.
»Du hast ja so was von recht.«
Lars lehnte sich zurück und schloss kurz die Augen; der Stuhl knarzte vor sich hin. Die Kaffeemaschine atmete rasselnd schwarze Tropfen in die Kanne, als stünde sie im Sterben. Der Putz blätterte von der Wand, und die Röhre an der Decke blinzelte ihrem Ende entgegen. Irgendwo draußen schlug der Wind gegen die Fensterscheiben und die schneebedeckten Gipfel dahinter wirkten, als würden sie die Menschen im Tal erdrücken wollen. Immerhin lag die Wintersonnwende nun schon mehr als einen Monat zurück. Die Tage wurden wieder länger – erst unscheinbar, dann spürbar. Ein Hoffnungsschimmer.
Unerwarteter Besuch
Lars starrte aus dem Fenster, während sich draußen ein Graupelschauer über den Morgen gelegt hatte. Bereits diese geringe Menge Schnee hatte ausgereicht, um den Verkehr auf seinem Arbeitsweg nahezu zum Erliegen zu bringen – als bräche die Gewalt des Winters immer wieder aufs Neue über die ansässige Bevölkerung herein, völlig überraschend und unvorbereitet. Das fahle Aschgrau des Himmels ging fast nahtlos in die gezuckerten Zacken des Kaisergebirges über, das unberührt über allem stand, beinahe stoisch. Der morgendliche Sex mit Bettina hatte die Tristesse des Winters für einen Moment gelindert – ein neues Ritual, das sich wie eine Wiedergutmachung für alte Wunden anfühlte. Er ließ es geschehen, wehrte sich nicht dagegen, genoss die warme, vertraute Zweisamkeit.
Ein Klopfen an der Tür des Kommissariats holte ihn in die Gegenwart. Es war diese bestimmte Art von Klopfen – mehr ein Hämmern, vehement, unheilvoll und nervenzerfressend. Als würde im nächsten Moment ein Sondereinsatzkommando den Raum stürmen. Gemächlich ging er durch das Vorzimmer bis zur Tür; Pauline war noch nicht am Platz.
Ein uniformierter Kollege von der Inspektion stand draußen – er kannte ihn vom Sehen. Gerötetes Gesicht, das Feingefühl einer betrunkenen Dampfwalze.
»Bergener? Vorne an der Wache ist jemand für dich.«
»Guten Morgen. Wer?«
»Eine Frau. Besteht darauf, mit dir persönlich zu reden.«
Bitte keine Presse ... dachte er.
»Seit wann hat ein Kriminalkommissariat eine Bürgersprechstunde?«, knurrte er – mehr zu sich selbst, in dem Wissen, dass sein Gegenüber nur der Bote war.
Er folgte ihm durch die Räumlichkeiten der Inspektion, wo ihm eine Melange aus kaltem Kaffee, Schweiß und feuchtem Putz entgegenschlug. In der Wache saß eine Frau auf der Wartebank. Sie war etwa Mitte fünfzig, hager; die Hände umklammerten eine abgewetzte Handtasche, als hinge ihr Leben daran. Ihr Gesicht war blass, die Ringe unter den Augen tief, die Lippen schmal wie ein Strich. Ihre Kleidung war schlicht und gepflegt, aber von einer Art, die keinen Zweifel ließ: Hier saß keine Anwältin und keine Pressevertreterin, sondern eine einfache Bürgerin – gezeichnet von den Sorgen und Nöten des Alltags.
»Frau …?«, sagte Lars.
»Reiter«, antwortete sie leise. »Anna Reiter. Ich … danke, dass Sie mich empfangen.«
Er war versucht, sie direkt abzufertigen, aber angesichts der hektischen Atmosphäre des gerade stattfindenden Schichtwechsels entschied er sich anders.
»Folgen Sie mir bitte«, sagte er und führte sie in sein Büro. Dort bot er ihr Alex’ leeren Platz gegenüber an.
»Setzen Sie sich. Möchten Sie einen Kaffee?«
Sie nickte dankbar. Pauline, die inzwischen auch da war, machte sich an der Maschine zu schaffen, als hätte sie ein stummes Kommando empfangen.
»Also, was kann ich für Sie tun?«, fragte Lars die Frau, die gerade ihre Hände verkrampft im Schoß faltete.
In diesem Moment begann die Kaffeemaschine zu zischen und zu schnaufen – wie eine dramatische Untermalung der trostlosen Szene.
»Wissen Sie, ich habe Ihren Namen in der Zeitung gelesen … Ihre Fälle … Es geht um meine Schwester …«, begann sie mit bebender Stimme.
Lars sagte nichts, hörte zu.
»Helene Falk. Sie sitzt seit sieben Jahren in der geschlossenen Psychiatrie in Haar. Weil … weil sie ihren Mann umgebracht haben soll …«
Lars nickte knapp. Den Namen hatte er schon einmal gehört, glaubte, sich an einen alten Pressebericht zu erinnern. Damals hatte er noch nicht in Bayern gelebt – was bedeutete, dass dieser Fall bundesweit Schlagzeilen geschrieben haben musste. Etwas, das weit weg gewirkt hatte. Eine direkte Angehörige vor sich zu haben, das war etwas anderes.
»Oh mein Gott. Da erinner i mi dran«, entfuhr es Pauline, die gerade zwei dampfende Tassen auf dem Tisch abstellte.
»Wie kann ich Ihnen da helfen?«, fragte Lars.
Sie schluckte. »Helene hat ihren Mann nicht getötet. Da bin ich mir sicher … Ich meine, sie hatte in der Vergangenheit psychische Probleme, aber dazu wäre sie nie imstande. Sie ist dort drin krank geworden, weil niemand ihr glaubt. Nur, weil sie von … Monstern gesprochen hat.« Ihre Stimme brach.
»Frau Reiter, erst einmal tut mir das alles sehr leid. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie es Ihnen damit als Angehörige gehen muss. Aber ich muss Ihnen auch eines gleich vorweg sagen: Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Wenn es gegen Ihre Schwester ein rechtskräftiges Urteil gibt, dann hilft kein Gespräch bei der Kripo. Wenn man so etwas aufrollen will, gibt es nur den Weg über ein Wiederaufnahmeverfahren nach § 359 der Strafprozessordnung. Und das geht nur, wenn neue Beweise auf den Tisch kommen, die Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Urteils erheben. Frau Reiter, Sie sollten sich einen Anwalt nehmen«, sagte Lars.
Er sah sie an, musterte das abgekämpfte Gesicht. Die Frau tat ihm leid.
»Bitte … Ich habe den Weg hierher extra auf mich genommen … Sie sind meine letzte Hoffnung …«, sagte sie, während sich ihre Stimme fast überschlug.
Es lag ihm auf der Zunge: Das ist Sache der Anwälte. Schuldunfähigkeit nach § 63 StGB bedeutete, dass man im Maßregelvollzug saß, bis die Gutachter sagten, die Gefahr sei gebannt – was im Zweifel lebenslang bedeuten konnte.
»Verstehen Sie, was ich meine: Zweifel allein reichen nicht. Sie brauchen etwas Handfestes – DNA, Fingerabdrücke, das Geständnis eines Dritten. Alles andere lässt das Gericht nicht gelten. Ich meine, juristisch gesehen war es kein Mordurteil. Sie gilt als schuldunfähig und sitzt im Maßregelvollzug. Für die Presse ist das freilich alles dasselbe«, sagte er stattdessen.
»Bitte. Ich hab nichts mehr außer dieser Hoffnung …«, flüsterte sie. »Sehen Sie sich die Akte an. Mehr erwarte ich nicht. Lesen Sie, was dort steht. Sie werden sehen, dass etwas nicht stimmt.«
Anna Reiter umklammerte die Kaffeetasse mit beiden Händen, als wäre es das Einzige, was sie noch wärmen konnte.
Lars schwieg einen Moment, dann nickte er. »In Ordnung. Ich sehe mir die Akte an. Versprechen kann ich Ihnen allerdings nichts.«
Die Frau atmete aus, als hätte sie seit Jahren die Luft angehalten. »Das ist bereits mehr, als mir bisher jemand für Helene getan hat …«
Sein Blick fiel auf die Hände der Frau, die zitterten, während sie die Tasse hielt – dann auf Pauline, die eine Augenbraue hochzog, als würde sie bereits einen neuen Fall wittern. Das alte Radio spuckte aus dem Vorzimmer die Gegenwart herein: Während Griechenland nach der Wahl eine neue Regierung formte und in der Ostukraine die Kämpfe weiter eskalierten, warnte der Wetterdienst für Südbayern vor einem Wintereinbruch mit Glätte und Schneestürmen. Autofahrer sollten mit erheblichen Behinderungen rechnen.
Er blickte nachdenklich aus dem Fenster der rustikalen Gaststube einer Kufsteiner Wirtschaft, die inzwischen zu seinem Stammlokal geworden war. Kleine Flocken rieselten von oben und die Kälte hatte sich als weiße, glitzernde Schicht über das Pflaster des Stadtplatzes gelegt. Er würde sich die Akte besorgen. Um eine andere Entscheidung zu treffen, wusste er zu gut, dass es keine Zufälle gab. Und spätestens seit ihrem Untersberg-Fall war ihm klar geworden, dass nichts unmöglich war. Er, der das verschwundene Mädchen gefunden hatte. Der Mann, der den Lauf der Dinge verändert hatte – berührt durch die Zeit selbst. Das Unfassbare war zu einer Konstante in seinem Leben geworden.
Die Akte Falk
Der Februar kündigte sich an, wie der Januar aufgehört hatte: kalt, windig, voller Schnee. Alex hatte einmal gesagt, dieser Monat sei wie eine Hühnerleiter – kurz und beschissen. Ganz unrecht hatte er nicht. Es war einer dieser nasskalten Monate ohne Trost und ohne Seele, der einem bewusst machte, dass der Winter noch ewig dauern konnte.
Lars saß an seinem Schreibtisch, umgeben von grauen Regalen voller Akten, dazwischen das matte Flackern der Neonröhre. Er blätterte in einer Akte, die halboffiziell in seinen Händen gelandet war. Die letzten Tage hatte er damit verbracht, eine Begründung zu basteln, die stark genug war, um die Mühlen in Bewegung zu setzen – und schwach genug, um niemanden hellhörig zu machen.
Offiziell hatte er keinen Anlass, Einsicht in die Akte Falk zu bekommen: ein rechtskräftiges Urteil mit festgestellter Schuldunfähigkeit, Unterbringung nach § 63 StGB. Fall abgeschlossen, sauber verbucht, gut für die Statistik. Offiziell bedeutete das Stillstand – und Stillstand mochte die Staatsanwaltschaft am liebsten.
Doch ein anonymer Hinweis – ein Zettel ohne Absender, ein Satz am Telefon – reichte schon, um die Akte wieder aus dem Regal zu ziehen. Also schrieb er den Hinweis selbst: Alte Sache Falk. Rott am Inn. Damals nicht sauber ermittelt. Schauen Sie genau hin.
Ein Dutzend Wörter, die auf dem Schreibtisch einer Sachbearbeiterin in Rosenheim landeten, die froh war, damit nichts zu tun zu haben. Sie leitete es weiter, wie man in der Verwaltung wohl das Meiste weiterleitete – mit einem Stempel und ohne Gedanken.
Pauline hatte den Vorgang über eine befreundete Kollegin dort beschleunigen können. Nichts Illegales, nichts Sauberes – wie so oft, wenn man in Bayern etwas wirklich herausfinden wollte. Er wusste, dass er sich damit rechtlich auf dünnem Eis bewegte. Aber war es nicht genau das, was ihn bei der Lösung vergangener Fälle so erfolgreich gemacht hatte?
Das Gespräch mit Anna Reiter war ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Vielleicht war es sein Bauchgefühl, vielleicht einfach sein Wissen darum, wie dieses System funktionierte. Vielleicht aber war es auch nur der verzweifelte Versuch, aus der winterlich fahlen Büroroutine auszubrechen.
Die Akte Falk war ein Backstein – vierhundert Seiten Ermittlungsprotokolle, Tatortskizzen, Gutachten, Anklageschrift. Der Versuch, ein menschliches Drama in Bürokratie zu pressen. Er beugte sich darüber und begann zu lesen.
Tatortbefund, 18. 01. 2008, ca. 20:45 Uhr, Rott am Inn, Gestüt Falk
Geschädigter: Dr. Leonhard Falk, 45 Jahre.
Auffindesituation: Leichnam im Stallbereich, massive Stich- und Schnittverletzungen im Bereich von Thorax, Abdomen und Hals. Großflächige Blutlachen am Boden. Neben dem Geschädigten ein verendetes Pferd (Wallach), multiple Verletzungen an Halsunterseite und Vorderläufen. Muster untypisch für Huftritt oder Unfall, bestätigt durch hinzugezogenen Veterinär.
Ehefrau Helene Falk, 38 Jahre, wurde unmittelbar am Tatort neben dem Leichnam sitzend angetroffen. Kleidung und Hände stark mit Blut kontaminiert, die Tatwaffe in der Hand haltend. Keine Flucht- oder Absetzbewegung. Beim Eintreffen der Polizei befand sie sich in apathischem Zustand, sprach abgebrochen von »Monstern«, die ihren Mann getötet hätten.
Lars kratzte sich am Kopf. Küchenmesser in der Hand, Blut überall – die halbe Arbeit für den Staatsanwalt schon erledigt.
Obduktionsbericht Dr. Leonhard Falk, Institut für Rechtsmedizin München
Todesursache: Verbluten infolge multipler Stich- und Schnittverletzungen (insgesamt 27 Wunden gezählt).
Auffällig: Zusätzlich zu den Schnittverletzungen wurde eine Fraktur des dritten Lendenwirbels festgestellt.
Gutachterliche Anmerkung: „Möglicherweise durch Sturz oder Schlag auf harten Untergrund entstanden.“ Weitergehende Untersuchung hierzu unterblieb.
Lars runzelte die Stirn. Ein gebrochener Rückenwirbel? Passt nicht ins Bild. Kein Messer, kein Sturz im Stall, der das erklärt. Und niemand hat es weiter untersucht.
Anonymer Notruf
20:32 Uhr – Anruf in der Einsatzzentrale Rosenheim, männliche Stimme, Hinweis:
„Auf dem Gestüt an der Alten Straße hat eine Frau ihren Mann mit einem Messer zugerichtet. Viel Blut. Beeilen Sie sich.“
Gespräch nach 14 Sekunden beendet. Die Nummer gehörte offenbar zu einer Prepaid-Karte; der Inhaber war nicht ermittelbar.
Notrufmitschnitt: lag nicht mehr vor.
Aktenvermerk: „Eine Sicherung der Aufzeichnung wurde nicht veranlasst. Löschfrist abgelaufen.“
Lars starrte auf den Satz. Nicht veranlasst. Was so viel hieß wie: Keiner hatte Bock.
Er konnte sich schon ausmalen, was passieren würde, wenn er versuchen würde, die Tondatei anzufordern: drei Dienstwege, vier Unterschriften, am Ende eine Absage wegen fehlender Relevanz. Ein Behördenstrick, den er sich ersparen würde.
Ermittlungsverlauf (Zusammenfassung)
Vernehmung Helene Falk: wirre, wechselhafte Angaben, mehrfach wiederholt, dass „Monster“ ihren Mann getötet hätten. Keine konsistente Erinnerung an den Tathergang.
Zeugenaussagen: Spaziergänger hörten Schreie. Keine weiteren Personen beobachtet.
Tatwaffe: Küchenmesser aus dem Haushalt Falk. DNA-Spuren der Frau und des Opfers. Keine fremden DNA-Spuren untersucht oder dokumentiert.
Lars schlug auf das Papier und lehnte sich zurück. Schlampige Arbeit. Keine Spurensicherung über den Tellerrand hinaus.
Juristische Bewertung
Der Fall landete beim damals frisch ernannten Staatsanwalt Dr. Merten, 32 Jahre.
In den Akten notierte er:
„Aufgrund der eindeutigen Beweislage (Tatwaffe, Spuren, psychische Auffälligkeit der Beschuldigten) wird Anklage wegen Totschlags erhoben. Schuldunfähigkeit gemäß § 20 StGB wird aufgrund des psychiatrischen Gutachtens bejaht. Antrag auf Unterbringung nach § 63 StGB.“
Das psychiatrische Gutachten stammte von Prof. Dr. R., einem bekannten Gutachter, der in Bayern schon so manches Verfahren abgesegnet hatte.
Zitat aus dem Gutachten:
„Die Beschuldigte leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Zum Tatzeitpunkt befand sie sich in einem akuten psychotischen Schub. Die Annahme der Schuldunfähigkeit ist zwingend.“
Lars schnaubte. Zwingend? Oder bequem?
Ein junger Staatsanwalt, der Karriere machen wollte. Ein bekannter Gutachter, der die Akte mit einem Stempel abnickte. Ermittler, die froh waren, den Fall schnell vom Tisch zu haben.
Am Ende eine Frau, die neben der Leiche ihres Mannes saß, blutverschmiert, mit einem Küchenmesser in der Hand – einfacher würde man es nie wieder bekommen.
Aber die Akte sprach auch von einem gebrochenen Rückenwirbel, von einem toten Pferd mit Verletzungen, die nicht passten. Und niemand hatte es weiter untersucht.
Er hatte schon genug Aktenleichen gesehen. Aber hier – da nagte etwas, das er nicht erklären konnte. Als ob ihn die Frau selbst aus dem Papier heraus ansah.
Lars rieb sich die Schläfen. Es roch nach Blut. Und nach Faulheit. Nach einem Behördenapparat, der menschliche Schicksale durch den Fleischwolf drehte, ohne hinzusehen.
Pauline trat mit zwei Tassen Kaffee ins Büro.
»Na, was sagt die Akt’n?«
Er hielt das vergilbte Deckblatt hoch.
»Ein Blutbad. Eine Frau, die angeblich durchgedreht ist. Und eine Ermittlungsarbeit, die schneller zugemacht wurde als eine Anforderung an das Sachgebiet für Liegenschaften. Die Schwester hatte recht.«
»Und, ham wir jetzt an neuen Fall oder ned?«
»Den haben wir.«
Neue Disziplin
Lars lehnte sich im Stuhl zurück, den Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr eingeklemmt. Am anderen Ende knurrte sein Chef, Reinhard Groll, inzwischen Leitender Kriminaldirektor – derselbe Mann, der schon früher jede Spur von Begeisterung hinter einem Berg aus Bürokratie zu ersticken wusste. Letztes Jahr hatte er Lars selbst kurzzeitig suspendiert und damit die Ermittlungen gefährdet.
»Groll.«
»Bergener hier. Machen wir’s kurz. Ich brauche meinen Mitarbeiter zurück«, sagte Lars ohne Umschweife.
Es folgte eine Pause, dann ein trockenes Schnauben. »Sie wissen, dass er suspendiert ist, und das hat seinen Grund. Disziplinarverfahren. Anzeige wegen Widerstands. Wir können das nicht einfach ignorieren und so tun, als sei nichts gewesen.«
»Ich brauche ihn. Jetzt. Wir ersticken in Arbeit. Hier stapeln sich die Akten, und wir müssen Nachermittlungen durchführen. Mit nur einer Bürokraft kann ich das nicht länger bewerkstelligen«, beharrte Lars, ohne Groll über den tatsächlichen Fall aufzuklären. Das würde nur Ärger bedeuten.
»Bergener …« Man hörte, wie Groll schwer durch die Nase ausatmete. »Sie wissen, wie das läuft. Personalangelegenheiten gehen nicht nach Bauchgefühl. Dienstaufsichtsbeschwerde, Dezernat I, Personalrat, dann das Präsidium. Wenn Sie Glück haben, haben Sie in einem halben Jahr einen Beschluss.«
»Ich brauche ihn morgen. Ich selbst kann da nichts machen. Aber Sie können«, entgegnete Lars.
»Morgen?«
»Ja. Das geht nicht länger so. Ich brauche Rindler. Keine Alternative. Oder wollen Sie jemanden aus einem anderen Kommissariat abziehen?«
Am anderen Ende knackte es, als würde Groll nervös mit einem Stift auf den Tisch schlagen. »Wenn ich das überhaupt durchbekomme, dann nur mit Auflagen. Und nur, wenn Sie die Verantwortung übernehmen. Sie wissen, was das bedeutet.«
»Damit kann ich leben.«
»Gut. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Aber wenn mir irgendetwas zu Ohren kommt, Bergener – dann hängen Sie mit drin. Schriftlich. Was das heißt, brauche ich Ihnen sicher nicht zu erklären.«
»Ja, ich weiß.«
»Geben Sie mir ein paar Tage.«
Das Gespräch endete, wie die meisten Gespräche mit Groll endeten: ohne Grußformel, nur mit einem genervten Auflegen.
Fünf Tage später lag das Schreiben auf Lars’ Schreibtisch:
POLIZEIPRÄSIDIUM OBERBAYERN SÜD
Az.: 34/2 – 1176/14
Rosenheim, den 03.02.2015
Widerruf der vorläufigen Dienstenthebung des KHM Alexander Rindler
Mit Bescheid vom 15.10.2014 wurde Kriminalhauptmeister Alexander Rindler gem. § 39 Abs. 1 BayDG vorläufig des Dienstes enthoben. Nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage wird die Dienstenthebung mit sofortiger Wirkung aufgehoben.
Die Aufhebung erfolgt unter folgenden Auflagen:
Die Wiederaufnahme des Dienstes erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Ausgangs des laufenden Disziplinarverfahrens.
KHM Rindler wird der Dienststelle K 13, Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter unmittelbarer Aufsicht von KHK Bergener zugewiesen.
KHK Bergener hat sicherzustellen, dass KHM Rindler den Dienst pflichtgemäß, zuverlässig und frei von dienstschädigendem Verhalten ausführt.
Bei erneuten Pflichtverletzungen wird die sofortige erneute Dienstenthebung vorbehalten.
Dieser Bescheid ergeht im Einvernehmen mit dem Personalrat.
gez. Reinhard Groll
Leitender Kriminaldirektor
Lars legte das Schreiben beiseite. Es klang weniger nach einer Wiedereinstellung als nach einer Bewährungsauflage. Typisch Personalverwaltung: lieber Kollegen auf der Ersatzbank verrotten lassen, als ein Disziplinarverfahren zügig durchzuziehen. Ein belastungseifriger Moloch, träger und aufgequollener als der Delinquent selbst.
Am Nachmittag fuhr Lars nach Fischbach. Alex wohnte dort, nach der Trennung von seiner Frau, wieder im Elternhaus. Ein grauer, verwitterter Bau, dessen Balkon längst Risse zeigte und der Putz von den Wänden fiel wie Schorf von einer alten Wunde. Außen abbruchreif, innen immerhin noch gemütlich. Für Spekulanten wäre es trotzdem eine Goldgrube gewesen – allein wegen der Lage. In Oberbayern trieb die Immobilienblase längst Blüten, für die man andernorts nicht einmal einen kranken Hund im Tausch bekommen hätte. Vor dem Haus parkte ein rostiger, dunkelblauer Renault 4, der schon wärmere Tage gesehen hatte – Alex’ Ersatz für den gammligen gelben Peugeot, der einst einem Anschlag zum Opfer fiel.
Eine zierliche Frau mit glasigem Blick öffnete die Haustür.
»Schau mal, Bua«, rief sie in die Stube hinein, »da Fritz kimmt di besuchen.«
Lars seufzte. Fritz war sein Vorgänger. Aber immerhin schien sie den Zusammenhang noch zu erkennen.
Im Wohnzimmer lag Alex auf der Couch, die Schuhe noch an, die Jeans voller Flecken. Er schnarchte, der Atem vom Bier geschwängert, der Tisch neben ihm gefüllt mit leeren Dosen und Flaschen. Das Fernsehgerät lief auf halber Lautstärke, zeigte eine Dauerwerbesendung. Teleshopping – der Inbegriff ständiger Wiederholung, grellbunter Sinnlosigkeit und aufdringlicher Verblödung. Eine aufgetakelte Frau mit Zähnen so weiß wie Klaviertasten fuchtelte mit einem Hochglanzmixer herum und redete dabei in einer Tonlage, als kommuniziere sie mit Kleinkindern. Jedes zweite Wort »innovativ«, jedes dritte »revolutionär«. Ein Gerät, das niemand brauchte – und bei dem doch so getan wurde, als hinge das Überleben der Menschheit von seiner Anschaffung ab. Ein leerer Schrei in das Nichts – Sinnbild einer übersättigten Gesellschaft. Ein Kreislauf, der perfekt zu der schalen Tristesse im Raum passte.
Lars packte seinen Kollegen am Arm und schüttelte ihn kräftig.
»Alex. Aufstehen!«
Alex öffnete ein Auge, rot und blinzelnd, verzog das Gesicht, gefolgt von einem Grunzen.
»I hab g’rad echt an schrägen Albtraum g’habt. Irgendwie war plötzlich a Preiß in meiner Wohnung.«
»Ganz der Alte. Dann bin ich ja beruhigt.«
»Was machst’n du hier?«
»Du bist zurück im Dienst. Morgen früh, acht Uhr – pünktlich und nüchtern im Büro.«
Alex setzte sich auf, rieb sich die Augen, starrte ihn ungläubig an. »Dei Ernst? Du hast doch ned ...«
»Ich hab mit Groll geredet. Du wirst gebraucht. Aber es gibt ein paar neue Regeln.«
»Oh mei … Was jetz wohl wieder kimmt …«
»Kein Alkohol mehr. Dafür mindestens zweimal die Woche Sport. Wenn du dir noch mal so einen Schnitzer erlaubst, dann hat’s uns beide. Verstanden?«
Alex lachte heiser, kratzte sich am Kopf. »Sport? Du mechst mi umbringa, oder? Du kennst doch mei Motto. Sport is Mord.«
»Das hier bringt dich um«, sagte Lars und stieß eine leere Bierdose vom Tisch, die scheppernd über den gefliesten Boden rollte, als wäre sie beleidigt.
Alex starrte ihn einen Moment lang an, dann grinste er schief. »Na guad. Moing um achte. Aber Sport … da red ma nochmal drüber.«
»Nicht reden. Machen. Der Verhandlungsspielraum ist aufgebraucht«, sagte Lars.
»Du bist ja no schlimmer als mei Ex«, schnaubte Alex.
»Mag sein. Aber ich bin dein Chef. Ober sticht Unter. Das solltest du als alter Kartenspieler doch am besten wissen.«
Vorhof zur Hölle
Schweißnass stand Alex in der Tür des Kommissariats – eingepfercht in einen ausgewaschenen, grünen Jogginganzug, der aussah, als stamme er aus Zeiten, in denen die RAF die größte Bedrohung der Republik war. Zu eng, zu kurz, die Nähte am Limit. Eine Presswurst mit ungepflegtem Haarkranz und wucherndem Bart, die Nase rot von der Kälte. Er schnaufte wie eine Dampflok auf ihrer letzten Fahrt zum Schrottplatz.
Aus dem Flur hallte das Gelächter eines Kollegen, ein anderer rief: »Schau dir des ned o, da Michelin-Mann feiert sei Comeback!«
»Oarschlöcher!«, entfuhr es Alex keuchend. Lars hatte ihn zum Frühsport verdonnert. Ohne Gnade. Kein glorreicher Anfang, aber immerhin ein Anfang.
»Wennst so weitermachst, brauch ma bald an Defibrillator«, sagte Pauline, die grinsend danebenstand, mit einer Kaffeetasse in der Hand.
»I schwör‘s da, Bergener, no a mal überleb i des ned.«
»Doch. Wir steigern das sogar noch. Das war jetzt gerade mal ein Kilometer. Der Sport ist nicht das Problem, sondern die Sauferei«, sagte Lars trocken.
»Aber des Sauf‘n is ned so schmerzhaft ...«
»Sieh‘s positiv. Wenigstens scheint heute zur Abwechslung mal die Sonne.«
»Sonne? Was is des?«
Einige Tage später war von Sport, Gelächter und gutem Wetter keine Spur mehr. Dafür waren gleich zwei Fahrspuren dicht, und es ging im Schneefall den Irschenberg hoch – im Schritttempo. Die Fahrt nach Haar führte sie durch ein grau verschneites Voralpenland, Schneematsch türmte sich an den Leitplanken der A8. Eine Wolkenwand hing schwer und grau über den Feldern, und nach mehr als zwei Stunden Fahrt tauchte schließlich der Klinikkomplex vor ihnen auf wie eine stumme Warnung: Betonklötze, Nachkriegsbaracken, dazwischen Altbauten mit vergitterten Fenstern. Alex war inzwischen im Bilde, was den Fall und die Akte betraf.
»Was erhoffst dir jetz eigentlich davon, mit dera zum reden?«, fragte Alex.
»Sie ist wahrscheinlich die Einzige, die uns sagen kann, was vor sieben Jahren wirklich passiert ist«, sagte Lars und versuchte dabei, zuversichtlich zu klingen – auch wenn er sich selbst nicht ganz sicher war, was er sich von diesem Gespräch erhoffte. Vielleicht fürs Gewissen, damit er Anna Reiter sagen konnte, er habe sein Möglichstes getan.
»Haar, des passt wenigstens wieder wie d’Faust aufs Aug.«
»Wieso?«
»Na, des sprichwörtliche Haar in da Supp‘n.«
An der Pforte musterte sie ein Wachmann mit eingefallenen Wangen und lustlosem Blick hinter der Panzerglasscheibe. Es folgte das Ausfüllen eines Besucherformulars.
»Des is ja wie bei da Suspendierung«, kommentierte Alex, als er seine Waffe und den Dienstausweis auf das matte Schiebetablett der Schleusendurchreiche legte. Lars tat es ihm gleich – Sicherheitsvorschrift. Es folgten die Gürtel mit den Schnallen, dann Schlüssel, Handys, ein silbernes Zippo vom Gebirgspionierbataillon Brannenburg und ein Schweizer Taschenmesser. Der Wachmann notierte Namen und Uhrzeit in ein zerfleddertes Besucherbuch, dann schob er zwei Besucherausweise durch die Schleuse. Ein weiterer Wachmann nahm sie in Empfang.
»Doppelte Türen. Immer warten, bis die erste geschlossen ist«, murmelte er, während er sie durch die Schleuse führte. Die Türen summten, surrten und klappten jedes Mal hart ins Schloss wie Zellentüren.
Drinnen roch es nach einer Mischung aus kaltem Essen, Desinfektionsmittel und Urin – eine Art von Gestank, die kleben blieb, sich in Haut und Kleidung fraß.
Patienten saßen auf Bänken entlang des Flures, in dem jeder Schritt hallte wie in einer leeren Kirche. Einer starrte mit leerem Blick in die Neonröhre, ein anderer lachte hysterisch, ohne Grund, ein weiterer saß apathisch da und wippte mit dem Kopf vor und zurück. Wieder andere wirkten völlig normal. Von irgendwo her tönte ein Schrei, schrill, abrupt abgeschnitten. Ein Pfleger kam ihnen entgegen – dunkle Ringe unter den Augen, der weiße Kittel fleckig, der Gesichtsausdruck stumpf, überarbeitet und gleichgültig. Begleitet von einem Farbenmeer der Monotonie aus Beige, Grün und Braun, zweckmäßig und geschmacklos – passend zum Geruch.
Ein Vorhof zur Hölle ..., dachte Lars, und der Gedanke, dass hier drin jemand zu Unrecht eingesperrt sein könnte, ließ ihn erschaudern. Hier wurde niemandem geholfen. Hier wurde verwahrt und vergessen. Menschen ohne Hoffnung – jene, vor denen die Gesellschaft geschützt werden musste.
Sie wurden in einen kahlen Besuchsraum geführt. Ein Metalltisch, zwei Stühle, kahle Wände, eine Kamera in der Ecke. Dort saß bereits eine Frau: Helene Falk. Lars erkannte sie wieder, von einem Foto aus der Akte. Im Vergleich dazu war sie um Jahre gealtert. Sie war zierlicher, als er sie sich vorgestellt hatte, die Körperhaltung eingesunken, die Hände im Schoß gefaltet, der Blick auf den Boden geheftet. Sie wirkte wie ein Schatten in Menschengestalt.
Lars nahm ihr gegenüber Platz.
»Frau Falk? Mein Name ist Lars Bergener. Das ist mein Kollege Alexander Rindler. Wir sind von der Kriminalpolizei und möchten uns mit Ihnen unterhalten«, begann er ruhig.
Keine Regung. Nur ein kaum wahrnehmbares Wippen ihres Körpers.
»Ihre Schwester, Anna Reiter, hat uns gebeten, uns Ihren Fall noch einmal anzusehen. Sie glaubt, dass Sie unschuldig sind«, sagte er nach einer Weile.
Helene hob langsam den Kopf. Ihre Augen waren gerötet, aber für einen Moment klar. Dann brach sie in hysterisches Gelächter aus – laut, schrill, verzweifelt.
»Meine Schwester glaubt noch an Gerechtigkeit. Ich nicht mehr«, hauchte sie schließlich leise.
Lars beugte sich leicht vor, sein Tonfall sanft. »Was ist damals wirklich passiert?«
»Das, was niemand hören will. Der Grund, warum ich hier drin sitze«, antwortete sie, fast flüsternd.
»Erzählen Sie es mir?«
»Monster haben ihn geholt. Und dann haben sie mich geholt. Aber wenn du sagst, es waren Monster, dann sperren sie dich ein. Niemand glaubt dir. Niemals!«, fauchte sie. Ihre Stimme war brüchig, aber deutlich. Alex warf Lars diesen Blick zu – denselben, den er immer hatte, wenn er sich dem Wahnsinn gegenüber wähnte. Lars blieb ruhig.
»Was waren das für Monster?«
Helene sagte nichts, ließ den Kopf wieder sinken. Im nächsten Moment riss sie ihn wieder hoch und sah Lars direkt in die Augen – mit einem klaren, durchdringenden Blick.
»Hast du schon mal eine Bestie gesehen, die einen Mann wie ein Spielzeug umherwirft? Hast du schon mal eine Bestie gesehen, die ein ausgewachsenes Pferd einfach umtritt? Hast du? Hast du? Monster! Monster!«, brüllte sie.
Ihre Lippen bebten, als wolle sie weitersprechen, doch stattdessen sprang sie plötzlich auf. Der Stuhl kippte nach hinten, sie schnellte nach vorne, kratzte Lars im Gesicht und spuckte ihn an.
»Ihr seid blind! Die Monster laufen frei herum! Blind! Blind seid ihr!«, schrie sie laut und hysterisch. Die Tür flog auf, zwei Pfleger stürmten hinein. Einer packte sie an den Armen, der andere drückte sie zu Boden. Jemand rief nach einem Arzt. Es folgte metallisches Klappern, dann wurde eine Spritze vorbereitet – vermutlich Haloperidol.
Lars stand auf, aber einer der Pfleger hob warnend die Hand. »Lassen Sie uns das machen.«
Sie sahen zu, wie Helene Falk fixiert wurde, bis ihre Schreie zu einem Wimmern zerfielen und schließlich die Stimme brach. Dann kam die Injektion, gefolgt von einem Zucken. Schließlich Stille.
Die Pfleger trugen sie weg. Zurück blieb ein leerer Stuhl, ein kalter Tisch und ein Nachhall von Schreien, der nicht vergehen wollte.
»Die is hinüber. Aber sowas von. Da machst nix mehr«, sagte Alex betreten, als sie wieder auf dem Flur standen.
Lars tupfte sich mit einem Tuch das Blut von der Wange.
»Es scheint so. Die Frage ist nur, ob sie es vorher schon war, oder ob sie hier drin dazu gemacht wurde ...«
Der Bruch
Der Heizkörper gluckerte, als kämpfe er gegen einen Frost, der längst in die Wände gekrochen war. Auf dem Schreibtisch stapelten sich Akten, daneben eine Kaffeetasse mit braunen Rändern, kalt und vergessen. Lars saß allein im Büro und hatte die Akte Falk vor sich aufgeschlagen. Pauline war längst gegangen und Alex hatte heute ebenfalls pünktlich Feierabend gemacht. Ihm hingegen war noch nicht nach Feierabend. Zuhause würde Bettina auf ihn warten, aber die war daran gewöhnt, dass es bei ihm oft spät wurde. Sie verstand ihre Rückkehr als zweite Chance – für ihn war es manchmal eher ein Arrangement: Wärme gegen seine Rastlosigkeit.
Die Wohnung war nicht leerer geworden, aber auch nicht wirklich voller. Und die Arbeit bot ihm den besseren Vorwand, sich nicht mit Fragen zu beschäftigen, auf die er ohnehin keine Antwort hatte.
Er strich mit dem Finger über die Stelle im Obduktionsbericht: Fraktur des dritten Lendenwirbels. Möglicherweise Sturz oder Schlag auf harten Untergrund.
Konnte eine solche Verletzung tatsächlich durch einen Sturz zustande gekommen sein? Für unmöglich hielt er das nicht, aber wie wahrscheinlich war so etwas? So etwas sah man normalerweise bei Autounfällen oder Stürzen aus großer Höhe. Dass dem nicht weiter nachgegangen worden war, ärgerte ihn.
»Verdammte Schlamperei«, murmelte er.
Helenes Stimme hallte in seinem Kopf nach: Monster … Hast du schon mal eine Bestie gesehen, die einen Mann wie ein Spielzeug umherwirft? Hast du schon mal eine Bestie gesehen, die ein Pferd einfach umtritt?
Lars rieb sich die Schläfen. So ein Verletzungsmuster passte nicht zu der zierlichen Person, die er gestern gesehen hatte. Selbst dann nicht, wenn sie in ihren besten Zeiten gewesen wäre. Er hatte eine gebrochene Frau gesehen, apathisch und abgemagert. Wie sollte so jemand einem gestandenen Mann eine solche Verletzung zugefügt haben?
Er beugte sich vor, notierte sich etwas am Rand: Kraftaufwand? Vergleich Profiboxer.
Das Bild ging durch seinen Kopf: ein Körper, der mit Wucht gegen einen Balken oder eine Wand geschleudert wurde. Ein brechender Rücken, wie wenn man einen Ast zu Boden wirft. Ausgeführt von einem Mann, vielleicht hundert Kilo oder mehr. Trainiert, voller Kraft. Ein Wutanfall einer psychotischen Frau? Nein. Hinweise auf eine medizinische Vorgeschichte von Dr. Leonhard Falk lagen ihm nicht vor. Osteoporose? Glasknochen? Etwas anderes, das so eine Verletzung plausibel machen könnte? Für den Moment wusste er keine Antwort.
Er beschloss, die Herangehensweise zu ändern. Er stellte sich die Frage, die sich jeder Mordermittler ab einem gewissen Punkt zwangsläufig stellen musste: Wer hätte einen Nutzen von Falks Tod?
Er klappte die Akte zu, bewegte die Maus und entsperrte den Bildschirm seines Computers. Es war so still, dass er das Gefühl hatte, das Klackern der Tastatur würde an den Wänden widerhallen.
Er gab den Namen in die Suchmaschine ein: Dr. Leonhard Falk.
Schnell tauchten die Ergebnisse auf: Fachartikel aus den Neunzigern, einige Verweise auf Kongresse. Nichts, was auf den ersten Blick von Bedeutung war. Mit einer Ausnahme. Falk war Inhaber einer Firma gewesen: MedGene Solutions GmbH – ein kleines Biotech-Unternehmen. Im Bundesanzeiger war von jährlichen Verlusten die Rede. Förderanträge über EU-Programme, die abgelehnt worden waren.
In der Regionalpresse stieß er auf einen acht Jahre alten Artikel: Biotech-Firma aus Hohenlinden will mit regenerativer Medizin durchstarten.
Der Bericht war gespickt mit Schlagworten, wie man sie offenbar gerne Investoren hinwarf: Stammzellen, Immunmodulation, Biomarker. Das klang irgendwie nach heißer Luft. In der Realität schienen die Ergebnisse eher mager gewesen zu sein. Die Firma schrieb rote Zahlen – wie viele Start-ups dieser Jahre: zu ambitioniert, zu klein, zu abhängig von frischem Geld.
Er beschloss, das Handelsregister zu bemühen.
Dort fand er den Eintrag zur Firma MedGene Solutions GmbH. Sitz: Hohenlinden. Gründung 2004, Geschäftsführer Dr. Leonhard Falk, Mitgesellschafter Dr. Markus Kronfeld. Stammkapital 50.000 Euro. Nach Falks Tod wurde der Eintrag geändert – seit 2008 war Kronfeld alleiniger Geschäftsführer. Offiziell widmete sich die Firma der Entwicklung neuartiger Therapien im Bereich regenerativer Medizin und Immunologie.
Er lehnte sich zurück, der Stuhl ächzte, als wollte er unter der Last seiner Gedanken zusammenbrechen. Die Lampe über ihm summte dünn, als hielte sie gerade so durch. Hohenlinden … Vermutlich ein schmuckloses Industriegebiet an der B12, irgendwo zwischen Lkw-Parkplätzen und Metallhändlern.
Er recherchierte weiter. Kronfeld war offensichtlich ein Studienfreund von Falk gewesen, wie er einem Interview aus der Fachpresse entnehmen konnte. Sie arbeiteten an Verfahren zur Zellregeneration nach schweren Verletzungen – einer Nische zwischen Unfallchirurgie und Krebsforschung.
Schwere Verletzungen … gebrochener Rücken?
Nach einer Weile stieß er auf etwas, das ihn stutzig machte: Im Jahr 2008 war plötzlich eine Erfolgsmeldung aufgetaucht. Ein Hinweis auf eine neue Forschungskooperation im Bereich Onkologie. MedGene Solutions präsentierte auf einem Kongress in Wien neuartige Ansätze zur Immuntherapie gegen Tumore.
Ein Fachartikel in der Zeitschrift Biotech Today sprach von vielversprechenden Ergebnissen im Tiermodell – eine Formulierung, die vermutlich alles bedeuten konnte, aber für Investoren nach Gold klang.
Seltsam … 2007 hatte die Gesellschaft laut Bundesanzeiger kaum noch liquide Mittel. 2008 dann das. Zufällig genau in dem Jahr, in dem Falk gestorben war und Kronfeld allein die Geschäfte führte.
Er ließ die Finger auf der Maus ruhen. Ein Unternehmen kurz vor dem Absturz. Ein Mann, der im Stall verblutet war – mit einem gebrochenen Rücken. Ein Geschäftspartner, der vielleicht davon profitierte.
Vor seinem inneren Auge ließ er den Besuch in Haar Revue passieren und sah Helenes Blick noch einmal vor sich – dieser eine Moment, in dem sie klar gewirkt hatte, durchdringend und furchterregend. Monster …
Das Hirngespinst einer Wahnsinnigen? Oder vielleicht nur eine Metapher? Er hatte zu viel erlebt, um keinen Platz für einen Restzweifel zuzulassen. Kälte kroch ihm den Nacken hinauf, und sie kam nicht von draußen. Etwas stimmte hier nicht. Das war sein Bauchgefühl. Der Drang nach der Wahrheit hatte längst das Ruder übernommen. Wenn auch nur der Funke einer Möglichkeit bestand, dass Helene Falk tatsächlich unschuldig in der Psychiatrie saß, dann war es seine Pflicht, das aufzudecken.
Er würde weiter ermitteln. Staub aufwirbeln. Steine umdrehen.
Genau das, wofür man ihn hasste – und wofür man ihn brauchte.
Müdigkeit stieg in ihm auf. Genug für heute. Er griff sich seine Jacke vom Stuhl und verließ das Büro. Im Flur hallten seine Schritte, irgendwo knallte eine Tür. Draußen hing der Mief von eisigen Temperaturen und Streusalz. Irgendwo röhrte ein Schneepflug durch die Straßen von Kiefersfelden.
Am Tatort
Die Fahrt nach Rott führte sie über die Bundesstraße 15, durch ein Land, das dem Wintergrau erlegen war. Felder, die wie mit Mehl bestäubt dalagen, Wälder, deren Äste schwer vom Schnee hingen. Dazwischen Dörfer, geduckt unter den Dächern aus rotem Ziegel, Schornsteine, die gegen die Minusgrade anqualmten wie Soldaten im Schützengraben. Der Himmel spannte sich trüb über die Landschaft – ohne Tiefe, ohne Hoffnung auf Frühling. Die Heizung blies in ihre Gesichter, trocknete den Hals aus wie einen alten Lappen. Der Lastwagen vor ihnen bremste die Fahrt – ein rollendes Denkmal für die Trägheit dieser Republik.
Auf der Frontscheibe glänzten helle Schlieren. Das Streusalz, mit dem man die Straßen großzügig überzogen hatte, legte sich wie ein Film über alles – Glas, Lack und Asphalt. Es vermittelte eine trügerische Sicherheit, die nicht existierte. In Wirklichkeit zerfraß es Karosserien, trank das Wischwasser leer und hinterließ den bitteren Nachgeschmack von Umweltzerstörung. Bayerns weiße Hoffnung auf freie Fahrt im Winter – billig erkauft.
Der Ortskern von Rott lag auf einer Anhöhe. Der Weg nach oben führte sie an Wohnhäusern, Gewerbebauten und Lokalen vorbei.
»Da liegt da Franz Josef«, sagte Alex und deutete auf eine Friedhofsmauer, die sich zu ihrer Rechten erstreckte.
»Franz Josef?«
»Na, unser ehemaliger Landesvater. Scho klar, dass des am Preißn nix sagt.«
Lars verzog keine Miene. Der Gedanke, dass hier der mächtigste CSU-Mann der Nachkriegszeit lag, passte zu einem Land, das seine Geschichte gerne ins Herz der Dörfer stellte. Vergangenheit und Gegenwart – immer dicht beieinander, manchmal zu dicht.
Sie durchquerten den Ort, der irgendwo zwischen winterlicher Voralpen-Tristesse und oberbayerischer Traditionsverbundenheit gefangen schien: enge Straßen, niedrige Häuser, ein Kirchturm, der stoisch gegen die triste Wolkendecke ragte. Schließlich bog Lars in den Franz-Josef-Strauß-Weg ein und ließ den Wagen auf einem kleinen Parkplatz ausrollen. Im Rathaus, das direkt an den Friedhof angrenzte, wartete bereits ein Mann auf sie: ein grauhaariger Gemeindearbeiter in einer ausgebeulten Jacke, die vermutlich schon bessere Tage gesehen hatte. Er überreichte ihnen den Schlüssel mit einer Ernsthaftigkeit in der Miene, als könne man damit das Tor zu einer anderen Dimension öffnen.
»Des is der Schlüssel fürs Gestüt«, sagte er ohne Umschweife und drückte Lars das kalte Metall in die Hand, nachdem der kurz seinen Dienstausweis gezeigt hatte. »Ihr seids die Ersten seit Ewigkeiten, die sich für des Ding interessier’n«, sagte er salopp. Sein Tonfall klang, als spräche er von einem rostigen Schneepflug im Bauhof, nicht von einem Ort, an dem ein Mensch sein Leben verloren hatte.
»Danke«, erwiderte Lars knapp.
Der Mann nickte, schob die Hände zurück in die Jackentaschen und stapfte auf dem Flur davon, als hätte er damit jegliche Verantwortung abgegeben.
Das ehemalige Gestüt Falk lag etwa einen Kilometer hinter dem Ortsrand, ein verwaister Fleck im Schnee – eingeklemmt zwischen der Postkartenkulisse des Dorfs und dem Rotter Forst. Nach dem Tod des Besitzers war der Hof in einer Zwangsversteigerung gelandet. Doch niemand wollte bieten. Nicht einmal ein Abbruchunternehmer. Also fiel das Grundstück an die Gemeinde – ein Klotz am Bein, der seit Jahren vor sich hinfaulte. Keiner wollte es kaufen, keiner wollte es haben. Landwirtschaftlicher Grund, auf dem Blut geflossen war, lockte selbst im gut betuchten Oberbayern keine Investoren hinter dem Ofen vor.
Lars holte den Koffer der Spurensicherung aus dem Wagen, nachdem sie sich über mehrere hundert Meter durch einen ungeräumten Feldweg gepflügt hatten. Der Stall war ein grauer Klotz, die Fenster eingeschlagen, das Dach mit Löchern gesprenkelt, durch die kalte Luft pfiff. Über der Tür hing noch immer ein verblichenes Holzschild mit dem Namen des Gestüts. Es wirkte wie ein Grabstein.
Der Schlüssel knirschte im Schloss, die Tür ächzte, als Lars sie aufstieß. Ein kalter, abgestandener Luftzug kam ihnen entgegen, vermischt mit Staub und Moder.
»Fast so g’miatlich wie a Gruft«, murmelte Alex und zog den Reißverschluss seiner Jacke höher, während sein Atem vor ihm kondensierte.
Lars schaltete die Taschenlampe ein; ihr Strahl schnitt durch Staubpartikel und eisige Luft. »Hier ist es passiert«, sagte er leise, mehr zu sich selbst als zu Alex.
Drinnen hallte jeder Schritt, als würden die Bretter selbst erschrecken. Spinnweben hingen wie Schleier in den Ecken, das Stroh war zu einer grauen, verfilzten Matte verrottet. Es roch nach feuchtem Holz, nach Vergessenheit und nach etwas, das einmal Leben war. Hier standen schon lange keine Pferde mehr. Lars konnte die Beklemmung dieses Ortes förmlich spüren. Ein Luftzug drückte durch die Ritzen und ließ die Balken knarren, als flüsterten sie noch die Schreie von damals. Ein vergessener Ort, der die Wahrheit kannte.
Sie machten sich an die Arbeit. Lars zog Einweghandschuhe über und öffnete den silbernen Koffer mit einem Klicken, das in der eisigen Stille widerhallte. Sprühflasche, Nikon-Spiegelreflexkamera mit Stativ, Schutzbrille – für ihn nichts Besonderes, die Standardausrüstung der Spurensicherung. Luminol war dabei die Waffe der Wahl: eine klare Lösung, die mit dem Eisen im Blut chemisch reagierte und in völliger Dunkelheit bläulich aufleuchtete – selbst dann noch, wenn der Tatort zehnmal geschrubbt worden war. Für das menschliche Auge unsichtbar, bis die Reaktion es sichtbar machte.
Er stellte die Kamera auf das Stativ und öffnete die Blende weit – Langzeitbelichtung. Nur so ließ sich das flüchtige Leuchten einfangen, bevor es wieder erlosch.
»Des nenn i mal echte Tatortarbeit. Ned den CSI-Schmarrn, den ma im Fernseh’n immer sieht«, kommentierte Alex trocken.
Sie löschten die Lampen. Für Sekunden lag der Stall in totaler Finsternis. Dann begann der Boden bläulich zu glimmen – geisterhaft, kalt, wie ein Nachleuchten von Sternen. Luminol. Jeder Spritzer, jeder Wisch, jede verschleppte Spur hob sich für Sekunden aus dem Schwarz heraus, lang genug, dass die Kamera sie mit offener Blende einfangen konnte.
»Ach du Scheiße«, entfuhr es Alex. »Sicher, dass des a mal a Pferdestall war und koa Metzgerei?«
Wie ein Teppich des Grauens leuchteten Spuren auf dem gesamten Boden. An den Wänden zeichneten sich Spritzer ab.
»An dieser Stelle ist er gestorben«, sagte Lars fast andächtig.
»Heilige …«, entfuhr es Alex. Sein Blick fiel auf ein Spritzmuster an der Stallwand, das sich in zwei Metern Höhe fächerförmig ausbreitete. Kein Messerstoß, keine Abwehrhaltung konnte so etwas erklären. Es sah aus, als sei jemand mit voller Wucht gegen die Wand geschleudert worden.
»Unmöglich … Wenn die Frau das gewesen sein soll, dann hatte sie definitiv Hilfe«, sagte Lars nach einer nachdenklichen Pause. Seit Maria Altmanstorfer wusste er, dass Akten nicht einfach Akten waren. Und dieser Fall roch nach demselben Schweigen, das ihn nachts wachhielt.
Er trat näher und ging in die Hocke. »Hier – Fußspuren. Deutlich größer als ein Damenschuh, vom Profil her eindeutig männlich. Es scheint, als hätte das Opfer hier gelegen und sich dann noch einmal aufgerafft, in Richtung der Boxen. Von dort ziehen sich Schleifspuren weg. Sieht für mich so aus.«
Alex schluckte hörbar. »Jetz glaub i dann a schee langsam an Monster …«
Es wurde still im Stall. Nur das Knarzen der Balken im Wind und das leise Tropfen von Schmelzwasser tönte von irgendwo aus der Dunkelheit. Lars richtete sich auf und rieb sich die Hände an seiner Hose. Sein Blick wanderte über den Ort, in dem ein Mann verblutet war und in dem die Wahrheit über Jahre begraben lag.
»Was auch immer hier passiert ist – es ist nicht das, was uns die Akte glauben machen will«, sagte Lars schließlich.
Alex nickte langsam. »Definitiv ned. Des schaut eher nach Krieg aus.«
Lars ließ den Blick noch einmal über das Spritzmuster wandern. »Um einen ausgewachsenen Mann so hoch gegen die Wand zu schleudern und ihm dabei eine derart schwere Verletzung zuzufügen … dazu wäre eine fast übermenschliche Kraft notwendig.« Er ließ die Lampe sinken. Was ist hier passiert?
Als das Leuchten wieder erlosch, blieb nur der Gestank von Chemie – und der Verdacht, dass hier mehr Blut geflossen war, als der erste Blick vermuten ließ.
Helenes Gesicht blitzte in seinem Kopf auf. Das Wort hallte in ihm nach. Monster …
Rott am Inn, Januar 2008
Der Wind fuhr in Böen über die Weiden, riss an den kahlen Pappeln und trieb feinen Schnee wie einen Schleier über den gefrorenen Boden. In der Ferne ratterte ein Zug, dumpf, als käme der Laut aus einer anderen Welt. Der Hof lag dunkel, nur die Stalllaterne zeichnete einen gelben Kreis ins Grau. Pferde schnaubten, stampften unruhig. Es roch nach Heu, nach Leder und nach kaltem Eisen.
Leonhard zog die Stalltür hinter sich ins Schloss, klopfte sich die Flocken von der Jacke und lächelte ihr zu. »Gleich fertig«, sagte er, »nur noch die Decken drauf.« Sie nickte, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, die Hände im Mantel vergraben. In ihr stieg diese Müdigkeit auf, die sich als Unruhe tarnte.
Dann nahm sie dieses andere Geräusch wahr.
Kein Wind. Kein Zug.
Stiefel auf Holz. Langsam. Gleichmäßig. Wie ein Metronom, das keine Eile kennt.
Die Stalltür ging auf, unerwartet, mit einem eisigen Luftzug: zwei Männer im Gegenlicht. Schwarz. Maskiert mit Sturmhauben, die wirkten, als wären sie aus dem Fell eines Raubtiers gemacht. Der eine hoch und sehnig, seine Bewegungen knapp und präzise. Der andere breiter, die Schultern schwer, das Gesicht hinter der Sturmhaube nur ein dunkler Schlund, aus dem der weiße Atem trat.
Ein Hauch kalten Zigarettenrauchs kroch vor ihnen her.
»Wer—?« setzte Leonhard an, bekam die Frage aber nicht zu Ende. Der Sehnige war schon da, zwei Schritte, die Hand an seiner Brust, ein Griff an den Kragen. Der Körper flog. Wie eine Puppe schlug er gegen die Boxentür, das Holz ächzte, Splitter sprangen. Sie schrie aus Leibeskräften. Pferde stiegen, Hufe hämmerten in Panik gegen die Bretter.
»Leonhard!«
Der Sehnige pfiff leise. Eine kindische Melodie, fast harmlos. Alle meine Entchen, dachte sie später, obwohl sie wusste, dass das nicht sein konnte. Ein helles, versponnenes Pfeifen, das durch die Luft schnitt wie ein kaltes Messer.
Der Breite packte sie, drehte ihren Arm auf den Rücken, als wäre er aus Draht. Der Griff war nicht nur hart; er war stärker, als es Hände sein durften. Es knackte in ihrer Schulter. Sie keuchte, trat, kratzte, doch er hielt sie, ohne jede Mühe, drückte sie mit dem Gesicht auf den kalten Beton. Der Hauch seines Atems an ihrem Ohr: Tief. Dunkel. Fremd. Wie der eines Wesens aus einer anderen Dimension.
Der Sehnige ging zu Leonhard hinüber. Ein eisblauer Blick in den Schlitzen der Maske. Lederhandschuhe knirschten, als er ihn hob, nur mit einer Hand am Kragen. »Wo ist es?«, fragte er und schleuderte ihn quer durch den Raum, mühelos, ohne die Antwort abzuwarten. Knochen auf Stein. Luft, die aus einer Lunge gepresst wurde wie aus einem Blasebalg. Leonhard versuchte aufzustehen, sackte wieder zusammen.
»Hör auf!« schrie sie. Der Breite zog ihr den Arm weiter hoch. Ein Schrei riss ihr die Kehle auf, salziger Geschmack breitete sich im Mund aus. Die Pferde drehten fast durch; eine Stange brach, ein Wallach stürmte aus seiner Box, das weiße Auge rollte. Der Sehnige machte keinen Schritt zur Seite, als das Tier auf ihn zuraste. Er stand. Wartete. Lächelte mit einem Mundwinkel unter dem Loch.
Und dann tat er etwas, das sie ihr Leben lang im Traum verfolgen sollte.
Er trat vor, ein Schritt, blitzschnell, der Stiefel wie ein Hammer gegen das Vorderbein, gefolgt von einem trockenen Krachen. Der Wallach stürzte in sich zusammen, schlug, voller Schmerz und in blanker Panik. Der Sehnige ging in die Hocke, pfiff wieder diese Melodie, zog ein Messer. Die Klinge blitzte nur kurz im Licht. Ein Ruck. Ein Schnitt. Warmes Blut spritzte in einem Bogen gegen die Bretter, auf den Boden, auf seine Handschuhe. Das Tier wurde still.
»Wieso …?« keuchte Leonhard. Seine Stimme war kaum mehr als ein Rest.
Der Sehnige wandte sich ihm zu. »Weil ich Angst riechen kann. Sie widert mich an. Schwäche widert mich an«, sagte er leise, mit einem Ton wie Schmirgelpapier.
Sie weinte jetzt leise, aus Schmerz, aus Wut, aus schierer Ohnmacht. Der Breite hielt sie noch immer, hart, unnachgiebig, brutal. Sein Griff war wie Eisen. Sie spürte, wie ihr die Tränen in den Schal liefen, schmeckte Heu und Staub. Monster, dachte sie. Monster.
Leonhard schleppte sich auf die Knie. Er blickte sie an, sah den Mann, der sie hielt, sah das Blut, das sich in dunkle Rinnsale zog. Sein Gesicht verengte sich zu einem Punkt, als ließe er nur noch einen Gedanken zu: Aufstehen. Er stützte sich am Futtertrog hoch, taumelte, kam zwei Schritte weit.
Der Sehnige kam ihm entgegen, trat ihm die Beine weg. Er fiel. Eine Hand griff in seine Haare, riss den Kopf zurück und ließ dann los. Sein Peiniger wollte es nicht schnell. Es war, als wollte er es auskosten.
»Sag mir, warum. Dann mach ich es schnell«, sagte er, als könne er ihre Gedanken lesen. Der Breite blieb stumm, nickte kaum merklich.
Leonhard schwieg. Das Messer tanzte. Nicht wahllos, nicht rasend – präzise, mit Pausen, als lauschte die Bestie zwischen den Stichen auf irgendeinen inneren Takt. Blut sprühte, warm und scharf, auf Stroh, auf Stiefel, auf den kalten Beton – der Geschmack von Eisen breitete sich aus. Leonhards Hände ruderten, fanden nichts. Er war ein Arzt gewesen, ein Forscher, ein Mann der Ordnung und der Akribie. Sein Leben endete in einem Stall, im Schmutz, in der Hatz eines Sadisten.
»Bitte«, sagte sie, doch das Wort war kaum mehr als Atem.
Der Breite senkte den Blick. Einen Moment lang dachte sie, er würde antworten. Stattdessen löste er den Griff, nur für einen Herzschlag. Sie riss sich los, stolperte zu ihrem Mann, kniete sich in sein Blut, presste beide Hände auf eine Wunde, die viel zu groß war für nur zwei davon. »Leonhard!«, schrie sie, »Le …«