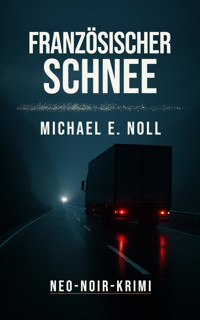
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MNbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mann, der alles verloren hat. Ein Freund, der zum Feind werden könnte. Eine Stadt, die keine Gnade kennt. Nachdem Jacques Bontemps seinen Job verliert, gerät sein Leben aus den Fugen. Der Versuch, seiner Familie finanziell beizustehen, führt ihn in ein Netz aus Schmuggel, Korruption und Gewalt – quer durch Europa, bis in den Untergrund von Hamburg. Zwischen falschen Freunden und echten Feinden kämpft er darum, seine Haut zu retten und das Richtige zu tun. An seiner Seite: Mikhail, ein Mann mit dunkler Vergangenheit, und Katerina, die gelernt hat, im Schatten zu überleben. Als ein Deal außer Kontrolle gerät, entbrennt eine gnadenlose Jagd – ein Kampf um Wahrheit, Loyalität und Überleben. Doch in einer Welt, in der Moral zum Luxus geworden ist, hat jede Entscheidung ihren Preis. Eine Geschichte über Schuld, Hoffnung und die Sehnsucht nach einem Neubeginn – packend, atmosphärisch und tief menschlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Französischer Schnee
Die Geschichte des Jacques Bontemps
Neo-Noir-Krimi
von
Michael E. Noll
Erstausgabe im November 2017
Alle Rechte bei Michael E. Noll
Copyright © 2025
MNbooks – Michael Noll
c/o IP-Management #6681
Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
https://mnbooks.de
ISBN 978-3-912186-07-9
Für meinen Opa Fred
Hinweise
Markennamen und Produktbezeichnungen werden ausschließlich beschreibend verwendet. Sie sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber; die Nennung impliziert keine Kooperation oder Billigung.
Dieses Werk ist fiktional. Namentlich erwähnte reale Personen erscheinen nur beiläufig; alle übrigen Figuren sowie einige Schauplätze sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Sprache & Darstellung: Dieses Buch enthält explizite Sprache, Gewaltbeschreibungen sowie diskriminierende Begriffe in Figurenrede. Sie dienen der authentischen Milieudarstellung und spiegeln nicht die Haltung des Autors wider.
Der größte Fehler
Was wäre, wenn sich dein Leben von heute auf morgen ändert?
Hast du je darüber nachgedacht, dass alles, was passiert, einen Sinn hat?
Das Dröhnen einer Alarmanlage riss ihn aus der Benommenheit. Ein zerstörter Wagen voller Kokain. Seine Kotze auf dem Asphalt. Polizeisirenen im Nacken. Ein Transvestit auf dem Beifahrersitz.
Sich darauf einzulassen, war der größte Fehler seines erbärmlichen Lebens. Und davon gab es viele. Doch hatte er je eine Wahl? Oder hat man immer eine? Sie hatten ihn ausgesucht – einen hilflosen Idioten, den man nach Belieben opferte. Einen Bauern, der nichts wert war, sobald er versagte.
Er hatte nur diese eine Aufgabe. Er hatte sie vergeigt. Jetzt würden sie ihn jagen. Er war erledigt.
Aber von Anfang an …
Jacques
Fremdbestimmung.
Das war es, was Jacques an diesem lauen Frühsommermorgen durch den Kopf ging – wie so oft, wenn er in seinem Wagen über die kleine Brücke der Ariège fuhr, auf dem Weg zur Arbeit.
Verkauft man nicht die besten Jahre seines Lebens? Ist Zeit nicht das Wertvollste, was wir besitzen?
Seit seinem vierzigsten Geburtstag im November plagte ihn dieser Gedanke stärker denn je. Er fühlte sich klein und machtlos – als stünde er vor einem Bergmassiv, das er nie bezwungen hatte. Von oben blickten jene auf ihn herab, die es geschafft hatten, voller Häme und zugleich Mitgefühl. Menschen, die er beneidete, weil sie das Leben offenbar leichter nahmen als er.
Er bog auf den mit Lastwagen vollgestellten Hof der Spedition Boisseau et Fils in Portet-sur-Garonne ein, wo er seit über elf Jahren Disponent war. Der Job war in Ordnung, die Bezahlung auch – eine Leidenschaft war es jedoch nie. Anfangs hatte er gehofft, etwas bewegen zu können, doch diese Hoffnung war längst von der grauen Routine des Alltags erstickt worden. Das war ihm bewusst – und er verdrängte es. Die Kollegen waren nett, der Kaffee gut, und er brauchte das Geld. Und das musste reichen.
Jacques’ finanzielle Situation war erdrückend. Das Haus hatte er vor acht Jahren gekauft, nach endlosen Verhandlungen mit der Bank, bei der er seit Jahrzehnten treuer Kunde war. Die Wohnung war einfach zu klein geworden für die beiden Kinder, für Violette und ihn. Die Immobilie war eigentlich zu teuer für ihre Verhältnisse, aber die Gelegenheit war günstig gewesen – und Jacques konnte einfach nicht Nein sagen.
Das war sein Problem. Er konnte es nie.
Violette hatte zwei Jobs angenommen: Sie arbeitete nebenbei als Putzfrau in einem Bürokomplex und hauptberuflich als Verkäuferin in einem Supermarkt, der auf Bio-Lebensmittel spezialisiert war – einer dieser Märkte, die Jacques stets mied, denn gesunde Ernährung war ein Luxus, den man sich leisten können musste.
Das Einkaufen überließ er ohnehin lieber ihr, denn er hasste es – und sie saß ja an der Quelle.
Vorletztes Jahr brauchte er einen neuen Wagen. Der alte Peugeot 406 hatte nach fünfzehn Jahren endgültig aufgegeben. Natürlich konnte die Bank den Kredit kaum ablehnen, denn er brauchte ja etwas, das ihn zuverlässig in die Arbeit brachte. Da kam das günstige Angebot mit dem Jahreswagen sehr gelegen. Die öffentlichen Verkehrsanbindungen hier auf dem Land im Süden waren mehr als dürftig.
Und dann war da noch Sophia, Violettes und Jacques’ gemeinsame Tochter. Sie war fast neunzehn, stand kurz vor dem Abitur und war im Begriff, ein Psychologiestudium zu beginnen. Sie war Jacques’ Liebling, und er war stolz auf seine Große.
Zu seinem Sohn Marc hatte er momentan einen weniger guten Draht. Er war fünfzehn und ein absoluter Rebell gegen alles, was seine Eltern, die Lehrer und die Gesellschaft ihm aufzwingen wollten.
Das meiste davon bekam Jacques nur aus Violettes Erzählungen mit, da er wegen vieler Überstunden oft spät nach Hause kam – und Marc sich ohnehin gerne in seinem Zimmer verkroch oder sich, neuerdings, mit zwielichtigen Gestalten herumtrieb, wie Violette sie nannte.
Und dann war da noch Violettes pflegebedürftige Mutter. Sie war siebenundsechzig und hatte letztes Jahr einen Schlaganfall erlitten. Die Unterbringung im Pflegeheim stellte für die kleine Familie eine zusätzliche Herausforderung dar. Frankreich unterstützte sie zwar mit einer Seniorenbeihilfe, und Violettes Mutter bekam noch eine schmale Rente, aber das reichte natürlich nicht, um die Kosten für das Heim zu decken.
Vor dem großen, gräulichen Gebäude stellte Jacques seinen Wagen ab, während die morgendliche Sonne langsam ihre Kraft entfaltete. Man konnte vermuten, dass dieser Klotz von Speditionsgebäude einmal weiß gewesen war, aber die Fassade hatte über die Jahre gelitten – eingefärbt von der Witterung und den Abgasen der Lastwagen, rissig von den permanenten Erschütterungen der angrenzenden Schnellstraße. Die milchigen Fenster wirkten wie traurige, längst erloschene Augen.
Der Bau ragte vor ihm auf und erinnerte ihn unweigerlich an das Bergmassiv in seinem Kopf.
Er stieg aus, atmete tief durch und betrat das Gebäude durch den gläsernen Eingangsbereich. Der vertraute Geruch von kaltem Zigarettenrauch, Kaffee und den Abgasen der Gabelstapler trat in seine Nase, die hektische Geräuschkulisse aus Brummen von Kühlanlagen, klingelnden Telefonen und Stimmengewirr in seine Ohren.
Mit einem knappen « Bonjour, Claire » begrüßte er freundlich nickend die Empfangsdame und Sekretärin – eine quirlige, hübsche Brünette Ende zwanzig, die seit drei Jahren hier arbeitete, nachdem ihre Vorgängerin in Pension gegangen war. Ein ebenso freundliches « Bonjour, Jacques, ça va? » hallte ihm nach, als er schon zielstrebig auf dem Weg zu seinem Büro war. Nach Smalltalk war ihm heute nicht; er war ohnehin eher ein schweigsamer Typ.
Sein Büro lag im Erdgeschoss, am Ende eines spärlich beleuchteten Flurs mit ausgetretenem, blauem Teppich. Seine beiden Kollegen, mit denen er sich das Büro teilte, waren bereits am Platz und telefonierten lautstark.
Er setzte sich an seinen Schreibtisch, stellte seine Tasche ab und schaltete den Computer ein. Windows startete träge, und sein Telefon war noch still. Also klemmte er sich den Clip seines mobilen Apparats an den Gürtel, ließ das Gerät in der Halterung einrasten und machte sich auf den Weg zur Kaffeemaschine im ersten Stock.
Die große Küche war einer der freundlicheren Räume im Gebäude. An einem Tisch in der hinteren Ecke saßen zwei Lkw-Fahrer. Beide schienen in ein Gespräch vertieft, während sie rauchten und Kaffee tranken. Nach einem flüchtigen, gegenseitigen « Bonjour » führte ihn sein Weg zur Espressomaschine am anderen Ende des Raumes, in möglichst großer Entfernung von dem bläulichen Dunst, den die Fahrer produzierten.
Er nahm sich eine Tasse und stellte sie unter den Hahn. Gerade als er den Knopf drückte und die Maschine brummend ihre Arbeit begann, betrat Claire den Raum. Sie griff sich zwei Tassen samt Untersetzern und stellte sie demonstrativ vor Jacques auf die Arbeitsplatte. Mild lächelnd, die schmalen Brauen über den kastanienbraunen Augen leicht hochgezogen, musterte sie ihn.
»Na, heute nicht besonders gesprächig?«, fragte sie.
Sie trug eine elegante, weiße Bluse und einen dunklen Midirock, unter dem sich eine helle Strumpfhose abhob, die ihre schlanke, aber dennoch sehr weibliche Figur betonte. Ihre schönen, leicht gelockten Haare hatte sie zu einer Art Dutt zusammengebunden.
»Ich hab heute nicht besonders gut geschlafen«, brummte er, bemüht freundlich.
Jacques bemerkte, wie die beiden Fahrer in der Ecke ihr Gesprächstempo signifikant verlangsamt hatten und wie angenagelt in Richtung Claire starrten. Er konnte es verstehen. Wie oft war mein Blick schon länger an ihr hängen geblieben, als nötig?
Er verwarf den Gedanken schnell wieder, denn er war mit Violette verheiratet – seit mittlerweile achtzehn Jahren. Sie war seine Jugendliebe, und nachdem sie bereits mit Sophia schwanger gewesen war, hatte er um ihre Hand angehalten. Auch wenn die Beziehung in den letzten Jahren zusehends eingeschlafen war und unter den Belastungen des Alltags litt, verbot er sich solche Gedanken – obgleich es ihm manchmal schwerfiel. Außerdem wusste er, dass Claire einen festen Freund hatte.
Der doppelte Espresso war durchgelaufen, und er nahm seine Tasse weg.
»Er hat Besuch«, sagte sie.
»Gisbert meinst du?«, fragte Jacques.
Die Spedition war ein Familienbetrieb, den Gisbert vor einigen Jahren von seinem Vater übernommen hatte. Gisbert war ein Mensch, der ruhig, aber sehr bestimmt seinen Willen durchzusetzen vermochte und – im Gegensatz zu seinem eher bescheidenen Vater – eine Leidenschaft für schnelle Autos und einen luxuriösen Lebensstil pflegte. Gisbert war einer jener Typen, die von dem Bergmassiv in Jacques’ Kopf auf ihn hinabsahen. Zugleich aber schien er Jacques’ akribische Arbeitsweise und seinen Fleiß zu schätzen.
»Ja, so ein Typ im dunklen Anzug. Der blickte ziemlich finster drein«, antwortete sie, während sie die zweite Tasse unter die Maschine stellte.
»Na ja, ich mach mich dann mal an die Arbeit«, sagte er. Der Typ im dunklen Anzug wird wohl einen Grund für den finsteren Blick haben.
»Viel Erfolg und bis später«, sagte Claire lächelnd.
« Merci », erwiderte er mit einem leicht gequälten Grinsen und machte sich auf den Weg zurück in sein Büro – vorbei an den noch immer starrenden Fahrern.
Am Ende dieses unspektakulären Arbeitstages – unzählige geplante Touren und Telefonate später – saß er allein im Büro. Seine Kollegen waren schon in den Feierabend gegangen, vermutlich, um noch etwas von der warmen Frühsommersonne zu genießen.
Jacques war der Chefdisponent für den Deutschland-Transit und blieb meist noch etwas länger. Die Arbeit war stressig, oft telefonierte er mit zwei Telefonen gleichzeitig und schrieb nebenbei noch E-Mails – aber er hatte sich daran gewöhnt. Wenigstens verging die Zeit schnell.
Er hatte gerade ein Gespräch beendet, als ihn das erneute Klingeln des Telefons jäh aus seinen Gedanken riss.
»Hi Jacques, hier Gisbert. Ich habe gerade einen Anruf von ›Reiter‹ in Lacroix-Falgarde bekommen. Wir müssten dort morgen noch drei Paletten Wein aufnehmen. Und ich brauche noch die Abrechnungen für April. Am besten bis morgen früh, wenn es geht.«
Natürlich ging es. Da Jacques nicht Nein sagen konnte, gab er Gisberts Willen widerstandslos nach und sah seinen Feierabend – so wie die restliche Sonne des Tages – vor seinem geistigen Auge sanft davon gleiten.
Sein Chef hatte am Telefon etwas gedrückt geklungen, aber Jacques machte sich keine weiteren Gedanken darüber und tat seine Arbeit.
Es war der Vorletzte des Monats, bald würde es wieder Geld geben. Immerhin wurde er stets pünktlich bezahlt. In elf Jahren hatte er zwei mickrige Gehaltserhöhungen bekommen. Ein schwacher Trost, aber besser als nichts.
Auf einen Lotteriegewinn rechnete er sich wenig Chancen aus, zumal er eine Abneigung gegen alles hatte, das mit Glücksspiel zu tun hatte.
An diesem Abend kam er spät nach Hause. Der zunehmende Mond stand am Himmel und leuchtete mit beruhigender Unbeugsamkeit. Es war still, als die Haustür hinter ihm ins Schloss fiel. Nur aus Marcs Zimmer hörte man das leise Gebrabbel des Fernsehers. Es war Dienstag, und Violette war heute mit ihrer besten Freundin aus.
Er stellte seine Tasche ab, hängte die Jacke an die Garderobe und ging in die Küche. Dort stand ein abgedeckter Topf auf der Herdplatte. Violette hatte Cassoulet gekocht, eine französische Art von Eintopf – sein Lieblingsessen.
Er setzte sich an den rustikalen Küchentisch und wartete, bis es wieder heiß war. Sein Blick verlor sich auf der glänzend lasierten, mit Astlöchern und Kratzern übersäten Tischplatte, und seine Gedanken trugen ihn fort.
Wird mein Leben ewig so dahinplätschern?
Er war vor Kurzem vierzig geworden und hatte das Gefühl, dass mehr Tage seines Lebens hinter ihm lagen als vor ihm. Das Bergmassiv war wieder präsent, drängte sich in den Vordergrund. Befand er sich etwa in der Midlife-Crisis? Die letzten Jahre war er zu sehr damit beschäftigt gewesen, alles zusammenzuhalten, hatte zu viel Zeit mit seiner Arbeit verbracht, zu wenig dagegen mit seiner Familie. War es das wirklich alles wert?
Sich selbst hatte er vernachlässigt, und seine einstigen Träume waren längst Ernüchterung und Resignation gewichen. Hobbys pflegte er kaum und wirklich nennenswerte Freundschaften auch nicht – abgesehen von seinem Kumpel Bert, mit dem er sich an den Wochenenden gelegentlich auf ein Bier oder zu einem Darts-Duell verabredete.
Früher war er Rallye gefahren, hatte das aber mangels Zeit und Geld – und letztendlich wegen der Familiengründung – an den Nagel gehängt und seinen Wagen verkauft. Jetzt, als er so darüber nachdachte, fühlte es sich an, als hätte er damals einen Teil von sich selbst verkauft.
Auch gemeinsame Urlaube waren selten geworden. Meistens verbrachten sie diese in Nordspanien oder Italien: nicht zu weit weg, aber weit genug, um neue Energie und Zuversicht zu tanken – bis die Finanzen irgendwann auch das mehr und mehr auffraßen.
Nachdem er gegessen hatte, spürte er jeden Knochen – als würde sein Körper noch nachhallen, wie nach einem langen Marsch. Erschöpfung machte sich breit, und er beschloss, nachdem er die letzte Nacht kaum geschlafen hatte, ins Bett zu gehen.
Die Gedanken gingen ihm noch lange nach, bis er schließlich in einen tiefen, traumlosen Schlaf fiel. Etwas Kraft zu tanken würde ihm guttun. Er konnte nicht ahnen, wie sehr er sie bald brauchen würde.
Sturz vom Bergmassiv
Es war, als würde er von einer Sirene träumen. Im Halbschlaf griff er nach der Taste des Weckers, der ihn pünktlich um sechs Uhr morgens aus dem Schlaf riss.
Er stand auf, um in das kleine Bad neben dem Schlafzimmer zu gehen. Nach der Morgentoilette ging er zurück ins Schlafzimmer und weckte Violette.
»Guten Morgen, Liebling«, sagte er und bekam ein verschlafenes »Guten Morgen« zurück.
Anschließend machte er sich auf den Weg vom ersten Stock in die Küche, um ein spartanisches Frühstück aufzutischen. Es war still und roch nach kaltem Cassoulet. Die Kinder schliefen noch.
»Na, wie war es denn gestern Abend?«, fragte er, als Violette die Küche betrat.
»Es war sehr schön. Erst waren wir im Kino und anschließend in der ›Bar pieds dans l’eau‹. Wir haben uns gut amüsiert.«
Wenigstens einer …, dachte er.
»Rate mal, wen ich gestern getroffen habe!«, sagte Violette.
»Ich habe nicht den Hauch einer Vorstellung«, entgegnete Jacques trocken.
»Kannst du dich noch an Claude erinnern? Claude Chevalier?«, fragte sie.
Ihm dämmerte etwas, und er erinnerte sich vage an den besagten Claude. Sie kannten sich von früher, aus der Zeit, als er und Violette noch ein frisches Paar gewesen waren.
»Ja, klar erinnere ich mich an den. Ich konnte nie viel mit ihm anfangen. Wie geht es ihm denn?«
»Mit wem konntest du schon etwas anfangen?«, entgegnete Violette amüsiert.
»Es geht ihm sehr gut, er hat sich vor Kurzem selbstständig gemacht. Er hat eine Praxis für Physiotherapie eröffnet«, sagte sie, was er mit einem kurzen Brummen quittierte.
»Er hat mir seine Karte gegeben. Du könntest ihn das nächste Mal aufsuchen, wenn dich die Rückenschmerzen wieder plagen.«
Ja, ganz bestimmt werde ich zu Claude gehen, dachte er und verzog sein schmales Gesicht – in Gedanken an seinen Rücken, dem die jahrelange Büroarbeit und der Bewegungsmangel zugesetzt hatten.
Nach dem Frühstück verabschiedeten sie sich mit einem flüchtigen Kuss voneinander, und er verließ das Haus. Violette würde nun die Kinder aufwecken und ihnen Frühstück machen, um sich anschließend selbst auf den Weg zur Arbeit zu machen.
Mit seinem sonoren Nageln trat der Renault-Dieselmotor seinen Dienst an, als er den Zündschlüssel umdrehte.
Im Radio lief gerade ein bekanntes Lied: Pour que tu m’aimes encore (Damit du mich noch liebst), als er in den Hof der etwa zwanzig Kilometer entfernten Spedition einbog. Es war bewölkt und sah nach Regen aus.
Als er das Gebäude betrat, erkannte er bereits durch den gläsernen Eingang, wie ein Kollege wild herumgestikulierte. Er drückte die Tür auf und sah Claire zusammengesunken hinter dem Empfangstresen sitzen. Ihr Gesicht war verquollen; sie hatte geweint.
»Das können die doch nicht machen!«, hörte er jemanden schreien. Einer der Fahrer, vom Vortag aus der Küche.
Er blieb wie angewurzelt stehen. Ein unheilvolles Gefühl beschlich ihn. Bisher schien seine Anwesenheit noch unbemerkt.
»Was ist denn hier los?«, entfuhr es ihm zögerlich und mit – für seine Verhältnisse – ungewohnt kräftiger Stimme.
»Wir wurden gekündigt. Alle«, setzte ihn der eben noch gestikulierende Kollege mit gesenktem Blick ins Bild.
Sein Magen zog sich zusammen.
»Ist das ein Scherz?«, erwiderte er. In diesem Moment fiel ihm nichts Passenderes ein. Als er es ausgesprochen hatte, wurde ihm bewusst, wie dämlich diese Frage angesichts der bedrückenden Stimmung war.
Die Gruppe vergrößerte sich; ein weiterer Fahrer und einer der Lageristen waren dazugestoßen. Während die anderen weiter lautstark diskutierten, beschloss er, der Sache auf den Grund zu gehen.
Er stellte die Tasche in seinem Büro ab und warf die Jacke über den Bürostuhl. Einer seiner Bürokollegen saß mit leerem Blick an seinem Schreibtisch.
»Ach, du bist es. Guten Morgen. Du hast es sicher schon gehört«, sagte der schließlich.
»Guten Morgen, ja«, gab Jacques kleinlaut zurück und machte sich schweren Schrittes auf den Weg zu Gisbert.
Die Tür zum Chefbüro stand einen Spalt offen. Er hielt einen kurzen Moment inne, dann klopfte er.
»Ja bitte?«, schallte es leise, kaum hörbar.
Gisbert stand hinter seinem protzigen, antiken Schreibtisch aus dunklem Eichenholz, als er eintrat. »Jacques«, sagte er und räusperte sich. »Setz dich doch bitte«, wies er ihn mit einer einladenden Handgeste an.
Er nahm auf einem schwarzen Bürostuhl aus Leder Platz, gegenüber dem Schreibtisch. Das Hinsetzen fiel ihm schwer, seine Knie waren weich wie ein Stück Gelatine. Die Hände feucht, und in seinen Beinen begann es leicht zu kribbeln.
Regen begann gegen die großen Fenster zu prasseln, was in diesem Moment beinahe etwas Beruhigendes hatte.
»Ich muss dir leider sagen …«, begann Gisbert den Satz und geriet ins Stocken. »Ich meine, du … Nein … Ihr alle seid mir in den Jahren … Ich … Ich habe deine Arbeit immer sehr geschätzt.«
Der sonst so eloquente und toughe Gisbert war blass, seine Augen dunkel unterlaufen. Er stammelte und machte einen unsicheren Eindruck. Man sah ihm an, dass er die letzten Nächte kaum geschlafen hatte. Trotz seiner stattlichen Größe, seiner breiten Schultern und seiner großen Hände wirkte er klein und unscheinbar.
Er trug ein beiges Designerhemd, auf dem sich große Schweißflecken abzeichneten. Seine sonst so gepflegten, gestriegelten Haare wirkten wie ein zusammengeknülltes Bündel Wolle. Normalerweise war er wie aus dem Ei gepellt. Nicht heute.
»Wir müssen schließen. Ich bin insolvent. Ich kann euch nicht mehr bezahlen. Es tut mir leid«, brachte er schließlich über die Lippen – und Jacques konnte erkennen, dass es ihm sichtlich schwerfiel.
Er saß wie gelähmt auf dem Bürostuhl und schluckte, brachte kein Wort heraus. Sein Puls beschleunigte sich, und sein Magen zog sich weiter zusammen; das Kribbeln war ihm ins Gesicht gestiegen.
In diesem Moment wurde er mit einer seiner schlimmsten Ängste direkt und unverhohlen konfrontiert: dem sozialen Abstieg.
Er sah vor seinem inneren Auge, wie die Leute von der Bank an seiner Haustür klingelten. Sie trugen dunkle Anzüge und blickten mit versteinerten Mienen in den Türspion. Unweigerlich kam die Erinnerung an Claires Beschreibung von Gisberts gestrigem Besuch in ihm hoch. Nun konnte er sich einen Reim darauf machen. Wie sollte er es Violette und den Kindern erklären?
»Es tut mir leid, Jacques, dass ich keine bessere Nachricht für dich habe. »Es tut mir leid«, holte Gisbert ihn aus seinen Gedanken zurück.
Betretenes Schweigen, eine unangenehme Stille legte sich über den Raum.
Nachdem er den ersten Schock verdaut hatte, stieg die Wut in ihm auf. Da sitzt dieses Arschloch in seinem protzigen Stuhl, hinter seinem protzigen Schreibtisch, und sagt, er könne nichts mehr für mich tun. Dieses Arschloch, an den ich die besten Jahre meines Lebens verhökert habe. Für was? Ist das der Dank? Ist das Gerechtigkeit?
Obwohl er seinen Job nicht geliebt hatte und ihm die Arbeit in den letzten Jahren immer schwerer gefallen war, traf ihn das soeben Gesagte härter, als er es jemals für möglich gehalten hätte. Wie eine Abrissbirne schlug diese Nachricht in sein Leben.
Nachdem er sich etwas gesammelt hatte, rutschte ihm ein »Scheiße« über die Lippen. Er stand auf und ging aus dem Büro seines ehemaligen Chefs, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Er hatte immer an Gerechtigkeit geglaubt. Die gab es jedoch nicht – zumindest nicht in seinem Fall. Der Fleiß der letzten Jahre war wie ein Tropfen Wasser auf einem heißen Stein verdampft.
Wieder betretenes Schweigen – diesmal in Jacques’ Büro. Sie würden die bestehenden Aufträge noch abwickeln und keine neuen mehr annehmen. Bezüglich der ausstehenden Gehaltszahlungen würden sie vom Insolvenzverwalter Bescheid bekommen.
»Das war es dann wohl«, meinte sein Kollege nüchtern. »Der Letzte macht das Licht aus.«
»Ich muss das jetzt erst mal sacken lassen«, sagte der andere.
Jacques schwieg. Er wusste einfach nicht, was er hätte sagen sollen.
Sein Blick fiel auf das Bild auf seinem Schreibtisch. Violette und die Kinder waren darauf zu sehen, wie sie unbeschwert in die Kamera lachten. Er nahm das Foto und ließ es in seine lederne Tasche gleiten. Es war das Einzige, was er mitnehmen würde.
War er überhaupt je wirklich hier gewesen?
Ein paar quälende Telefonate später wusste er nicht, was er hier noch ausrichten sollte. Ein letztes Prüfen des E-Mail-Postfachs. Ein letzter Blick auf die bunt blinkende Landkarte der Planungssoftware.
Vor seinem inneren Auge sah er, wie Gisbert vom Bergmassiv stürzte und neben ihm auf dem Boden zerplatzte.
»Dieses Arschloch fährt Porsche – und wir?«, entfuhr es ihm.
»Was ist mit uns, verdammt? Wo bleiben wir, die diesen Laden am Laufen gehalten haben? Könnt ihr euch vorstellen, in welcher Scheiße ich jetzt sitze?«, sagte er mit erhobener Stimme.
Die beiden anderen sahen ihn für einen kurzen Moment perplex an. »Wir sitzen alle in der Scheiße, Jacques«, sagte einer; der andere nickte stumm.
Nachdem er die letzten Aufgaben erledigt und sich von allen noch anwesenden Kollegen teils schweren Herzens verabschiedet hatte, stieg er in seinen Wagen. Es war später Nachmittag und noch immer bewölkt, hatte aber aufgehört zu regnen.
Er blieb noch einen kurzen Moment sitzen, bevor er den Zündschlüssel herumdrehte. Er war kein emotionaler Typ, aber der Abschied von seinen Kollegen ging ihm nahe.
Er sah, wie Claire gerade von einem Mann abgeholt wurde – ihrem Freund, wie er vermutete. Er ertappte sich dabei, wie er ihn beneidete. Sie sah ihn im Auto sitzen und winkte; er winkte zurück.
Dann fuhr er los. Kein Blick zurück – in eine ungewisse Zukunft.
Glück im Unglück
Fast ungebremst krachte er in das Heck des Lieferwagens. Er hatte noch versucht zu bremsen, aber es war bereits zu spät. Er war in Gedanken und hatte die Bremslichter zu spät wahrgenommen.
Quietschende Reifen, ein ohrenbetäubendes Knallen. Mit einem heftigen Ruck wurde er nach vorne geschleudert, der Gurt schnitt sich in seine Brust und der Airbag bremste sein Gesicht unsanft. Alles ging so schnell, dass er kaum realisierte, was gerade passiert war.
Der Airbag fiel langsam in sich zusammen und gab den Blick auf die Motorhaube frei, die sich wie ein Blatt Papier zusammengefaltet hatte. Weißer Qualm drang aus dem zerquetschten Motorraum. Das Autoradio funktionierte noch und spielte gerade die Nachrichten ab.
Benommen schnallte er sich ab. Es bedurfte einiges an Kraftaufwand, um die Fahrertür zu öffnen. Sie knackte und quietschte, aber der Spalt war groß genug, sodass er aussteigen konnte. Als er nach unten sah, bemerkte er, wie Blut auf sein Hemd tropfte. Sein Schädel brummte, sein Rücken pochte.
»Ist alles in Ordnung?«, hörte er eine weibliche Stimme hinter sich. Er drehte sich um, und eine korpulente Frau mittleren Alters blickte ihn an. Er nickte stumm.
Die Fahrertür des Lieferwagens, den es einige Meter nach vorne geschoben hatte, öffnete sich. Ein junger Mann sprang heraus. Aus dem Mund des Mannes ergoss sich ein Schwall feinster französischer Flüche.
»Es tut mir leid, ich habe zu spät gesehen …«, setzte Jacques an, aber bevor er den Satz beenden konnte, erntete er einen weiteren Fluchschwall.
Der junge Mann ging um die Autos herum, um das ganze Ausmaß des Schadens zu begutachten. Sie befanden sich an einer Kreuzung in Castanet-Tolosan, etwa einen halben Kilometer von Jacques’ Haus entfernt.
Die Ampel hatte bereits wieder auf Grün umgeschaltet, und der Verkehr wollte weiterfließen – konnte aber nicht. Autos hupten, und sobald kein Gegenverkehr kam, scherten sie auf die Gegenspur aus und überholten die Unfallstelle hektisch.
Der junge Mann kam wieder auf ihn zu.
»Alter … Ich fürchte, Sie brauchen einen Abschleppwagen«, stellte er salopp fest.
»Die Schuldfrage ist ja wohl eindeutig. Ich muss die Polizei hinzuziehen, ist nicht mein Auto. Gehört der Firma. Ach ja, Sie bluten da aus der Nase«, fuhr er fort.
»Ja, der ist Ihnen voll draufgeknallt, ich hab’s gesehen!«, sagte die Frau, die noch immer an der gleichen Stelle stand.
»Ja, ich hab’s auch gesehen!«, herrschte Jacques die Frau unvermittelt an. »Ich bin doch nicht blöd, ich weiß, dass ich schuld bin! Ja, es war mein Versagen!«
»Na, dann werde ich hier wohl nicht mehr gebraucht!«, giftete sie empört zurück und entfernte sich in Richtung ihres Autos.
»Ja, das sehe ich auch so!«, rief er ihr hinterher. Renitente Kuh.
Der Unfallgegner hatte bereits sein Mobiltelefon am Ohr und telefonierte mit der Polizei.
»Wären Sie bitte so freundlich, mir Ihr Telefon zu leihen? Ich weiß gerade nicht, wo meines ist. Ich bin Mitglied beim ACA und muss dort anrufen, wegen des Abschleppwagens«, bat Jacques ihn, nachdem er aufgelegt hatte.
»Ja klar. Die Polizei ist unterwegs. Kann aber dauern, meinten die«, antwortete der junge Mann und überreichte ihm ein klobiges, schwarzes Smartphone.
»Die Kosten für das Telefonat werde ich Ihnen selbstverständlich erstatten.«
»Lass stecken, ist eh ein Firmentelefon«, kam es trocken zurück.
Während Jacques in der Warteschleife der ACA-Hotline hing, sah er dem jungen Mann zu, wie dieser eine Warnweste anzog und ein Warndreieck platzierte.
Er war noch immer benommen; das Blut auf seinem Hemd hatte bereits einen rostroten Farbton angenommen. Wieder zogen hupende Autos vorbei, besetzt mit gestikulierenden und gaffenden Menschen. Am Bürgersteig neben der Straße hatten sich ein paar Schaulustige versammelt.
Es dauerte fast eine Stunde, bis endlich ein Streifenwagen der Police municipale auftauchte. Ein jüngerer und ein älterer Polizeibeamter stiegen aus, beide setzten ihre Dienstmützen auf.
»Ah, die Flics sind da«, ließ der Fahrer des Lieferwagens verlauten. Zielstrebig kamen die beiden Polizisten auf sie zu.
»Klassischer Auffahrunfall«, stellte der jüngere Polizist fest.
Was für ein Schlaumeier!, dachte Jacques, hielt es aber für unklug, das auszusprechen.
»Wer ist der Fahrer des Renault?«, wollte der ältere Polizist wissen.
»Das bin ich«, antwortete Jacques.
Der Polizist sah ihn an. »Brauchen Sie einen Arzt?«
»Nein.«
»Führerschein, bitte«, sagte der Beamte knapp und bestimmt. Jacques gehorchte.
»Sind Sie der Halter des Wagens?«, fragte der Polizist, nachdem er den Führerschein in Augenschein genommen hatte.
»Ja.«
»Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden?«
Hab ich eine Wahl? Er nickte.
»Haben Sie einen Atemalkoholtester dabei?«
»Ja. Im Handschuhfach. Ich weiß allerdings nicht, was davon noch übrig ist.«
Der Beamte blickte auf die völlig deformierte Front des Renault, dann wies er seinen jüngeren Kollegen an, einen Alkoholtester aus dem Dienstfahrzeug zu holen. Der Test verlief negativ – wie erwartet.
Gerade als die Polizeibeamten die Aufnahme des Unfalls beendet hatten, hielt das Fahrzeug eines örtlichen Abschleppunternehmens hinter dem Streifenwagen.
»Endlich!«
»Soll ich Sie irgendwohin mitnehmen?«, fragte der Fahrer des Abschleppwagens, nachdem er das Auto aufgeladen hatte.
»Nein, die paar Meter kann ich zu Fuß gehen. Danke«, erwiderte Jacques.
»Ok, dann bekomme ich noch eine Unterschrift.«
Er unterschrieb das Formular des Automobilclubs und machte sich auf den Weg nach Hause. Etwas Bewegung wird mir guttun.
Eigentlich wollte er gar nicht nach Hause. Denn dort würde sicher schon Violette auf ihn warten, und er musste ihr beichten, dass er heute seinen Job verloren hatte. Und dann noch das mit dem Auto. Vor Kurzem hatte er die Kfz-Versicherung von Voll- auf Teilkasko umstellen lassen – um Geld zu sparen. Er würde auf dem Schaden, den er grob auf mindestens zehntausend Euro schätzte, sitzen bleiben.
Was für eine Misere.
Zu allem Übel hatte sich der Himmel wieder zugezogen, und ein starker Regenschauer ergoss sich über die Kleinstadt. Doch dann wurde ihm plötzlich bewusst, dass er am Leben war. Am Leben und unverletzt, abgesehen von einer blutigen Nase und ein paar Schrammen. Er spürte sich.
Das Wertvollste, was er besaß, hatte er behalten.
Zuhause angekommen stellte er fest, dass er neben seinem Mobiltelefon auch seinen Schlüsselbund vermisste. Beides musste in seiner Jacke sein, die noch in seinem Wagen lag. In der ganzen Aufregung hatte er völlig vergessen, sie aus dem Auto zu holen.
Bis auf die Haut durchnässt, blieb ihm keine andere Wahl, als zu klingeln. Sophia öffnete die Tür.
»Papa, was ist denn passiert?«
Er kämpfte mit den Tränen, brachte kein Wort heraus – aber er musste stark sein vor seiner Tochter.
»Mama hat versucht, dich zu erreichen. Wir haben uns schon Sorgen gemacht«, flüsterte sie, während sie ihren Vater umarmte.
Zum ersten Mal seit Langem fühlte er sich wieder geliebt und geborgen – in den Armen seiner Tochter. Er genoss diesen kurzen Moment und schaffte es, die Fassung zu bewahren, bevor sie beide ins Haus gingen.
Neue Wege
Violette war aufgebracht. Ihre Wangen waren gerötet, wie immer, wenn sie wütend war.
»Warum hat er euch das nicht schon früher gesagt? Er hat dich einen ganzen Monat umsonst schuften lassen! Das ist dir klar, oder?«, polterte sie.
Sie saßen am Küchentisch, Violette hatte Sophia nach oben geschickt. Marc war noch nicht zu Hause; wahrscheinlich mit seinen Freunden unterwegs. Jacques saß geknickt und leicht in sich zusammengesackt auf dem Stuhl. Er hatte ihr alles erzählt.
»Und das mit der Versicherung! Was hast du dir überhaupt dabei gedacht?«, setzte sie nach.
»Gisbert – ich habe gleich gewusst, dass er die Firma seines Vaters früher oder später gegen die Wand fahren wird! Dieser Taugenichts!«, zischte sie.
»Aber es steht ja noch gar nicht fest, ob ich für diesen Monat Geld bekomme oder nicht. Wir müssen warten, was der Insolvenzverwalter sagt«, versuchte er, sie zu beschwichtigen.
Aber Violette war nicht zu beschwichtigen. Trotz der Wut in ihrem Gesicht wirkte sie fast anmutig unter dem trüben Licht der antiken Hängelampe über dem Tisch. Man sah ihr nicht an, dass sie neununddreißig war. Sie trug schwarzes, schulterlanges Haar, und ihr strenges, aber hübsches Gesicht zierte eine dezente Brille, hinter der smaragdgrüne Augen hervorfunkelten. Sie war in Fahrt. Sie war eines dieser schönen französischen Mädchen, von denen jeder Mann träumen musste, sie eines Tages zu treffen, wenn er nach Frankreich reiste.
»Du brauchst schnellstmöglich einen neuen Job, das ist dir klar, oder?«, sagte sie in forderndem Ton.
»Ja, klar weiß ich das! Denkst du, ich bin ein Idiot?«, konterte er. »Glaubst du, ich hab mir diese verdammte Scheiße ausgesucht?«
»Hör auf zu fluchen in diesem Haus!«, keifte sie.
Er dachte an das Jesuskreuz, das im Flur hing. Violette hatte damals darauf bestanden, es aufzuhängen. Er selbst hielt nicht viel auf Gott oder irgendeine Form von Glauben. Er hatte seinen Glauben schon vor langer Zeit verloren.
»Ich fluche, wann und wo ich will!«, erwiderte er trotzig.
»Wo ist denn dein Gott, wenn man ihn mal braucht? Sacrebleu!«
»Du mit deiner Blasphemie! Vielleicht hättest du öfter mal beten sollen. Aber du hast ja keine Zeit für so etwas«, konterte sie mit zittriger Stimme, während sie in Tränen ausbrach.
»Wie soll das denn jetzt weitergehen?«, schluchzte sie.
Es folgte einige Minuten betretenes Schweigen.
»Mir wird etwas einfallen«, sagte er und versuchte, zuversichtlich zu wirken, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte. Er war aufgestanden und hatte seine Hand auf ihre Schulter gelegt. Zögerlich streichelte sie seine Finger.
»Es wird schwer werden, etwas zu finden. Wir haben kein Auto mehr und Speditionen in der Nähe gibt es nicht viele«, sagte sie.
»Ich werde morgen mit dem Bus nach Toulouse fahren und mich auf dem Amt arbeitslos melden. Dann sehe ich, wie viel Unterstützung uns zusteht – ich bin da nicht auf dem Laufenden«, erwiderte er. »Und ich werde mit der Bank reden, vielleicht können die uns ein bis zwei Raten für das Haus stunden.«
»Und was ist mit dem Wagen? Der war noch nicht mal abbezahlt. Einen Neuen können wir uns nicht leisten«, warf sie ein.
»Ich fürchte, wir müssen vorerst ohne auskommen«, sagte er und dachte an sein altes Fahrrad, das in der Garage stand. Er hatte es seit Jahren nicht mehr benutzt. Der Unfall hatte sein Ego gekränkt. Ihm war das passiert, ausgerechnet ihm. Er, der einstige Rallye-Pilot, der sich selbst immer als guten und sicheren Autofahrer eingeschätzt hatte.
Er hörte, wie sich das Türschloss öffnete. Einen kurzen Moment später stand Marc in der Tür. Er sah seine Eltern skeptisch an.
»Hallo, Marc«, sagte Jacques.
»Wo warst du?«, fuhr Violette ihren Sohn in strengem Ton an.
»Ich war mit Denis und Gérard in der Stadt«, rechtfertigte sich Marc.
»Ich will nicht, dass du dich mit diesem Gérard herumtreibst. Der tut dir nicht gut. Das habe ich dir schon oft genug gesagt!«, herrschte sie ihn an.
Es folgte eine kurze Grundsatzdiskussion zwischen den beiden; Jacques beschloss, sich rauszuhalten. Er befürchtete, die Stimmung würde sich sonst noch weiter aufheizen. Nachdem Marc beleidigt auf sein Zimmer gegangen war, wandte sich Violette wieder ihm zu.
»Du hättest ruhig auch mal etwas sagen können. Er ist auch dein Sohn!«
Mit einem gedrückten »Ja, ich weiß« quittierte er ihren Vorwurf. Sie saßen noch lange zusammen. Er wusste nicht, wann sie das letzte Mal eine so intensive Unterhaltung geführt hatten.
In dieser Nacht schliefen sie miteinander. Es fühlte sich anders an als sonst. Er konnte nicht sagen, warum. Er fühlte sich so frei und lebendig wie schon lange nicht mehr. In all den Jahren hatte sich eine Art Routine eingeschlichen. Er empfand den Sex meist als gut, aber die anfängliche Leidenschaft war im Laufe der Zeit nahezu unbemerkt versiegt. Er dachte einen Moment daran, wie es war, als sie sich kennengelernt hatten. Er lag noch wach im Bett; Violette war bereits eingeschlafen. Seine Gedanken fielen auf den folgenden Tag. Unbekannte Herausforderungen würden auf ihn warten. Ungewohnte Muster. Andere Menschen. Neue Wege, die er beschreiten musste. Er hatte seinen ungeliebten Job verloren und damit seine einst unbestrittene Rolle als Ernährer der Familie. Dieser Gedanke füllte ihn mit schmerzhafter Leere. Das Kartenhaus seines Lebens war an nur einem einzigen Tag zusammengebrochen.
Am nächsten Morgen wachte er auf, noch bevor der Wecker klingelte. Heute würde er Frühstück für Violette und die Kinder machen. Dieser Gedanke half ihm gegen das aufkeimende Gefühl von Nutzlosigkeit. Er fragte sich, ob es seinen ehemaligen Kollegen wohl ähnlich ergehen würde. Sie frühstückten an diesem Tag gemeinsam, als Familie. Er genoss es, und er hatte das Gefühl, die anderen auch. Nachdem alle ihrer Wege gegangen waren, räumte er auf und setzte sich an den Küchentisch. Heute würde er nicht mehr seinen Wagen starten und den gleichen Weg fahren, den er die letzten elf Jahre gefahren war. Diese Leere … Ihm wurde zum ersten Mal wirklich bewusst, wie einsam er war. Das einstige Bergmassiv in seinem Kopf war einer trostlosen Steppe gewichen. Keine Menschen mehr, die auf ihn herabsahen. Einfach niemand mehr.
Er verließ das Haus, die Tür fiel krachend ins Schloss. Es ging nur nach vorn. Sein Blick fiel auf die leere Einfahrt, in der einst sein Wagen parkte.
»Guten Morgen, Jacques!«, hallte es von rechts. Frederic, sein Nachbar, stand am Zaun. Der hat mir gerade noch gefehlt. Frederic war ein äußerst geschwätziger Mensch, der sich gerne profilierte. Jacques hatte sich oft seine Geschichten angehört – oder er ließ sich ein Gespräch aufzwingen, aus Höflichkeit und um der guten Nachbarschaft willen. Und natürlich, weil es ihn viel zu viel Überwindung gekostet hätte, einfach Nein zu sagen.
»Na, wo ist denn dein Wagen?«, fragte Frederic mit argwöhnischem Unterton.
»Guten Morgen. Ist in der Werkstatt«, antwortete Jacques karg.
»Ich hab dir doch gleich gesagt, du sollst dir was Anständiges kaufen!«, sagte Frederic und schielte mit einem süffisanten Lächeln auf den glänzend aufpolierten BMW in seiner Einfahrt.
»Was die Deutschen da gebaut haben, ist wirklich genial. Biturbo-Diesel, diese Maschine …«, setzte Frederic an.
»Das interessiert mich einen Dreck! Ich scheiß auf deine verdammte Karre! Lass mich einfach in Ruhe!«, fiel er ihm ins Wort.
Die Kinnlade seines Nachbarn klappte herunter, und er sagte keinen Ton mehr. Selbst überrascht von seiner Reaktion verließ Jacques das Grundstück und machte sich auf den Weg zur Bushaltestelle. Das war bitter nötig. Längst überfällig.
An die Haltestange geklammert, spürte er erneut diese Leere in sich. Für eine ältere Dame hatte er seinen Sitzplatz freigemacht, während er sich auf dem Rückweg von einem ernüchternden Besuch beim Arbeitsamt befand. Er musterte die anderen Menschen im Bus: wie sie in ihrer Vielfalt aus unterschiedlichen Kleidungsstilen, Hautfarben und Altersklassen herumstanden oder saßen. Wo kommen diese ganzen Menschen nur her? Wo gehen sie hin? Sind sie wirklich alle zufriedener und glücklicher als ich? Er kam zu dem Schluss, dass wohl ein jeder sein Päckchen zu tragen habe. Er hatte zwar ein kaputtes Auto, aber wenigstens noch gesunde Beine.
Die Schiebetüren öffneten sich, und eine Menschentraube ergoss sich auf den Bürgersteig. Er setzte sich zügig von der Menge ab und ging zum Autohaus, in das sein Wagen abgeschleppt worden war – dort hatte er ihn auch gekauft. Er sprach mit einem älteren, grauhaarigen Werkstattmeister, der einen blauen Kittel trug. Er kannte ihn vom Sehen.
»Der Rahmen ist verzogen, das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden«, sagte der Meister.
»Da ist so ziemlich alles hin, was nur hin sein kann. Sie werden ja von der Versicherung einen Neuen bekommen«, meinte er flapsig.
Jacques ließ das unkommentiert und bedankte sich. Er vereinbarte, den Kostenvoranschlag abzuwarten. Er holte seine Jacke samt Schlüsselbund und Mobiltelefon aus dem zerstörten Renault und verließ das Gebäude. Auf seinem Telefon waren drei Anrufe in Abwesenheit mit gestrigem Datum verzeichnet – Violettes Nummer. Draußen sah er sich die Gebrauchtwagen auf dem Hof an. Es war keiner dabei, den er sich auch nur ansatzweise hätte leisten können.
So fühlt es sich also an, wenn man mittellos ist.
Hoffnung
Es war Dienstag, und knapp zwei Wochen waren seit seiner Kündigung vergangen. Das morgendliche Aufstehen fiel ihm von Tag zu Tag schwerer. Das tägliche Frühstück mit der Familie blieb die einzige Konstante, eine neue Form von Rhythmus. Tagsüber war er allein.
Er nutzte die Zeit, um sich Stellenangebote im Internet anzusehen – was jedes Mal in einem noch stärkeren Frustgefühl endete als am Vortag. Er kümmerte sich um Dinge, die in den letzten Jahren zu kurz gekommen waren: kleine Reparaturen am Haus, hier und da, zumindest solange es ihnen noch gehörte. Staubsaugen. Rasen mähen. Unkraut jäten. Einkaufen, auch wenn er es nicht mochte. Es war besser, als zu Hause herumzusitzen und nichts zu tun.
Aber was wollte er eigentlich? Was erwartete er vom Leben? Sein Job hatte ihn schon lange nicht mehr erfüllt, doch mit der jetzigen Situation ging es ihm noch schlechter. Er trieb ziellos umher, wie eine Nussschale im Ozean, in der Hoffnung, irgendwo auf einer paradiesischen Insel zu stranden, wo alles besser war. Ihm war bewusst, dass er einzig und allein aus eigenem Antrieb aus dieser Situation entkommen konnte; doch genau der fehlte ihm.
Die Bank würde ihnen zwei Raten stunden. Gegen Bearbeitungsgebühr natürlich. Wie er dieses ausbeuterische Bankensystem verfluchte. Da brummte man denen, die ohnehin schon in der Klemme saßen, noch zusätzliche Kosten auf. Und das, obwohl er seit Jahren treuer Kunde bei dieser Bank war. War das gerecht? Auf der anderen Seite war er froh, dass die Stundung überhaupt möglich war.
Er leerte den Briefkasten. Darin fand er einen Brief von der Bank, einen vom Amt und einen vom Autohaus sowie einen Werbeflyer des örtlichen Supermarkts. Er öffnete den Brief des Autohauses. Der Kostenvoranschlag konnte es nicht sein – den hatte er schon vor einer Woche erhalten. Der Brief enthielt die Aufforderung, binnen einer Woche mitzuteilen, wie mit dem Wagen weiter zu verfahren sei; andernfalls würden Standgebühren erhoben. Darum hatte er sich noch nicht gekümmert.
Er ging zurück ins Haus und warf den Brief, zusammen mit den beiden ungeöffneten Schreiben in den Zeitungskorb im Flur. Es war ihm gleichgültig. Er beschloss, in die Garage zu gehen und sein altes Modellflugzeug wieder in Schuss zu bringen. Er war einmal ein ziemlich geübter Modellpilot gewesen. Früher war er oft mit Marc zusammen geflogen. Zumindest würde ihm das etwas Ablenkung verschaffen.
Die Garage stand voll mit allem möglichen Plunder. Sein Blick fiel auf eine alte Wanduhr, und er überlegte, was man davon wohl zu Geld machen könnte. Im nächsten Moment verwarf er den Gedanken wieder – wer will dieses Gerümpel schon? Nachdem er sich den Weg freigeräumt hatte, kramte er den eingemotteten Flieger samt Fernbedienung hervor und machte sich an die Arbeit.
Später kochte er für die Kinder. Violette hatte den Abend, an dem sie mit ihrer Freundin ausging. Wirklich kochen konnte er nicht; Violette hatte das ja immer übernommen, solange er denken konnte. Also wurde es eine selbst belegte Pizza. Und die schmeckte nicht mal schlecht.
Beim Essen erzählte ihm Sophia, wie es ihr in der Schule erging. Was für ein hübsches und intelligentes Mädchen sie doch ist, dachte er voller Stolz.
Marc war nicht zum Essen aufgetaucht. Er trieb sich sicher wieder herum. Ich muss ein ernstes Wort mit ihm reden. Unbedingt. Bisher hatte er das aufgeschoben, weil er einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen war. Ich muss mich dem stellen.
Als Violette nach Hause kam, war er noch wach. Sie roch nach kaltem Zigarettenrauch, Parfüm und Kneipe. Marc war zwischenzeitlich auch aufgetaucht, hatte ihm jedoch ausweichend geantwortet und sich in sein Zimmer geflüchtet. Er verspürte nicht die notwendige Energie, die es gebraucht hätte, um seinem Sohn die Pistole auf die Brust zu setzen. Also ließ er es dabei bewenden. Für heute.
»Na, wie war es denn heute?«, fragte er.
»Sehr lustig war es – und weißt du, wen ich wieder getroffen habe?«
»Lass mich raten: Claude«, sagte er nach kurzem Überlegen.
»Ja, wie konntest du das nur wissen?«, scherzte sie; er bemerkte, dass sie leicht angetrunken war.
»Claude war so nett, mich nach Hause zu fahren«, fuhr sie fort. Sein Magen zog sich leicht zusammen. Ihm missfiel, dass seine Frau in letzter Zeit immer wieder mit diesem Claude zu tun hatte. Nun fährt er sie sogar schon bis vor das Haus. Er sagte nichts; er war nicht in der Stimmung, einen Streit zu provozieren, zumal sie getrunken hatte.
»Ich hab eine tolle Neuigkeit für dich!«
»Was denn?«
»Ein Bekannter von Claude betreibt eine Reifenwerkstatt im Nachbarort. Er heißt Gaston Brunel und sucht noch jemanden. Claude hat mir seine Nummer gegeben.«
»Ich soll als Reifenmonteur arbeiten?«, fragte er verdutzt. Er dachte kurz darüber nach. So abwegig war das gar nicht. Er kannte sich mit Autos ganz gut aus, noch aus seiner Zeit als Rallyefahrer. So viel hatte sich seit damals ja nicht an Fahrzeugen und Reifen geändert. Allerdings widerstrebte es ihm, dass der Tipp ausgerechnet von diesem Claude kam.
»Du könntest mit dem Fahrrad dorthin fahren, es sind nur drei Kilometer. Und es braucht ja nur vorübergehend zu sein«, fügte sie voller Zuversicht an.
Auf ihr unnachgiebiges Drängen hin gab er schließlich nach.
»Okay, ich werde morgen mit dem Fahrrad dorthin fahren und mit diesem Gaston reden. Schaden kann es ja nicht.«
Violette fiel ihm um den Hals und drückte ihm einen dicken Kuss auf die Wange. Das hatte sie schon lange nicht mehr getan.
Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, verließ er das Haus, um mit dem Fahrrad zu der Reifenwerkstatt nach Mervilla zu fahren. Er wusste ungefähr, wo sie war, und wollte es auf gut Glück versuchen. Der Himmel war wolkenlos, und die Maisonne entfaltete gerade ihre Kraft. Es schien ein schöner, sonniger Tag zu werden.
Er benutzte den Chemin Joseph Gayssot, der teils durch grüne Mischwälder und entlang von Feldern führte, teils an einer Schnellstraße verlief. Es fühlte sich gut an, in die Pedale zu treten und die laue, sommerliche Morgenluft im Gesicht zu spüren. Er nahm die Gerüche der Natur um ihn herum auf: feuchter Waldboden, frisch gemähtes Gras. Dinge, die er im Auto nie bewusst wahrgenommen hatte. Nach etwa zwanzig Minuten erreichte er sein Ziel.
Vor ›Gastons Garage‹ stieg er ab und lehnte das Rad an die Wand. Ein flacher, eckiger Werkstattbau an der Schnellstraße, mit grauer, verwitterter Fassade – sie erinnerte ihn an seine alte Firma. Vorn ein kleiner Eingang mit Vordach und milchiger Tür; daneben ein Fenster und ein schmales Garagentor. Davor ein schwarzer Geländewagen, neu und glänzend wie das Gefieder einer Krähe in der Sonne. Ein gelber Pfeil an der Wand wies nach hinten.
Er beschloss, es erst einmal am Haupteingang zu versuchen. Er war abgesperrt. Durch das verschmutzte Fenster erkannte er die Umrisse eines schmuddeligen Büros. Dem Wegweiser folgend, gelangte er zu einem umzäunten Hinterhof. Der Zaun war etwa 1,80 Meter hoch – etwas höher, als er selbst groß war. Das Stahltor stand offen. Auf der Rückseite des Gebäudes befanden sich zwei große, hellbraune Rolltore nebeneinander; eines davon war geöffnet.
Er ging über den Hof, an Fässern, Reifenstapeln und zwei ausgeschlachteten Autowracks vorbei, und betrat die Werkstatt durch das geöffnete Rolltor.
»Hallo?«, rief er.
Ein Mann trat aus einer dunkelgrauen Brandschutztür, die zum vorderen Teil des Gebäudes führte. Der untersetzte Typ war um die fünfzig, trug einen Blaumann, und seinen Kopf zierte eine breite Glatze mit spärlichem, dunklem Haarbewuchs an den Rändern. In der Hand hielt er einen Schraubenschlüssel – er musterte Jacques mit grimmiger Miene und listigem Blick.
»Ja, bitte? Was kann ich für Sie tun?«, fragte er unfreundlich, in genervtem Ton.
»Sind Sie Gaston?«
»Wer will das wissen?«, konterte der Mann barsch.
»Mein Name ist Jacques Bontemps, ich komme aus Castanet-Tolosan. Ich habe gehört, Sie suchen noch jemanden.«
»Wer erzählt denn so was, hä?«, raunte der Mann.
Jacques war verunsichert. Was für ein Unsympath.
»Ja, ich bin Gaston. Und es stimmt, ich suche noch jemanden, der mir hier zur Hand geht«, sagte der Mann schließlich.
Erleichtert atmete Jacques auf.
»Woher hast du diese Info? Ich habe die Stelle nicht ausgeschrieben!«, duzte Gaston ihn plötzlich.
»Ich weiß es von Claude. Claude Chevalier.«
»Ah, der. Ja, ist ein Kunde von mir. Hast du Erfahrung?«, sagte Gaston mit gerunzelter Stirn.
»Erfahrung womit?«, fragte Jacques, noch immer unsicher.
»Ja, womit wohl – wonach sieht’s denn aus, hä? Du kannst vielleicht dämliche Fragen stellen. Das hier ist ein Reifenservice, klingelt’s?«, sagte Gaston mit erhobener Stimme und zynischem Unterton.
»Außerdem machen wir auch kleinere Reparaturen – Bremsen tauschen, Ölwechsel und so weiter.«
Er verspürte den Drang, sich umzudrehen und einfach zu gehen. Aber er riss sich zusammen.
»Ich hab die letzten Jahre in einer Spedition gearbeitet. Aber früher bin ich Rallye gefahren und hab fast alle Reparaturen selbst durchgeführt. Außerdem …«
»Ja, ja, das reicht!«, fiel Gaston ihm ins Wort und musterte ihn. »Von mir aus kannst du morgen zur Probearbeit kommen, dann sehen wir weiter. Was Besseres kommt ja ohnehin nicht. Also, bis morgen um acht.«
»Vielen Dank!«
»Ja, ja, überschlag dich nicht gleich vor lauter Begeisterung!«, sagte Gaston, drehte sich um und schlug die Tür wieder hinter sich zu.
Altes Neuland
Nach dem Probetag hatte Gaston ihm mitgeteilt, dass er ihn einstellen würde. Er lernte den Umgang mit der Reifenmontiermaschine und der Wuchtmaschine schnell. Mit anderem Werkzeug, etwa der Hebebühne, war er ohnehin vertraut. Eine Besonderheit von Gastons Reifenservice war die Ausrüstung zum Aufziehen und Wuchten von Lkw-Reifen.
Anfangs machte ihm die schwere körperliche Arbeit zu schaffen; er war sie einfach nicht gewohnt. Die jahrelange Büroarbeit hatte ihn körperlich abbauen lassen. Abend für Abend dachte er, sein Rücken würde ihn umbringen. Aber er war drahtig, und er biss sich durch.
Schwerer als die Arbeit wog, Gaston zu ertragen. Er war ein Choleriker und Chauvinist erster Güte. Jacques verstand, warum sein Vorgänger aufgehört haben musste. Aber er biss die Zähne zusammen. Er nahm es in Kauf – besser, als nichts zu tun. Die Bezahlung war schlecht, nur ein paar Euro über der Arbeitslosenhilfe. Doch so hatte er zumindest das Gefühl, wieder etwas zu leisten, wieder etwas wert zu sein. Und er hatte Ruhe vor dem Arbeitsamt. Die Stimmung zu Hause hatte sich gebessert – Violette war spürbar erleichtert, als sie hörte, dass er den Job angenommen hatte.
Je mehr er sich einarbeitete, desto öfter zog sich Gaston in sein Büro zurück. Ihm war das recht; so musste er sich dessen plumpe, sexistische und rassistische Sprüche nicht anhören. Ansonsten gab Gaston nicht viel von sich preis, und Jacques fragte nicht. Sein neuer Boss war meist vor ihm da und oft noch in der Werkstatt, wenn Jacques nach Hause fuhr. Zu Stoßzeiten herrschte reges Treiben, dazwischen war es meist ruhig. Tagsüber wirkte das Industriegebiet sehr belebt, gegen Abend wie ausgestorben.
Der Umgang mit den Kunden tat ihm gut. Der Smalltalk brachte ihn weg von seinen Sorgen, und manche gaben gern ein paar Euro Trinkgeld. Die Lkw-Fahrer packten meist selbst mit an, denn die Felgen und Reifen der Lastwagen waren um einiges größer und schwerer als die der normalen Autos. Einige Kunden bestellten ihre Reifen im Internet und ließen sie direkt in die Werkstatt liefern. Für das Montieren verlangte Gaston bei solchen Kunden einen Aufschlag – »schon aus Prinzip«, wie er zu sagen pflegte.
Ein großer, weißer Sattelschlepper mit MAN-Zugmaschine fuhr auf den Hof. Die hydraulischen Bremsen zischten, und das Fahrerhaus neigte sich nach vorn, als er zum Stehen kam. Ein schlaksiger Mann mit dunklem Teint stieg aus. Er stellte sich als Ghali vor. Jacques vermutete, dass er marokkanischer Abstammung war. Das große Gespann passte gerade so auf den Hof.
»Ich soll hier zwei Räder tauschen lassen«, sagte der Fahrer in breitem Akzent und deutete auf die hintere Achse des Anhängers.
Jacques sah im Lager nach und fand tatsächlich zwei fertig montierte Räder; ein Zettel mit dem Namen von Ghalis Spedition hing daran. Offenbar hatte Gaston sie gestern Abend vorbereitet. Soll mir recht sein – spart Zeit.
Sie machten sich an die Arbeit. Die Räder kamen Jacques heute noch schwerer vor als sonst, was er auf die wieder aufflammenden Rückenschmerzen schob. Inständig hoffte er, dass sie fertig wären, bevor Gaston nach dem Rechten sah – was er regelmäßig tat. Ghali würde kaum vom Hof sein, da würde Gaston loslegen: Die »Kolonie-Affen« waren eines seiner Lieblingsthemen. Was für ein Arschloch. Sind das nicht Menschen wie du und ich?
Ghali war Aushilfsfahrer für eine große Spedition nahe der spanischen Grenze und offenbar öfter auf der Durchreise hier. Viele Servicemöglichkeiten für Laster gab es in der Gegend nicht. Von ihm erfuhr Jacques auch etwas über seinen Vorgänger Raul. Raul war Spanier und, so wie es klang, von heute auf morgen spurlos verschwunden. Irgendwie wirkte das dubios.
»Die alten Räder sollen hierbleiben«, sagte Ghali, als sie fertig waren.
»Wo geht’s denn eigentlich hin?«, fragte Jacques.
»Brüssel. Hab spanischen Wein geladen.«
Ghali fuhr gerade vom Hof, und Jacques dachte über Raul nach. Es beschäftigte ihn. Als er aufsah, stand plötzlich Violette vor ihm. Er hatte sie überhaupt nicht bemerkt.
»Ich dachte, ich besuche dich mal in deiner neuen Arbeit und schau, wie es dir geht. Ich habe dir einen kleinen Snack mitgebracht«, sagte sie.
Er freute sich. Im nächsten Moment trat Gaston aus der Tür zum Büro. Plötzlich empfand Jacques die Situation als unangenehm.
»Hey, schön, äh … ja, das ist Gaston, mein neuer Chef«, sagte er verlegen.
»Du sollst arbeiten und nicht rumflirten!«, schrie dieser – dann grinste er breit, und seine bräunlich-gelben, ungepflegten Zähne kamen zum Vorschein. Angst vor dem Zahnarzt? Am Geld kann es ja nicht liegen …
»Guten Tag, die hübsche Dame!«, begrüßte sein Chef Violette auf schmierige Art und musterte sie. Jacques stellte die beiden einander vor. Nach einer kurzen, oberflächlichen Unterhaltung verabschiedete sich Violette wieder und fuhr mit dem Fahrrad vom Hof. Gaston glotzte ihr mit offenem Mund hinterher.
»Was für ein geiler Hintern!«, sagte er und klopfte Jacques dreckig lachend auf die Schulter.
»Erzähl mir lieber, was es mit Raul auf sich hat«, platzte es aus Jacques heraus.
Gastons Lachen verstummte. Grimmig musterte er ihn.
»Das geht dich ’n feuchten Dreck an! Warum willst du das überhaupt wissen? Wer hat dir davon erzählt?«
»Ein Kunde eben.«
»Das war bestimmt dieser verdammte Algerier. Der erzählt viel, wenn der Tag lang ist, Junge! Mach dich lieber wieder an die Arbeit und räum die Werkstatt auf – aber dalli!«
Damit war die Konversation beendet. Schweigend rollte er die beiden Räder, die er an Ghalis Lastwagen getauscht hatte, ins Lager. Dabei fiel ihm auf, dass das Profil noch gut war. Es wunderte ihn – aber gut, wird schon seine Richtigkeit haben, dachte er und verwarf den Gedanken.
Seltsamer Tag heute …, dachte er später, als er sich mit dem Fahrrad auf den Nachhauseweg machte. Er spürte nahezu jeden Muskel seines Körpers; es brannte und schmerzte. Andererseits fühlte er sich stark und lebendig. Das hatte er lange nicht gespürt. Heute rede ich mit Marc. Von Mann zu Mann. Wir haben es vereinbart.
»Ein schmieriger Typ, dieser Gaston. Ich weiß nicht so recht, was ich von dem halten soll«, sagte Violette. Das Essen stand schon auf dem Tisch. Es gab Lasagne; sie rief die Kinder.
»So genau weiß ich das auch nicht. Aber dank ihm habe ich wieder Arbeit – zumindest, bis ich etwas Besseres gefunden habe.«
»Was hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Lange halten wir das finanziell so nicht durch«, sagte Violette.
Er nickte stumm und aß seine Lasagne. Heute genehmigte er sich zwei Portionen – zum ersten Mal, seit er sich erinnern konnte.
»Die neue Arbeit scheint dich ja ganz schön auszuzehren«, lachte Sophia.
Marc sagte nicht viel. Er war pünktlich nach Hause gekommen – ein gutes Zeichen. Offensichtlich war ihm das Gespräch mit seinem Vater wichtig.
Das anschließende Gespräch zwischen Vater und Sohn verlief ruhiger als erwartet. Marc war ein freiheitsliebender, rebellischer Junge mitten in der Pubertät. Jacques spürte, wie wenig Zeit er in den letzten Jahren bewusst mit seinem Sohn verbracht hatte. Das schmerzte. War ich ein guter Vater? Dazu kam die Angst, seinen Kindern in der aktuellen Lage nicht das bieten zu können, was andere Väter konnten. So ein Gespräch von Vater zu Sohn war längst überfällig – diese Rolle konnte nur er wahrnehmen. Sie vereinbarten, am Wochenende wieder gemeinsam mit dem Modellflugzeug zu fliegen und zusammen ins Kino zu gehen. Das wird uns guttun.
Nachdem sie gesprochen hatten, dachte Jacques an das Verhältnis zu seinem eigenen Vater. Als er in Marcs Alter war, lebte dieser seine Spielsucht und seinen Hang zum Alkohol bereits unverhohlen aus. Jacques konnte nur hilflos zusehen, wie sein Vater immer mehr zum Schatten seiner selbst wurde. Wirklich zielführende Gespräche gab es nie – nur hin und wieder eine Ohrfeige oder eine Tracht Prügel. Er war zwar physisch anwesend, emotional jedoch selten.
Seine Mutter, eine Deutschlehrerin aus Straßburg, stand dem Ganzen ebenso hilflos gegenüber, bis sie sich schließlich – viel zu spät – von ihrem Mann trennte. In der darauffolgenden Zeit fiel sie in eine Depression und in die Abhängigkeit von Tabletten. Sie hatte Jacques stets eingebläut, sich anzupassen und unterzuordnen, ein anständiger Mensch zu werden. Ihre größte Angst schien immer gewesen zu sein, er könnte eines Tages wie sein Vater enden.
Nein. So werde ich nie.
Unerwartete Wende
Es war bereits Juni geworden. Seine Bemühungen, einen besser bezahlten Job zu finden, waren bislang erfolglos. Ab dem nächsten Monat würden sie die Raten für das Haus inklusive der Stundungsgebühr bedienen müssen. Daran zu denken war frustrierend und aussichtslos. Immerhin hatte er es mit Gastons Hilfe geschafft, seinen Wagen zu einem bekannten Autoverwerter in der Gegend zu bringen – ohne weitere Kosten. Natürlich ließ Gaston keine Gelegenheit aus, ihm diese »Wohltat« unter die Nase zu reiben. Wahrscheinlich hatte er es ohnehin nur getan, weil er den Betreiber des Autohauses kannte und nicht ausstehen konnte.
Trotzdem fand Jacques immer mehr Gefallen an seiner Tätigkeit – sie war so anders als das, womit er das letzte Jahrzehnt zugebracht hatte. Durch die tägliche Fahrt mit dem Fahrrad und die körperliche Arbeit erwachten Körperbewusstsein und Kraft spürbar neu. Schmerzen hatte er kaum noch; sein Körper stellte sich langsam um.
Die Sonne brannte, und Gaston hatte ihn ausnahmsweise etwas früher nach Hause geschickt. Ihm war das recht, denn er war mit seinem Kumpel Bert verabredet. So blieb Zeit für eine Dusche und frische Kleidung. Zu Hause lehnte er das Fahrrad ans Garagentor und ging zur Haustür. Erst jetzt merkte er, dass er seinen Schlüssel vermisste. In der Arbeitsjacke. Die hing in der Werkstatt. Es blieb nur zu klingeln. Niemand öffnete; im Haus regte sich nichts. Violette war um diese Zeit gewöhnlich bei ihrer Mutter im Pflegeheim. Anrufen konnte er niemanden – auch das Mobiltelefon steckte wohl in der Jacke.
Bei Frederic würde er sicher nicht klingeln; lieber würde er sterben, als sich diese Blöße zu geben. Sophia war bei einer Freundin in Toulouse, um für eine der letzten Abiturprüfungen zu lernen. Marc war bei dem Wetter vermutlich draußen, im Schwimmbad oder am See. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zurück nach Mervilla zu fahren und zu hoffen, dass Gaston noch in der Werkstatt war.
Verdammt, murmelte er, schwang sich wieder aufs Rad und trat in die Pedale. Für die Schönheit der Natur hatte er diesmal keine Augen; er fühlte Zeitdruck und schwitzte in der drückenden Nachmittagshitze. Lediglich der Fahrtwind und der gelegentliche Schatten der Bäume verschafften etwas Abkühlung.
Nach etwa einer Viertelstunde erreichte er die Werkstatt. Gastons Geländewagen stand noch vor dem Gebäude. Erleichterung. Der vordere Eingang war jedoch abgesperrt. Am Bürofenster war der Rollladen unten; sein Klopfen blieb unbeantwortet. Auf der Rückseite war das große Hoftor verriegelt. Dahinter, so weit er sehen konnte, waren auch die Rolltore verschlossen.
Kurzentschlossen kletterte er über den Zaun. Der Maschendraht schnitt ihm in die Finger. Oben schwang er sich auf die andere Seite, stieg auf ein altes Ölfass und sprang in den Hof. Am Seitenfenster der Halle brannte trübes Licht, doch die Opalglasscheibe ließ keinen klaren Blick zu. Gerade als er klopfen wollte, hörte er Motorengeräusche, dann ein kurzes Quietschen.
Er lugte um die Ecke zur Straße. Vor dem Tor hielt ein schwarzer Mercedes; zwei Männer saßen darin. Der Fahrer hupte zweimal kurz. Instinktiv verharrte Jacques, um nicht gesehen zu werden. Nach wenigen Sekunden öffnete sich die kleine Tür im Rolltor. Gaston trat heraus, ging zum Hoftor und schloss auf. Inzwischen war auch der Beifahrer ausgestiegen, öffnete den Kofferraum und übergab Gaston ein Paket, etwa so groß wie eine Weinkiste. Sie redeten kurz; aus der Entfernung war nichts zu verstehen. Dann stieg der Beifahrer wieder ein, der Wagen schoss davon. Gaston stellte das Paket ab, verschloss das Tor und verschwand samt Paket in der Werkstatt.
Grotesk, dachte Jacques und blieb wie angewurzelt. Niemand schien ihn bemerkt zu haben. Erst nach einem Moment besann er sich auf sein eigentliches Vorhaben – die Jacke. Er ging zur Tür und öffnete sie.
In der Werkstatt kniete Gaston mit dem Rücken zu ihm an einem Lkw-Reifen. Wie vom Blitz getroffen fuhr er herum, riss die Augen auf, bis er erkannte, wer da stand.
»Du verdammtes Arschloch, was willst du hier?«, brüllte er.
»Ich wollte nur meine Jacke holen. Ich brauche meinen Schlüssel – der steckt da drin«, sagte Jacques, noch immer unsicher ob der übertriebenen Reaktion.
Sein Blick fiel auf das geöffnete Paket neben Gaston. Augenblicklich stockte ihm der Atem, der Puls schoss hoch. Gaston setzte an, erneut loszuschreien, verstummte jedoch, als er merkte, worauf Jacques starrte. Der konnte nicht glauben, was er sah – und er wusste sofort, worum es sich handelte, obwohl er nie damit zu tun gehabt hatte.
Langes, betroffenes Schweigen.
»Ist es das, was ich denke? Kokain?«, brachte er schließlich hervor.
»Nein, das ist ein neues Heilmittel gegen Krebs. Wonach sieht’s denn aus?«, gab Gaston gedämpft zurück – der Sarkasmus blieb.
Weißes Pulver, sauber zu kleinen Quadern gepresst, in Folie eingeschweißt. Leugnen war sinnlos. Jacques hatte seinen Boss bei einer höchst illegalen Nebentätigkeit ertappt.
»Nun wird mir so einiges klar«, sagte er leise, mehr zu sich selbst. Der neue Geländewagen. Die schweren, vormontierten Lkw-Räder … Plötzlich begriff er, dass er seit Wochen – ohne es zu wissen – als Werkzeug für etwas Größeres gedient hatte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken.
»Wie lange machst du das schon?«, fragte er.





























