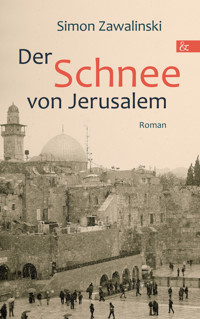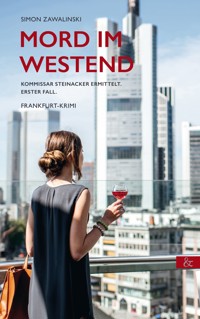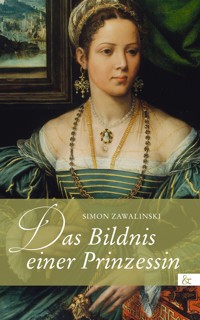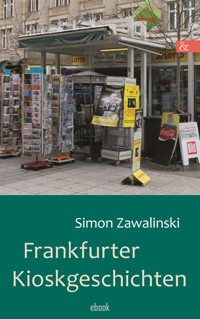
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buch&media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein Kiosk ist ein Verkaufsort, aber auch Treffpunkt und Platz zum Verweilen. Hier begegnen sich Menschen unterschiedlichster Couleur. Der Banker trifft auf den Obdachlosen, der Polizist auf den Kriminellen, der Promi auf den Gescheiterten. Es ist ein Ort, an dem Geschichten erzählt werden und neue entstehen, Schicksale zusammengeführt werden und sich wahre Freundschaften bilden. Simon Zawalinski betreibt am Rathenauplatz in Frankfurt am Main einen Kiosk, früher befand sich dieser am Börsenplatz. Seine Beobachtungen und Erlebnisse berichten aus einem Alltag, der voller Kuriositäten, interessanter Details und großer Namen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SIMON ZAWALINSKI, geboren 1952 in Stettin, lebte zunächst mit seinen Eltern in Polen. Während der antijüdischen Exzesse in den Jahren 1967 bis 1970 emigrierte er nach Israel und von dort in die Bundesrepublik Deutschland, wo er sich in Frankfurt am Main niederließ. Noch in Polen schrieb er als Jugendlicher Gedichte und Erzählungen. In Israel redigierte er mit anderen Mitgliedern eine Kibbuzzeitung, für die er auch regelmäßig schrieb. In Deutschland war er Mitherausgeber und Autor einer polnischen Exilzeitschrift. Von ihm erschienen bereits die Romane »Der Ostpark-Blues« (2010) und »Der Schnee von Jerusalem« (2013). Sein Theaterstück »Der polnische Patient« wurde 2014 erfolgreich in Frankfurt am Main uraufgeführt.
Simon Zawalinski
Frankfurter Kioskgeschichten
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter www.buchmedia.de
März 2015 © 2015 Buch&media GmbH, München Lektorat: Christa Opitz-Schwab Umschlaggestaltung: Kay Fretwurst, Freienbrink unter Verwendung eines Fotos von Simon Zawalinski Printed in Germany · ISBN 978-3-95780-029-9
INHALT
Einleitung
Ein Kiosk ist zu verpachten
Der verrückte Theaterdirektor
Manfred
Hausmeister Chomik
Freya und Heini
Die Promis
Die tollen Broker von der Börse
Die Schweigsame
Das Etablissement in der Seitengasse
Der polnische Besucher
Frau Geifer
Der rumänische Frauenhändler
Die Frau mit dem silbernen Stern
Der Wirt vom Börsenplatz
Ein Gentleman mit Geschichte
Miami Vice in Frankfurt
Die Schwächsten der Schwachen
Der bö(h)se Onkel
Die müde Kämpferin
Der »Kommunist«
Conny & Ronny
Die glorreichen Vier
Der Hemdenbaron
Die drei Kuriere.
Iwan
Der Bettler
Die spanische Armada
Epilog
Gewidmet meinen Kunden, die mir in den Jahren meines Kioskbetriebes immer zur Seite gestanden haben und eigentlich die Mitautoren dieses Buches sind.
EINLEITUNG
Was ist eigentlich ein Kiosk? Wodurch unterscheidet er sich von einer Trinkhalle oder einem Marktstand? Oder ist das nur ein anderer Name für ein kleines Bauwerk aus leichter Substanz? Laut einer Studie von Elisabeth Naumann, die sie vor Jahren in dem Buch »Kiosk – Entdeckungen an einem alltäglichen Ort« veröffentlichte, ist dies ein Ort, wo sich schnell und einfach die kleinen, alltäglichen Wünsche erfüllen lassen. »Kiosk« sei ein Sammelbegriff für eine Trinkhalle, wo meistens Getränke mit oder ohne Alkohol verkauft werden, aber auch für einen Verkaufspavillon, wo man praktisch alles zum Leben Benötigte käuflich erwerben kann. Allerdings war ein Kiosk früher etwas anderes: In der Antike war er ein Kühle spendendes Nomadenzelt in der heißen Wüste, die alten Ägypter ließen in ihm ihre Götter wohnen, im Nahen Osten gab es schicke Gartenkioske, in denen sich der Adel zu erholen pflegte. In der Türkei gab und gibt es immer noch wunderschöne, architektonisch sehr kunstvoll gestaltete Kioske. Auch Gartenhäuschen und Gartenlauben sind im weiteren Sinne Kioske. Insbesondere im Orient blühte früher diese Architektur und jeder reiche Grundbesitzer sah es als Pflicht an, in seinem Garten einen Kiosk aufzustellen. Je vermögender dessen Eigentümer war, desto prachtvoller fiel das Bauwerk aus.
In der Neuzeit wurden diese Kioske wie so viele Dinge kommerzialisiert und ihrer ursprünglichen Bestimmung beraubt. Zwar gibt es immer noch genügend Gartenhäuschen, Lauben, Schuppen, Buden und ähnliche Bauten, aber den Kiosk als einen der Erholung und dem exklusiven Lebensstil dienenden Pavillon gibt es nicht mehr. Der auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen ausgerichtete Kiosk ist ein Kind des 19. und 20. Jahrhunderts. Er dient jetzt als Marktstand. Diese Entwicklung von einem vornehmen Ort der Erholung zu einem gewöhnlichen Bauwerk für Verkaufsgeschäfte gefällt nicht jedem. Der Kunsthistoriker Carel J. Du Ry beklage diesen Vorgang als »Begriffsverwirrung in unserer westlichen Welt«, schreibt Elisabeth Naumann, und er spreche von »Degradierung traditionsreicher und künstlerisch wertvoller orientalischer Bautradition«. Nun, die Erinnerung an die feudale orientalische Herkunft der Kioske ist schon verblasst und geht langsam verloren.
Schon vor zwei Jahrhunderten hat sich der Begriff Kiosk als Bezeichnung für ein Verkaufshäuschen durchgesetzt. Das ist kein Prestigeverlust, sondern einfach der Lauf der Dinge. Laut Elisabeth Naumann erfolgte mit der Kommerzialisierung des Kioskes auch ein Standortwechsel. Er verließ die ruhigen Gärten und wanderte dorthin, wo sein Verkaufsangebot von vielen Menschen wahrgenommen wurde. Die Kioske entstanden hauptsächlich auf Bahnhöfen, in Fußgängerzonen, an Haltestellen – immer dort, wo der Mensch einen Moment Zeit hat und das Verlangen, etwas gerade Gewünschtes zu erwerben: sei es ein Getränk, ein Eis, ein schneller Imbiss, sei es eine Zeitung oder eine Zeitschrift, eine Schachtel Zigaretten oder ein Lottoschein. Im Kiosk erfolgen Impulskäufe, man ersteht Dinge, an deren Kauf man vorher nicht dachte.
Ein Kiosk hat aber auch eine wichtige soziale Aufgabe zu erfüllen: Er ist Anlaufstelle für Menschen, die sich mitteilen wollen, die einsam sind und sich nach etwas Kontakt sehnen und die wahrgenommen werden wollen. Ältere Menschen zieht der Kiosk wie ein Magnet an, aber auch die Zu-kurz-Gekommenen, die Außenseiter unserer Gesellschaft nutzen den Aufenthalt in einem Kiosk, um etwas Wärme, Geborgenheit und Anerkennung zu erfahren. Ein Kiosk baut sich eine Familie auf. Das sind Freunde und Kunden des Kioskes, die immer wieder hier erscheinen, die sich das Leben nur schwer ohne diesen vorstellen können. Im Kiosk treffen sich die Reichen mit den Armen, die politischen Antagonisten, die Kulturschaffenden mit den Kulturbanausen. Der Bankdirektor wechselt ein paar Worte mit dem obdachlosen Bettler, der Starmoderator aus dem Fernsehen hält einen Small Talk mit der Harz-IV-Empfängerin. Der Kiosk ist eine Begegnungsstätte, die menschliche Schicksale zusammenführt, manchmal mit einem unerwarteten Ergebnis. Die soziale Komponente dieses »Marktplatzes« ist sehr hoch. Jemand sagte einmal, Kioske und Trinkhallen seien die Kurorte des kleinen Mannes. Aber auch der »große« Mann lässt sich gerne hier blicken, plaudert ein bisschen und geht dann weiter. In all den Jahren, in denen ich Kioske betreibe, hat sich viel Prominenz bei mir die Klinke in die Hand gegeben. Magnetisch lockt die besondere Atmosphäre eines Kioskes viele Menschen an. Hier begegnet man den verschiedensten Schicksalen, hier erfährt man die neuesten Nachrichten, hier werden Neuigkeiten akribisch analysiert oder weiter in die Welt hinausgeschickt. Hier kommen Kriminelle und deren Verfolger zu Wort, die Begüterten und die ewig Benachteiligten, die Schönen und die Hässlichen, die großen Volksredner und die Schweigsamen. Man könnte zu Recht sagen: Hier trifft sich das Volk.
Es ist ein Querschnitt des bundesdeutschen Lebens mit all seinen Problemen und Begebenheiten. Man bezeichnet den Kiosk als ein Straßenmöbel, und das Treiben darin ist »eine kleine Welt, die nicht viel gilt und die dennoch viel über den Zustand unserer Welt erzählt«, wie die Berliner Morgenpost einmal richtig urteilte. Diese Straßenmöbel werden meist gering geschätzt, belächelt und nur mit Widerwillen akzeptiert. In der Stadt Frankfurt gab es einmal einige Verfechter eines kioskfreien Lebens. Sie monierten die Rückständigkeit dieser Institution und betrachteten sie als ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten, das in der modernen Welt keinen Platz mehr habe. Es zeigte sich jedoch, dass diese Überlegungen etwas verfrüht waren. Nach wie vor tragen die Kioske, Trinkhallen und Verkaufsstände zur Belebung nicht nur des Handels, sondern auch des öffentlichen Lebens bei. Man darf hier das angesprochene soziale Element nicht vergessen. Elisabeth Naumann kommt in ihrem Buch zu dem Schluss, dass der Kiosk niemanden zurückweist, er akzeptiert den Kunden bedingungslos. Der Kiosk stellt sich dem Käufer zur Verfügung. »Er kann dir ein verlässlicher Freund sein, ein guter Bekannter, ein sozialer Kontaktpunkt oder auch nur ein anonymer Aufenthaltsort. Er erlaubt dir die scheinbare Teilnahme an den unterschiedlichsten Erlebniswelten, indem er die Illusion nährt, überall dabei zu sein.«
Im Kiosk begegnet man den unterschiedlichsten Menschen und erlebt die unglaublichsten Geschichten. Wenn man fast dreiundvierzig Jahre dort arbeitet, hat man viel zu berichten. So hat sich in all den Jahren jede Menge Erzählenswertes angesammelt, meine Notizbücher sind voll von den verschiedensten Erlebnissen. Manche sind ernst, manche sind komisch. Meine Niederschriften reichen für zwei Bücher. Der erste Band liegt vor Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und eine gute Unterhaltung.
Simon Zawalinski
EIN KIOSK IST ZU VERPACHTEN
Eines Tages beschlossen mein Vater und ich, uns selbstständig zu machen. Aus Mangel an Kapital mussten wir gezwungenermaßen kleine Brötchen backen. Wir suchten ein kleines, aber feines Geschäft, welches ausbaufähig war und seinen Betreibern nur überschaubare Kenntnisse abverlangen würde. Unser Augenmerk richtete sich zunächst auf die Nahrungsmittelbranche wie Imbissstände, Tante-Emma-Läden oder Minibars. Um eine Übersicht über die angebotenen Geschäfte zu bekommen, riet uns ein Bekannter, am Freitagabend die Frankfurter Rundschau zu besorgen. Also erwarben wir an einem Zeitungsstand im Stadtteil Bornheim ein solches Exemplar. Um uns bis zu den Geschäftsinseraten vorzukämpfen, mussten wir die Autoanzeigen überspringen und die Stellenangebote sowie den Wohnungsmarkt überfliegen, außerdem noch die Todesanzeigen und die Suche nach Bekanntschaften durchblättern. Dann endlich fanden wir die Annoncen, die wir gesucht hatten. Die Angebote beinhalteten Restaurants, Imbissbuden, Handwerksbetriebe und sonstige Geschäftszweige, die entweder zu verkaufen oder zu verpachten waren. Uns fiel eine Anzeige auf, in der ein Pächter für einen Kiosk in der Stadtmitte von Frankfurt gesucht wurde. Dieser Kiosk weise gute Umsätze vor und alles Weitere könne man unter der angegebenen Telefonnummer erfahren. Es klang verlockend, besonders der Hinweis »Stadtmitte« weckte unser Interesse und traf auf einen tief in unseren Herzen schlummernden Wunschtraum. Da wir damals noch kein eigenes Telefon besaßen, marschierten wir mit der Zeitung los und fanden in der Berger Straße, genauer am Merianplatz, eine Telefonzelle. Selbstverständlich war diese besetzt und noch einige weitere Anwärter standen Schlange, um einen Anruf zu tätigen. Damals gab es noch keine Handys, keine digitalen Fotokameras, kein Video, und die Computer waren groß wie Schränke, nur Großunternehmen konnten sich solche Rechenanlagen leisten. Folglich standen wir geduldig an und warteten. Das Warten hat sich gelohnt, denn unser Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung, ein Herr Wolf, signalisierte sein Entgegenkommen. Er nannte uns auch die Adresse, an der sich das Objekt unserer Begierde befinden sollte: auf dem Börsenplatz gegenüber der Frankfurter Börse.
Also kauften wir Fahrkarten, stiegen in die Straßenbahn Nummer 12 und fuhren bis zur Hauptwache. Damals war die Hauptwache eine riesige Baustelle, man baute in Frankfurt die U-Bahn. Von der Hauptwache zum Börsenplatz ist es nur ein Katzensprung. Dort angelangt hielten wir Ausschau nach dem Kiosk. Ohne Erfolg. Wir fanden das Gebäude der Frankfurter Industrie- und Handelskammer, das die Börse beherbergt, wir sahen ein Stückchen weiter eine Bildergalerie, wir drehten uns um und erblickten das Gebäude des Kassenvereins der Börse, in dem sich ein Parkhaus befand. Etwas weiter entdeckten wir den Bau der Frankfurter Stadtsparkasse, in dem sich außerdem ein Antiquitätengeschäft und an der Ecke zur Schillerstraße das Modegeschäft Lang befanden, das laut eigener Werbung früher ein k. u. k. Lieferant gewesen sein wollte. Für die nicht Eingeweihten: K. u. k. ist die Abkürzung für die kaiserliche und königliche Monarchie des ehemaligen Staatengebildes Österreich-Ungarn.
Wir nahmen jedes Geschäft unter die Lupe, schauten uns mindestens zehn Mal gründlich um, aber einen Kiosk konnten wir nicht ausfindig machen. Da wir diesen Herrn Wolf ernst nahmen und davon ausgingen, dass er uns nicht zum Narren halten wollte, suchten wir beharrlich weiter. Direkt vor uns befanden sich ein italienischer Eissalon und ein Modegeschäft, schräg links das Café Foerst. Wir drehten uns noch mal um, aber außer einer kleinen Holzbude, die wie ein vergessenes Klo von anno dazumal aussah, fanden wir nichts, was mit einem Kiosk Ähnlichkeit gehabt hätte. Vom Börsenplatz aus riefen wir den Herrn Wolf an und fragten nach dem Verbleib dieser geheimnisvollen Immobilie. Zu unserer Verwunderung beschrieb Herr Wolf den Kiosk sehr genau und wir erkannten sofort die Holzbude als das gesuchte Objekt. Noch im Schockzustand betrachteten wir das Bauwerk von allen Seiten, um uns ein Bild zu machen. Wie man in dieser Hütte, die zum Kiosk mutiert war, Presseartikel und Tabakwaren verkaufen sollte, wollte mir nicht in den Kopf.
Aber mein Vater analysierte schon die neu eingetretene Lage. »Absagen kannst du immer«, belehrte er mich. Er erkannte sofort das Potenzial der Lage. Im Zentrum Frankfurts könnte laut seinen Überlegungen auch eine solch halb verfallene Holzbude gutes Geld bringen. Er beobachtete die Menschenströme, die zur Arbeit eilenden Börsianer, die um den Platz gruppierten Geschäfte, zählte, wie viele Bars, Kneipen und Restaurants sich in der Nähe befanden. Wir verbrachten den ganzen Tag mit unseren Recherchen und erfuhren dabei, dass die auf der Schillerstraße stillgelegte Straßenbahn diese Straße wieder befahren sollte, was durch die Einrichtung von zwei Haltestellen viele Menschen in die Nähe der Bude bringen würde. Und wenn nur einige von ihnen den Weg zum Kiosk fänden, dann wäre das für den Verkauf eine hervorragende Sache. Dann begutachteten wir das in der Mitte des Platzes stehende Bauwunder. Das Holz war schon morsch, an einigen Stellen drohte der Bau auseinanderzubrechen. Einige Ausbesserungsarbeiten waren hier vonnöten. Graffitis bedeckten die Außenwände. Ganz oben, rund um das Dach, betrieb die FAZ Reklame. An der Ecke zur Schillerstraße hin hatte die Firma Philip Morris ein Viereck mit Werbung für ihre neue Marke Marlboro angebracht. Der Cowboy zu Pferd schien die Bude zu bewachen. Hinter dem Kiosk angelehnt stand eine Holzkiste, in welche die Lieferanten neue Zeitungen und Zeitschriften hineinlegten und alte wieder mitnahmen.
Herr Wolf wollte für das Prachtstück zweitausend Mark, obwohl ihm das Gebäude gar nicht gehörte. Er war nur Pächter. Der Besitzer der Bude – aber nicht des Grundstücks – war ein Ansichtskartenhersteller, Herr Zimmermann, der in Frankfurt den Verlag Michel & Co gegründet hatte und in der Mainmetropole fast ein Monopol in dieser Branche hatte. Mein Vater handelte die Abstandssumme um fünfhundert Mark herunter. Bei der Bauaufsichtsbehörde im Römer ließen wir uns die Pläne des Kioskes aushändigen. Dieses Meisterwerk der Baukunst war im Jahr 1946 auf dem Börsenplatz aufgestellt worden. An dieser Stelle hatte in den späten dreißiger Jahren bereits ein Kioskpavillon gestanden, wo man neben Presseerzeugnissen auch Zigaretten und Erfrischungsgetränke verkaufte. Im Jahr 1948 war der Kiosk umgebaut und von einer Erna Hasenpflug betrieben worden, die ihn dann an den jetzigen Besitzer verkaufte. Diesen trafen wir nun in einem Café und informierten ihn von unserem Wunsch, seinen Kiosk zu pachten. Zu unserer Verwunderung und Überraschung fragte er uns, ob wir Interesse hätten, den Kiosk zu kaufen. Er würde uns einen guten Preis machen, denn er brauche Geld für die Erweiterung seines Geschäftes. Doch er nannte eine Summe, die wir nicht aufbringen konnten. Wenn wir uns sofort entschließen würden, bot er an, könne er mit dem Preis noch runtergehen und uns dem Filialleiter der Stadtsparkasse am Börsenplatz vorstellen. So geschah es auch. Die Bürokratiemaschinerie wurde in Gang gesetzt, wir bekamen den Kredit und der Besitzer sein Geld direkt von der Bank. Dann mussten wir das Gewerbe anmelden, ein Geschäftskonto bei der Bank eröffnen, einen Liefervertrag mit dem Pressegrossisten unterschreiben, einen Steuerberater finden, Handwerker mit der Ausbesserung verschiedener Kioskelemente beauftragen und den angesammelten Mist im Kiosk ausräumen. Bevor wir diesen wieder eröffneten, meldeten sich bei uns verschiedene Behörden wie das Liegenschaftsamt, das Gewerbeamt, das Amt für Stadtplanung und Gesamtentwicklung, das Straßenbauamt, die Stadtwerke, das Katasteramt und zu guter Letzt das Finanzamt. Überall mussten wir etwas einzahlen, Kautionen hinterlegen, Dokumente unterschreiben. Bei der städtischen Müllabfuhr, dem Vorläufer des FES, mussten wir Mülltonnen bestellen. Für die Ablagekiste mussten wir eine Versicherung abschließen. Nur den Kiosk selbst wollte keine Versicherung der Welt versichern. Bevor wir das Schloss an der Tür auswechselten, mussten wir diese ersetzen. Auch die Frontklappe, die außerdem als Schutzdach für die ausgelegte Ware diente, mussten wir neu anfertigen lassen.
Und dann kam der Tag X, an dem wir unseren Kiosk, unseren Verkaufsstand, öffnen durften. Die Zeitungskiste war voll mit Presseerzeugnissen und wir stellten erschrocken fest, dass die Kiste ein größeres Volumen hatte als der Kiosk, der genau einen Quadratmeter maß. Der erste Kunde war eine Dame, die nach Dunhill verlangte. Wir wussten nicht, ob das eine Zeitschrift sein sollte, eine Milchschokolade oder ein Getränk. Die Kundin half uns, indem sie uns aufklärte, Dunhill sei eine Zigarettenmarke.
Alle Anfänge sind schwer, unserer war aber besonders schwer, weil wir keine Ahnung von diesem Geschäft hatten. Wir sprangen ins tiefe Wasser, ohne richtig schwimmen gelernt zu haben. Mit jedem Tag lernten wir etwas dazu. Bald schon beherrschten wir das Auspacken und das Remittieren der Presseerzeugnisse, wir lernten die Namen der Zigarettenmarken, kauften und verkauften Getränke, Kaugummis und Süßigkeiten. Nach und nach begriffen wir auch die Gepflogenheiten der deutschen Bürokratie und den Umgang mit Überweisungen und Lastschriften. Es offenbarten sich die ersten Freunde des Kioskes, die Stammkunden, die uns die Treue hielten. Wir schlossen mit der Stadt Frankfurt einen Vertrag über die Benutzung der Liegenschaft ohne eigene Nummer auf dem Börsenplatz. Dafür kassierte der Magistrat eine Pacht, die überschaubar und der Größe des Objekts angemessen war. Als die Straßenbahn die Schillerstraße wieder befuhr, merkten alle Läden, wir eingeschlossen, eine Belebung ihrer Geschäfte.
Nach einigen Jahren beantragten wir bei der Stadt eine Baugenehmigung für einen neuen Zeitungskiosk. Doch alle Anträge, die wir immer wieder stellten, wurden abgelehnt. Bis uns eines Tages mitgeteilt wurde, dass man im Römer eine Umgestaltung und Modernisierung des ganzen Börsenplatz und der Schillerstraße plane. Im Rahmen dieser Maßnahme stellten die Mitarbeiter der verschiedenen städtischen Ämter Überlegungen an, wie man den Kiosk am besten in die neue Landschaft hineinkomponieren könnte. Am Ende des städtischen Nachdenkens bekamen wir den Bescheid, dass man den Ausbau des Platzes ohne einen Kiosk beschlossen habe. Erst nach unserer Intervention bei fast allen Ämtern, nach dem Einschalten der Presse und des Hessischen Rundfunks änderten die Verantwortlichen der Stadt ihre Meinung und beschlossen, doch einen Kiosk einzuplanen. Als wir schon so weit waren, einen Architekten zu beauftragen, kam Herr Wachler mit der neuesten Nachricht zu uns. Wie ihm jemand aus dem Liegenschaftsamt zugeflüstert habe, seien die Verantwortlichen dabei, den Platz für den neuen Kiosk an eine Betreiberkette zu vergeben. Er mahnte zur Eile. Wir sprachen die Börsianer an, die Fraktionen im Frankfurter Stadtparlament, die Industrie- und Handelskammer, die Vertreter der Frankfurter Medienlandschaft. Diese konzertierte Aktion wurde von Erfolg gekrönt. Der Leiter des Liegenschaftsamtes bat meinen Vater zum persönlichen Gespräch, bei dem er ihm versicherte, nur an uns die Baugenehmigung zu vergeben. Und es geschah auch so. Dann meldete sich plötzlich das Gartenamt mit dem Ansinnen, auf dem Platz des künftigen Kioskes Bäume pflanzen zu wollen. Nach vier turbulenten Wochen, in denen unser Nervenkostüm aufs Äußerste strapaziert wurde, versammelten sich im Römer die Stadtabgeordneten und laut allen Frankfurter Zeitungen beschlossen sie einstimmig, auf dem Börsenplatz einen Zeitungskiosk bauen zu lassen. Die Betreiber sollten die jetzigen sein.
Wir hatten diesen Sieg hart erkämpft. Wie viel Nerven uns das gekostet hat, ist gar nicht zu sagen. Wir beauftragten ein bekanntes Architekturbüro mit der Planung unseres neuen Kioskes, der jetzt »Verkaufspavillon« hieß. Dem Architekten gelang ein toller Entwurf und das später aufgestellte Konstrukt trug zur architektonischen Belebung der City bei. Für uns begann eine neue Ära des zeitgemäßen Verkaufens in einem modernen Pavillon auf einem runderneuerten Börsenplatz an der neu gestalteten, straßenbahnfreien Schillerstraße.
DER VERRÜCKTE THEATERDIREKTOR
Am Anfang unserer Tätigkeit im Kiosk, als dieser noch Kiosk und nicht wie heute Verkaufspavillon hieß, aus Holz gebaut und nicht begehbar war und nur einen Quadratmeter maß, lief alles viel gemütlicher ab, war aber nicht weniger stressig als heute. Zuerst lernten mein Vater und ich die verschiedenen Zigarettenmarken kennen. Die heutigen Marken gab es damals fast alle noch nicht. Und wer erinnert sich heute noch an die damals gängigen Marken wie HB, Stuyvesant, Krone, Ernte 23, Milde Sorte, Eckstein, Kent, Reval oder Roth-Händle? Die weniger bekannten, aber ebenfalls vorhandenen Marken hießen Sheffield, Astor, Zanussi, Kurmark, Paramount, Overstolz, St. Laurent, Gold Dollar und Ducall. Auch die Presselandschaft war teilweise eine andere. Es gab in Frankfurt neben der bundesdeutschen Bild-Zeitung noch die FAZ, die Frankfurter Rundschau, die Frankfurter Neue Presse, die Abendpost / Nachtausgabe und die Frankfurter Rundschau am Abend. Noch früher erschienen zudem die Abendpost am späten Nachmittag und die Nachtausgabe am Abend. Es gab damals auf den bundesdeutschen Printmedienmarkt Zeitschriften, deren Existenz man schon vergessen hat, zum Beispiel die Frauenzeitschriften Jasmin oder Annabelle. Wer weiß heute noch, dass es die Satire-Zeitschriften Pardon und Spontan gab? Es erschienen auch mehrere linke Blätter wie Das da, Pflasterstrand und Konkret, ein Männermagazin Esquire und ein Konkurrenzblatt für den Stern vom Bauer-Verlag mit dem Namen Quick. Es gab außerdem eine illustrierte Ausgabe der Bild-Zeitung namens Neue Revue. Damals erschienen aber auch schon die Zeit, der Stern, der Spiegel, die Brigitte, Für Sie, Freundin, Hörzu und die deutsche Ausgabe des Playboy, die Rekordumsätze einfuhr. Dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hinter der immer schon ein kluger Kopf stand, von den meisten klugen Köpfen der Republik nur kurz »FAZ« genannt wurde, mussten wir erst lernen.
Einer dieser »klugen Köpfe« erkor unsere Verkaufsstelle zu seinem Stammkiosk und besuchte uns täglich, immer zwischen 9.45 Uhr und 10.00 Uhr. Dieser Herr von nicht besonders großer Statur trug unter der Nase eine Art Schnurrbart, hatte kurz geschorenes Haar und einen etwas verschwommenen Blick. Er verlangte nach einer »FAZ«. Weder mein Vater noch ich verstanden, was der Kunde von uns wollte. Eine FAZ kannten wir beide nicht. Wir fragten ihn so nett wie möglich, was diese ominösen drei Buchstaben bedeuteten, da meinte er barsch, wer Presseerzeugnisse verkaufe, der sollte alle Titel kennen, auch die Abkürzungen. Dann ging er, ohne irgendetwas gekauft zu haben. Wir dachten, der Spuk sei vorbei, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Tags darauf erschien dieser komische Kerl wieder und verlangte nach der »FAZ«. Auch diesmal konnten wir uns darunter nichts vorstellen, worüber sich unser Kunde sehr aufregte. Er schimpfte wie ein Rohrspatz über unbelehrbare Menschen, die zu dumm seien, die drei Buchstaben zu interpretieren. Das sei ein schlechter Dienst am Kunden und eines Zeitungsverkäufers nicht würdig. Wieder ging er unverrichteter Dinge weiter. Jetzt passten wir auf. Gleich den nächsten Kunden fragten wir nach den drei dubiosen Buchstaben. Zu unserer Enttäuschung konnte er uns nicht weiterhelfen. Wir waren also nicht allein, auch andere Menschen in der Bundesrepublik kannten das Geheimnis nicht. Später am Tag erschien ein netter junger Mann, der die Süddeutsche Zeitung kaufen wollte. Er blätterte darin und fragte laut, aber an sich selbst gerichtet, ob über dieses Thema auch in der FAZ berichtet würde und bat uns dann, ihm auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung auszuhändigen. Für uns war das ein Aha-Erlebnis. Jetzt hatten wir die Lösung! Endlich! Wir brauchten den Mann gar nicht mehr zu fragen, jetzt war klar: FAZ war die Abkürzung für Frankfurter Allgemeine Zeitung, dessen waren wir uns sicher. Der Kunde bezahlte die beiden Zeitungen und wünschte uns noch einen schönen Tag. Dieser Tag war schon schön, hatten wir doch die Bedeutung dieser drei Buchstaben erfahren. Wir freuten uns schon auf die morgige Begegnung mit dem komischen Kauz, aber zu unserer Enttäuschung kam er nicht. Dieser schlecht gelaunte Mensch kam auch nicht am nächsten Tag. Aber als er nach zwei Wochen endlich unseren Kiosk aufsuchte, legten wir ihm sofort die FAZ vor die Nase. Er schaute uns verdutzt an und erklärte sichtlich zufrieden: »Na bitte, der Mensch ist imstande, alles zu lernen. Er braucht nur den Ansporn und ein wenig Hilfe. Heute brauche ich aber die FR, die FAZ habe ich schon.«
Wir blickten ihn ein wenig entgeistert an, aber mein Vater schaltete schnell. Er lächelte, nahm die FAZ weg und legte stattdessen die Frankfurter Rundschau vor den Kunden. Diesmal war es dem arroganten Intellektuellen nicht gelungen, uns zu verhöhnen. Er bedankte sich in süffisantem Ton und ging von dannen. Am nächsten Tag war er wieder da und holte seine geliebte Lektüre, die FAZ.
Bei einem der nächsten Käufe versuchte ich behutsam ein Gespräch einzufädeln, doch er wehrte sofort ab. Nach einigen vergeblichen Versuchen gab ich auf und bediente ihn ganz förmlich, indem ich ihm seine Zeitung fast ohne Worte aushändigte. Das ging etwa fünf bis sechs Monate so, bis ich eines Tages das Volksbildungsheim aufsuchte, wo sich auch das »Theater am Turm« befand. Heute ist das Volksbildungsheim woanders untergebracht, das Theater logiert in einem ehemaligen Straßenbahndepot und am Turm befindet sich aktuell ein Kino-Center. Damals aber war dieses Theater die wohl wichtigste Adresse für avantgardistisches Theater in Frankfurt. Als ich den Vorraum betrat, drohte mir schon von fern unser humorloser FAZ-Käufer. Sein Bild hing nämlich an einer Tafel, die die Schauspieler und andere Mitglieder des Ensembles präsentierte. So erfuhr ich, dass unser Kunde der Direktor dieses Theaters war und Rainer Werner Fassbinder hieß. Der Name war mir schon geläufig, denn dieser Regisseur und Schauspieler war verantwortlich für viele engagierte Filme, die im Verlag der Autoren entstanden sind. Unter dem Bild dieses großen Gurus des deutschen Films und Theaters fand ich auch das Foto des Mannes, der bei uns die Süddeutsche Zeitung gekauft und das Stichwort für die FAZ geliefert hatte. Er war ein bekannter Schauspieler, dessen Name mir bedauerlicherweise entfallen ist.
Als Herr Fassbinder uns wieder mit seinem Besuch beehrte, sprach ich ihn direkt auf seine Tätigkeit im Theater am Turm (TaT) an. Zu meiner Überraschung zeigte sich unser »schwierigster Kunde « ganz jovial und gesprächsfreudig. Er freue sich, dass wir uns für den Kulturbetrieb in Deutschland interessierten, und bat um Verständnis, dass er ein kleines Experiment mit uns gemacht hatte.
Er wollte uns selbst die Lösung des Rätsels der drei Buchstaben herausfinden lassen. Als er merkte, dass eine längere Geschichte daraus werden könnte, schickte er »seinen besten Mann«, um der Sache auf die Sprünge zu helfen, was ja auch erfolgreich war. Der junge Mann hatte seine Rolle sehr gut gespielt, das konnten wir bestätigen.
Der Direktor Fassbinder freute sich sichtlich über unser Interesse am politischen und kulturellen Leben in diesem Land. Er lud uns zu einem Theaterbesuch ein, wo wir seine Regiekunst bewundern könnten, eine Freikarte bot er uns aber nicht an. Er war schon ein Unikum, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir versprach er eine Statistenrolle in einem seiner Filme, was er selbstverständlich nicht einhielt. Bald darauf gab er den Direktorenposten am Theater ab und ging nach München. Unser Kultregisseur drehte später noch viele bekannte Filme und hielt nicht nur das Publikum mit seinen Visionen in Atem. Mein Vater wollte nicht glauben, dass dieser Kauz solch eine Filmkarriere machte.
Auch ich konnte lange diesen Autor von »Angst essen Seele auf«, »Die Sehnsucht der Veronika Voss«, »Berlin Alexanderplatz«, »Deutschland im Herbst« und vielen anderen Filmen nicht mit unserem Zeitungskäufer in Einklang bringen. Ich habe mir alle seine Filme angeschaut. Er kämpfte in seinem Leben gegen alles, aber insbesondere gegen sich selbst. Bis er eines Tages aufgab. Aber seine Legende lebt weiter!
MANFRED
Jeder Mensch hat einen Freund oder eine Freundin, fast jede Familie hat einen Hausfreund. Auch in unserem Kiosk war es nicht anders. Unser »Hausfreund« hieß Manfred und arbeitete zwei Straßen weiter in einer Großhandelsfirma. Diese vertrieb Presseerzeugnisse aller Art. Am frühen Morgen um sieben Uhr war Manfred schon zur Stelle. Zu dieser Zeit war ich mit dem Auspacken der gelieferten Zeitungen und Zeitschriften beschäftigt. Manfred half mir dabei und die Arbeit ging schnell voran. Bevor er mir aber zur Hand ging, trank er zunächst einige kleine Fläschchen eines bekannten Kräuterlikörs leer. Damit er nicht so schnell betrunken wurde, verdünnte er die unangenehm riechende Flüssigkeit mit Mineralwasser. Nach getaner Arbeit genehmigte sich Manfred dann noch weitere Fläschchen des norddeutschen Elixiers. So gestärkt begann er Neuigkeiten aus seinem Leben zu erzählen, während ich die alten Zeitschriften aussortierte. Manfreds Erzählungen drehten sich fast immer um sein Haus, seinen Garten, die Mutter, die bettlägerig war, und um seine Frau, die er als die größte Nervensäge Hessens bezeichnete. Im gleichen Atemzug aber pries er seine Anvertraute als das Beste, was ihm in seinem Leben passieren konnte. Er erzählte mit seinem unverwechselbaren südhessischen Dialekt von den Schwierigkeiten, die Dame seines Herzen zu ehelichen.
Ich erfuhr von fast unüberbrückbaren Hindernissen, welche die verschiedenen Konfessionen der beiden Liebenden mit sich brachten. Bisher war ich davon ausgegangen, dass es Schwierigkeiten gäbe, wenn z. B. Moslems oder Juden einem christlichen Partner das Ja-Wort geben wollten. Aber dass es auch unter den Christen solche religiösen Animositäten gab, war mir neu. Protestanten, Katholiken, Orthodoxe – sie alle hatten doch eigentlich einen Glauben. Woher kam diese hartnäckige Ablehnung der etwas anderen Fraktion? Das Christentum hat jedoch außerhalb dieser drei Hauptrichtungen noch sektenähnliche Sondergruppen, die fast schon Abspaltungen sind. Die protestantische Kirche hat die Lutheraner, die Baptisten und andere weniger oder mehr mit der Hauptkirche assoziierte Richtungen. Auch die katholische Seite kann mit vielen Glaubensrichtungen aufwarten. Manfred und seine Angebetete setzten sich schließlich über alle Hürden hinweg und heirateten trotzdem. Damals waren die beiden neunzehn und am Anfang ihres Erwachsenenlebens.
Manfred gehörte mit der Zeit zum Kiosk-»Inventar«. Allen Stammkunden und Bekannten fiel es auf, wenn er mal nicht da war. »Ist Ihr Bekannter krank?«, war die häufigste Frage, die seiner Abwesenheit galt. Denn nicht nur in der Hauptpause, sondern auch in den Zwischenpausen, die er sich selbst einräumte, war Manfred in unserem Verkaufspavillon. Sein Kräuterlikörkonsum belief sich tagein, tagaus auf vierundzwanzig 20-ml-Fläschchen dieses Zaubertranks. Dazu kamen etwa zwei Liter Wasser täglich. Bis zum Abend merkte man ihm von seinem Hobby, das eine Sucht war, nichts an. Wenn er jedoch nach der Arbeit seine letzten vier »Kurzen« schluckte, begann er zu lallen, da erkannte man die Grenzen dieser einmaligen Aufnahmefähigkeit. Sein Gesicht lief rot an und seine Zunge weigerte sich beharrlich, einwandfreie Arbeit zu verrichten.
Manfred hatte fast immer gute Laune, er war hilfsbereit und konnte ohne Schwierigkeiten zwischenmenschliche Kontakte herstellen. In der Nähe des Verkaufspavillons, den wir nach wie vor Kiosk nannten, befand sich eine besondere Einrichtung, die von einem anderen Stammkunden geleitet wurde. Die Mitarbeiterinnen dieses Betriebes gehörten ebenfalls zu unserer Stammkundschaft. Manfred machte den hier einkaufenden Damen Komplimente, lehnte aber ihre Einladungen dankend ab. Er erklärte mir den Standpunkt, den er in dieser Angelegenheit vertrat, mit dem Satz: »Draußen holt man sich den Appetit, zu Hause wird dann gegessen.« Manfred und seine Frau waren kinderlos, obwohl Manfred Kinder liebte und auch die Kinder mochten ihn sehr. Er hatte eine Abneigung gegen Fremdsprachen, deswegen machte er immer in Deutschland Urlaub, denn hier fühlte er sich am wohlsten.
Er betrachtete auch Sächsisch als Fremdsprache. Nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze kamen die ersten DDR-Bürger zu uns. Man konnte sie an ihrem Auftreten und an ihren blassblauen Jeansuniformen, dem Markenzeichen des ehemaligen Ostblocks, erkennen. Einige dieser »Touristen« besuchten auch unseren Kiosk, und da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit intensivem Sächsisch. Die freiheitstrunkenen »Invasoren« konnten meistens nur unzulänglich Hochdeutsch. Zu meinem Erstaunen verstand auch Manfred die »sächselnden« Neubundesbürger kaum. Seinen Urlaub verbrachte Manfred stets in Berchtesgaden, wo er vom Bürgermeister eine Treuemedaille für fünfundzwanzig Jahre stetiger Urlaubsaufenthalte entgegennehmen durfte. Er gab zu, doch einmal im Ausland gewesen zu sein, und zwar in Salzburg im schönen Österreich. Zwei Mal im Jahr fuhr Manfred nach Berlin, wo sein Onkel einer Kosmetikfirma vorstand und ihm das Gästehaus der Firma zur Verfügung stellte. Nach dessen Tod endete diese einmalige Gelegenheit abrupt, denn des Onkels Sohn regierte ab jetzt mit eiserner Hand und nahm auf seine Verwandten keine Rücksicht.
Manfred war befreundet mit dem Außendienstmitarbeiter des Grossohandels, der außerdem ein entfernter Verwandter seiner Gattin war. Dieser Stefan Smarra war ein sehr netter Mensch, aber er hatte eine Schwäche: Er trank während der Arbeit. Zugegeben, sein Alkoholkonsum war gegenüber dem von Manfred fast schon unbedeutend, nur musste Stefan den Firmenwagen lenken, was alkoholisiert viele Gefahren mit sich brachte. Prompt kollidierte er eines Tages mit einem Taxi. Der Fahrgast seines Unfallgegners wurde verletzt und es entstand ein erheblicher Sachschaden. Man entzog Herrn Smarra die Fahrerlaubnis und der Arbeitgeber entzog ihm die Arbeitsstelle. Durch seine Dummheit hatte er einen krisensicheren Job verloren. Er hatte eine Frau und zwei Töchter in der Ausbildung, die finanzielle Unterstützung benötigten, und bewohnte mit seiner Familie ein Haus, das noch nicht abbezahlt war. Da in dieser Zeit der Arbeitsmarkt deutlich übersättigt war und die Stellensuche einem Lotteriespiel ähnelte, war seine wirtschaftliche Lage plötzlich äußerst schwierig. Schnell wuchsen ihm die hausgemachten Probleme und die Existenzsorgen über den Kopf und eine Woche nach seinem Rauswurf nahm er sich das Leben. Immerhin verschaffte er sich einen starken Abgang, indem er sich am Eingang zu seiner ehemaligen Firma erhängte.
Manfred kritisierte den Alkoholkonsum seines Freundes und nannte ihn eine Krankheit – auf sich selbst bezog er diese Diagnose jedoch nicht. Er sah sich nicht als alkoholsüchtig an und belog sich selbst mit der Feststellung, er trinke sehr wenig Alkohol und nur bei mir im Kiosk. Abgesehen von seinem Alkoholproblem war Manfred ein pflegeleichter, sympathischer, hilfsbereiter Zeitgenosse, der mir unzählige Male in allen Notsituationen, die ich im Kiosk erlebte, zu Hilfe kam und auf den ich immer zählen konnte. In seinem Sozialverhalten war er ein Mensch ohne eigene Meinung, ein Jasager, der mit niemandem auf Kriegsfuß stehen wollte. Er wollte beliebt sein und war es auch, aber wirklich respektiert wurde er von den wenigsten. Mit dem Erreichen seines dreiundsechzigsten Lebensjahres wurde er sofort in Rente geschickt. Diese Maßnahme kam einer fristlosen Kündigung zuvor, denn die neuen, energischen Manager tolerierten im Gegensatz zu der alten Firmenleitung keine Eskapaden nach Manfreds Art. Noch einige Zeit besuchte er mich, dann wurden seine Besuche immer seltener, bis sie eines Tages ganz aufhörten. Vor Jahren kam er mit seiner Gattin noch einmal vorbei. Er litt an Prostatakrebs. Die nötige Operation musste jedoch immer wieder verschoben werden. Den Grund dafür lieferte er selbst mit dem Produkt aus dem Norden der Republik.
HAUSMEISTER CHOMIK
Der Hausmeister Karl Chomik war in der Schillerstraße und am Börsenplatz eine Institution. Die ganze Frankfurter City kannte den temperamentvollen Mann, eine Frohnatur, die tief in ihrem Inneren ein kleines Kind geblieben war. Er sammelte Aufkleber, später auch Sticker genannt, Tierbilder, Bilder von der Wildnis und der Natur. Auch Fotos von Oldtimern und nur spärlich angezogenen jungen Damen verschönerten die Wände seines Hobbykellers. Er hieß eigentlich Karl, aber alle nannten ihn Charles oder Charlie. Nur seine bessere Hälfte sagte Karl oder auch Karlik zu ihm, was auf Tschechisch Karlchen bedeutet.
Die Lebensgeschichten mancher Menschen scheinen so unglaublich, dass sie einfach wahr sein müssen. Sie sind so abstrus und sonderbar, wie nur das Leben sein kann. Käme eine solche Geschichte aus der Feder eines Dichters, würde man sie als Kitsch, als vollkommen unglaubwürdig bezeichnen. Die Story des Karl Chomik ist jedoch wahr. Er wurde in Dortmund geboren, war eigentlich ein Kind des Ruhrpotts. Gleich nach dem Krieg war die Lage dort ziemlich hoffnungslos. Karls Vater beschloss daher, dem Ruhrgebiet den Rücken zu kehren und in der weiten Welt nach Glück und Sicherheit für seine Familie zu suchen. Einer seiner Verwandten lebte in Prag. Auf der Seite der siegreichen Russen erhoffte sich Charles’ Vater bessere Lebensbedingungen und Überlebenschancen. Entgegen dem Strom der ins Innere von Deutschland flüchtenden Menschen gelangte er mit seiner Familie hinter den Eisernen Vorhang. Die erste Unterkunft bezog die Familie bei den entfernten Verwandten in Prag, die die deutsche Sprache schon fast vergessen hatten. Die Familie Chomik lernte fleißig Tschechisch und bekam nach einer gewissen Zeit eine Wohnung zugewiesen. Dann eröffnete der Vater, des Tschechischen schon einigermaßen mächtig, eine Gastwirtschaft in einem Prager Außenbezirk. Der junge Charlie lernte schnell die neue Sprache und integrierte sich bald in die tschechische Gesellschaft. Mit dem Betrieb der Gastwirtschaft gelang dem Vater die finanzielle Unabhängigkeit. Die Deutschen waren fleißig und arbeiteten ohne zu jammern, damit erzeugten sie Missgunst und Neid bei ihren tschechischen Nachbarn. Und schon begann die Staatsmacht mit ihren Maßnahmen, um die Familie an den sozialistischen Alltag zu gewöhnen. Man schickte ständig Finanzinspektoren, Hygienekontrolleure, Angestellte aller möglichen Ämter, die den Betrieb überprüften, Strafen verhängten und dem Gastwirt das Leben schwer machten. Schließlich wies man Herrn Chomik finanzielle Unregelmäßigkeiten nach, das Lokal wurde geschlossen und dessen Inhaber in den Knast geschickt. Als er wieder freikam, war seine Kneipe verstaatlicht und er selbst arbeitslos. Er betrank sich jetzt öfter, denn als »subversives Element« bekam er keinen Job. Man warf ihn wegen Trunkenheit und Widerstand gegen die Staatsgewalt ins Gefängnis. Nach Ansicht der Parteibonzen und folgerichtig auch der Richter gab es in einer sozialistischen Gesellschaft keine Arbeitslosigkeit und daher auch keine Arbeitslosen. Wer trotzdem nicht arbeitete, war ein Parasit, ein Herumtreiber, ein Staatsfeind. Und wenn dieses Individuum auch noch ein Ausländer, gar ein Deutscher war, dann war er besonders gefährlich. So einer konnte auch ein Spion sein.
Aber alle Schikanen und alle Maßnahmen seitens der abgewirtschafteten »Volksdemokraten« konnten weder die Familie Chomik noch das tschechische Volk in die Knie zwingen. Als Alexander Dubcek den »Sozialismus mit menschlichem Gesicht« einführen wollte und in der Tschechoslowakei für einige Zeit eine Art Halbdemokratie praktizierte, beschloss die Familie, in den Ruhrpott zurückzukehren. Es waren vierundzwanzig Jahre vergangen, seitdem sie in Prag angekommen war. Aus dem kleinen Karl war ein junger Mann geworden, dem die Mädchen verstohlene Blicke zuwarfen. Solche Blicke wurden auch von einer Zdenka abgeschickt und sie landeten direkt im Herzen des jungen Mannes. Nach einer Zeit des Kennenlernens beschloss Charles, dem Mädchen einen Heiratsantrag zu machen. Sowohl dessen Eltern als auch die von Zdenka widersetzten sich diesem Vorhaben, aber gegen die Macht der Liebe standen sie auf verlorenem Posten. So heiratete Charles also seine Zdenka in dieser bewegten Zeit, in der sich das tschechoslowakische Volk an der neuen, minimalen Freiheit berauschte. Der Prager Frühling erzeugte ungekannte Gefühle in der tschechoslowakischen Gesellschaft, Träume von einem menschlichen osteuropäischen Sozialismus. Nun weiß man, dass »Träume Schäume sind«, auf die meist bald die harte und schmerzhafte Gegenwart folgt. So war es auch beim Prager Frühling, dem schon im Sommer ein schnelles, gewaltsames Ende bereitet wurde.
Als die Warschauer-Pakt-Staaten mit ihren Panzern die neue Freiheit niederwalzten, war die Familie Chomik schon in Westfalen. Die frisch angetraute Ehefrau machte die Reise selbstverständlich mit. Karl besuchte eine Berufsschule und wurde als Dachdecker ausgebildet. Zdenka paukte deutsche Präpositionen und Pronomen, erweiterte beständig ihren Wortschatz und wagte bald, mit der Nachbarin einige Worte zu wechseln. Die Arbeit gefiel Karl sehr und der Meister war mit dem Gesellen mehr als zufrieden. Schon damals entwickelte Charles seine hausmeisterlichen Fähigkeiten. Er konnte Schlösser reparieren, Zelte aufstellen und kleine Ausbesserungsarbeiten am Haus verrichten.