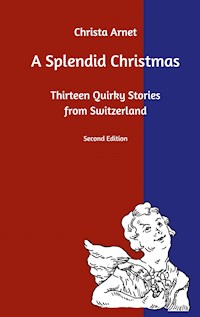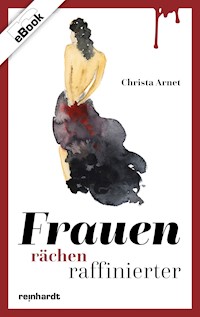
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Friedrich Reinhardt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Achtung! Dies sind keine üblichen Krimis. Alle Geschichten beginnen mit dem Ende des Falls: Die Mörderinnen sind von Anfang an bekannt. Es sind durchwegs normale, unauffällige und angepasste Frauen – keine bösartigen Monster. Denn sie sind eigentlich Opfer, die zu Täterinnen werden. Und zwar aus psychischer Selbstverteidigung, aufgrund von Diskriminierung, Liebeskummer, Bevormundung, Psychoterror, Rücksichtslosigkeit oder Zerstörung eines Lebenstraums. Interessant sind also nicht die Ermittlungen – es gibt gar keine –, sondern die Motive und der jeweilige Tathergang, wobei der Mord selbst stets einen verblüffenden Schlusspunkt setzt. Und interessant sind auch die garantiert ungefährlichen Kochrezepte, die jeden Fall abschliessen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christa Arnet
Frauenrächenraffinierter
Friedrich Reinhardt Verlag
Alle Rechte vorbehalten
© 2023 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Projektleitung: Claudia Leuppi
Korrektorat: Daniel Lüthi
Layout: Morris Bussmann
Illustrationen: Christa Arnet
eISBN 978-3-7245-2650-6
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-2602-5
Der Friedrich Reinhardt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
www.reinhardt.ch
Inhalt
Adonis
Die Präsentation
Der Besuch
Das Forschungsprojekt
Der Geburtstag
Gourmet-Carpaccio
Geschichten im Fels
Griechisches Konfekt
Der Gletscher
Kreuzfahrt ins Paradies
Die Schönheit der Sprache
Grausame Rache
Über die Autorin
1
Adonis
Antonia war eine jener ganz normalen netten Frauen, die man überall sieht und nirgendwo wahrnimmt. Eine von denen, die in Restaurants den Katzentisch erhalten, in Boutiquen übersehen werden und an Supermarktkassen am längsten anstehen müssen. Und sie glaubte auch zu wissen, warum. Ihr fehlten die entscheidenden Dinge im Leben: Die Figur eines Models, das Auftreten eines It-Girls und die «Requisiten» der High Society, von der Vuitton-Tasche bis zum Porsche. Sie hatte nicht einmal einen Mann, was eigentlich seltsam war, da laufend wesentlich hässlichere Frauen geheiratet wurden. Ihre dicke, pickelgesichtige Schwester zum Beispiel hatte schon mit 23 Jahren einen Gatten und drei Kinder. Und natürlich war sie mächtig stolz auf sich.
Lange hatte Antonia auf eine Karriere beim Theater gehofft, nachdem ihr der Gesangslehrer eine ungewöhnlich gute Stimme attestiert hatte. Einmal brachte sie es sogar bis auf die Bühne des Volkstheaters, wo sie drei Wochen lang ein Dienstmädchen verkörperte, das von der Herrin aus Eifersucht erstochen wird. Besonders gut lag ihr die Todesszene, in der sie mehrere Minuten lang den Lebens- und Liebesschmerz in Versform hinausschrie, hinauswürgte und in sich hineinröchelte. Einmal warf ihr ein Unbekannter nach diesem erschütternden Auftritt einen Blumenstrauss zu.
Nachdem sich das Ensemble wegen Streitereien aufgelöst hatte, suchte und fand Antonia glücklicherweise eine verlässlichere Aufgabe: Sie wurde Aufseherin im Kunstmuseum. Und von diesem Tag an besass auch sie etwas, das sie mit Stolz herzeigen konnte: eine schicke dunkelblaue Uniform mit dem Museumssignet und ihrem Namensschild am Revers. Morgens, in der S-Bahn von Leimbach zum Zürcher Hauptbahnhof, setzte sie sich gerne in die erste Bank – im Winter mit offenem Mantel –, damit alle hereinkommenden Passagiere das Schild sehen konnten. Und an freien Tagen spazierte sie gelegentlich in der Uniform durch die Innenstadt. Vom Hauptbahnhof über die Bahnhofstrasse, den Rennweg hoch zum Lindenhof, dann hinunter an die Limmat und durch die Storchengasse zum Fraumünster bis zum Bürkliplatz. Zurück zum Bahnhof ging sie gerne über die Quaibrücke, den Sechseläutenplatz und das Limmatquai, wobei sie sich stets beim Sternen-Grill am Bellevue eine oder auch zwei der berühmten Bratwürste gönnte.
Auf ihrem Rundgang blieb sie immer wieder kurz stehen, um dem gemeinsamen Glockenkonzert der Altstadtkirchen St. Peter, Fraumünster und Grossmünster zu lauschen und den Schwänen am Seeufer zuzuschauen. Oder sich über die schwindelerregenden Preise der zahlreichen Nobelboutiquen zu wundern. Wer solche Klamotten kaufte, war ihr schleierhaft. So wenig Stoff für so viel Geld! Das war definitiv nicht ihre Welt. Nie hätte sie ein solches Geschäft betreten, selbst wenn sie ein Vermögen besessen hätte. Die heuchlerische Freundlichkeit arroganter Verkäuferinnen hätte sie nicht ertragen.
Manchmal wurde sie von Touristen, asiatischen vor allem, nach dem Weg oder einer speziellen Sehenswürdigkeit gefragt, weil sie für eine Polizistin oder Fremdenführerin gehalten wurde. Das schmeichelte ihr sehr. Freundlich und detailgetreu gab sie Ratschläge über besonders interessante Stätten und wies natürlich auch auf ihr Museum hin. Ein Geheimtipp für Kulturfreunde! Naja, ein bisschen Werbung konnte nicht schaden. Zugegeben: Ihr Museum umfasste nur einen Bruchteil dessen, was weltberühmte Institutionen, wie die Uffizien, beherbergten. Aber dieser Bruchteil war in ihren Augen absolut erstaunlich, bemerkenswert, einmalig. Zu Unrecht völlig verkannt.
Der schlichte ältere Bau umfasste mehrere Sektoren und Flügel, in denen die verschiedensten Kunst- und Stilrichtungen von der Frühzeit bis zum 20. Jahrhundert präsentiert wurden. Antonias Reich war der Saal mit den altgriechischen Skulpturen, Vasen und Bronzen aus dem Nachlass des Barons Eduard Klunge von Rabis, einem aus Deutschland eingewanderten Hobbyarchäologen, der seinerzeit selbst an Ausgrabungsarbeiten teilgenommen hatte. Der Baron hatte zu Lebzeiten noch die genaue Anordnung der Exponate bestimmt: die Vasen in einer Glasvitrine in der Mitte des Raums, damit sie von beiden Seiten betrachtet werden konnten. Die überlebensgrossen Marmorskulpturen in den Ecken, die kleinen Bronzestatuetten in zwei Vitrinen an der hinteren Wand, beidseits des berühmten Grabreliefs «Sitzende Frau mit Sklavin» aus dem 5. Jahrhundert vor Christus.
Antonia liebte diesen Raum, die leicht verstaubten Vitrinen, die nach Altertum riechende Luft, die schweren, ausgebleichten Vorhänge, die sie im Sommer schon am Morgen halb zuzog, um die antiken Kostbarkeiten vor dem grellen Licht zu schützen. Oft schaute sie aus dem Fenster, über Dächer, Türme und Giebel hinweg zum Üetliberg und wünschte sich, ein Vogel zu sein, frei umherzufliegen wie die Tauben, sich hochzuschwingen, auf alles herabzuschauen und überall Dreck fallen zu lassen, auf diese Stadt, ihre Bewohner und Besucher. Vor allem Letzteres, dachte sie, müsste überaus befreiend sein.
Da sich die Sammlung im vierten Stock befand und der Lift bloss bis zum dritten Stock fuhr, kamen meist nur ein paar wenige Altertumsliebhaber. Etwas atemlos vom Treppensteigen streiften sie jeweils suchend durch den Raum, warfen einen kurzen Blick auf die Skulpturen und verglichen schliesslich das Grabrelief mit der Abbildung in ihrem Reiseführer. Manche riefen Antonia über die Schulter zu: «Ist es das?» Andere zückten gleich ihre Mobiltelefone. Dann erhob sich Antonia von ihrem Stuhl neben dem Fenster und sagte in strengem Ton: «Fotografieren verboten.» Danach verzogen sich die Leute bald wieder. Das war ihr sehr recht. Denn so hatte sie Zeit, ihren Gedanken nachzuhängen und Zwiesprache mit den verschiedenen Figuren zu halten. Längst kannte sie alle Details der ausgestellten Objekte, hätte jederzeit Auskunft über Fundorte, Alter und Namen der Dargestellten geben können. Aber das war nicht ihre Aufgabe. Dafür waren die diplomierten Führerinnen und Führer zuständig. So behielt sie das Wissen für sich und lächelte höchstens vielsagend, wenn wieder einmal jemand mit geschwellter Brust über einen Gegenstand referierte. Sollten sie doch irgendeinen Schwachsinn behaupten! Gut, dass ihre Schutzbefohlenen nicht alle Details von sich preisgeben mussten. Besonders ER, der überlebensgrosse Jüngling in der linken Ecke, hatte es nicht verdient, mit neugierigen Blicken und dreisten Fragen seziert zu werden. Für IHN, der täglich seine Hand begehrend nach ihr ausstreckte, hatte sie längst viel mehr als nur Bewunderung entwickelt. Im Stillen nannte sie ihn Adonis.
Eine Tafel an der Wand beschrieb ihn als «Statue der Kykladeninsel Andros, 4. Jh. v. Chr.» Nur wer sich die Mühe nahm, die Detailbeschreibung im Museumsarchiv zu studieren, erfuhr, dass es sich wohl um die Darstellung eines jungen Gottes handelte, geschaffen aus parischem Marmor «in grossartiger Ausgestaltung». Auf einem doppelten Sockel stehend, hatte er die rechte Hand wie zum Gruss erhoben. Der linke Arm war knapp unter dem Ellenbogen abgebrochen. Die Haare fielen wie Flammen rund um die Stirn, und auf seinen Lippen lag ein verheissungsvolles Lächeln. Es handle sich, so war in einer alten Beschreibung zu lesen, trotz einiger Unvollkommenheiten um ein bemerkenswertes Werk. Denn der Körper habe durch die exakte Wiedergabe der Muskeln eine unglaubliche Plastizität erhalten.
Sie wusste, dass das nicht alles war. Von allem Anfang an hatte sie die Kraft gespürt, die in ihm wohnte. Dies war kein seelenloses steinernes Abbild, sondern die materialisierte Liebe schlechthin. Über die Jahrtausende hinweg hatte sich in diesem Marmor eine ungeheure Zahl von Informationen gespeichert, dessen war sie sicher: «Die Steine leben. Man muss ihre Botschaft nur entschlüsseln können.» Und wie sollte das anders möglich sein als über Gefühle? Doch das war nicht immer einfach. Manchmal empfing sie längere Zeit keinen einzigen Impuls. Dann wieder glaubte sie, eindeutige Zeichen zu erhalten. So wurde ihr eines Tages schlagartig klar, wie grausam es war, dass einer wie er, der jahrhundertelang auf das blaue griechische Meer geblickt hatte, nun nicht einmal mehr in den Himmel schauen konnte. Wenn man ihn nur ein bisschen nach links drehen würde, hätte er anstelle der alten Vasen das Fenster im Blick. Doch ihr Versuch scheiterte kläglich. Trotz kräftigem Ziehen und Stossen vermochte sie den Sockel keinen Zentimeter zu verschieben. Dafür begann die Statue selber gefährlich zu wanken. Scheinbar waren die Füsse nicht mehr fest genug im Sockel verankert. Oh Gott, was da hätte passieren können!
In den folgenden Monaten wies sie sowohl den Kurator als auch den Direktor mehrmals auf die unhaltbare Situation hin, natürlich ohne ihren Versuch zu erwähnen. Ihre Bitte um eine rasche Reparatur, oder besser noch, eine Neukonzeption der ganzen Präsentation, die IHN ins Zentrum rücken würde, stiess jedoch auf taube Ohren. Die Stadt habe für so etwas kein Budget. Alle finanziellen Mittel seien in den Neubau des «Museums für Transzendentale Installationen» geflossen.
«Wozu denn Transzendentale Installationen!», dachte sie bitter. Das besagte Museum bestand aus lauter leeren Räumen. Aber gerade das, so wurde sie belehrt, sei das Geniale daran: Nur wo nichts sei, könne der Geist etwas entwickeln. Oder anders gesagt: Man müsse den Menschen Gelegenheiten bieten, sich ihrer eigenen Fantasie zu stellen.
Antonia verstand kein Wort. War das keine Fantasie, was sie praktisch jeden Tag erlebte, wenn sie in der Stille des Museums die Wellen der Ägäis rauschen hörte? Wenn sie den Rosmarin, den Basilikum und den Oleander in den Tälern von Andros roch? Wenn sie den köstlichen Geschmack gefüllter Tomaten auf der Zunge spürte? Und wenn ER ihr bedeutete, dass er ohne sie nicht sein könne? Diese Momente gehörten zu den Schönsten in ihrem Leben.
Als sie von den Sommerferien zurück kam, war indessen alles anders. Ihr Stuhl stand nicht mehr neben dem Fenster, sondern neben dem Eingang, sodass der Blick auf ihren Adonis durch die Vitrinen verbaut war. Dies aufgrund einer neuen Vorschrift, die auf einem Gutachten über Diebstahlprävention basierte. Sie realisierte deshalb erst nach geraumer Weile, dass sich bereits eine Person direkt vor dem schönen Jüngling auf den Boden gesetzt hatte. Eine weibliche, junge und ziemlich attraktive noch dazu. «Fotografieren verboten!», rief sie gebieterisch. Da erhob sich die Person und verkündete mit strahlendem Lächeln: «Ich fotografiere nicht. Ich zeichne!» Antonia traf fast der Schlag. Was in Fleisch und Blut vor ihr stand, war eine Kopie der Frau auf dem berühmten Grabrelief. Wie eine Gesandte aus der Vergangenheit! Ein dumpfes Pochen kroch aus ihrem Bauch durch den ganzen Körper hinauf bis in die Schläfen und ihre Stimme wurde ungewöhnlich schrill: «Das geht nicht. Nehmen Sie sich sofort ein anderes Sujet!» Nun verzog die junge Frau den Mund zu einem spöttischen Lächeln. «Ich kann nicht aufhören, es geht um die Kreation der Grundstruktur für eine Transzendentale Installation im neuen Museum. Die Direktion hat mir die Erlaubnis dazu erteilt.» Und das traf tatsächlich zu, wie Antonias sofortige Nachfrage beim Direktionssekretariat ergab. Man habe einer vielversprechenden Nachwuchskünstlerin namens Nathalia eine Bewilligung für drei Monate erteilt. Sie, Antonia, solle sie bitte nicht behindern. Es gehe um ein neuartiges, geradezu visionäres Werk.
«Die Zeichnungen», erläuterte die junge Frau, «bilden die stoffliche Grundlage für eine dreidimensionale Figur, teilweise überlagert oder verbunden mit Fotos von Marilyn Monroe und Kate Moss, alles in tänzerisch-erotischer Bewegung, selbstverständlich.»
«Selbstverständlich», murmelte Antonia und sah vor ihrem geistigen Auge, wie ihr Liebster verhöhnt und seiner unbefleckten Anmut beraubt würde. «Das darf niemals geschehen», schwor sie sich. Doch Nathalia liess sich nicht umstimmen. ER und kein anderer musste es sein. Und so sass sie jeden Morgen drei Stunden vor dem Standbild, beäugte jeden Teil seines Körpers, sogar mit der Lupe, und nahm ihm mit ihrem rücksichtslosen Skizzieren jegliche Würde.
Dann, an einem Mittwoch im September, wollte es der Zufall, dass Antonia ganz allein auf dem 4. Stock Wache hielt, weil die alte Sofia von der benachbarten ägyptischen Sammlung mit einer schweren Erkältung im Bett lag. So waren die Exponate während ihres Toilettengangs für etwa fünf Minuten unbeaufsichtigt, was sich insofern verantworten liess, als Nathalia währenddessen am Zeichnen war und sich somit niemand unbemerkt an den Ausstellungsstücken vergreifen konnte.
Wer hätte denn ahnen können, dass sich genau in dieser Zeit etwas so Schreckliches ereignen würde? Als Antonia von der Toilette zurückkam, fiel sie sogleich in Ohnmacht. Ihr Geliebter lag in einer Blutlache auf dem Boden, über beide Beine zogen sich lange Risse, der Rest des linken Arms war zerschmettert, die rechte Hand lag abgetrennt neben dem Kopf, ein wirres Haarbüschel zwischen den Fingern. Und unter seinem Körper befand sich offenbar ein genauso lebloser zweiter. Es war derjenige von Nathalia.
Antonia war noch immer nicht völlig bei sich, als die Polizei eintraf. Offenbar hatte ein britisches Besucherpaar den Alarm ausgelöst. Auf die Frage, was passiert sei, konnte sie nur «Toilette» stammeln. Die Tränen rannen ihr in Strömen übers Gesicht. «Na, na», tröstete sie der Direktor. «Ein tragisches Unglück, zweifellos. Aber Sie trifft keine Schuld.» Der Fall sei doch klar: Die junge Frau habe in ihrem künstlerischen Taumel die Statue zu heftig angefasst, vielleicht sogar umarmt, und sei mit ihr zusammen zu Boden gestürzt. Sie habe ja nicht ahnen können, dass der Sockel beschädigt war – den man übrigens in den nächsten Tagen habe reparieren wollen. «Absolut einleuchtend», fanden die beiden Polizisten. «So muss es gewesen sein», bekräftigte der Sanitäter. «Traurig, aber ein gerechtes Schicksal», meinte der ebenfalls herbeigerufene Kurator. Antonia konnte trotzdem nicht aufhören zu weinen. «Die Statue, dieses fantastische Werk …» Der Direktor lächelte väterlich: «Machen Sie sich um die keine Sorgen, die flicken wir schnell wieder zusammen. Nehmen Sie Urlaub und fahren Sie an irgendeinen erholsamen Ort. Wenn Sie zurückkommen, steht sie in voller Schönheit wieder da.»
Antonia nickte. Es bestand wirklich kein Grund zum Heulen. Schliesslich war alles bestens gelaufen. Ein Stoss hatte genügt, um den Jüngling zu Fall zu bringen. Genau im richtigen Moment an die richtige Stelle. Gewiss hatte er selber es so gewollt. Voller Zärtlichkeit blickte sie auf seine abgebrochene Hand und flüsterte unhörbar «Danke». Ja, jetzt wollte sie Urlaub beziehen und nach Andros fahren.
Gefüllte Peperoni –eine Erinnerung an Ferien auf Andros
Zutaten pro Portion
2 grüne Peperoni
2 gehäufte EL Langkornreis
2 ausgepresste Knoblauchzehen
1 kleine gehackte Zwiebel
2 Prisen Salz
2 dl Olivenöl
4 mittelgrosse Kartoffeln
Peterli, Thymian, Basilikum, Pfefferminzblätter Gemüsebrühe
Zubereitung
Auf der Stilseite der Peperoni einen Deckel abschneiden, das Fruchtfleisch herausschälen und ohne Kerne zerkleinern.
Den Boden einer feuerfesten Schüssel mit Olivenöl einfetten, die Peperoni nebeneinander hineinstellen.
Reis, zerkleinertes Fruchtfleisch, gehackte Zwiebel, ausgepresste Knoblauchzehen, fein geschnittene Kräuter und Salz vermischen.
Jede Peperoni bis 1 cm unterhalb des Randes mit der Reismischung füllen. Je 1 EL Olivenöl darüber geben und mit dem passenden Deckel verschliessen.
Die Kartoffeln schälen, vierteln und zwischen die Peperoni legen. Schüssel mit Gemüsebrühe bis ca. 2 cm unter den Rand auffüllen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad dünsten, bis der Reis gar ist, was je nach Ofen 45 Minuten bis 1 ½ Std. dauern kann. Zwischendurch mehrmals die Peperoni mit Gemüsebrühe übergiessen.
2
Die Präsentation
I