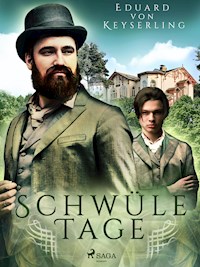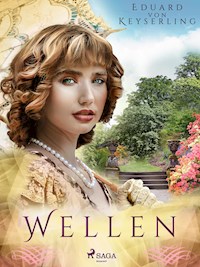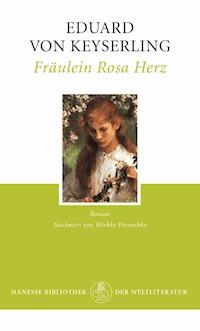
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem ersten Roman widmet sich Eduard von Keyserling dem prekären Glück der Besitzlosen. Voller Mitgefühl und Sympathie zeichnet er die Figur der Rosa Herz, die um ihrer ersten Liebe willen zum radikalen Bruch der Konventionen bereit ist.
Rosa Herz ist siebzehn Jahre alt und hat einen einzigen Wunsch: der Enge und Biederkeit der Kleinstadt zu entfliehen. Beim Gedanken an eine Zukunft als Lehrerin an der Töchterschule und Ehefrau des schmierigen Ladendieners Lurch packt sie das Grauen. Als der charmante Ambrosius Tellerat in der Stadt auftaucht, verströmt er den abenteuerlichen Duft der weiten Welt und verzaubert Rosa auf der Stelle. Doch ihrer Liebe stehen allerlei Hindernisse im Weg – und es bräuchte einen willensstärkeren Mann als Ambrosius, um sie zu überwinden.
Mit Rosa Herz, dem Mädchen aus kleinen Verhältnissen, aber mit großen Träumen von Freiheit und Selbstbestimmung, schuf Eduard von Keyserling (1855−1918) eine seiner liebenswertesten Frauenfiguren. Ihren Ausbruchsversuch aus den gesellschaftlichen Zwängen − und dessen bittere Konsequenzen – schildert Keyserling mitreißend und mit scharfem Witz. Die bigotten Spießbürger werden der Lächerlichkeit preisgegeben. Was zunächst wie das subtil-ironische Porträt einer provinziellen Idylle daherkommt, entpuppt sich als beißende Kritik an einer Gesellschaft, die jede Abweichung gnadenlos ächtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
EDUARD VON KEYSERLING
Fräulein Rosa Herz
Eine Kleinstadtliebe
Roman
Nachwort von Wiebke Porombka
MANESSE VERLAG
ZÜRICH
So di che poco canape s’allaccia
Un’ anima gentil, quand’ ella è sola,
E non è chi per lei difesa faccia.1
Petrarca
VORWORT
Ich weiß sehr wohl, dass Rosa Herz nur ein unbedeutendes armes Mädchen ist, das ein Schicksal erleidet, wie es unzählige unbedeutende arme Mädchen erleiden. An ihr und ihrem Schicksal ist somit nichts, was des Aufhebens wert wäre. Dennoch – könnte ich bewirken, dass der Leser diese unbedeutende Mädchenseele und dieses gewöhnliche Schicksal nachfühlt und nachlebt, so würde ich glauben, demjenigen mit meiner Erzählung willkommen zu sein, der, nicht zufrieden, nur ein Leben und eine Seele zu besitzen, gern fremdes Leben in sich aufnimmt. Da ist es denn gleich, ob es ein König oder ein armes Mädchen ist; nur ein Menschenleben – wirkliches Leben – muss es sein – «ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe», sagt der Prediger Salomonis.2
Der Verfasser
ERSTES BUCH
Liebesversuche
ERSTES KAPITEL
Den Ort, an dem Fräulein Rosa Herz das Licht der Welt zuerst erblickt hatte, vermochte keiner anzugeben. Wo ihre Wiege gestanden – ob sie überhaupt je eine Wiege besessen –, wer konnte es wissen! Über jenen Teil von Fräulein Rosas Leben hatte sich undurchdringliches Dunkel gebreitet.
Herr Klappekahl, der Apotheker, war gewiss ein Mann von seltenem Scharfblick. Ein halbes Jahr hatte er in der Residenz verlebt, und die Früchte jenes Aufenthaltes, ohne Zweifel, waren: Weltklugheit, Bildung, skeptische Klarheit in der Beurteilung der verwickeltsten Verhältnisse; Eigenschaften, die ein jeder ihm zuerkannte. Vielleicht auch ein Anflug von Frivolität, aber – «Mein Gott!», meinte er, «wer kann sich in der verderbten Weltstadt davor bewahren!» Herr Klappekahl nun pflegte zu sagen, wenn das Gespräch auf Rosa Herz kam: «Ihren Geburtsort? Gott, wer soll den kennen! Solche arme Würmer kommen ebenso geräuschlos und plötzlich zur Welt wie die Pilze nach dem Sommerregen. Gelegentlich einmal, während eines Zwischenaktes, hinter einer alten Kulisse, was weiß ich! – Das Publikum klatscht und ruft. Dann tritt der Regisseur vor und dankt, denn die Fee oder der Engel kann nicht erscheinen, ein kleines Unwohlsein … Und in einer Ecke hört man’s piepen. In einer verstaubten Papprüstung – auf einem wackeligen Theaterthron liegt etwas in Gazefetzen gewickelt und wimmert. Das ist dann das Kind, Fräulein Soundso, Fräulein Rosa. Es wird mit all dem Plunder zusammengepackt, und weiter geht es. Glauben Sie, Madame Herz oder Monsieur Springinsfeld erinnerten sich schließlich selbst daran, wo die Geschichte mit dem Kinde passierte? Gott bewahre! Das geht alles so geschwind; heute hier, morgen dort. Ich kenne das!»
Was kannte Herr Klappekahl nicht! Und hier hatte er, wie sonst immer, recht. Rosas Mutter war Balletttänzerin, ihr Vater Balletttänzer gewesen. Während des rastlosen Umherziehens von einer Stadt zur anderen war Rosa geboren worden; doch kostete ihre Geburt der armen Madame Herz das Leben. Herr Herz – traurig, einsam, des Tanzens müde, sehnte sich danach, sein unstetes Leben mit einem ruhigeren zu vertauschen. Auf diesem Standpunkte angelangt, gedachte er wieder seiner Heimatstadt.
Als Knabe hatte er sie verlassen, zum Leidwesen seines Vaters, des braven Schustermeisters Herz, um, statt für die Füße anderer Leute zu sorgen, sich mit den seinigen unsterblichen Ruhm zu erwerben. Jetzt sehnte sich sein alterndes Herz nach der friedlichen Heimat zurück. Sein Vater war längst tot, aber eine Schwester lebte ihm noch; eine musterhafte Schwester. Als Herr Herz von dem Verluste seiner Gattin betroffen ward, langte ein schwarzgerändertes Schreiben von Frl. Ina Herz an, voll schwesterlichen Bedauerns und frommer Ermahnungen. Am Schluss meinte die gute Seele: Da die kleine Rosa der mütterlichen Pflege beraubt sei, möge man ihr das Kind bringen; sie wolle für dasselbe sorgen und ihm eine zweite Mutter sein. – Gerührt von so viel Liebe, beschloss Herr Herz, nicht nur das Kind, sondern auch sich selbst der Sorgfalt seiner guten Schwester anzuvertrauen. So begab er sich denn mit seiner Tochter in seine Heimatstadt zurück.
Anfangs zwar war Fräulein Ina über diese Wendung der Dinge ein wenig bestürzt; aber ihre mutige Seele fand sich selbst in die neue Lebenslage hinein. Die ganze Familie Herz versammelte sich traulich um einen Herd und lebte in Eintracht von dem kleinen Vermögen des Fräulein Ina, denn Herr Herz hatte aus seiner langen Künstlerlaufbahn nur steife Beine und greise Haare gerettet. «Ertanztes Geld», meinte er – und er hatte seinerzeit viel ertanzt –, «sei, weiß es Gott, das unbeständigste der Welt!»
Fräulein Ina pflegte ihre Schutzbefohlenen mit jener zarten Aufopferung, die besonders alten Frauenherzen eigen zu sein scheint, denen das Leben es lange Zeit versagt hat, ihre Liebebedürftigkeit zum Ausdruck zu bringen. Die müden Füße des Balletttänzers durften jetzt in bequemen Pantoffeln ausruhen, und die stille, geordnete Häuslichkeit gewährte dem geplagten Komödianten-Herzen ein tiefes Behagen. Herr Herz wurde mit seiner alten Schwester selbst zur alten Jungfer. Er besuchte fleißig die Kirche, ward Mitglied des Armenvereines; sammelte eifrig die kleinen Ereignisse der Stadt, um sie eifrig wieder auszutragen. Sah man die Geschwister Herz beieinander, so fand man mehr männliche Entschlossenheit in Fräulein Ina als in ihrem Bruder.
Auf die kleine Rosa ward die äußerste Sorgfalt verwandt. Fräulein Ina ließ das Kind nicht aus den Augen; es musste zu ihren Füßen auf dem Teppich spielen, sie sang es des Abends mit tiefer, heiserer Stimme in den Schlaf; sie nahm es stets in die Kirche mit. Rosa schlief zwar während des ganzen Gottesdienstes; Fräulein Ina jedoch meinte, der bloße Aufenthalt in dem heiligen Raum müsste guttun; vielleicht hoffte sie auch dadurch gewisse weltliche Einflüsse zu bannen, die bei der Geburt des Kindes gewaltet haben mochten.
Nachdem Herr Herz sich eine Zeit lang ausgeruht hatte, fühlte er wieder den Drang nach Beschäftigung in sich erwachen, auch quälte ihn das Bewusstsein, nur auf die Mildtätigkeit seiner Schwester angewiesen zu sein. Die Stelle eines Turnlehrers am städtischen Gymnasium war frei. Er bewarb sich um dieselbe und erhielt sie. Daneben erbot er sich, jährlich, von Weihnacht bis zu den Fasten, den heranwachsenden Herren und Damen des Städtchens Tanzunterricht zu erteilen.
Das einträchtige Beisammenleben mochte einige Jahre gedauert haben, als Fräulein Ina eines Morgens ihrem Bruder melden ließ, er möge beim Frühstück nicht auf sie zählen, da sie, eines leichten Unwohlseins wegen, länger im Bett bleiben wolle. Aber auch um die Mittagsstunde, als er aus dem Gymnasium heimkehrte, fand er seine Schwester nicht im Wohnzimmer. Er eilte in ihre Schlafkammer. Da lag sie bleich und regungslos auf ihrem Bett. Die kleine Rosa saß auf dem Estrich daneben und spielte mit der herabhängenden Hand ihrer Tante. Fräulein Ina war tot.
Dieser Verlust musste den armen Herrn Herz auf das Empfindlichste treffen. Nicht nur die Liebe zu der treuen Schwester weinte in seinem Herzen; neben dieser tapfern und kräftigen Genossin hatte er sich entwöhnt, für sich und sein Kind zu sorgen. Wie eine wohltätige Vorsehung hatte Fräulein Ina um ihn gewaltet und ihm jede Aufregung eines Entschlusses erspart. Jetzt, dieser Stütze beraubt, fühlte er sich hilflos und verwaist.
Auf die Trauerbotschaft eilten viele Nachbarn herbei und staunten den alten Mann an, der wie ein Kind weinte, liebevoll den Arm der Toten streichelte und immer wiederholte: «Schwester, was fange ich nun an? – Und die Rosa? – Schwester, dass du das tatest!»
Herr Klappekahl bemerkte zu diesem Auftritt: «So einer von der Bühne hat doch mehr Sentiment und Aplomb als jeder andere Christenmensch.»
Agnes Stockmaier, die alte Dienerin, hüllte ihre Herrin in das schwarzseidene Abendmahlkleid, setzte ihr die schwarze Spitzenhaube auf und legte ihr ein Kruzifix in die bleichen Hände. So trug man Fräulein Ina zum Friedhof hinaus. Der Pfarrer Raser hielt am Grabe eine erbauliche Rede, in der er die Verdienste der Dahingeschiedenen nicht genug zu preisen wusste und ihr reichen Himmelslohn verhieß. Die zahlreich erschienenen Freunde drückten die Taschentücher an die Augen und sprachen halblaut miteinander: «Also ganz plötzlich?»
«Ja, ein sanfter Tod!»
«Gott sei gelobt!»
Dann blinzelte der eine oder der andere zur hellen Märzsonne auf und meinte gefühlvoll: «Sie hat ein wahres Gotteswetter für ihre letzte Reise.»
Herr Herz stand bleich, eine große Kreppschleife am Hut, vor der Gruft und blickte, jetzt gefasst, vor sich nieder. Agnes Stockmaier trug die kleine Rosa auf dem Arm, die, fest in ein schwarzes Umschlagtuch gehüllt, staunend all die ernsten Menschen anblickte und die zarten Linien ihres Gesichtchens verzog, als wollte sie weinen.
Im Haushalt der Herz’ übernahm nun Agnes Stockmaier die Rolle ihrer verewigten Herrin. Sie besorgte die Wirtschaft, erzog Rosa, ja hatte auch gewissen Einfluss auf die Verwaltung des kleinen Vermögens, welches Fräulein Ina ihrem Bruder hinterlassen hatte. Herr Herz fügte sich willig in die neue Herrschaft, froh, sich wieder seiner gewohnten Sorglosigkeit hingeben zu dürfen. Er ging jetzt mehr aus; saß des Abends im Klub und spielte Whist. Sonst blieb alles beim Alten. Fräulein Schank, die Freundin des Fräulein Ina und Vorsteherin der städtischen Töchterschule, kam zuweilen, um nach Rosa zu sehen, und erteilte ihr auch den ersten Unterricht, als die Zeit dazu herankam.
ZWEITES KAPITEL
Als Rosa Herz ihr siebzehntes Jahr erreicht hatte und Primanerin der Schank’schen Schule war, gab ein jeder im Städtchen es zu, dass Rosa ein sehr hübsches, lustiges und gutes Kind sei. Nur eines ward ihr mit Recht vorgeworfen: Sie glaubte berechtigt zu sein, ohne irgendeinen triftigen Grund jede beliebige Unterrichtsstunde versäumen zu dürfen, nur weil die Sonne gerade besonders hell schien oder weil, wie sie meinte, Fräulein Schanks Gesicht ihr heute besonders zuwider war. Wenn ihre Mitschülerinnen sich auf die Bänke setzten und gespannt auf die Türe blickten, durch welche die Lehrerin eintreten sollte, stülpte Rosa den braunen Sommerhut gleichmütig auf den blonden Kopf und verließ mit verbindlichem Lächeln, als täte sie das Selbstverständlichste von der Welt, das Zimmer. Dagegen vermochten weder Strafarbeiten noch Ermahnungen, noch die strengsten Verweise etwas auszurichten.
Nachlässig, als gäbe es keine Lehrerin, die ihr begegnen könnte, stieg sie die Stufen der Treppe hinab und ging ihres Weges. Sie setzte die Füße dicht voreinander und trat stärker mit der Spitze auf, was der ganzen Gestalt im verblichnen, grauen Sommermäntelchen ein leichtes Hin- und Herschwanken, eine freie, sorglose Bewegung gab, wie man sie oft bei Knaben aus dem Volke findet, deren Glieder nie durch einen Zwang beengt werden. Die blonden Haare flatterten unter dem verbogenen Hute hervor; sie waren zu leicht, um lange Ordnung halten zu können. Unter der geraden, runden Nase stand ein sehr beweglicher Mund mit ein wenig breiten, sinnlichen Lippen; die Mundwinkel jedoch waren ganz spitz und hinaufgebogen, was dem Gesichte etwas Kluges, Nachdenkliches verlieh. Die Augen aber waren es, die diesem Mädchen jene frische Klarheit gaben, die den Gesamteindruck ihrer Persönlichkeit bildete; runde, hellblaue Augen unter rötlichen Augenbrauen; ein Blau, das für Licht und Freude so empfänglich und eines intensiven, fast scharfen Glanzes fähig ist.
Langsam schritt Rosa an den Gartenzäunen der engen Gasse entlang. Einer Kindsmagd, die auf einem Gartenwege mit einem Kinde spielte, winkte sie einen Gruß zu, sang einen Liedervers mit tiefer Stimme vor sich hin und pflückte zerstreut die sonnenwarmen Blätter von den Hecken, um sie wieder zu verstreuen.
Die «Schulgasse» mündete in den «Stadtgarten» – den Stolz der Bürgerschaft: ein anmutiges Stück Rasenland, niedrige, künstlich aufgeführte Hügel; eine grün angestrichene Hängebrücke; kleine Lauben allerort, runde Plätze, mit jungen Kastanien und Linden besetzt. Auf der Westseite ward der Garten von einem Flusse begrenzt, der, in enge, hohe Ufer eingezwängt, hier eine wunderliche Stromschnelle bildete. Auf der Nordseite erhob sich der breite rote Backsteinbau des Gymnasiums mit seinem unbeholfenen achteckigen Turm und seinem geräumigen Hof, auf dem sich die Schüler in freien Augenblicken tummeln durften.
Rosa bog in einen Kiesweg des Stadtgartens ein, spähte von einer Anhöhe in den leeren Schulhof hinab und begab sich dann in eine Fliederlaube, um dort auf der Bank auszuruhen. Den Hut schob sie von der heißen Stirn in den Nacken, streckte die schlanken, siebzehnjährigen Beine gerade von sich und holte aus der Tasche ihres Mantels ein Buch hervor, das einen grauen Einband und auf dem Rücken einen gelben Zettel mit einer Nummer hatte. Zuweilen, wenn sie an einen Absatz gelangte oder die Seite umwandte, erhob sie den Kopf und blickte in den Garten hinaus. Dieser lag friedlich, in Sonnenglanz gebadet, vor ihr. Das Grün des Rasens ward von einem Staubschleier bedeckt, der ihm einen gelblichen Anflug gab. Die Baumgruppen auf den Hügeln malten große dunkelgrüne Flecken auf das satte Himmelsblau. Ein Häuschen mit einer Holzveranda lag am Eingange des Gartens, rote Buchstaben auf einem weißen Schilde verkündeten, dass hier Verkauf von Wein und Bier stattfinde. Ein Kellner lehnte müßig an einer Holzsäule der Veranda, den Rücken der Sonne zugekehrt, die den abgetragenen Frack wie Metall erglänzen ließ.
Auf dem breiten Kiesweg ging eine alte Dame langsam auf und ab, bei jedem Schritte mit dem Kopfe nickend. Zerstreut schaute Rosa über all das hinweg, und wenn sie sich wieder auf ihr Buch niederbeugte, hoben sich ihre Brauen mit leichtem, missmutigem Zucken. Sie erwartete jemanden, dessen Ausbleiben ihr verächtlich erschien.
Natürlich! War Rosas Platz in der Töchterschule leer, so musste auch in der Sekunda des Gymnasiums eine Lücke sein. Hatte Rosa es für gut befunden, lieber im Stadtgarten als auf der Schulbank ihre Zeit zu verbringen, so wäre es von Herweg Kollhardt feige und lächerlich gewesen, bei den Büchern zu bleiben. Er ließ sich dieses Vergehen nicht zuschulden kommen; ihm fehlte jedoch bei der Ausführung seiner Flucht jene kühne Ruhe, die man an Rosa bewundern musste, und so war sein Erscheinen zuweilen verspätet. Aber er kam. Hörte Rosa seinen schweren Tritt, dann vertiefte sie sich noch eifriger in ihren Roman und sah erst auf, wenn er vor ihr stand und seine Entschuldigung vorbrachte.
Baron Kollhardt von Kollerwegen liebte Rosa, und sie ließ es geschehen. Ein Sekundaner ist stets verliebt, und das hübsche Wort «Liebe» wird im vertrauten Sekundanerkreis viel genannt. Aber auch die Schank’sche Schule, wie jede Schule, beschäftigte sich viel mit jener schönen Leidenschaft. In der Prima galt es für eine Schande, nicht zu lieben. Eine jede hatte ihre «Liebe» und sprach in ruhigem Geschäftston davon wie von etwas Selbstverständlichem: «Gestern sah ich deine Liebe, er ging bei uns vorüber.» – «So! Wer ist doch deine Liebe? Ah so, ich weiß schon!» Und dann kamen die Geschichten von bedeutungsvollen Blicken, von Lächeln, Bemerkungen. An Gegenliebe zweifelte eine Schank’sche Schülerin nie; nur hatte den meisten die Gelegenheit gefehlt, sich ihrer Liebe zu nähern. Marianne Schulz hatte lange nicht gewusst, für wen sie sich entscheiden sollte, bis sie endlich, auf das Drängen ihrer Freundinnen, erklärte, sie liebe den Sekretär Feiergroschen. Sobald nun der Sekretär an der Schule vorüberging, hieß es: «Marianne, Marianne! Deine Liebe geht vorüber!» – dann stellte sich das arme Kind – über und über rot – an das Fenster und riss die runden Augen weit auf, während Herr von Feiergroschen ruhig vorüberging, ohne zu ahnen, dass es eine Marianne Schulz auf der Welt gäbe. Aber immerhin! Marianne war froh, dass sie eine Liebe gefunden hatte. Rosa war zu unmittelbar und zu lebhaft, als dass sie sich mit diesen Liebesgeschichten ins Blaue hinein zufriedengegeben hätte. Der Sekundaner Kollhardt war ihre «Liebe». Gut! Sie schrieb ihm einen Brief und bestellte ihn in den Stadtgarten. Seitdem wiederholten sich diese Zusammenkünfte; Rosa war von ihren Mitschülerinnen ihrer Kühnheit wegen bewundert und als Autorität in Liebessachen angesehen.
Herweg Kollhardt sah äußerst gutmütig und liebevoll aus, wenn er verlegen vor Rosa stand, den breitkrempigen Hut vom Kopfe nahm und sich die feuchte Stirn trocknete. Er war von behaglicher Fülle, die man bei Jünglingen seines Alters nur selten findet. Überall weiche, runde Linien, Arme und Beine drohten das blaue Sommertuch des Anzuges zu sprengen; der Rücken hatte eine kraftvolle Wölbung, die der ganzen Gestalt etwas männlich Reifes verlieh. Von diesem mächtigen Körper lächelte ein weiß und rotes Gesicht freundlich und kindlich herab, und die kleinen braunen Augen glänzten verschmitzt zwischen den roten Wimpern hervor. Das kurzgeschorene rote Haar war stark mit Öl getränkt und stand aufrecht um die niedrige weiße Stirn.
«Es war heute wirklich schwierig», meinte Herweg lächelnd. «Ich habe enorm klug sein müssen.»
Rosa zog die Augenbrauen in die Höhe und sagte: «Was war schwierig?»
«Was?», wiederholte Herweg und setzte sich langsam auf die Bank. Er stützte die Arme auf die Knie und schwenkte seinen Hut wie einen Pendel zwischen den Beinen hin und her: «Rosa, wie können Sie so fragen? Ich mache mir nichts daraus; aber der Direktor sprach sehr unhöflich über mein häufiges Schwänzen.»
«Glauben Sie, die Schank bemerkt mein Ausbleiben nicht?», fragte Rosa gereizt.
«Wie sollte ich», erwiderte Herweg, nahm vorsichtig einen von Rosas Zöpfen und betrachtete ihn aufmerksam.
Rosa ward ungeduldig: «Was haben Sie nur?» Dann lachte sie: «Wissen Sie, Kollhardt, dass Sie mit jedem Tage dicker werden?»
«Hm, ja!», meinte Kollhardt nachdenklich. «Missfällt Ihnen das?»
«Mir? Sie wissen ja, dass mich das nichts angeht. Nur für Sie wäre es angenehmer, nicht so dick zu sein.»
«Oh, ich mache mir nichts daraus! Es kommt, denke ich, vom vielen Bier. In letzter Zeit leben wir ein wenig wild.»
«So! Ja, das glaube ich, da geht es wohl wüst her.»
«Wie man’s nimmt. Vorige Nacht haben wir bis drei Uhr gekneipt.»
«Schämen Sie sich», mahnte Rosa freundlich. «Wovon sprachen Sie denn bei diesem wilden Gelage?»
«Oh, von mancherlei! Von Ihnen, Rosa, war auch die Rede.»
«Das verbitte ich mir. Mein Name soll bei solchen – unsoliden – Kneipereien nicht genannt werden.»
«Er wird mit großer Bewunderung genannt», wandte Herweg ein.
«Ich mag es nicht», eiferte Rosa weiter. «Was haben Sie von mir zu sprechen? Sagen Sie mir das, Kollhardt.»
«Eine ganze Menge!»
«Nun was denn?»
Herweg ward verlegen und drehte zerstreut den blonden Zopf in seiner Hand, Rosa aber entzog ihn ihm, wie man einem Kinde, das seine Lektion hersagen soll, ein Spielzeug aus der Hand nimmt.
«Sagen Sie doch», wiederholte sie.
«Ich trinke auf Ihr Wohl.»
«Was mir das nützen wird! Nun gut! Was weiter?»
«Nun – ich sage, dass Sie hübsch sind, sehr hübsch.»
«Wie altmodisch!»
«Wieso altmodisch?»
«Gleichviel», drängte Rosa. «Was noch?»
«Ich spreche von meiner Liebe.»
«Davon spricht man nicht bei Kneipereien. Und dann, Ihre Liebe, Kollhardt; das ist ja Unsinn.»
«Durchaus nicht!», rief Herweg hastig. «Ich liebe Sie wirklich! Das wissen Sie ja. Ich würde mich sonst doch nicht all den Unannehmlichkeiten mit dem Direktor aussetzen.»
Rosa zuckte die Achseln, und dennoch leuchtete dieser Beweis ihr ein. Nun schwiegen beide. Herweg schaute seine Geliebte unverwandt an und lächelte behaglich. Zuweilen berührte er behutsam mit einem Finger Rosas Hand oder strich sanft über den grauen Sommermantel. Rosa achtete nicht darauf, sondern zog aufmerksam mit ihrem Absatz eine tiefe Furche in den Sand. Herweg begann wieder zu sprechen, machte die Bemerkung, der Kellner Heinrich stehe dort an der Säule, wie ein Affe, der Prügel bekommen hat; er machte Rosa auf die alte Dame aufmerksam, die, in ihrem Spaziergang innehaltend, mit schriller, klagender Stimme «Max, Max!» rief und mit einem Tuche winkte: «Eine tolle Schrulle! Ihren Hund Max zu nennen! So etwas kann sich auch nur eine alte Jungfer ausdenken! Treffe ich das Vieh einmal allein, dann soll es …» Die Unterhaltung wollte doch nicht in Gang kommen. Lähmend und erschlaffend legte sich auch über die beiden Kinder die schläfrige Mittagsruhe; jene träge, lautlose Ruhe, die wie ein flimmernder Schleier sich über das Gras und den Kies, über die Hügel und Bäume, über das Schweizerhaus, den Kellner Heinrich und die alte Dame breitete, die jetzt stumm und regungslos dastand, einsam und gefasst, denn Max kam nicht; jene Ruhe, die mit ihrer sonnigen Langeweile über dem Schulgebäude brütete und so weit das Auge reichte, wie die Gegenwart des Schuldirektors, jede lebhafte Bewegung unterdrückte, als wollte sie eine Störung des Schulunterrichtes vermeiden. Die ganze Natur war still, warm und staubig wie eine Schulstube; zuweilen nur rief eine Feldgrille ihren kleinen trockenen Ton in das Schweigen hinein, und er klang dann wie das Knarren einer Feder in einer trägen Schülerhand.
Rosa und Herweg saßen noch eine Weile beieinander, bis die Turmuhr des Gymnasiums einen heiseren Schlag von sich gab. Da trennten sie sich. Herweg nahm Rosas Hand und sagte gefühlvoll: «Leben Sie wohl, Rosa. Ich seh Sie doch bald?» Rosa nickte und stäubte noch mit einigen kräftigen Schlägen Herwegs Rock ab. Dann gingen sie auseinander.
Rosa musste wieder zur Schulstraße zurück, um zu ihrer Wohnung zu gelangen. Nachdenklich schwenkte sie ihre Schulmappe und blickte zu den Häusergiebeln auf, die schläfrig über die Kastanien auf sie herabsahen. Hier und dort machte ein geöffnetes Fenster ein schwarzes Loch in das lichtvolle Bild, gleichsam ein Mund, der in den Alltag hineingähnte. – Sie dachte an Herweg und war unzufrieden mit ihm. Die große, plumpe Gestalt; Gott, und die platten Fragen, die er tat; und das schüchterne Streicheln ihrer Hände und Zöpfe! Gewiss, es war lächerlich, und sie lächelte. Dann seufzte sie wieder.
Rosas Wohnung lag im zweiten Stock. Aus einem Fenster desselben schaute Herr Herz nach seiner Tochter aus, und als er sie erblickte, nickte er ihr zu, jenem seltsamen Drange folgend, vom Fenster aus sich einem Bekannten auf der Straße bemerkbar zu machen, wenn es auch nicht den geringsten Zweck hat. Rosa war zu sehr an dieses nickende weiße Haupt gewöhnt, um darauf zu achten. Sie stieg gemächlich die Treppen hinan und fragte beim Eintreten in das Wohnzimmer statt jeden Grußes streng, ob das Essen angerichtet sei. «Freilich», sagte Herr Herz und versuchte mit zwei Fingern die Wange seiner Tochter zu tätscheln, die Wange aber entzog sich ihm, und so fuhren die beiden Finger zärtlich im Leeren hin und her.
Das Gemach trug noch allenthalben das Gepräge seiner früheren Herrin. Überall standen wunderliche, nutzlose Sächelchen umher, die sich um einsame alte Frauenzimmer anzusammeln pflegen: unbegreifliche Ungeheuer aus Wolle und Seide, bunte Porzellanfigürchen, ganz zwecklose Körbe aus Schmelzen3, verwitterte Papierblumen, die vielleicht einst jemanden geschmückt oder an irgendetwas erinnert hatten; jetzt standen sie abgeschmackt und nichtssagend da und wussten nicht, warum sie auf der Welt seien; verstaubt und unbeachtet waren sie, tot – wie ihre Herrin.
Viele breite, schwerfällige Möbel aus Mahagoniholz, mit einem Überzug von schwarz und rotem Wollenstoff, beengten das Gemach. Ein Daguerreotyp4, den Schustermeister Herz darstellend, hing über der Kommode; man konnte darauf jedoch nur den großen weißen Halskragen unterscheiden. Auf der Kommode stand die Familienbibliothek: sechs Bände Zschokkes Novellen5, Arenths Andachtsbuch, Schillers Gedichte und drei Jahrgänge einer illustrierten Zeitschrift. Unter manchen Reliquien aus der Zeit des Fräulein Ina lag auch ein kleiner weißer Atlasschuh, an der Spitze mit einer Rosenknospe geschmückt. Er war das Einzige, was Rosa von ihrer Mutter geerbt hatte.
Neben dem Wohngemach befand sich das Speisezimmer, ein schmales Rechteck; sechs Rohrstühle, ein runder Eichentisch, ein Schrank mit Glastüren und ein großes Buffet aus Birnholz füllten den Raum, in dem Herr Herz und seine Tochter sich zum Mittagsmahl niedersetzten.
Herr Herz schöpfte die Suppe vor und zerlegte sehr gewandt den Braten, dabei war er eifrig um die Unterhaltung bemüht. «Heute», sagte er und legte Rosa ein Stück Braten auf den Teller, «während ich draußen im Hof Unterricht erteilte, sah ich eine verdeckte Kutsche den Weg hinabfahren. Du hast wohl nichts gehört?»
«Nein. Jemand vom Lande?», bemerkte Rosa.
Herr Herz schüttelte ungläubig den Kopf: «Um diese Zeit! Weiß es Gott! Ich muss später zu Klappekahl hinüber, der wird es wissen.»
Rosa war schweigsam. Ihr Vater bemerkte das wohl und fragte nach der Veranlassung, aber Rosa erwiderte, es sei nichts; sie dächte über die Kutsche nach. «Ja, merkwürdig!», plauderte Herr Herz fort. «Wie ich aus der Schule komme, begegnet mir Lanin.» Herr Herz schaute seine Tochter erwartungsvoll an, als müsste diese Nachricht Eindruck auf sie machen; Rosa jedoch bemerkte nur trocken: «So! Sprach er von seiner dummen Tochter?»
«Dummen Tochter! Rosa, wie du sprichst!» Herr Herz lachte, als wäre das ein guter Witz gewesen. «Nein», fuhr er dann fort, «er teilte mir aber mit, dass nächstens ein junger Mensch, ein Verwandter von ihm, in das Geschäft kommt.»
«Noch einer? Hat er denn mit dem Korinthen-Konrad nicht genug?»
«Mit diesem hat es seine Bewandtnis. Der junge Herr scheint ein wenig wild gewesen zu sein …»
«Ah, was hat er getan?»
«Gott, in der Jugend, da kommt manches vor! Genug, er soll hier gebessert werden. Als ich vorhin dort am Fenster stand, dachte ich darüber nach, ob Lanin bei der ganzen Geschichte nicht etwas für seine Tochter im Sinn hat, für die Sally.»
«Die!», rief Rosa und lachte, weil jedem jungen Mädchen jeder Heiratsplan außer ihrem eigenen lächerlich erscheint. «Du vergisst, Vater, dass Sally schielt.»
«Pah!», meinte Herr Herz. «Ich habe manche Schönheit gekannt, die schielte. Viele lieben das sogar.»
«Es wäre ein Glück für die arme Sally; aber ich zweifle …», sagte Rosa und hob die Tafel auf. Während sie voran in das Wohngemach schritt, wandte sie sich in der Türe um und fragte mit einem gleichgültigen Zucken der Augenbrauen: «Vater! Wie soll denn dieser neue Korinthen-Konrad heißen?»
«Ambrosius Tellerat. Er ist ein Brudersohn von ihr – der Lanin. Die Frau Lanin ist eine geborene Tellerat, wie du weißt.»
«Ach ja!»
Als Vater und Tochter im Wohngemach auf den breiten Sesseln nebeneinander saßen, bemerkte Rosa nachdenklich: «Ich glaube nicht, dass dieser – Ambrosius sie nimmt.»
«Ja, ja», erwiderte Herr Herz darauf, ohne dass es schien, als dächte er sich etwas dabei. Bequem rückte er seinen Kopf auf der Lehne des Sessels zurecht und schloss die Augen zu seinem Nachmittagsschlummer. Die Sonne badete das kleine Gesicht des alten Mannes in gelbem Feuer, entzündete in den greisen Augenbrauen leuchtende Pünktchen und wärmte die eingefallenen Wangen, dass sie zu glühen begannen wie die Wangen eines schlafenden Kindes. Die Fliegen trieben im Gemach ihr lautes Wesen und stießen ärgerlich summend gegen die Fensterscheiben. Lange Staubsäulen zogen ihre trüben Bänder durch das Zimmer.
Rosa lag in ihrem Sessel zurückgelehnt da, ganz überdeckt von stetigen Lichtfunken, die der Sonnenstrahl in ihrem Haar, ihren Augenbrauen und Wimpern erweckte. Die Augen halb geschlossen, träumte sie ihren altgewohnten Traum.
Er war mit ihr herangewachsen. Jeden Morgen erwachte er mit ihr, um ihr neu gestärkt zu folgen. Er ging mit ihr in die Schule, mischte sich in alles, was sie vornahm. In der Nacht kam er oft, mit dem seltsamen Narrentand unserer Träume angetan. Er war immer zur Hand! Wovon er sprach? Das ist das schwer zu lösende Geheimnis liebender Herzen, die nie geliebt, opfermutiger Seelen, die nie ein Opfer gebracht haben. Eines nur wiederholte er immer wieder: «Bald, bald muss etwas geschehen, muss etwas erlebt werden. Bald, sonst versäumst du’s.»
Nachdem Rosa eine Weile ihrem treuen Gefährten zugehört hatte, seufzte sie, erhob sich und ergriff Hut und Mantel, um auszugehn.
DRITTES KAPITEL
Die Straße war leer, kein Lufthauch regte sich. Gerüche von Fleisch und Gemüse strömten aus den geöffneten Fenstern. Papierfetzen und alte Schuhsohlen lagen auf dem Pflaster und sonnten sich.
Rosa ging zum Marktplatz hinab. Die Hände in die Taschen ihres Mantels gesteckt, wiegte sie sich lässig hin und her und blickte auf die Häuser und in die Fenster, mit der gleichgültigen Zerstreutheit, die wir gewohnten Dingen entgegenzutragen pflegen, wenn unsere Blicke an ihnen haften, ohne sie zu sehen.
Am Ausgang der Straße und Eingang des Marktplatzes lag das Geschäft «Firma Lanin und –», Verkauf von Kolonialwaren jeder Art. Das Geschäft Lanin war von größter Wichtigkeit für das Städtchen; lange schon war es die Hauptquelle für die Bedürfnisse der Haushaltung, und mehrere Generationen hatten den Namen Lanin zugleich mit den Worten Zucker, Rosinen und so weiter aussprechen gelernt. Herr Lanin saß im Rat, wie sein Vater und Großvater vor ihm dort gesessen. Herr Lanin spielte eine bedeutende Rolle bei der Feuerwehr, der Armenpflege und Sparkasse. Herr Lanin war eine so große Persönlichkeit, dass die bescheideneren Bürger der Stadt nicht zu protestieren wagten, wenn die Firma ihnen doppelte Rechnungen machte oder schimmeligen Käse verabfolgte. «Firma Lanin und –», stand über der Türe. Dieses «und» war eine Huldigung für die Tochter der Firma, für Fräulein Sally. Der künftige Schwiegersohn sollte Kompagnon werden; das war sicher; so legte die ganze Stadt dieses «und –» aus; bis Fräulein Sally aber ihre Wahl getroffen, musste das «und –» allein stehen bleiben und warten.
Die Firma war sich ihres Wertes viel zu sehr bewusst, um auf äußeren Glanz etwas zu geben; dieserhalb war das Geschäftslokal ein enges, finsteres, unreinliches Zimmer. Das abgeriebene, von der Sonne gebleichte Schild vor der Türe zeigte einen entsetzlichen Neger, der einen weißen Zuckerhut in den Armen hielt.
Rosa öffnete die niedrige Glastüre, die in das Lanin’sche Verkaufslokal führte, und setzte dabei eine heisere Glocke in Bewegung. Ein starker Geruch von Orangen, Fisch, feuchtem Stroh schlug ihr entgegen. Fässer und Kisten türmten sich bis zur Decke auf; schwarz angestrichene Holzleisten liefen an den Wänden hin und trugen mächtige Pakete, in blaues, gelbes, graues Papier gehüllt, halb von Dämmerung und Staub verborgen. Hinter dem Ladentisch stand Konrad Lurch, der Diener der Firma. Sein langes, sehr schmales Gesicht war über und über mit Sommersprossen bedeckt. Seine Augen hatten die matte, gelbliche Farbe des Gesichtes und schienen mit diesem ineinandergeflossen. Er trug einen weiten Rock von glänzendem Sommerstoff, wie schwarzes Packpapier, und rotgelbe Beinkleider, die in der Farbe mit dem Papier Ähnlichkeit hatten, in das man Stearinkerzen packt – acht auf ein Pfund.
«Ah, Fräulein Rosa!», sagte er leise, als Rosa eintrat.
«Guten Tag, Herr Lurch», erwiderte sie. «Wie geht es Ihnen? Ist Sally zu Hause?»
Lurch blickte nicht auf und kaute an einem Bindfaden, der von der an der Decke befestigten Rolle niederhing. «Guten Tag, Fräulein Rosa», sagte er, «mir geht es gut; ich hoffe, Ihnen gleichfalls, Fräulein Rosa? Was Fräulein Sally betrifft, so war sie die ganze Zeit über hier. Sie sehen noch dort auf der Reiskiste das Buch, in dem sie las. Plötzlich ging sie hinaus; warum, weiß ich Ihnen nicht zu sagen; ich vermute, sie wird gleich wieder hier sein.»
«Also Sie meinen, ich soll hier warten? Wie?»
«Ja, Fräulein Rosa, das wird das Beste sein. Sie setzen sich unterdessen vielleicht dort auf die Heringstonne?»
«Ich danke, wenn Sie keinen besseren Platz haben. Ich sitze nicht gern auf Heringstonnen.»
«Ja so! Natürlich! Es ist auch nicht angenehm, obgleich das ein seltener Artikel ist! Schottische Fett- oder Königs-Heringe. Aber dort die Lichtkiste? Sie ist vielleicht nicht ganz rein? Nehmen Sie mein Taschentuch und setzen Sie sich darauf.»
Lurch bot Rosa ein ganz klein zusammengeballtes Tuch an. Sie lehnte es jedoch mit dem schrillen, kurzen Lachen siebzehnjähriger Mädchen ab und setzte sich auf die Lichtkiste.
«Sollten Sie nicht einige Korinthen nehmen, Fräulein Rosa?», begann Lurch nach einer Pause.
«Nein, ich mag mir nicht immer von Ihnen Korinthen schenken lassen.»
«Oh! Fräulein Rosa – Korinthen, Korinthen –» Lurch war sichtlich verlegen. «Korinthen sind doch nur ganz kleine Rosinen.»
«Das macht nichts», versetzte Rosa energisch; dann fügte sie sanfter hinzu: «Herr Lurch! Gestatten Sie es nicht, dass wir Sie Korinthen-Konrad nennen?»
«Gewiss, Fräulein Rosa! Wenn der Name Ihnen gefällt; ich hoffe, er ist keine Verhöhnung meines Berufes; ich denke, er ist es nicht?»
«Durchaus nicht! Nur der Korinthen wegen, wissen Sie.»
«Oh, dann – warum nicht?» Ja, Lurch schien der Name sogar zu gefallen, denn ein öliges Lächeln zeigte sich auf seinem Gesichte.
Endlich trat Sally Lanin durch eine Hintertüre des Ladens ein. «Ach Rosa! Liebes Herz! Du bist es!», rief sie in allerliebster Freude aus, hüpfte auf Rosa zu, küsste sie auf die Lippen, setzte sich mit einer flinken, schmiegsamen Beweglichkeit auf die Kiste und schlang ihren Arm um Rosas Taille. «Wie gut, dass du kamst!»
Sally Lanin trauerte um einen geliebten Onkel und trug daher ein schwarzes Kleid und eine schwarze Halskrause. Auf den Schulterblättern saßen zwei weiße Kalkflecken, und auch sonst war an dem Kleide viel von dem Staub der Kisten hängen geblieben, was dem Ganzen ein etwas schäbiges Aussehen verlieh. Eigentlich hübsch war Fräulein Lanin nicht; einige kleine Fehler störten den Eindruck des Gesichtes; so schielten die schönen, vanillebraunen Pupillen der Augen ein wenig, und die Nase war oft an der Spitze rot.
Fräulein Lanin legte ihr Köpfchen auf die Schulter ihrer Freundin und seufzte: «Liebste Rosa! Ich habe dir viel zu erzählen.»
«Wirklich? Erzähl doch!», drängte Rosa mit großer Teilnahme. «Ich habe wohl davon gehört – aber …»
«Ja, ja –» sagte Sally bewegt. Dann rief sie träumerisch: «Lieber Lurch!»
«Fräulein Sally!», erwiderte dieser.
«Lieber Lurch! Geben Sie auf einen Augenblick die Büchse mit den trocknen Pflaumen her.»
«Ja, Fräulein Sally. Es ist jedoch nicht viel mehr darin.»
«Die trocknen Pflaumen, Lurch», wiederholte Sally bestimmt.
«Gewiss, Fräulein Sally; warum auch nicht? Hier!» Und er hielt ihr eine hohe Büchse hin.
«Ja Rosa, du hast von uns gehört», begann Fräulein Sally, ohne die Büchse anzusehen, in die sie ihre Hand tief versenkte.
«Der Vater sprach von euch, ich hörte aber nicht recht hin. Was ist es denn?», fragte Rosa.
Sally brachte jetzt eine Pflaume zum Vorschein, betrachtete sie und erwiderte dann: «Ein zweiter junger Mensch kommt ins Geschäft.» Dann steckte sie die Pflaume in den Mund.
«Ein Verwandter von dir?»
«Lieber Lurch», unterbrach Sally ihre Freundin, «stellen Sie die Büchse her und gehen Sie ein wenig in den Hintergrund. Ich habe mit meiner Freundin zu sprechen.»
Lurch gehorchte und rief aus der Dunkelheit kläglich hervor: «Ist es so weit genug, Fräulein Sally?»
«Ja, Lurch! Ich danke. Siehst du, Rosa», nahm sie das Gespräch wieder auf, «er ist ein schlechter junger Mensch.»
«Du meinst natürlich den Neuen», schaltete Rosa ein.
«Ja, der Neue. Er hat Schulden gemacht. Er liebt eine Zigeunerin, oder Kunstreiterin, ich weiß es noch nicht genau. Nun wird der arme junge Mensch von der Geliebten getrennt und soll vergessen, soll sich bessern und das Geschäft erlernen. Sehr wüst soll er sein. Ob er sich bessern wird? Gott gebe es!»
«Wie alt ist er denn?»
«Zwanzig Jahre, sehr jung, nicht wahr? Die Person, die ihn verführt hat, weißt du, muss keine gute sein, und er vergisst sie wohl.»
«Wer kann das wissen!», meinte Rosa mit einem sehr verständigen Gesicht. «Die Frauen von der Bühne bestricken die Männer ganz seltsam.»
Fräulein Lanin wollte das nicht wahrhaben und schüttelte ihren Kopf mit den vielen Löckchen, denn zwei Pflaumen in ihrem Munde hinderten sie am Sprechen.
«Weißt du noch», sagte Rosa, «in dem Roman ‹Anna-Liese, die Männerhasserin› ist’s auch eine Tänzerin, die den jungen Golo unglücklich macht.»
Fräulein Sally schluckte heftig und breitete die Arme aus; sie wollte etwas sehr Wichtiges vorbringen.
«Und», fuhr Rosa eifrig fort, «wenn er ein Wüstling ist, dann wird das Leben hier ihm fade erscheinen.»
«Nein, mein Herz», begann Sally, sobald die Pflaumen es gestatteten. «Nein, nein!» Und sich plötzlich unterbrechend, rief sie: «Lieber Lurch, können Sie etwas hören?»
«Ein wenig, Fräulein Sally», verlautete die freundliche Stimme aus der Ecke. «Ich kann es nicht leugnen; ab und zu höre ich doch einiges.»
«Dann halten Sie sich die Ohren zu. Seien Sie so gut, ja?»
«Ohne Weiteres, Fräulein Sally. Nur fürchte ich, wenn jemand käme und wollte etwas kaufen, so würde ich’s nicht hören.»
«Seien Sie unbesorgt! Ich bewerfe Sie dann mit einem Pflaumenkern.»
«Danke, Fräulein Sally. So, jetzt höre ich nichts mehr.»
«Nun denn», nahm Sally ihre Erörterung wieder auf. «Du bedenkst nicht, liebe Rosa, dass das Familienleben, die Gesellschaft des Papa und dann, weißt du, der Umgang mit gebildeten, feinfühlenden Mädchen ihm guttun wird.»
«Meinst du?», warf Rosa zerstreut hin.
«Gewiss! So etwas verfehlt nie seinen Eindruck auf Männerherzen. Er sieht gut aus, sehr gut.»
«So; braun?»
«Ja, goldbraunes Haar in Locken; große Augen.» Sally beschrieb mit dem Finger einen Kreis um ihr halbes Gesicht.
«In drei Tagen, denke ich, wird er hier sein. Dann lege ich die Trauer ab; es sind schon volle sechs Monate her, dass der arme Onkel starb. Papa sprach von einem Tanzabend. Du verstehst, um ihn zu zerstreuen. Ambrosius heißt er.»
«So hörte ich», erwiderte Rosa und erhob sich, «begleitest du mich vielleicht?»
Nein, Sally mochte nicht spazieren gehen, sie musste einen Roman zu Ende lesen, eine sehr spannende Erzählung: «Emmas Schmerz». Sie fürchtete, ihre Heldin stehe im Begriff, sich das Leben zu nehmen.
So – dann wollte Rosa allein gehen; es war zu warm im Zimmer. Sie küssten sich und standen noch einen Augenblick beieinander, dieses und jenes zu erörtern. Eine rote abendliche Sonne drang durch die trüben Fensterscheiben, blitzte auf den Blechbüchsen, erweckte in den Flaschen und Gläsern bunte Lichter, schlüpfte in die Ecken und Löcher, um farbige Punkte auf die staubigen Papiere zu streuen, suchte Lurch in seinem entlegenen Winkel auf und malte einen großen blau und roten Fleck auf seine bleiche Stirn.
«Auf Wiedersehen!»
«Auf Wiedersehen, mein Herz» – dann lachten sie, wie junge Mädchen bei Abschied und Wiedersehen es zu tun pflegen – und Rosa ging hinaus.
Die drückende Schwüle war vorüber, und die Straßen belebten sich. Alte Herren mit breitrandigen Strohhüten standen mitten auf dem Marktplatz und disputierten laut miteinander. Aus den Fenstern beugten sich Mägde, um Teppiche auszustäuben. Auf den Treppen saßen Frauen ohne Hut und strickten. In langen Reihen zogen die Gymnasiasten, Arm in Arm, die Gasse entlang. Über all dem stand ein blassblauer Himmel von schmalen, rosenroten Wolken durchzogen.
Leicht und fröhlich ging Rosa dahin. Sie grüßte die Vorübergehenden mit verbindlichem Kopfnicken und lächelte dabei ihr stets bereites, ausgelassenes Lächeln. Das Gefühl, dass der Sommerabend auch ihr, wie allem rings um sie, gut ließ6, stimmte sie heiter.
«Ich habe die Ehre!» Klappekahl war es. Er zog vor Rosa seinen hohen Strohhut und blieb stehen. «Schönes Wetter! Wie geht es dem Papa?» Ein süßes Lächeln, das er ganz besonders für Damen bereithielt, umspielte seinen langen Mund. Er trug einen weißen Sommeranzug, eine rote Nelke im Knopfloch und ein Stöckchen, mit dem er nachlässig an seine Beine schlug.
«Ich danke», erwiderte Rosa, «ich ließ ihn beim Nachmittagsschlaf.»
«So, so! Und die Tochter treibt sich derweil ein wenig herum. Ha – ha – junges Blut. Sie werden aber mit jedem Tage hübscher, Rosette.» Neckend legte er seine Hand auf den Arm des Mädchens. «Ohne Scherz! Ich sagte noch gestern zu meiner Tochter: ‹Rosette Herz ist zu hübsch für unser Nest; die gehört in eine Weltstadt.› Auf Ehre, das sagte ich.»
Rosa errötete und meinte, sie käme gern in eine große Stadt. Der Apotheker glaubte das wohl; er nickte, drückte Rosa die Hand und ging weiter, um zwei Schritte davon den Dr. Holte anzuhalten und mit dem Kopfe nach Rosa hindeutend zu sagen: «Ein hübsches Mädchen, Doktor, was? Aber kokett, ich sage Ihnen, wenn die in eine große Stadt kommt – ich stehe für nichts! Guten Abend, Doktor!»
Vor Steinings Konditorei saß Herweg mit einigen Kameraden, sorgsam hinter mageren Oleanderbüschen verborgen. Als er Rosa erblickte, grüßte er, und sie nickte ernst zum grünen Laubgitter hinein. Kaum aber war sie weitergegangen, als sie Herwegs schweren Schritt hinter sich vernahm. Sie wusste, so musste es sein; so war es jeden Abend. Treulich folgte er ihr lange Stunden, zuweilen eine Schwenkung machend, um ihr zu begegnen und sie immer wieder zu grüßen. Das war der Ausdruck seiner Liebe.
Am morschen Geländer des Flussufers machte Rosa halt. Herweg kam heran und lehnte neben ihr. Ein stetes Gemurmel sandte der Fluss empor. Im Strudel, den das Wasser hier bildete, schwammen bewegliche Lichtfetzen. Ein flaches, gelbes Land dehnte sich auf dem entgegengesetzten Ufer aus. Große Sandgruben lagen voll roten Lichtes, und hinter der Wellenlinie der niedrigen Sandhügel ging die Sonne groß und rot unter.
«Das ist schön, Rosa, nicht?», rief Herweg und deutete zur Sonne hinüber. Rosa nickte, die Blicke nachdenklich in den Glanz verloren. «Schauen Sie dort das Feld!», fuhr Herweg fort. «Es ist ganz rot. So rot habe ich’s noch nie gesehen.»
In der Tat! Ein grelles Purpurlicht badete das Land. Es schien zu beben und zu flackern. Dann ward es blasser und erlosch. Die Sonne war hinter den Hügeln verschwunden. Ein milderes Scheinen klomm den Himmel hinan, ein blasses, gewässertes Gold, wie an alten Messgewändern. Eine Schar winziger Wölkchen flatterte in einem fast weißen Himmel, viele rosige Schleier, kleine Flügel, eine Schar ausgelassener Cherubim. Weiter oben schien der Himmel unermesslich hoch und veilchenblau. Schweigend standen die beiden Kinder vor diesem Farbenwunder. «Rosa», fragte Herweg endlich leise, in seinen guten Augen stand ein weicher, zärtlicher Glanz. «Rosa! Warum sagen Sie nichts? Gefällt es Ihnen nicht?»
«Doch», meinte Rosa ernst.
«Nicht wahr?», begann Herweg wieder und griff nach Rosas Hand. «So etwas … Sie wissen, Rosa, wenn ich so etwas sehe, bin ich wie bekneipt!»
«Lassen Sie, Kollhardt», sagte Rosa; dann setzte sie verständig hinzu: «Es war sehr poetisch.»
Herweg empfand das wohl. Er küsste Rosas Hand, als hätte sie das Schauspiel geschaffen, und flüsterte: «Rosa! Ich bin Ihnen wirklich gut.» Rosa musste erröten, und es trieb sie nach Hause.
Im Wohnzimmer war noch immer die bedrückende Glut der Mittagsstunden eingeschlossen. Rosa öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus, um in das langsame Herabdämmern auf die Häusergiebel hineinzusehen. Sie fühlte sich erregt, erwartungsvoll und dennoch missgelaunt. Er war schön gewesen, der große, leuchtende Abendhimmel, das seltsam stille Verglühen. Gewiss, sehr schön! Und doch – was war es? Sollte sie das glücklich machen? Konnte das etwas an der Nüchternheit ihres Lebens ändern? Sonnenuntergang – Gott ja, sehr gut; aber wenn sie es recht bedachte, fügte er nichts zum Leben hinzu. – Herweg hatte ihr gefallen, der gute Junge! Wie er sie angeblickt, wie stürmisch er ihr die Hand geküsst hatte: «Rosa, ich bin Ihnen wirklich gut», das klang rührend.
ENDE DER LESEPROBE
Copyright © 2015 by Manesse Verlag, Zürich
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
ISBN 978-3-641-17222-0
www.manesse.ch