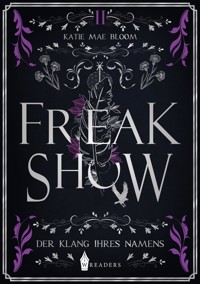
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine neue Identität, der Verlust ihrer großen Liebe und ein zerschmettertes Bein. Als die junge Zirkusartistin nach einem tragischen Unfall erwacht, weist ihr neuer Name auf die dunklen Vorzeichen ihres Schicksals hin: Mallory, die Unglückselige. Statt sich im Schutz der Freakshow ein neues Leben aufzubauen, sucht sie nach der Wahrheit hinter ihrem Unglück – doch etwas Verborgenes ans Licht zu bringen, fordert einen ähnlich hohen Preis, wie es zu begraben. Bald schon findet sie sich in bodenlosen Abgründen wieder – sowohl in der kriminellen Unterwelt als auch in ihrer Seele – und ein unbändiger Rachedurst beginnt in ihr zu keimen. Aber ist dies nur der klägliche Versuch, ihre eigenen Schuldgefühle zum Schweigen zu bringen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WREADERS E-BOOK
Band 218
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book Ausgabe
Copyright © 2023 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Umschlaggestaltung: Theresa Wöll
Lektorat: Laura Röthele, Vanessa Janke
Satz: Ryvie Fux
www.wreaders.de
ISBN: 978-3-96733-427-2
Ein Unglück, sei es auch tragisch, ist immer eine Möglichkeit zur Wandlung. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren obliegt einem selbst.
Prolog
Ein warmer Herbstabend, welch bezaubernde Zeit zwischen Sommer und Winter. Eine Zeit des Wandels und der Vorbote auf alles Zukünftige.
Für die gebückte Gestalt im schummrigen Licht der Straßenbeleuchtung war jedoch jeder Wandel vollzogen und jede Zukunft dahin. Welch Ironie des Schicksals, dass sie gerade zu dieser Zeit des Jahres hierhergekommen war. Oder besser gesagt, dass sie genau zu diesem Zeitpunkt hierhergeführt wurde. Schon ihr ganzes Leben lang lenkten unsichtbare Schnüre ihren Weg. Doch weder war sie betrübt noch wütend darüber. Ihr Handeln wurde davon wenig berührt. Außerdem hatten diese Schnüre ihr nicht nur Schlechtes beschert, wenn die Gleichung auch nicht ganz ausgewogen war.
Ein tiefer Atemzug gefolgt von einem leisen Seufzer.
Es war das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass ihr der Geruch dieser Stadt in die Nase drang. wieder saugte sie die Luft tief in sich hinein, als wollte sie ihn dort einschließen und für eine weitere Ewigkeit konservieren. Wie jeder Ort dieser Welt hatte auch diese Stadt einen ganz eigenen Geruch. Eine Mixtur aus allen üblichen und unüblichen Dingen, die nur hier in diesem einzigartigen Verhältnis aufeinandertrafen. Die Gaststuben ringsum hatten die Fenster nach der letzten Runde geöffnet. Der Duft von längst erkalteten Speisen zog vermischt mit dem gegärten Dunst der überfüllten Kneipen durch die Gassen.
Gesättigte und besoffene Bürger waren eine gefährliche Kombination, aber genau die Art von Aufruhr war nun nötig. Einige dieser selbstgerechten Einwohner beobachteten sie bereits, wie sieverwirrt durch die Gassen streunte. Dabei kannte sie jeden Winkel dieser kleinen Gassen. Jeden Stein, jede Unebenheit und jede dunkle Ecke, die von der Straßenbeleuchtung nicht erreicht wurde. Alles seit ihrer Kindheit abgespeichert in ihrem Kopf. Sie hätte hier ohne großen Aufwand unsichtbar zu ihrem Ziel finden können, doch sie war nicht ohne Grund hier.
Und ebenjener war die Notwendigkeit für diesen Aufruhr, den sie jetzt bedächtig schürte. Ihr Ziel war fast erreicht. Die eiligen Schritte hallten schon hörbar durch die Gassen, sie hatte nicht mehr viel Zeit. Doch diese eine Sache musste sie noch erledigen, denn sie musste es mit ihren eigenen Augen sehen. Ein paar der Spießbürger standen erschrocken auf der anderen Straßenseite und gafften sie unverhohlen an, während sie das alte quietschende Tor hinter sich schloss. Ein kühler Blick von grünen, durchdringenden Augen ließ die Passanten erschaudern und sogleich das Weite suchen. Der Hass und Unmut in der Stadt hatten längst zu brodeln begonnen.
Vor ihr lag nun ein Teil der Stadt, der völlig abgeschottet und trotzdem so zentral wie sonst kaum etwas Verborgenes war. Als hätte sie gerade eine Schleuse hinter sich gebracht, hatte sich die Luft um sie herum komplett verändert. Es war kühler und kälter als eben noch auf den Gassen. Dieser Ort wurde nicht von der Wärme der umliegenden Häuser erreicht und noch weniger von den Herzen der Bürger. Modriger Geruch der feuchten Friedhofserde stieg vom unbefestigten Weg unter ihr auf. Blanke, aufrechte Steinplatten säumten diesen einsamen Weg und schluckten jedes Geräusch ihrer Schritte. Von ihren unsichtbaren Schnüren geleitet, blieb sie stehen, atmete erneut tief ein und drehte sich langsam zu ihrer rechten Seite um. Zwar war sie hier noch nie gewesen, trotzdem weckte es schmerzliche Erinnerungen in ihrem Innern.
Eine Welle von Gefühlen, Bildern und Worten überrollte sie binnen weniger Sekunden. Die Last dieser Welle traf sie so heftig, dass sie kurz strauchelte. Ihr war bewusst gewesen, was sie hier finden würde, und trotzdem traf es sie härter, als sie gedacht hatte. Der Name ganz unten auf dem Grabstein stieß ihr mit voller Wucht ein Messer ins Herz. Ein Name, den sie so lange nicht mehr gehört hatte. Ein Name, den sie besser als jeden anderen kannte. Ein Name, der mal ihr eigener gewesen war. Dieser Teil von ihr, der schon vor langer Zeit gestorben war, quälte sie immer noch so heftig, dass Tränen augenblicklich in die sonst so kühlen Augen trieben. Eine geliebte, sehnlichst vermisste Stimme in ihrem Kopf hauchte ihren Namen und durchströmte sie mit einer Wärme, die sie gleichzeitig erschaudern ließ: „Grace, komm nach Hause.“
Hastige, lärmende Schritte in der Ferne schreckten sie plötzlich aus diesem dämmrigen, schmerzenden Zustand auf. Es würde beginnen und sie war bereit. Ein letztes Mal sah sie auf die Umrisse des eingemeißelten Namens im blassen Licht. „Grace.“
„Ja, ich höre dich“, murmelte sie zu sich selbst. „Ich komme.“
Als würde sie vor einem unsichtbaren Spiegel stehen, richtete sie ihre Garderobe und strich sich durch die halbfrisierten Haare. Geübt und makellos zog sie in der Dunkelheit ihren blutroten Lippenstift nach. Von oben griff sie in ihr Mieder und ertastete ihren alten, geliebten Talisman. Ja, sie war so weit.
Ohne sich noch einmal umzusehen, verließ sie den Friedhof. Langsam öffnete sie das Tor und das sanfte Flackern der Laternen fiel auf ihr Gesicht. Mit einem umwerfenden Augenaufschlag und einem kaum erkennbaren Lächeln blickte sie in die Gewehrläufe vor sich. Noch einmal erinnerte sie sich an das, was längst vergessen schien …
1
Noch nie war sie in einer solchen Stadt gewesen. Weder in einer solch großen Stadt noch in einer so korrupten und verdorbenen. Ein Ort, der gar nicht erst versuchte, eine gewisse Idylle und Rechtschaffenheit vorzutäuschen. Nach der vorgeheuchelten Spießbürgerlichkeit oder den kunstvollen Zirkusillusionen war ihr diese offen gelebte Unterwelt sogar lieber.
Wie immer zog es sie zunächst in die übelste Spelunke, die sie finden konnte, auch wenn hier so ziemlich jedes Etablissement übel war. Schließlich fiel ihre Wahl auf einen Club, welcher vorgab, besonders nobel zu sein. Sie brauchte kaum darauf hoffen, mit ihrer bloßen Anwesenheit ein paar Drinks ergattern zu können. Die Stadt war voll von bedauernswerten Frauen, die für ein Glas Hochprozentiges alles machten. Es kam ihr gelegen, denn sie war auf etwas völlig anderes aus.
Wie selbstverständlich nahm sie als Einzige an der Bar Platz und bestellte einen sündhaft teuren Rum. Da sich keiner sonst in der überfüllten Kneipe an diese Plätze traute, schienen diese nur für besondere Gäste reserviert zu sein. Mallory nahm es sich einfach heraus, sich deswegen angesprochen zu fühlen. Genüsslich nippte sie kleinste Schlucke des edlen Tropfens und brauchte ein gefühltes Jahrzehnt, um ihr Glas zu leeren. Kritisch wurde sie dabei vom Wirt höchstpersönlich beobachtet. Vermutlich versuchte er zu ergründen, was sie hier verloren hatte. Vielleicht war sie eine neue Gespielin eines obersten Kundenkreises, weshalb es zunächst abzuwarten galt.
„Ich nehme noch einen.“
„Schätzchen, denkst du nicht, du solltest den einen zuerst mal bezahlen, bevor du einen zweiten bestellst?“, knurrte der unfreundliche Wirt.
„Ich werde garantiert nicht bezahlen, aber du wirst mir so oft nachschenken, wie ich möchte“, erwiderte sie kühl.
„Was glaubst du, wo du bist, Püppchen? Wäre besser, du würdest deinen süßen Hintern ins Hinterzimmer schleppen, damit ich dich für diese Dreistigkeit mal ordentlich rannehme. Dann kannste auch gleich deine Rechnung begleichen, Häschen.“
„Wäre besser, du würdest darauf achten, wie du mit mir redest.“
„Jetzt hab ich aber genug von dir“, schimpfte er und griff nach ihrem Hals. Dabei kam er ihr beachtlich nahe und schnaubte ihr ins Gesicht.
„Schön, dass wir nun unter vier Augen miteinander reden“, begann sie zu flüstern. „Streckst du deinen Fusel auch in diesem Hinterzimmer?“
„Was?“, fragte er mit einer Mischung aus Knurren und Flüstern.
„Ich kenne sehr wohl den Geschmack von echtem karibischem Rum und dieser Fusel ist genauso weit davon entfernt wie dein fetter Wanst von einer Nummer mit mir.“ Zwar lockerte sich sein Griff um ihre Kehle, doch sein hochrotes Gesicht blieb dicht vor ihrem. Da sie keine Reaktion erwartete, sprach sie genauso leise weiter wie bisher: „Wie machst du es, hm? Kaufst billig die leeren Originalflaschen, damit keiner beim Einschenken Verdacht schöpft? Füllst den gepanschten Schwarzgebrannten rein und fälschst das Siegel mit Kerzenwachs? Ich muss schon sagen, ziemlich nah dran, der Geschmack. Was hast du reingetan? Getrocknete Orangenschale für das fruchtige Aroma? Stücke von alten Fässern für die feine Holznote? Karamell für die herbe Süße und die Farbe? Was würden nur deine zwielichtigen Gäste sagen, wenn sie wüssten, was sie da wirklich trinken?“
„Was?“
„Na ja, so würde ich es zumindest machen, wenn ich so ein mieser Betrüger wie du wäre. Allerdings fehlt etwas Vanille, nicht wahr?“
Etwas blass um die Nase wich der Wirt hinter den Tresen zurück, beugte sich dann wieder vor und knurrte: „Wer bist du?“
„Also zuerst würde ich noch einen nehmen. Aber bitte von dem Guten. Die Flasche, die du irgendwo für deine Kostproben versteckst. Ja – genau, ich meine dein gut gehütetes Schatzkästchen.“
Missmutig kramte er die letzte Flasche aus dem kleinen Schränkchen unter dem Tresen hervor und brach das echte Siegel auf. Mit angespanntem Kiefer goss er ihr zögerlich einen Doppelten in ihr Glas und ließ die Flasche daneben stehen.
„Wer ich bin?“, lachte sie leise über seine vorherige Frage. „Schätzchen, das würde ich nur zu gern selbst wissen. Es gab Zeiten, da wusste ich nicht mal, ob ich überhaupt noch unter den Lebenden wandle …“
…
Das heftige Fieber trieb kalte Schweißperlen auf ihre Stirn. Vor Schmerzen wand sie sich auf der harten Pritsche hin und her. Wildes, unverständliches Gemurmel wechselte sich mit schmerzerfüllten Seufzern ab. Immer wieder gequält von denselben Albträumen. Nur, dass es leider keine wirren Fantasien waren, sondern wahre Begebenheiten, die sich immer und immer wieder von Neuem in ihrem Geist abspielten. Bei jedem Versuch, sich durch Kopfschütteln die Bilder aus ihrem Gedächtnis zu schlagen, machte sich der stechende, lähmende Schmerz aus ihrem zertrümmerten Bein bemerkbar. Die behelfsmäßige Schiene, die es ruhig halten sollte, tat nur beschränkt ihren Dienst und sorgte durch ihre Enge für eine andere Art von Unbehagen.
Sie dachte nicht einmal daran, ob sie ihr Bein je wieder richtig benutzen, ob sie je wieder laufen können würde. Ob ihr Bein unter diesen erbärmlichen Umständen nicht schon längst verloren war. Alles schien so weit weg in ihren Gedanken. Die wenigen ruhigen Momente, die nicht von Fieber oder Schmerz geprägt waren, verabscheute sie regelrecht.
Alles, was an Realität grenzte, war ihr zuwider. Vor allem, weil die quälenden Albträume jedes Erlebnis in ihrem Kopf unerbittlich an die Oberfläche lockten. Wie lange würde sie diesen komatösen Zustand noch überleben? Wollte sie das überhaupt? Im Fieberwahn glich ihre Wahrnehmung einer einzigen Irrfahrt. Die Grenzen zwischen Wachzustand und Wahnvorstellung verschwammen vor ihren Augen.
Erinnerungen an glückliche Tage, die surreal und zerbrechlich wie Schlösser aus Sand wirkten. Erinnerungen an schreckliche Momente, die ihr ebenso unwirklich wie grausam vorkamen. Einzig die Schmerzen gaben ihr die traurige Gewissheit, dass alles wahr war. Das Gute und das Schlechte. Sie hatte die Liebe gefunden, eine wahre Liebe, wie sie nur wenige Menschen überhaupt begreifen konnten. Und eben jene Liebe war verloren, viel zu früh und viel zu schmerzhaft. Folgenschwere Entscheidungen und unglückliche Fügungen hatten zu einem furchtbaren Unfall geführt.
Liam. Ein Name, der sie jedes Mal hochschrecken ließ, sobald ihn ihr Verstand rief. Oh, Liam. Ihr geliebter Liam. Sein Gesicht erschien so nah vor ihrem, dass sie vergebens versuchte, es zu berühren. Doch schreckhaft zog sie ihre Hand sofort zurück. Das Bild hatte sich gewandelt. Sein Kopf lag halb im Sand der Manege und ihre eigenen Schreie übertönten die Zirkusmusik.
Nur sie war verschont und ihrem Leid überlassen worden. Allein. Verlassen. Verdammt. Verflucht. Wieso hatte sie überlebt? Wie war sie überhaupt hierhergekommen? Auf diese harte, notdürftig gebaute Pritsche in einem alten Zelt. War sie nicht eben noch in einem wackelnden Planwagen aufgewacht? Ob nun ein paar Tage oder sogar Jahrzehnte seit dieser traumatischen Nacht vergangen waren, konnte ihr wirrer Kopf kaum deuten.
Dieses kleine Kuriositätenkabinett hatte sie wie eine verlassene Requisite aufgelesen und einfach mitgenommen. Nun steckte sie in dieser Freakshow fest, unfähig, sich zu bewegen. Ja, man hatte ihr das Leben gerettet. Aber wozu? Wäre es nicht eine bessere Show gewesen, wenn die Hauptattraktionen zusammen den Tod gefunden hätten? Niemals wollte sie gerettet werden. Sie wollte zu Liam, zurück an den Ort, an dem er gestorben war. Wieder dort neben ihm liegen und ihre Hand sanft auf sein Gesicht legen.
„Ich bin bei dir, mein Herz. Ich bin hier“, hörte sie sich selbst murmeln.
War es ihr nicht bestimmt, neben ihm zu sterben, ihm bis in den Tod zu folgen? Hatten sie es sich nicht versprochen? Damals unter dem alten Baum, als sie endlich erkannt hatte, wofür es sich zu leben lohnte. Oder dann erneut im strömenden Regen, als sie zueinander gerannt waren. Als sie gewusst hatten, dass sie nicht mehr ohne einander leben wollten und sie ihr bürgerliches, adrettes Selbst aufgegeben hatte, um mit dem Zirkusartisten fortzulaufen. Ja, da hatten sie es sich versprochen. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihnen.
Ihre Bewegungen, mit denen sie die Bilder aus ihrem Kopf kriegen wollte, wurden immer unkontrollierter. Die Pritsche begann wackelig zu tanzen und drohte fast umzukippen. Ihr Herz flehte die Albträume an, gnädig zu sein, doch sie wollten nicht hören.
Plötzlich verstummte der Kampf in ihrem Inneren, als sich die Zeltplane öffnete und ein großer, plumper Riese eintrat. Sein Name musste Trevor sein. Zumindest zuckte er jedes Mal zusammen, wenn dieser Klang durch die Zeltplane grollte. Wortlos stand er über sie gebeugt, und ihre müden, fiebrigen Augen blickten zu ihm hoch. Seine Gestalt hatte sie schon oft gesehen, sobald diese wie durch einen Nebel durch ihre Albträume lugte. Die trübe Leere in seinem Antlitz schien ihr dabei jedes Mal zu versprechen, dass keine Gefahr von ihm ausging.
Nur durch ein kratziges Räuspern war hinter Trevors imposantem Körper zu erkennen, dass er nicht ihr einziger Besucher war. Es war diese alte, runzlige Frau, welche ihre ungefragte Rettung zu verantworten hatte. Auch der Zustand des dämmrigen Vegetierens war ihr Verdienst.
Behutsam fühlte der stumme Riese ihre kranke Stirn und zog augenblicklich seine Hand wieder weg, als wäre diese ein kochender Suppenkessel. „Sie glüht, Mamma M! Sie hat immer noch Fieber“, flüsterte der große Kerl.
„Lass mich sehen. Geh, ich muss sehen“, knurrte Mamma M und schob den Berg mühelos beiseite. „So, Kleines. Hm, ja, Fieber, immer Fieber.“
Ihre Stimme klang noch älter, als ihr Erscheinungsbild vermuten ließ. Ein wirres Gemisch von allerhand Akzenten versteckte sich in jedem Wort. Als hätte sie auf ihren Reisen von jedem angetroffenen Akzent etwas mitgenommen. Genauso schien sie es auch mit Menschen zu handhaben und füllte auf diese Art ihre Freakshow. Gebückt und behäbig ging sie hinüber zu einer großen, alten Truhe und kramte darin herum.
„Wo habe ich … Oh, wo habe ich nur?“, murmelte sie dabei. „Ah, hier!“
Mit ihren knorrigen Fingern fummelte sie an einem uralten, kleinen Tonkrug herum. Dieser schien aus längst vergangenen Epochen zu stammen, und wer wusste schon, wie viele Jahrhunderte die Alte selbst schon auf dem Buckel hatte.
Fast schon erschrocken riss Trevor seine großen Augen auf, als er sie mit dem Gefäß in ihren Krallen kommen sah. „Mamma, nein! Das wird sie umbringen.“
„Papperlapapp! Das hat schon die alten Spartaner auf dem Schlachtfeld wieder zum Leben erweckt und es wird auch sie wieder zu den Lebenden führen.“
„Aber Mamma …“
Ohne auf die Widerworte ihres Ziehsohnes zu hören, goss sie einen kräftigen Schluck der unheilvollen Brühe in einen Holzbecher. Ein übelriechender Dunst stieg in dem Zelt auf und Trevor drehte sich weg, teils aus Abscheu vor dem Gesöff, teils aus Angst vor dessen Wirkung. Es fehlte nur noch, dass von dem Becher eine Art Nebel aufstieg.
Wie eine alte Kräuterhexe rührte sie den Inhalt mit ihrem überlangen Fingernagel um und wedelte sich genüsslich mit der flachen Hand dessen Geruch zu. Ein tiefer Atemzug des beißenden Dunstes stieg ihr in die faltige Nase und sie seufzte dabei, als wäre es eine frische Bouillon.
Das Häufchen Elend vor ihr versuchte mit halb geöffneten Augen dem Geschehen zu folgen, war aber zu schwach, um wirklich wach zu bleiben. Das Einzige, was die junge, verletzte Frau fühlte, war ein beherzter Griff in den Nacken und wie ihr das widerliche Gebräu die Kehle hinuntergeschüttet wurde. Sie war viel zu geschwächt, um sich angewidert zu schütteln oder sich gegen den Trank zu wehren.
Als der Becher endlich leer war, beugte sich die Alte zu ihr herunter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Diesmal ohne den üblichen Wirrwarr aus Grammatik und Akzenten. Die klare Aussprache nahm ihrer Stimme allerdings nichts von dem unheimlichen, verwirrenden Klang.
„Ich weiß, was du willst. Ich weiß, du sehnst dich nach dem Tod. Aber Kleines, der Tod wird dich noch früh genug holen.“
Der Trank, aus was auch immer er bestand, wirkte schnell. Abgetrieben in einem schwarzen, leeren Strudel glich ihr Zustand nun wirklich einem Koma. Kein Albtraum, keine Erinnerungen, kein dämmriger Wachzustand. Nur Dunkelheit. Nur Stille.
2
Es fühlte sich an, als wären Tage vergangen, bis sie endlich aus diesem tiefen Schlaf erwachte. Gänzlich ohne Schmerzen und ohne Fieber schlug sie langsam die Augen auf. Ihr Körper war nicht mehr in diesem stickigen Zelt, sondern lag festgezurrt wie ein Koffer auf der harten Bank des ruckelnden Planwagens.
„Herrlicher Morgen für neues Leben, oder?“, kicherte Mamma M neben ihr und paffte mal wieder eine ihrer stinkenden Kräuterzigarren. „Bist jetzt bereit zu sein, Mallory?“
Die großen grünen Augen starrten die alte Hexe an, als blickten diese zum ersten Mal in deren verlebtes Gesicht. Ihr Gedächtnis brauchte unheimlich lang, um sich nach dem Trank wieder zu ordnen.
„Ich dir doch sagen, du ab jetzt Mallory? Ich waren früher Mallory, Frau von der ich früher lernen auch Mallory. Immer gleich. Erst Mallory, dann Madame Mallory, dann Mamma Mallory. Aber ich jetzt nur noch Mamma M. Zu wenig Zeit für Buchstaben so viele.“
Die neue Mallory starrte Mamma M immer noch verwundert an. Erst langsam begriff sie wieder, wo sie war, was geschehen war und warum sie so einen widerlichen Geschmack auf der Zunge hatte.
„Aber ich heiße … Ich bin … Ich meine … Ich war –“
„Du gestorben, tot. Du nicht mehr sein. Du müssen vergessen alten Namen und annehmen neuen.“
Ein stechender Schmerz durchfuhr sie, als ihr Verstand vollends in der Gegenwart ankam. Obwohl es kaum zu unterscheiden war, aus welchem Bereich ihres Körpers diese Qual hervorquoll. Sicher war nur eins: Dieser Schmerz ließ sie ruckartig in Gänsehaut erzittern.
Mamma M sah sie musternd an, holte dann erneut den Krug mit der stinkenden Brühe hervor und goss einen noch größeren Schluck als vorher in den Holzbecher. Ohne den albernen Hokuspokus von zuvor packte sie Mallory im Nacken und führte den Becher zu ihrem Mund. Ihr Körper zog sich vor Ekel zusammen, doch sie konnte sich kaum wegdrehen. Die festgezurrten Riemen hielten sie an Ort und Stelle. Noch dazu schmerzte das zertrümmerte Bein bei der kleinsten Bewegung.
Die halbgerauchte Zigarre in Mamma Ms Mundwinkel verstreute heiße Asche überall, als sie begann zu murmeln: „Lass, Kleines, nicht. Nicht wehren. Ist gut für dich. Ist gut für Bein. Ist gut für Kopf.“
Mallorys Körper gab den Kampf gegen die Alte viel zu schnell auf, oder besser gesagt, er schien diesen Trank wirklich zu wollen. Jede Faser der erschöpften Muskeln sehnte sich nach Betäubung und Ruhe. Einzig Mallorys Geist schien sich gegen die kommende Entspannung zu wehren. Vollkommen wehrlos schleuderte das Gesöff ihre Seele in einen tiefen Strudel. Ein Kontrollverlust, der einen dunklen Teil ihrer Persönlichkeit weckte und sogleich zutiefst empörte.
Diese grimmige Hexe würde nicht zulassen, dass sie sich aufgab. Mit Hingabe und fragwürdigen Substanzen wurde Mallory gegen ihren Willen am Leben erhalten. Die Frage nach dem Warum brachte den eben erweckten Argwohn zum Beben. Sahen sie denn nicht, dass es keinen Grund gab, weiterzuleben? Was hatten diese Gestalten mit ihr vor? In Mallory hatte sich im Bruchteil einer Sekunde jenes Misstrauen ausgebreitet, welches sie fortan begleiten sollte.
Bevor sie jedoch diesen düsteren Teil ihrer Seele erkunden konnte, hatte der Trank die Oberhand über ihre Sinne übernommen. Allein der Geschmack machte sie halb ohnmächtig. Die ätzende Flüssigkeit ergoss sich in ihren Magen und verbreitete eine unangenehme Hitze. Die betäubende Wirkung setzte ein und brachte Mallorys Körper wieder in den ersehnten Tiefschlaf. Das zerstörte Bein entspannte sich und ließ die zertrümmerten Knochen heilen. Dieser komatöse Strudel zog ihren Verstand diesmal jedoch nicht ins Leere. Stattdessen zeigte die Mixtur aus Betäubung und Argwohn ihrem Innersten einen Abgrund jenseits jeder Erwartung. Diese neuen Albträume begannen dort, wo ihre Erinnerungen lückenhaft verschwammen. Noch dazu um vieles realer und erschütternder, als sie der Fieberwahn zuvor gezeichnet hatte:
Wie eine unfähige, teilnahmslose Zuschauerin sah sie immer wieder den Moment des Schreckens. Die angstvoll aufgerissenen Augen ihres Rappens, welcher panisch durch die Manege jagte, wie vom Teufel höchstpersönlich geritten. Die nahende Hand Liams, der sich vom Trapez herunterstürzte, um sie zu greifen und zu retten. Wie sich die beiden liebenden Hände fast erreichten und dann doch unwiderruflich auseinandergerissen wurden. Die hallenden Schüsse, die eigentlich für den unkontrollierbaren Rappen bestimmt waren und tragischerweise auch Liam trafen. Der lähmende Augenblick, als sie verletzt auf dem Manegenboden aufwachte. Ihr blieb nur noch Liams letzter Atemzug übrig, um sich zu verabschieden. Ein irrwitzig kurzer Augenblick. Jedes Detail seiner erstarrenden Augen, die sonst so viel Wärme in sich verbargen. Ein quälender Satz, eine quälende Stimme. Immer und immer wieder in ihrem Kopf: „Komm nach Hause!“
Jedes Mal, wenn der Schreckensmoment erneut begann, wollte sie eingreifen, das Schicksal ändern. Aber sie war nur einer der stummen, unnützen Zuschauer, die sich um die tragische Szene versammelt hatten. Je öfter sie dies durchleben musste, desto mehr Zuschauer der regungslosen Menge trugen Mallorys Gesicht. Nach kurzer Zeit erdrückte die Menge dieser duplizierenden Doppelgänger das gesamte Schauspiel. Eine Wand aus seelenlos starrender Selbstbilder verdrängte alles aus ihrem Blickfeld und einzig Liams Stimme hallte durch die überfüllte Manege. Immer verzweifelter und ruppiger stieß sie diese Trugbilder von sich weg, um zu Liam zu gelangen, doch vergebens. Die Spiegelbilder türmten sich zu einem unüberwindbaren Berg auf.
Eine einsame, kleine Träne rann über das Gesicht der betäubten Mallory und ihre Lippen zuckten – versuchten flehende Worte zu formen.
Zwar konnte das verletzte Bein heilen, aber ihrer Seele wurde in diesem Zustand Grausames zugefügt.
Abgelenkt von ihrem Gewimmer drehte sich Trevor immer wieder besorgt auf dem Kutschbock um und schaute Mamma M flehend an. „Weck sie auf, Mamma! Bitte weck sie auf.“
Mamma M erwiderte seinen Blick nicht, sondern steckte sich mit dem glühenden Stummel der Zigarre direkt eine Neue an. Der blaue Dunst um sie herum wurde zu einem undurchdringlichen Nebel. Wieder einmal wechselte sie von ihrem unverständlichen Dialektwirrwarr zu einer klaren, gleichzeitig rauen Stimme.
„Nein, Herzchen. Sie ist noch nicht so weit. Sie wird es nicht ertragen können. Sie ist noch nicht bereit für –“
„Bereit für was?“, seufzte Mallory, welche kurzzeitig aus der erdrückenden Lähmung hochschreckte.
Mamma M legte ihre Hand beruhigend auf Mallorys Stirn und endlich schien auch ihr Geist in eine erlösende Taubheit zu sinken. Ihr Gewimmer verstummte und eine flache Atmung verdeutlichte den ersehnten Tiefschlaf.
„Noch nicht bereit für …“, begann die Alte zu flüstern, doch traute sich selbst kaum, es auszusprechen. „Sie ist noch zu zerbrechlich. Ihr Verstand würde kapitulieren. Sie würde zu einem Geist werden, gefangen in der Vergangenheit. Im schlimmsten Fall aber würden wir etwas Schreckliches erwecken.“
3
Die Tage schlichen dahin und zeitweise schaffte es Mallory, sich sogar öfter mal aufzusetzen und die Realität um sich wahrzunehmen. Verborgen im Zelt oder im Planwagen bekam sie jedoch wenig von den Städten mit, in denen die Freakshow campierte. Dumpfe Laute, die durch die Plane zu ihrem kleinen, einsamen Krankenbett vordrangen, weckten mühsam ihre tauben Lebensgeister. Ein waberndes Stimmengewirr von staunenden, erschrockenen oder entsetzten Gaffern, welche sich an den Schaubuden vorbei schubsten. Diese Geräusche erinnerten sie an die Wunder und Abenteuer, die dort draußen warteten.
Aber was kümmerte sie diese Welt noch? Hatte sie nicht mehr Wunderliches gesehen, als den normalen Menschen vergönnt war? Sollte sich die verlorene Schönheit dieser absonderlichen Kuriositäten doch jemand anderem aufdrängen, nicht ihr.
Doch unaufhörlich zog etwas ihre Gedanken neugierig nach draußen, irgendetwas rief nach ihr. Halb gelangweilt von ihrer einstigen Neugier lenkte sie ihre Gedanken auf etwas Schmerzhaftes. Angestrengt beugte und streckte sie die Zehen ihres geschundenen Beines. Eine Übung, welche den tiefen Riss ihrer selbst verdeutlichte: Zum einen verfluchte sie diese schmerzhafte Mühsal, zum anderen genoss sie den leichten Schwindel. Ähnlich verhielt es sich mit den Fortschritten, die sie dadurch sah. Halb beglückt über ihre neue Beweglichkeit, halb enttäuscht über ihre schwindende Behinderung. Ihr Grübeln, zu welchem Gefühl ihre wechselhafte Stimmung heute mehr tendierte, konnte sie jedoch nicht lange von der lockenden Außenwelt ablenken.
Vergebens versuchte sie, durch die winzigen Löcher in der Plane etwas von dem wunderlichen Mikrokosmos zu erspähen. Doch auch an diesem Tag war es ihr nicht möglich, viel zu erkennen, außerdem wurde es langsam dunkel. Die Stimmen, das Gemurmel und die gaffenden Besucher verschwanden in dem großen Festzelt des Zirkus. Die Freakshow war nur ein geduldeter Begleiter und Pausenfüller neben der eigentlichen Attraktion in der Manege. Immerhin versprach die nahende Nacht auch den geliebt-gehassten Schlaftrunk und oh, wie sie sich nach der nächsten „Medizin“ sehnte.
Mallory hatte sich längst an den betäubten und seelenlosen Zustand, den ihr der Trank bescherte, gewöhnt. Nicht, weil sie die positive Wirkung für ihre schweren Verletzungen wahrnahm, sondern weil sich ihr Verstand darin übte, die Möglichkeiten dieser abstrusen Zwischenwelt zu erforschen. Mehr noch, sie begann darin zu wandeln. Hier warteten nicht nur die schrecklichen Teile ihrer Odyssee, sondern auch die wunderschönen. Jeder Schluck des Gesöffs war wie russisches Roulette, welches Kapitel sie diesmal durchleben durfte oder musste. Manchmal, wenn sie in einer besonders glückseligen Erinnerung verweilte, wünschte sie sich, ihr Körper würde einfach sanft entschlafen.
Als überraschend Besuch eintrat, versuchte sich Mallory noch weiter aufzusetzen. Neugierig, wer es sein würde, streckte sie ihren Kopf hin und her. Eigentlich war es noch zu früh für die nächste Dosis, doch sie würde sich kaum beschweren. Ihr Bein war schon fast verheilt, auch wenn es fraglich war, ob es ihr Gewicht überhaupt tragen konnte. Jetzt schon fürchtete sie den Tag, an dem Mamma M beschließen würde, sie hätte genug von dem Trank gehabt. Vermutlich ahnte diese bereits, dass die Wirkung der Substanz ein Eigenleben entwickelt hatte.
Seufzend sank Mallory wieder auf die harte Pritsche, als sie in der Dunkelheit Trevors massigen Körper erkennen konnte. Doch da war noch etwas. Vor ihm rumpelte der alte, klapprige Rollstuhl von einem der verstümmelten Freaks ins Zelt. Mit hochgezogener Augenbraue und verkniffenem Mund starrte Mallory auf das näher kommende, quietschende Fuhrwerk.
Ihr Gegenüber verband mit dem Rollstuhl offensichtlich andere Gefühle. Wie ein kleines Kätzchen vor einem Teller Milch grinste Trevor und sagte ihr voller Stolz: „Wir holen dich kurz hier raus. Ein bisschen Luft schnappen. Aber leise, damit Mamma nichts merkt.“
Behutsam hob Trevor ihren Körper in den Rollstuhl. Obwohl sich Mallory knurrend und grummelnd dagegen wehrte, schien ihm dieser Kraftakt völlig mühelos zu gelingen. Am liebsten hätte sie dabei geschrien und Beschimpfungen gebrüllt, doch sie war zu schwach und ihre Abwehrversuche liefen ohnehin ins Leere.
Wenige Augenblicke später unterließ sie auch diese. Nicht, weil sie aufgab, sondern weil sie ihr eigener Anblick schockierte. Bislang hatte sie sich nicht getraut, unter die kratzigen Decken zu schauen. Nun saß sie in dem klapprigen Rollgefährt und musste unweigerlich an sich heruntersehen. Ihr schillerndes Kostüm, in welchem sie verunglückt war, war längst einem mottenzerfressenen, schwarzen Kleid gewichen. Dieser Lumpen sah aus, als wären darin bereits mehrere Generationen von muffigen Schaustellern verstorben. Leider roch der Fetzen auch genauso. Nur eines konnte sie dieser Aufmachung abgewinnen: Durch den pludrigen Rock sah sie ihr zertrümmertes und geschientes Bein nicht.
…
Die kalte, klare Luft des Abends füllte Mallorys Lungen und vertrieb die unangenehme Stickigkeit des Zeltes sowie den Lumpen-Muff. Es fühlte sich so belebend an wie die erste Frühlingssonne nach einem langen Winter. Umsichtig und vorsichtig schob Trevor den Rollstuhl durch die verlassene Zeltstadt, als wäre ihm die Fracht darin unsagbar wichtig. Der ungelenke Riese war nicht sehr gesprächig, vermutlich, weil er die meiste Zeit nicht wusste, was er sagen sollte. Oder weil er einfach kein Mann der vielen Worte war.
Obwohl in den engen Gassen zwischen den Zelten keine Seele zu sehen war, konnte Mallory trotzdem ihre Blicke fühlen. Dann und wann schob eine Hand die Zeltplane eine Winzigkeit zur Seite und Mallory konnte die neugierigen Augen in der Dunkelheit fast glühen sehen. Ihre Anwesenheit hatte sich längst herumgesprochen und die misstrauischen Schausteller hatten wenig übrig für gefallene Zirkusleute wie sie. Gewiss galt die Freakshow als letzte Heimat für allerhand ausgediente Artisten, doch jemandem wie Mallory misstrauten sie. Nicht nur, weil sie ein Neuankömmling war, sondern vor allem wegen der Geschichte, die sie umgab. Das Unglück war selbst für diese wundersamen Gestalten so tragisch, dass sie darin etwas Unheilvolles sahen. Die flüsternden Warnungen vor dem neuen Gast hatte Mallory freilich auch in ihrem dämmrigen Zustand wahrgenommen. Vermutlich ergab sie sich deswegen so bereitwillig der mitleidigen Vorstellung, verflucht zu sein. Den eiligen Schatten, die hektisch in die Zelte huschten, konnte sie es somit kaum verübeln. War dieser Rundgang nur dazu gedacht, ihr die eigene verwunschene Existenz zu zeigen? Ach, wenn die Alte die nächste Portion des Trankes nur überdosieren könnte.
Von ihrer Magengegend aus kribbelte unvermittelt eine überraschende Leichtigkeit durch ihre Gedärme. Zwischen den Zelten drang ein zarter Lichtschimmer hindurch und hinter der letzten Plane erhob sich das imposante Festzelt des Zirkus. Die Beleuchtung und die festliche Musik waren ihr vertraut. Rhythmisches Klatschen sowie herzhaftes Gelächter aus dem Inneren zeigten, dass die Vorstellung in vollem Gange war. Mallorys Augen begannen zu glänzen, sie schien eine Ewigkeit in diesem dunklen, stickigen Zelt gehaust zu haben. Und es schien noch eine weitere Ewigkeit her zu sein, dass sie ein solches Festzelt gesehen hatte. Den Namen darauf erkannte sie als früheren Konkurrenten. Sie nahm einen tiefen Atemzug der kühlen Nachtluft und war erleichtert, hier keine bekannten Gesichter entdecken zu müssen. Wobei sie nicht wusste, was sie daran mehr fürchtete: Dass jemand von früher sie in diesem erbärmlichen Zustand erkannte oder dass sie gar nicht erkannt wurde. Ihr Herz allerdings sehnte sich nach all dem Trubel, den dieses Zelt beherbergte. Eine freudige Anspannung, als würde sie sich auf den nächsten Auftritt vorbereiten, erfasste ihre zurückgebildeten Muskeln. Beinahe konnte sie den warmen Manegenboden unter ihren Füßen spüren, wie das grelle Licht der Scheinwerfer auf ihrer Haut brannte, und hörte das aufgeregte Schnauben der Pferde hinter ihr. Verträumt schloss sie ihre Augen und sah jedes Detail ihres glitzernden Kostüms. Die Muskeln in ihrem Arm spannten sich an, bereit für die große Eröffnungspose, sobald sich der Vorhang öffnete. Vor dem inneren Auge ging sie jede Position, jede Drehung ihrer Dressur durch. Der tobende Applaus, welcher gedämpft in ihre Ohren drang, schien nur ihr zu gelten.
Ein leises Knacken unweit neben ihnen holte sie plötzlich aus ihrer Erinnerung. Die dunklen Umrisse einer Gestalt stand einige Meter von dem Festzelt entfernt, starrte einige Augenblicke direkt zu ihr rüber und verschwand zwischen den Fressbuden am Eingang.
Ihre Augen versuchten krampfhaft, die Gestalt zu erkennen, doch versagten. Als würde diese Silhouette Mallory mit sich ziehen, beugte sich ihr Oberkörper so weit aus dem Rollstuhl wie nur möglich. Ihre Gedärme zogen sich zusammen. Der eigene, wahnhafte Verstand trieb ein übles Spielchen mit ihr und flüsterte ihr Unmögliches zu. Immer weiter zog ihr Blick sie in die Richtung des verschwundenen Schattens und verlagerte ihren Schwerpunkt unglücklich. Ohne jegliche Kraft durch das ständige Liegen konnte sie sich kaum noch aufrecht halten. Kurz bevor das Ungleichgewicht sie aus dem Rollstuhl fallen ließ, packte Trevor beherzt zu und verhinderte einen Sturz. Diese ruckartige Bewegung hatte nicht nur zur Folge, dass Mallory augenblicklich aus ihren Gedanken hochschreckte, sondern ließ ihr wirres Gehirn auch schmerzhaft gegen den Schädel knallen. Dieser Rückruf in die Realität verursachte Schwindel und Kopfweh.
„Wer war das?“, murmelte sie zu sich selbst, als sie sich wieder fing.
„Wer?“
„Der Mann da hinten. Eben stand da noch ein Mann. War das etwa … Nein. Oder doch?“
„Nein, da war niemand“, versuchte Trevor sie abzulenken.
„Doch, da war –“
Der harte Ruck, mit dem Trevor plötzlich den Rollstuhl umdrehte, raubte ihr den Atem. Wie mit der Peitsche angetrieben, setzte sich der Riese in Bewegung und schob den klapprigen Rollstuhl wieder zurück in Richtung des stickigen Zeltes. Ständig beschwichtigte er die verwirrte Mallory, sie hätte nur einen Schatten gesehen und kein bekanntes Gesicht. Seine hastige Geschwindigkeit sagte jedoch etwas anderes.
4
Erst als sie wieder das stickige Zelt erreicht hatten, schien Trevor wieder der gewohnt behäbige Riese. Ebenso behutsam, wie er sie von der Pritsche aufgehoben hatte, legte er sie auch wieder zurück. Zog die warme Decke über ihr geschundenes Bein und wollte sich gerade grußlos verabschieden, als Mallory ihn bei der Hand packte.
„Sag es mir! Sag mir die Wahrheit! Was verschweigt ihr mir? Wieso versteckt ihr mich? Wer war das?“
Als wollte er einem drohenden Schlag ausweichen, zuckte er zusammen und riss seine Augen erschrocken auf. „Ich kann nicht … Ich darf nicht … Ich kann dir das nicht sagen“, stotterte er.
Einem Kleinkind ähnlich, welches gerade ausgeschimpft wurde, riss er sich los. Außer sich brüllte sie ihm hinterher: „Dann hol mir wenigstens meine Medizin! HOL SIE MIR! Bring mir meine Medizin!“
Die Zeltplane war nicht mal zugefallen, da stampfte Mamma M mit schnellen Schritten in Mallorys Richtung. Ihr Blick war voller Zorn und gleichwohl erfüllt mit ein wenig Furcht und Verwirrung.
„Was zum Teufel soll der Aufstand? Wie kannst du es wagen, so mit ihm zu reden? Was ist hier los?“
„Was hier los ist? Ja, das wüsste ich auch gern. Ich will endlich wissen, was ihr hier mit mir treibt.“
„Was wir treiben? Du undankbares, kleines Miststück. Was bildest du dir ein? Du willst also raus hier? Gut. Es wird Zeit, dass du endlich mal etwas für deinen Unterhalt tust. Sonst kannst du deine Medizin vergessen.“
Schnaubend und wütend starrten sich die beiden sturen Frauen an. Ein stiller Machtkampf war entbrannt. Dabei flackerten in Mallorys Gesicht zum ersten Mal ungewohnte Emotionen auf. Ihre Wangen glühten und ihre Augenbrauen zogen sich zusammen. Heiße Tränen stiegen in ihren Augen empor, doch schienen in der Hitze ihrer Wut direkt wieder zu verdampfen. Wortlos einigten sich die beiden auf ein Unentschieden, und während Mallory langsam den Blick senkte, trat Mamma M mit ruhigen Schritten wieder rückwärts aus dem Zelt. Für heute genügte es. Den Kampf würden sie ein andermal ausfechten.
Brodelnd vor Zorn blieb Mallory allein zurück. Es bestand kein Zweifel, dass ihr etwas verschwiegen wurde. Ihr blinder Wahn verkannte, dass es zu ihrem Schutz war. Sich ständig in den verschwommenen Erinnerungen zurückzuziehen hatte zur Folge, dass sie nicht nur die Realität nach wie vor ablehnte. Darüber hinaus nahm ihr steigendes Misstrauen immer abstrusere Formen an. Verstrickte Verschwörungen über den wahren Grund ihrer Rettung und die heimliche Pflege waberten in ihrer Bitterkeit wie giftiger Rauch. Vermutlich wollten sie Rache an einer erfolgreichen Artistin nehmen. Erst verschuldeten sie einen verheerenden Unfall, nur um die Überlebende zu einem willenlosen Lakaien zu degradieren. Bestimmt versuchten alte Weggefährten aus dem Zirkus, sie zu retten, deswegen wurde sie versteckt. Schließlich hätten andere Artisten bemerken müssen, dass sie verschleppt worden war.
Bei so viel Hirngespinsten dürstete es Mallory nach einem guten Drink. Außerdem sagte ihr zumindest der hassgeliebte Trank immer die Wahrheit. Vorsichtig, aber zielstrebig erhob sie sich von der Pritsche. Ihr verletztes Bein schleifte dabei hinterher, doch auch das andere war zu schwach, um sie allein zu tragen. Den unvermeidbaren Sturz fing sie mit ihren Armen ab. Einen schmerzhaften Schrei verschluckte sie, um keine Geräusche von sich zu geben. Was sie jetzt am wenigsten brauchte, war ein herbeieilender Trevor, der nach ihr sah. Unter Schmerzen, aber unermüdlich krabbelte sie immer weiter zu der heruntergekommenen Truhe in der Ecke. Mit letzter Kraft öffnete sie den schweren Deckel und kramte darin herum, bis sie den alten Krug fand. Hastig und gierig schluckte sie so viel wie möglich von der beißenden Flüssigkeit herunter, bis sie der widerliche Geschmack fast zum Würgen brachte. Das ekelhafte Gesöff ließ all ihre Innereien in Flammen aufgehen und ein heftiger Schwindel packte sie. In einer plötzlichen Ohnmacht sackte sie zusammen.





























