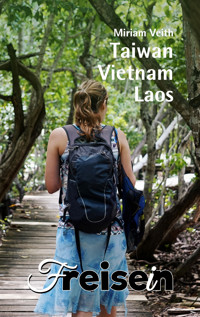Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: fREISEiN
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist ein typischer Herbsttag. Die Globetrotterin Miriam sitzt auf ihrem gemütlichen Schaukelstuhl und wärmt sich die Füße am Ofen, während engagierte Menschen auf einem anderen Kontinent dafür kämpfen, Straßenhunde und -katzen medizinisch versorgen zu können. Es vergehen einige Wochen, in denen sich Miriam auf einem Gnadenhof in Deutschland für den Tierschutz einsetzt, dann steigt sie in ein Flugzeug, und reist auf die Inselgruppe der Kapverden. Dort trifft sie auf die Organisation Simabo (Kreol für: »wie du«). Sie kommt nicht nur mit der kapverdischen Kultur in Kontakt, sondern schließt auch Freundschaften mit Vier- und Dreibeinern. Die Stadt Mindelo ist für Hunde und Katzen ein hartes Pflaster. Schon am ersten Tag stößt Miriam an ihre emotionalen Grenzen. Der Gedanke kommt auf, die Sache abzubrechen, sich dem Leid der Tiere zu entziehen, doch sie lässt sich nicht unterkriegen, und schon bald erfährt sie von ergreifenden Geschichten, die jedes Tierfreundeherz höherschlagen lassen. Von Machtlosigkeit über Gelingen lernt sie am Ende ihrer Mission eine Hündin namens Super Lucky kennen. Diese soll schon bald die Chance bekommen, adoptiert zu werden und in ein schönes Leben zu starten. Doch es kommt zu Hürden. Muss Super Lucky zurückbleiben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REISEN BEDEUTET FREISEIN
Miriam Veith
Kapverden
Miriam Veith
FREISEIN
Kapverden
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: September 2023
Miriam Veith
www.freisein-verlag.de
www.instagram.com/miriam.freisein
www.facebook.com/miriam.freisein
Titelbild: Gaurav Sharma, www.instagram.com/gs.clicks
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Verlag: Freisein-Verlag Miriam Veith
11 Rue de Hatten, FRA-67480 Forstfeld, Frankreich
eISBN: 978 3 9825501 3 8
Miriam Veith
Kapverden
Durchkreuzte Pläne
Meine Zeit auf dem Gnadenhof »Animal hope«
Spendenaufruf
Abreise aus Deutschland
Ankunft auf den Kapverden
Mein erster Hilfseinsatz
Gedanken und Schnurrhaare
Ein Tag voller Gegensätze
Balsam für die Seele
Neue Energie und Lebensfreude
Zurück nach Mindelo
Neun Fellnasen zum Verlieben
Gäbe es doch nur mehr freiwillige Helfer!
Du fehlst mir
Auf zu neuen Ufern
Abenteuerliches Santo Antão
Muskelkater zu Nikolaus
Besuch aus Indien
Tierrechte und Botschafter
Schräge Begegnungen
Wo ist Azulin?
Weihnachtsvorbereitungen
Tierische Begleitung
Nichts für Zartbesaitete
Eine beeindruckende Frau
Hoch hinaus
Der Start einer Rettungsaktion
Ungewissheit
Enttäuschung und Abschied
A Very Important Pooch
Letzte Etappe
Heiligabend
Über ein Jahr später
Spendenaufruf
Quellen
Diese Reise fand im Jahr 2020 statt.
Die Namen sämtlicher Personen, die in diesem Buch auftauchen, wurden geändert, um deren Privatsphäre zu bewahren. Davon ausgenommen sind die Namen der Gnadenhofleiterin von Animal hope (Felicia), der Gründer von Simabo (Silvia und Paolo) und der Gastgeberin auf der Insel Santo Antão (Liana).
Die Euro-Angaben basieren auf den Umrechnungen eines Währungsrechners, den ich zum Zeitpunkt meiner Reise genutzt habe.
Alle Angaben im Hinblick auf kulturelle und ländertypische Informationen wurden nach bestem Wissen gemacht. Diese wurden von den Einheimischen vor Ort, durch ausgiebige Recherche und etliche Reiseführer zu dem Land eingeholt.
Feedback zu diesem Buch ist erwünscht. Ich freue mich über jegliche Anregungen, Fragen oder Kritik. Meine E-Mail-Adresse lautet: [email protected]
Durchkreuzte Pläne
Es war ein Sonntagabend im November. Ich befand mich in einem Flughafenhotel in Portugal und ließ die vergangenen Wochen Revue passieren. Wäre alles so gelaufen wie geplant, wäre ich an jenem Abend nicht mehr in Europa gewesen, sondern längst auf einer vulkanischen Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas: den Kapverden.
Zuletzt hatte es jedoch einige Ereignisse gegeben, die meinen ursprünglichen Plan in eine andere Richtung lenkten. Obgleich ich schon vor längerer Zeit einen Flug auf die kapverdische Insel Boa Vista gebucht hatte, steckte nun ein Flugticket auf die Insel São Vicente in meinem Rucksackfach.
Wie es dazu kam, bedarf einer kurzen Erklärung.
Einige Wochen zuvor – im Oktober – saß ich in meinem gemütlichen Schaukelstuhl im Wohnzimmer und wärmte mir die Füße am Feuer meines Ofens. Es war ein lauschiger Herbsttag. Draußen war die Erde von bunten Blättern gesäumt und der Himmel zeigte sich wolkenfrei. Parallel zu dieser heilen Welt lief im Radio eine Sendung über den afrikanischen Kontinent. Es ging um die dort zunehmende Hungersnot; ein immerzu präsentes Thema, das bei Weitem nicht nur Afrika betrifft, sondern viele Teile außerhalb der westlichen Welt.
Zwar geht es auch in reichen Ländern nicht allerorts rosig zu – welches Land ist schon frei von Armut –, dennoch spricht man bei den Menschen aus der westlichen Welt1 in aller Regel von jenen, die ein privilegiertes Leben haben. Wer in der westlichen Welt zu Hause ist, hat es meist besser.
An jenem Tag beschäftigte mich das Thema Ungleichheit in unserer Welt stark und ließ mich nicht los. Von jetzt auf gleich war ich entschlossen, meinen Rucksack zu packen und etwas dagegen zu tun! Ich bin vielleicht nicht die Heilige Maria – obgleich sich mein Name Miriam von Maria ableitet –, dennoch vertrete ich die Ansicht, dass jeder Einzelne die Macht hat, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ich wollte an einen Ort reisen, an dem ich etwas bewirken konnte. Insbesondere weil es zu jener Zeit, seit Ausbruch der Infektionskrankheit COVID-192, in vielen Ländern an freiwilligen Helfern fehlte. Ich wusste, was das für einige Menschen auf dieser Welt bedeutete. Ich war in den letzten Jahren viel gereist und hatte einige Hundert Male bei Einheimischen in den unterschiedlichsten Ländern übernachtet. Dabei hatte ich immer wieder festgestellt – so verschieden wir Menschen auch sein mögen –, dass wir alle dieselben Grundbedürfnisse haben.
Manchmal frage ich mich, warum ich das Anrecht auf einen vollen Kühlschrank und ein kuscheliges Bett habe, wohingegen manch anderer gerade so über die Runden kommt. Desgleichen frage ich mich hin und wieder, ob es nicht bequemer wäre, Nachrichtensender vollends aus meinem Leben zu verbannen. Durch das Verfolgen der allgemeinen Nachrichten unterzieht man sich meiner Meinung nach einer negativen Gehirnwäsche und wird nicht selten damit geblendet, die Welt sei schlecht. Dabei ist diese Welt nicht per se schlecht, und das würde durchaus deutlicher werden, wenn Nachrichtensender ihre Strategie änderten, indem sie ihren Fokus nicht immerzu auf schockierende Vorkommnisse setzten, sondern vorwiegend gute Ereignisse verkündeten. Wer behauptet, dass schlimme Nachrichten wichtiger sind als gute?3
»Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gutgehen wird. Aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schiefgehen wird.« – Friedrich Schiller
Ganz klar sollten dringende Nachrichten (und lustige Katzenvideos) stets Priorität haben, dem stimme ich voll und ganz zu, und das Leben ist nun mal leider nicht immer ein Ponyhof, auch das ist klar. Ich – die ich mich als Optimistin bezeichne – war jedenfalls wild entschlossen, mich in naher Zukunft auf den afrikanischen Kontinent aufzumachen und mich in einer Gegend einzubringen, wo man meine Hilfe benötigen konnte. Wo ich helfen würde, spielte für mich keine Rolle.
Wie ich im Endeffekt auf die Kapverden aufmerksam wurde, weiß ich im Nachhinein gar nicht mehr so genau. Sie spiegeln nicht gerade das typische Bild Afrikas wider, das man als Laie eventuell haben mag. Die meisten, die an Afrika denken, haben wohl eher eine trockene Steppe vor Augen oder malen sich Landschaften mit Löwen und Giraffen aus.
Tatsächlich waren die Kapverden vielen Leuten noch bis vor einiger Zeit gar kein Begriff. Doch das änderte sich innerhalb der letzten Jahre rasant. Der steigende Tourismus führte in dem Land zu einem starken Wachstum und wurde für einige Kapverdianer zu einer Quelle lebenswichtiger Einnahmen. Ebenso wie viele andere Länder auf dieser Erde gehören auch die Kapverden zu jenen, die stark von Deviseneinnahmen abhängig sind.
Ich finde, dass Tourismus nie der Hauptträger eines guten Lebens sein sollte, aber er kann ein Land unterstützen. Auf der anderen Seite kann er aber auch überhandnehmen. Die kometenhafte Entwicklung der Tourismusinfrastruktur auf der kapverdischen Insel Boa Vista führte zum Beispiel dazu, dass in der Vergangenheit massenweise Einheimische von ihren Heimatinseln abwanderten und sich auf Boa Vista ansiedelten, um Arbeit in einer der vielen All-inclusive-Anlagen zu finden. Die Lebenshaltungskosten sind für die Kapverdianer auf dieser Insel jedoch so immens hoch, dass über die Jahre hinweg richtige Barackensiedlungen entstanden. In diesen leben viele Kapverdianer unter schlimmsten Bedingungen.
Als ich während meiner Afrika-Recherchen von jenen Baracken erfuhr, packte es mich. Ich hatte mein Projekt gefunden und setzte mich sogleich mit einer Organisation in Verbindung, die die Menschen vor Ort mit Nahrungsmitteln versorgte. Recht zügig erhielt ich eine Rückmeldung, wenn auch nicht unbedingt eine positive – zumindest nicht für mich. Die Ansprechpartnerin der Hilfsorganisation war im achten Monat schwanger und wünschte sich sehnlichst, ihr Baby in ihrem Heimatland Deutschland auf die Welt zu bringen; nicht zuletzt wegen der ärztlichen Versorgung. Dass ich sie gerade zu diesem Zeitpunkt kontaktiert hatte, war wohl schlechtes Timing.
Trotzdem wollte ich mein Vorhaben nicht aufgeben, denn wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt habe, bin ich davon schwer wieder loszureißen. Ich war mir sicher, dass ich es schon irgendwie schaffen würde, mich mit den anderen (einheimischen) Mitgliedern der Organisation zu verständigen, notfalls mit Händen und Füßen. Also buchte ich kurzerhand einen Flug – bevor ich überhaupt wusste, wie ich auf Boa Vista von A nach B kommen oder gar eine vorübergehende Bleibe finden sollte.
»Hast du denn nie Angst, dass auf deinen Reisen mal etwas schiefgeht?«, werde ich immer wieder gefragt. Dieser Satz bringt mich jedes Mal zum Schmunzeln. Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, was auf meinen Reisen schon alles »schiefging«. Aber alles wandte sich immer zum Guten. Wo bliebe denn der Spaß, wenn immer alles planmäßig verliefe? Das Leben ist doch ein Abenteuer! Und was würde der Satz »Wird schon schiefgehen« für einen Sinn ergeben, wenn sich dahinter nicht etwas Positives verberge?
Mein Flug nach Boa Vista war also gebucht. Da es keine Direktflüge gab, war ein Zwischenstopp in London geplant. Großbritanniens Hauptstadt. Oder die Hauptstadt von England? Naja, das Vereinigte Königreich eben! Oder wie die Engländer es erklären würden, äh … ich meine die Briten: Das Vereinigte Königreich umfasst die Länder England, Schottland, Wales und Nordirland, Großbritannien hingegen nur England, Schottland und Wales und England ist lediglich ein Landesteil des Vereinigten Königreichs bzw. Großbritanniens. Ist doch ganz einfach, oder?
Aber ich schweife ab. Eine meiner leichtesten Übungen! Abzuschweifen oder den Faden zu verlieren liegt mir überaus gut. Meine Deutschlehrerin verpasste mir zu Schulzeiten nicht umsonst öfter mal bei Aufsätzen die Note 6; mit der freundlichen Begründung: Thema verfehlt! Würde sie nun dieses Buch in ihren Händen halten, wäre sie wohl ganz schön überrascht. Dennoch würde sie vermutlich einiges rot markieren, aber ich bin ja inzwischen erwachsen (glaube ich) und kann schreiben, was ich will!
Nachdem mein Flug nach Boa Vista also gebucht war, war ich voller Tatendrang, die humanitäre Organisation zu unterstützen – bis mir völlig unerwartet ein Riegel vor meine Zielsetzung geschoben wurde. Nun kann man ein gläubiger Mensch sein oder nicht – die folgenden Ereignisse waren ganz klar alles andere als zufallsbedingt.
Zuerst bekam ich die Nachricht vonseiten der Airline, dass mein Flug nach Boa Vista gecancelt wurde; nur wenige Tage vor meiner Abreise. Das brachte mich für einen Moment in die Bredouille, sollte mich aber nicht davon abhalten, einen neuen Flug zu buchen. Als ich nach langer Suche einen fand und gerade meine Passagierdaten eingeben wollte, brach auf einmal inmitten meines Buchungsvorgangs die Internetverbindung zusammen. Das machte mich so stutzig, dass ich die Sache einen Tag lang ruhen ließ.
Am nächsten Morgen betete ich um eine Art Erleuchtung, doch mein Gebet schien ignoriert zu werden. Anscheinend hatte der liebe Herrgott gerade Wichtigeres zu tun. »Na vielen Dank auch!«, moserte ich an jenem Morgen beleidigt, während ich meine Jacke überzog und nach meinem Haustürschlüssel kramte. Ich machte mich gerade auf den Weg zur Arbeit.
Die ganze Woche über war ich pünktlich, an diesem Morgen aber hatte ich etwas getrödelt und schon befürchtet, den Zeitverlust durch schnelleres Autofahren ausgleichen zu müssen (bitte nicht nachmachen). Da mein Auto wie üblich auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt war, musste ich die Hauptstraße überqueren. Das kann schon mal gut und gerne ein, zwei Minuten dauern, obwohl ich in keiner hektischen Stadt, sondern einem überschaubaren Dorf wohne. Dessen Einwohner scheinen morgens allerdings allesamt hinterm Steuer zu sitzen. Dass ich an jenem Morgen hingegen kein einziges Auto erblickte, verwunderte mich. Die Hauptstraße war wie leer gefegt. Es war fast so, als habe mir jemand den Weg freigemacht.
War das etwa die zeitlich verzögerte Antwort auf mein Gebet? Sollte das bedeuten, meinem Vorhaben, mich auf die Insel Boa Vista aufzumachen, stünde nichts mehr im Wege?
Erfreut und auf einmal irgendwie erleuchtet, marschierte ich auf die andere Straßenseite, da hupte es hinter mir. Eine parkende Autofahrerin wies mich darauf hin, dass ich meine Weste verloren hatte. Tatsächlich lag die mitten auf dem Gehweg. Zeitgleich kamen von links und rechts aus heiterem Himmel die vermissten Autos. Ich rannte hastig zurück und schaffte es gerade noch so auf den Gehweg.
Was diese Wendung mit der Antwort auf mein Gebet zu tun gehabt haben sollte, verstand ich nicht. Es war, als hätte »man« mich mit Absicht gestoppt.
Die Krönung erlebte ich, als ich am Tag darauf mit einem geplatzten Autoreifen da stand und schon wieder nicht weiterkam, und ein noch einschneidenderes Erlebnis hatte ich am Folgetag, als ich für eine Routineuntersuchung zu meinem Arzt fuhr – genauer gesagt zu meinem Frauenarzt. Nicht gerade mein Lieblingsarzt, aber was tut man nicht alles für die Gesundheit. An jenem Tag stand nicht nur eine Vorsorgeuntersuchung an, ich sollte bei der Empfangsdame auch einen Becher mit meinem Blaseninhalt abgeben; ich hatte nämlich schon seit einigen Tagen ein komisches Gefühl im Bauch.
Nachdem ich den Becher brav mit meinem Namen beschriftet hatte, stellte ich ihn an der vorgesehenen Stelle ab und setzte mich anschließend ins Wartezimmer. Als ich eine halbe Stunde später in den Sprechstundenraum gebeten wurde, traf mich die Verkündung meines Arztes wie ein Schlag: »Miriam, du bist schwanger.«
Da fing ich ohne jede Vorwarnung an wie ein Schlosshund zu heulen; so laut, dass man mich bis in das Wartezimmer hören konnte. Die anderen Patientinnen mussten wohl gedacht haben, man habe mir die Diagnose einer unheilbaren Krankheit verkündet. Ich war außer mir. Das hatte ich nun wirklich nicht erwartet! Dieses Mal hatte definitiv jemand Stopp zu meiner Reise gesagt.
Fast zwanzig Minuten vergingen, in denen mir mein Arzt schilderte, wie nun der weitere Ablauf sei; sowohl im Bezug auf eine Entscheidung für als auch gegen das Baby. Ich war nicht in der Lage, zu sprechen, also redete er. Anschließend ging es ins Behandlungszimmer, wo er eine Ultraschalluntersuchung durchführte. Noch immer kullerten mir die Tränen. Ich war wie überrannt, vollkommen überfordert, und mein Arzt zunehmend verwirrt … Nicht über mich, sondern über das, was er auf dem Bildschirm vor sich sah – nämlich nichts.
»Das ist ja mehr als merkwürdig!«, sagte er. »Das Testergebnis ist positiv, aber die Ultraschalluntersuchung weist auf keinerlei Schwangerschaft hin.«
Da war auch ich in meinem Gefühlschaos irritiert.
»Zieh dich doch bitte erst mal wieder an«, forderte er mich auf, während er sich zu der Sprechstundenhilfe begab, die den Schwangerschaftstest durchgeführt hatte. Als er zurückkam, traf mich seine Verkündung schon wieder wie ein Schlag.
»Entwarnung, Entwarnung, der Test ist negativ! Du bist nicht schwanger!«
Da fing ich wieder an wie ein Schlosshund zu heulen – diesmal aber vor Erleichterung –, während sich die anderen Patientinnen im Wartezimmer die schlimmste Krankheitsdiagnose aller Zeiten ausgemalt haben mussten. Zeitgleich kam die Sprechstundenhilfe auf mich zu und gestand mir beschämt, dass sie meinen Becher mit dem einer anderen Frau vertauscht habe. Heute sei ihr erster Tag.
Bis dato hatte Gott fünf Anläufe gebraucht, um mir begreiflich zu machen, dass gerade nicht die richtige Zeit für eine Reise war.
»Mann, ist die dämlich!«, musste er sich gedacht haben. »Habe ich an dem Tag der Erschaffung dieser Knalltüte etwa gepennt?«
Zum Pennen war am späten Abend auch mir zumute, während ich mir über das Wieso und Weshalb den Kopf zerbrach. Nichts auf der Welt macht mich glücklicher als zu reisen, und so konnte ich es schlichtweg nicht aushalten, die Füße hochzulegen und auf irgendeinen richtigen Moment zu warten.
Ich missachtete die Hinweise »von oben« trotzig, begab mich um 23.00 Uhr noch auf die Straße und ging ein Stück spazieren; mit dem Vorhaben, erneut einen Flug zu buchen. Die Internetverbindung bei mir zu Hause mochte vielleicht zusammengebrochen sein, das Datenvolumen auf meinem Smartphone aber nicht!
Ich hatte zwar durchaus verstanden – wenn auch nicht akzeptiert –, dass ich das mit den Kapverden gerade lieber sein lassen sollte, »jetzt gerade« war aber ein dehnbarer Begriff. Ich würde einfach ein paar Tage später fliegen, setzte ich mir in den Kopf.
Gerade hatte ich mein Smartphone in die Hand genommen, um eine Buchung aufzurufen, da bellte mich im Stockdunklen ein großer Hund hinter einem Zaun an, woraufhin mir das Gerät beinahe aus der Hand fiel. Mit Herzklopfen schaute ich über den Zaun, hinter dem mich ein kuscheliger Husky beäugte:
»Na, na, na, Miriam, lässt du das mit der Buchung wohl bleiben!«, grummelte er.
Dieses letzte Ereignis gab mir den Rest und ließ mir die ganze Nacht über keine Ruhe. In meinem Kopf ratterte es. Ich versuchte vergeblich, zu begreifen, warum das mit dem Verreisen gerade nicht sein sollte. Vor allem dieses Erlebnis mit dem Hund beschäftigte mich stark. Warum hatte mich gerade ein Tier darauf aufmerksam gemacht, erst mal nicht zu fliegen? Um mich daran zu hindern, hätte mir ja auch ein Ast auf die Birne fallen können. Fast zeitgleich, als ich mir diese Frage stellte, besann ich mich, dass ich vor einigen Monaten auf einen Hilferuf einer Gnadenhofgründerin4 gestoßen war, die für einen großen Umzug im Herbst tatkräftige Unterstützung brauchte. Als ich mich unversehens an diesen Hilferuf erinnerte, dämmerte es mir allmählich. Gott hatte mir bewusst keinen Ast auf den Schädel fallen lassen, sondern einen Hund geschickt; ein Tier, das mich daran erinnern sollte, dass es ganz in der Nähe Geschöpfe gab, die meine Hilfe brauchten.
Dabei hatte ich doch vorgehabt, Menschen zu helfen! Bei meinen Freiwilligenprojekten waren es bislang immer die Tiere gewesen, die meine Hilfe bekamen. Sollten nun nicht auch mal die Menschen an der Reihe sein?
Das wäre mir jedenfalls sehr viel leichter gefallen, denn Menschen können einem mit Worten mitteilen, was sie fühlen. Nun schien es jedoch so, als müsste ich mich mal wieder mit dem Schicksal derer auseinandersetzen, die nicht sprechen können. Eigentlich hatte ich gar keine Kraft dafür, schon wieder Geschichten über Gräueltaten zu hören, wie Tiere ausgebeutet wurden und was man ihnen angetan hatte.
Aber wie es aussah, scheint das Helfen für Tiere irgendwie meine Aufgabe im Leben zu sein. Jeder Mensch ist aus einem ganz bestimmten Grund auf dieser Erde. Es gilt nur, diesen herauszufinden.
Ich arrangierte mich also damit, wusste aber zugleich nicht, ob für den Umzug des Gnadenhofes überhaupt noch Helfer benötigt wurden. Um es in Erfahrung zu bringen, rief ich dort an und teilte der Gründerin mit, dass ich in den nächsten Wochen außerplanmäßig viel Zeit habe, und fragte nach, ob man meine Hilfe auf dem Hof denn brauchen könne. Bei meinem Anruf stellte sich heraus, dass eine der wenigen Freiwilligen des Gnadenhofes dafür gebetet hatte, dass sich jemand meldete.
1 Der Begriff »westliche Welt« definierte sich ursprünglich aus der Kultur Westeuropas. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit die Bedeutung von westlichen Werten, sodass man diesen Begriff heute nicht mehr ausschließlich geografisch anwenden kann. Sprich: Nicht in allen Ländern im Westen gelten automatisch westliche Werte.
2 Corona Virus Disease 2019 | Coronavirus-Erkrankung 2019
3 Lass dich eines Besseren belehren: www.goodnews.eu.
4 Ein Gnadenhof ist ein Zuhause für Tiere, die gerettet wurden. Sie dürfen dort den Rest ihres Lebens in Frieden verbringen. Finanziert werden solche Höfe ausschließlich durch Spenden.
Meine Zeit auf dem Gnadenhof »Animal hope«
Es war Oktober – noch immer.
Die Gnadenhofgründerin Felicia war mit ihrem kleinen Team schon seit vielen Wochen bis an ihre Grenzen und darüber hinaus gegangen, um einen Umzug vorzubereiten, der ihren Schützlingen ein neues Leben ermöglichen sollte. Für all die Tiere, die sie in der Vergangenheit gerettet hatte, war schon längst nicht mehr genug Platz. Nicht gerade das, was sich Felicia für ihre lieben Schätze gedacht hatte, schließlich war ihr Gnadenhof »Animal Hope«5 ein Versprechen an die Tiere, dort ein schönes Leben zu haben. Sie sollten nachts in ihren Ställen Luft zum Atmen haben und ihren Platz nicht mit zahlreichen anderen teilen müssen.
Um einen Umzug zu verwirklichen, hatte es all die Jahre an den finanziellen Mitteln gemangelt. Dann aber kam es völlig unerwartet zu einer Erbschaft. Felicia kaufte von dem Geld einen neuen Hof, einen sehr viel größeren. Andere Menschen hätten sich an ihrer Stelle vielleicht materielle Dinge für den Eigengebrauch angeschafft. Für Felicia aber waren ihre Tiere das Wichtigste auf Erden. Die vielen Hunde, Pferde, Schweine, Esel, Kühe, Ziegen und Katzen Tag für Tag zu versorgen, war bereits ein Vollzeitjob, da blieb kaum ein Puffer, um einen Umzug zu bewerkstelligen. Demzufolge waren so viele helfende Hände wie nur möglich nötig. Als ich dabei ins Spiel kam, war ich mir nicht sicher, ob ich emotional in der Lage sein würde, den Anblick so vieler vom Leben schwer geprägter Geschöpfe zu verkraften. Welch ein Glück, dass all ihre Geschichten ein Happy End hatten!
Ein glückliches gerettetes Schwein namens Rügenwald
Schon an meinem allerersten Tag als Helferin stellte ich fest, dass ich nicht nur mit Tieren in Kontakt kommen würde, die von Schicksalen geprägt waren, sondern auch mit Menschen, die es in ihrem Leben nicht leicht hatten. Der erste Mann, der mir bei meinem Betreten des Hofes ins Auge (und Gehör) stach, zeigte ein auffälliges Verhalten. Er führte laute Selbstgespräche, schimpfte unwillkürlich vor sich hin und bewegte sich unkoordiniert. Man hätte annehmen können, er sei über etwas wütend, doch sein Verhalten schien eher krankheitsbedingt.
Als ich auf ihn zuging, um mich vorzustellen – ich konnte außer ihm niemanden sonst auf dem Hof sehen –, erweckte seine Begrüßung den Eindruck, dass er über mein Kommen nicht sonderlich erfreut war. Ziemlich schnell wandte er sich ab und widmete sich wieder seiner Arbeit. Ich stand an diesem ersten Morgen also erst mal wie bestellt und nicht abgeholt herum, während der Mann in den Gummistiefeln die Futtertröge für die bereits ungeduldig schreienden Esel vorbereitete.
»Scheiß Viecher!«, gab er dabei zuckend von sich und gleich darauf folgte ein liebevolles: »Hier kommt euer Futter.« Auch eine Taube wollte gerne etwas abhaben, woraufhin sie von dem Mann als »blöder Geier« bezeichnet wurde. Gleich danach wiederholte er in einer Dauerschleife das Wort »Hopp!« und begab sich dann in den hinteren Teil des Hofs. Zu stören schien die Tiere die viele Schimpferei nicht. Sie reagierten noch nicht einmal darauf. Das war merkwürdig, denn Tiere sind sensible Lebewesen, die negative Auren spüren. Was auch immer diesen Mann so aufgewühlt hatte, es schien nicht böser Natur zu sein.
Der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi sagte einmal: »Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt.«
Nun würde ich zwar bestreiten, dass es auf dieser Welt auch nur eine einzige Nation gibt, die »ihre« Tiere rundum gut behandelt, aber es gibt unbestritten ein paar tolle Menschen, die das tun.
Der hitzköpfige Mann auf dem Gnadenhof steckte offensichtlich bis zum Hals in der Arbeit und so fackelte ich nicht lang herum. Ich sagte ihm kurz und knapp, dass ich hier sei, um mit anzupacken, und kaum eine Minute später hatte ich eine Mistgabel in der Hand. Fast zur gleichen Zeit kam Felicia zum Hoftor herein. Bislang kannte ich sie nur von dem Telefonat. Als ich sie schließlich sah, wirkte sie von der ersten Sekunde an wie eine starke Persönlichkeit auf mich, geprägt von so einigen Erlebnissen.
Die Mistgabel nahm sie mir sofort wieder weg und hieß mich freundlich willkommen. Bevor es an die Ställe gehen sollte, bat sie mich, erst einmal mit ein paar Hunden Gassi zu gehen. Dabei stellte sie mich einem jungen Kerl vor, der gerade eine Kippe rauchte und von oben bis unten schwarz gekleidet war. Auch er begrüßte mich freundlich und nahm mich – den Zigarettenstummel mit seinen geschnürten Boots austretend – mit zu den Hundezwingern.
Warte mal! Zwinger? Das hatte ich auf einem Gnadenhof nicht erwartet! Ich dachte vielmehr, dass es dort alle Tiere kuschelig haben! So trottete ich dem schwarz gekleideten Marvin etwas zaghaft hinterher, woraufhin er mir zurief: »Nicht traurig sein, auf dem neuen Hof wird es so etwas nicht mehr geben!«
Marvin konnte offenbar Gedanken lesen. »Der neue Hof ist so groß, dass kein Tier je wieder Gitter sehen muss! Das hier ist nur vorübergehend, weil Felicia kurzfristig noch ein paar Notfälle aufnehmen musste.«
Ich war von dem Anblick dieser Notfellchen in der Tat etwas angeschlagen, begriff aber schnell, dass eine räumliche Abtrennung der verschiedenen Hunderassen nötig war, um Kämpfe untereinander zu vermeiden. Es handelte sich bei jenen Hunden um »schwierige Fälle«; zumindest würde man das so in dem Titel eines Zeitungsberichts lesen. »Kampfhunde«, um es auf den Punkt zu bringen.
Wer mit Hunden im Alltag nicht viel zu tun hat, hätte sich bei dem Anblick des Zwingerbereichs wahrscheinlich vor Angst in die Hose gemacht. Der Lärm dieser Kraftpakete, die mit all ihrer Masse gegen die Gitter sprangen und wie verrückt bellten, war akustisch kaum auszuhalten. Bevor ich mir jedoch die Ohren zuhalten konnte, hatte mir Marvin schon eine Leine in die Hand gedrückt und sich unterdessen – die Tür nur einen Spalt öffnend – in einen Zwinger mit zwei Bullmastiffs gequetscht. Während er unter großer Kraftanstrengung versuchte, einen der beiden Riesen anzuleinen, sah ich in die Augen eines American Staffordshire, eines Rottweilers, eines Pit Bulls, Kangals und Dobermanns. Allesamt verausgabten sich laut bellend damit, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Ich bin mit Hunden aufgewachsen und wusste, dass dieses vermeintlich »aggressive« Verhalten nur ein Hilferuf war. Die armen Wesen wollten raus aus ihren Zwingern. Sie wollten im Gras schnuppern und für eine kurze Zeit einfach nur ein Hund sein. Obwohl mir das bewusst war, hatte ich Respekt vor ihnen; ich konnte ihnen ja nicht in ihre Seelen blicken. Ich wusste nicht, was sie schon alles erlebt hatten. Es ist nun mal ein Unterschied, ob ein Hundebesitzer einen Mops gequält hat oder einen Muskelprotz wie jene hinter diesen Gittern. Böse Absichten bekommen kräftige Hunde nicht in die Wiege gelegt, aber das ist bei Haien auch nicht der Fall und trotzdem würde ich lieber von einer Flunder gebissen werden.
Meine Freude, gleich einen der beiden Bullmastiffs kennenzulernen, war trotz alldem riesengroß! Ich würde sagen, ich hatte Herzrasen, welches sich zu zwanzig Prozent aus Respekt und achtzig Prozent Begeisterung zusammensetzte. Ich weiß, dass einige Menschen dieses Gefühl mit mir teilen würden, weitaus mehr bei dem Gedanken an solche Hunde hingegen eine Gänsehaut bekämen.
Wer den Umgang mit Hunden nicht gewohnt ist und vielleicht sogar Angst vor ihnen hat, dem möchte ich an dieser Stelle ein paar Tipps geben. Zu wissen, wie man sich zu verhalten hat, hilft ungemein, mit bestimmten Situationen besser umgehen zu können. Vorweg ist allerdings zu sagen – und das ist möglicherweise etwas ernüchternd –, dass sich die Angst gegenüber einem Hund nicht vor ihm verbergen lässt. Mit seiner feinen Nase kann ein Hund die Ausschüttung von Angsthormonen bei einem Menschen riechen. Diese Reaktion des eigenen Körpers lässt sich nicht unterdrücken. Eine »korrekte« Verhaltensweise ist deshalb umso wichtiger. Verhält man sich »falsch«, kann sich die eigene innere Unruhe schnell auf den Hund übertragen.
Zunächst sollte man bei einer Begegnung mit einem Hund nicht hektisch sein und schon gar nicht wegrennen oder gar anfangen, hysterisch zu schreien. Eine gerade Körperhaltung, keine hastigen Bewegungen und das Vermeiden von (starrendem) Blickkontakt tun schon das meiste zur Sache. Die Hände lässt man einfach locker nach unten hängen oder bildet – wenn man sich dadurch sicherer fühlt – eine Faust. Da Hunde meist neugierige Wesen sind und wissen möchten, mit wem sie es zu tun haben, kommen sie in aller Regel her und schnuppern. Dabei sollte man dem Tier Zeit lassen, es geht dann oft von ganz allein wieder weg.
Hat man das Bedürfnis, den Hund zu streicheln, sollte man das erst tun, wenn er zu Ende geschnuppert hat, denn erst dann hat er alle Informationen gesammelt. Wir Menschen wollen ja auch nicht, dass uns bei den Acht-Uhr-Nachrichten mittendrin jemand vor den Bildschirm läuft – auch wenn das vielleicht manchmal besser wäre.
Mir persönlich fiel es bei dem Anblick der beiden Bullmastiffs unfassbar schwer, ruhig da zu stehen, denn ich konnte es kaum erwarten, sie zu knuddeln. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind, um jeden Besitzer auf der Straße fragen zu können, ob ich ihn streicheln dürfe (also den Hund).
Doch nicht nur ich schien mich auf die Bullmastiffs gefreut zu haben, auch sie waren von meiner Präsenz überaus angetan, ja regelrecht außer sich. Da war nichts mit langsamem Annähern und erst mal schnuppern! Die beiden waren so voller Energie, dass sie mich fast umwarfen. Trotzdem konnte ich es nicht lassen, ihre Riesenschädel zu kraulen.
Von Marvin bekam ich die Leine mit dem Rüden Rokko in die Hand gedrückt, er dagegen nahm lieber das Weibchen Shiva. Und das, obwohl Marvin fast zwei Köpfe größer und sehr viel stattlicher gebaut war als ich! Wäre es da nicht fairer gewesen, mir das Weibchen zu geben? Weit gefehlt! Die 47-Kilo-Dame hatte sehr viel mehr Power als ihr Kumpel Rokko. Shiva zerrte Marvin geradezu nach draußen und hechelte dabei wie verrückt, bis sie schließlich das Gras berührte und erschnüffeln konnte, wer sich da schon so alles herumgetrieben hatte. Die riesengroße Freude, draußen sein zu dürfen, konnte man ihr ansehen. Aber nicht nur Shiva war energiegeladen, auch Rokko ging eher mit mir Gassi als ich mit ihm, also erhob ich meine Stimme.
Da sagte Marvin zu mir, dass das nichts bringe. Rokko sei taub.
Die Hunde, die Felicia bislang aufgenommen hatte, waren oft traumatisiert, weil ihnen schlimme Dinge angetan wurden. Häufig waren ihre Zweibeiner mit ihnen aber auch einfach nur maßlos überfordert gewesen, weil sie sich nach außen mit einer als »gefährlich« geltenden Rasse behaupten wollten, ihr eigenes Leben aber gar nicht im Griff hatten. Einen Hund am Ende wegzugeben, war für viele Menschen leider der einfachste Weg.
Ich hatte mit Rokko – den zu halten ganz schön kräftezehrend war – einen Mordsspaß! Er war bildschön, ein Prachtexemplar von Hund, auch wenn ich eine Gegnerin von Zucht bin. Wer Hunde züchtet, vergisst wohl, dass die Tierheime in unserer Welt voll sind, und wo es keine Tierheime gibt, landen Straßenhunde in Tötungsstationen. Abgesehen davon werden durch gezieltes Züchten rassebedingte Erbkrankheiten am Leben gehalten. Schäferhunde zum Beispiel leiden häufig an Hüftproblemen, Französische Bulldoggen an Kurzatmigkeit, Golden Retriever an Epilepsie; die Liste ist lang.6
Während ich zusammen mit Marvin von den Bullmastiffs durch die Felder gezogen wurde, fragte ich ihn, ob er denn öfter zum Helfen auf den Gnadenhof komme. Daraufhin antwortete er mir ganz souverän, als sei das sein Hauptjob: »Ich bin unter der Woche jeden Tag hier, immer von neun bis fünfzehn Uhr«, dann fing er an zu schmunzeln. »Ich leiste Sozialstunden ab! Ich habe in den letzten Jahren ziemlich viel Scheiße gebaut.«
Obgleich wir uns nicht kannten, hatte ich das Gefühl, er habe Redebedarf. Selbstverständlich hakte ich nicht nach, was er verbrochen hatte, ich hörte nur zu. Etwas später gestand er, dass er schon vier Jahre seines jungen Lebens im Knast verbracht und dort sogar seinen Schulabschluss gemacht hatte. Nun war er zwanzig und auf Bewährung draußen. Drogen verkaufen und in Häuser einbrechen wolle er nicht mehr, dennoch bezeichnete er sich als Wiederholungstäter.
Als ich auf seine Geschichte über die Einbrüche hin anmerkte, dass ich mir schon allein bei dem Gedanken daran ins Hemd machen würde, erwiderte er fast etwas beschämt: »Dann hat man aber wenigstens Geld …«
Hätte Marvin mir das mit den Sozialstunden nicht erzählt, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass er nicht immer anständig war. Er wirkte auf mich unglaublich nett, hatte das Aussehen eines Mädchenschwarms, behandelte die Hunde liebevoll und ging Felicia zur Hand, wo es nur ging. Später am Tag – beim Ausmisten der Ställe – merkte er außerdem an, dass »der alte Rudi« nichts dafürkönne, dass er so mies gelaunt sei. Dass Marvin damit den Mann meinte, der die geretteten Hoftiere immerzu als »scheiß Viecher« bezeichnete, war mir sofort klar.
»Rudi liebt die Tiere, er ist nur unzufrieden. Sein Tourettesyndrom ist über die letzten Jahre schlimmer geworden. Er geht zu keinen Behandlungen mehr und will auch keine Ärzte mehr sehen«, schilderte Marvin.