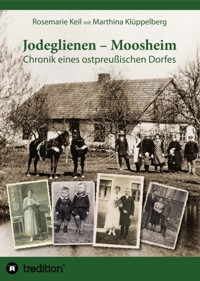Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Laumann Druck und Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein geheimnisvoller Brief im Nachlass der Mutter veranlasst Anne, in die fremde Heimat ihrer Vorfahren zu reisen: ins ehemalige nördliche Ostpreußen, das nun zu Russland gehört. Sie will besonders nach Spuren ihres Großvaters suchen, der dort seit April 1945 vermisst wird. In der früheren Kreisstadt Schloßberg trifft sie den russischen Lehrer Valeri, der in der Schulzeit ihr Briefpartner war. Seine Eltern wurden 1946, nach Flucht und Vertreibung der Deutschen, aus einem zerstörten Dorf bei Brjansk hierher umgesiedelt. Gemeinsam begeben sich Anne und Valeri auf eine spannende, oft auch schmerzhafte Reise in die Vergangenheit. Erstaunt entdecken sie dabei viele Parallelen im Schicksal ihrer Familien und empfinden allmählich immer mehr füreinander. Durch die Eindrücke und Erlebnisse während ihrer Reise gelingt es Anne endlich, die Lasten der Vergangenheit loszulassen. In der Erzählung von Rosemarie Keil, die selbst zur Generation der 'Kriegsenkel' gehört, spiegelt sich ihre eigene Familiengeschichte wider.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosemarie Keil
Fremde Heimat Ostpreußen
Spurensuche und Begegnungen
Erzählung
Laumann-Verlag
Foto Telegrafenamt: Jurij Bardun;
alle anderen Fotos: Falk-Uwe Keil und privat
Kartenskizzen Seite 126: Falk-Uwe Keil
Umschlaggestaltung und Foto: Falk-Uwe Keil
© 2016 by Laumann Druck & Verlag GmbH & Co. KG, 48249 Dülmen
Gesamtherstellung:
Laumann Druck & Verlag GmbH & Co. KG,
Postfach 1461, 48235 Dülmen
ISBN 978-3-89960-431-3
www.laumann-verlag.de
Heimat sind Wurzeln und Flügel.
Goethe
Zur Erinnerung an meine Großeltern Friedrich Schiborn und Emma geb. Bergau sowie ihre vier Kinder, von denen Eva meine Mutter war.
1
Worauf hatte Anne sich da eingelassen? Aber nun war sie im Zug und es gab kein Zurück mehr. Ihre Gedanken wanderten zu jenem nasskalten Februartag, an dem alles begann. Sie saß damals in ihrer kleinen Wohnung, hoch über den Dächern der Stadt, vor einem grauen Pappköfferchen mit abgestoßenen Ecken und sortierte Fotos, Briefe und Dokumente ihrer Mutter Eva. Nach deren Tod im Oktober hatte sich Anne endlich dazu aufraffen können. In der letzten gemeinsamen Zeit gab es noch viele gute Stunden für sie beide, und manchmal hatte Eva sogar von Ostpreußen erzählt, was vorher nur selten vorgekommen war.
Beim Kramen fiel Anne ein dicker, brauner Umschlag in die Hände, auf dem ihr Name stand: »Annemarie«. Das war höchst ungewöhnlich, denn so wurde sie in der Familie von jeher nur zu offiziellen Anlässen, oder wenn sie als Kind etwas angestellt hatte, genannt. Erstaunt fand sie darin tausend Euro, zwei alte Fotos und den Ausschnitt einer Landkarte. Die beiden Fotos kannte sie aus ihrer Kindheit. Das eine, zerschnittene Bild, das ihren Großvater und die Hälfte eines Arms zeigte, stand immer auf Omas Kredenz auf einem sorgfältig gestärkten Hohlsaumdeckchen aus Leinen. Oma hatte es damals in Ostpreußen noch selbst auf dem großen Webstuhl in der Stube hergestellt. Dieses einzige Andenken aus ihrer Heimat bekam sie nach dem Krieg von ihrem Bruder Fritz aus Berlin zurück, dem sie es einst zu Weihnachten geschickt hatte. Das andere Foto war eins von Evas Lieblingsbildern gewesen und hatte, zusammen mit einigen anderen, in einer bunt bemalten Holzschachtel in Omas Schrank gelegen. Darauf war Eva als junges Mädchen zu sehen, wie sie sich lächelnd an eine der schlanken Birken in einem
Eva in Schloßberg
Wäldchen ihrer Heimat lehnt. Anne freute sich, diese beiden auch von ihr geliebten Fotos wiedergefunden zu haben.
Aber der Kartenausschnitt bereitete ihr Kopfzerbrechen, denn er war in russischer Sprache beschriftet, doch Eva beherrschte kein Russisch. Der nördliche Teil Ostpreußens gehörte seit dem Kriegsende zu Russland. Auf der Karte war das jetzige Kaliningrader Gebiet abgebildet, also die Gegend um das frühere Königsberg bis hin zur litauischen Grenze, in deren Nähe Eva mit ihren Eltern und Geschwistern einst lebte. Drei Orte waren mit einem Farbstift markiert, darunter das heutige Dobrovolsk, Mutters damalige Kreisstadt Schloßberg. Wie sie das bloß herausgefunden hatte? Und noch einen vierten Farbpunkt entdeckte Anne: genau zwischen Schloßberg und der litauischen Grenze. Da hatte sie sicher ihr kleines Dorf Moosheim eingezeichnet. Doch wie war sie nur zu dieser russischen Karte gekommen? Und vor allem: Was bedeutete der ganze Inhalt des braunen Umschlags? War es vielleicht eine Botschaft für Anne, die ihr Eva nicht mehr erklären konnte oder es gar nicht gewollt hatte? Das sähe Mutter ähnlich, denn oft genug hatte die Tochter erraten müssen, was sie fühlte und dachte. Gespräche darüber waren meist schwierig gewesen. Nach Tagen des Nachdenkens gelangte Anne zu der Vermutung, dass ihre Mutter sich wünschte, sie – Anne – solle an ihrer Stelle in das ehemalige Ostpreußen fahren und dort vielleicht auch nach Spuren ihres Großvaters suchen, die sich damals mit dem Einmarsch der Roten Armee in Königsberg verloren hatten. So ließe sich das Geld erklären. Doch die Karte?
Anne grübelte wochenlang, was sie tun sollte. Schon seit Jahren ließen ihr diese blinden Flecken in der Familiengeschichte keine Ruhe. Nach der Wende hatte sie sich Bücher über Ostpreußen besorgt und die hier im Osten so lange unzugänglichen Informationen wie ein trockener Schwamm aufgesaugt. Filmaufnahmen im Fernsehen über dieses versunkene Land verfolgte sie
Großvater auf seinem Hof in Moosheim
wie gebannt und war fasziniert von der weiten, melancholisch wirkenden Landschaft mit dem hohen Himmel. Doch sollte sie es wirklich wagen, in Mutters nun fremde Heimat zu fahren? Wäre sie als Deutsche nach all den Ereignissen der Geschichte überhaupt willkommen bei den russischen Bewohnern, die jetzt dort lebten? Auch hatte sie noch die Bemerkung ihres Onkels im Ohr, dass »die Russen« dort alles »verkommen« ließen. Und dass von Mutters Dorf nach dem Krieg nichts mehr übrig geblieben war, hatte Anne ja schon erfahren. Was sollte sie da also noch finden?
Schließlich siegten Wissensdrang und Neugierde. Sie entschloss sich, Mutters Auftrag anzunehmen und in ihren eigenen zu verwandeln. Ja, Anne wollte sich selbst ein Bild von diesem früheren Land machen, das es so nicht mehr gab. Sie wollte nach Spuren ihres Großvaters forschen und, soweit möglich, all die Orte aufsuchen, an denen ihre Familie einmal war. Und sie wollte sehen, wie die Menschen heute dort leben. Ob ihr dies alles gelingen würde?
Nun war sie also unterwegs nach Russland. Doch zunächst brachte sie der Zug bis nach Bremen, wo sie von ihrem Freund Arno, einem »alten Ostpreußen«, und seiner russischen Frau Tatjana erwartet wurde. Anne war froh und dankbar, dass die beiden sie in ihrem Auto mitnahmen und sie auf diesem Weg sogar eine sachkundige Reisebegleitung bekam. Arno, der aus Evas Nachbardorf stammte und schon mehrmals im Kaliningrader Gebiet gewesen war, kannte sich mittlerweile dort recht gut aus.
Tatjana war unerbittlich und übte unterwegs mit Anne russische Konversation, und ganz langsam kamen einige Brocken vom verschütteten Schulrussisch wieder zum Vorschein.
»Du musst sprechen einfach, Grammatik nicht wichtig!«, meinte sie und nickte Anne aufmunternd zu.
Arno trug manchen Scherz zur Unterhaltung bei, und so verging die Zeit wie im Flug. Im polnischen Elblag, dem früheren Elbing, übernachteten sie. Anne konnte nicht einschlafen und versuchte sich vorzustellen, was sie in den folgenden Tagen erwarten würde. Hätte sie es gewusst, wäre sie wohl gleich mit dem nächsten Zug zurückgefahren. Oder vielleicht auch nicht?
2
Das russische Grenzregime mit all seiner langwierigen, umständlichen Bürokratie und Unfreundlichkeit war für Anne neu und recht gewöhnungsbedürftig. Obwohl so früh am Morgen nur wenige Autos vor ihnen standen, dauerte die Abfertigung über zwei Stunden. Doch dann, jenseits der Grenze, fühlte sie sich wie in einer anderen Welt. Fassungslos starrte sie auf traurige Dörfer mit oftmals verfallenen, grauen Häusern, auf riesige, versteppte Felder. Nur ab und zu waren Spuren landwirtschaftlicher Bearbeitung oder Nutztiere zu erkennen. Weit und breit nur einsame, wilde Landschaft. Worauf hatte sie sich nur eingelassen? Doch die üppig blühenden Wiesen, wenn es auch nur »Unkraut« wie Goldrute oder von Mohn gesäumte blaue Kornrade war, und dieser unglaublich hohe Himmel mit den gewaltigen, schnell dahinziehenden Wolkengebirgen entschädigten sie.
»Ja, das ist Russland …«, seufzte Tatjana, und Anne konnte im Rückspiegel ihr trauriges Gesicht sehen.
Aber dann gab es auch Erfreulicheres zu entdecken: Eine Backsteinkirche aus deutscher Zeit war sorgfältig restauriert worden und diente offensichtlich wieder Gottesdiensten. In einem anderen Ort strahlte eine neu erbaute russisch-orthodoxe Kirche mit weiß-goldenen Kuppeln in den Tag.
Gegen Abend kamen sie in dem unscheinbaren Gebietsstädtchen Krasnosnamensk an, dem früheren Haselberg, wo sie am Marktplatz von einem mächtigen, mit hellgrauer Ölfarbe gestrichenen Lenin-Denkmal empfangen wurden. Anne riss die Augen auf. Den gab es also noch, trotz Perestroika und Glasnost! Na gut, sollte Wladimir Iljitsch sie eben hier bewachen, dachte sie amüsiert. In der kleinen Pension neben der Schule begrüßte sie Swetlana, die Inhaberin, in beinahe perfektem Deutsch und umarmte sie herzlich. Anne war die Jüngste von ihnen und wurde für die nächsten Tage im gemütlichen Dachstübchen einquartiert. Auch Mareike und Manfred aus Kiel lernte sie kennen, die hier ebenfalls auf Spurensuche waren. Manfred hatte die ersten Jahre seiner Kindheit in einem Nachbardorf von Haselberg verbracht und das Haus vor zwei Jahren sogar in gutem Zustand wiedergefunden. Dann gab es auch schon ein Abendessen »wie bei Muttern«: mit kräftiger Gemüsesuppe, Fleisch, Kartoffeln und allerhand Köstlichkeiten aus dem eigenen Garten, nicht zu vergessen die gute, dicke Sahne, die sich noch als obligatorisch herausstellen sollte. Also wieder keine Chance zum Abnehmen, seufzte Anne. Und als sie den selbstgekochten dicken Obstsaft zum Nachtisch probierte, musste sie an ihre geliebte Oma denken, bei der er ganz genauso geschmeckt hatte.
»Ja, die russische Küche hier hat viel mit der ostpreußischen gemeinsam«, bestätigte Swetlana vergnügt.
Beim üppigen Frühstück am nächsten Morgen fasste Anne sich ein Herz und fragte die quirlige, aufgeschlossene Wirtin, woher all die Leute stammen, die hier nach dem Krieg angesiedelt wurden. Schlagartig wich das Lächeln aus ihrem Gesicht, und auch die anderen waren sehr ernst geworden. Anne erschrak: Hatte sie etwa ein Tabu-Thema berührt? Schnell wollte sie um Verzeihung bitten, doch Swetlana legte ihr, während sie Tee nachgoss, die freie Hand auf die Schulter.
»Nein, nein, es ist schon alles in Ordnung«, meinte sie beruhigend. Sie setzte die Kanne bedächtig ab, stützte sich mit beiden Händen auf einen freien Stuhl und berichtete.
»In diese Gegend hier kamen hauptsächlich Menschen aus dem Kursker und Brjansker Gebiet, aber auch aus anderen Orten westlich von Moskau, die im Krieg völlig zerstört worden sind. Man versprach den Leuten damals – wie sagt man? – Blaues vom Himmel, aber längst nicht alles wurde gehalten. Einige überlebten die manchmal wochenlange Fahrt im Eisenbahnwaggon mit wenig Nahrung nicht, und manche auch nicht den ersten harten Winter. Aber die Jungen heute wissen davon meist nichts mehr«, schloss sie mit einem Schulterzucken, das wohl locker wirken sollte.
Dann holte sie tief Luft und erzählte weiter: »Hier, im früheren Haselberg, war ja nicht so viel kaputt wie woanders, und so ließen die Behörden aus den zerstörten Häusern in der Umgebung Fenster, Türen, Dielen und anderes Brauchbare ausbauen, um damit in unserem Krasnosnamensk nutzbare Wohnungen zu schaffen. Die Gebäude selbst blieben aber Staatseigentum und bröckelten meist weiter vor sich hin, weil der Staat nichts zur Erhaltung tat. So blieb den Leuten oft nichts anderes übrig, als Eimer und Schüsseln unter die undichten Dächer zu stellen oder sich irgendwie anders zu behelfen.«
Ja, das kannte Anne noch gut aus DDR-Zeiten. Gerade in der mittelalterlichen Innenstadt ihres Heimatortes gab es viele ähnliche Fälle.
»Aber hier im Kaliningrader Gebiet kam noch hinzu, dass viele meiner Landsleute damals hofften, später wieder zurück in ihre alte Heimat gehen zu können und sich deshalb über Jahre und Jahrzehnte hin nur provisorisch einrichteten. Irgendwann mussten sie jedoch resigniert der Tatsache ins Auge sehen, dass ihnen ›zu Hause‹ niemand neue Häuser bauen würde, und so blieben sie hier. Besonders schlimm war das wohl für die Älteren.«
Alle schwiegen betroffen. Anne dachte daran, wie ihre Oma, Eva und viele andere Flüchtlinge und Vertriebene damals in Sachsen und anderswo unter ähnlich schweren Bedingungen ganz von vorn anfangen mussten. Hier wie dort das gleiche Schicksal! Das war ihr bisher noch gar nicht so bewusst geworden.
Einer plötzlichen Eingebung folgend, holte Anne den braunen Umschlag aus ihrem Rucksack und legte den russischen Kartenausschnitt aus dem Nachlass ihrer Mutter Eva auf den Tisch. Bis heute war er ihr rätselhaft geblieben. Sie betrachtete ihn erneut, und ihr Blick blieb an der farbigen Markierung von Krasnosnamensk, dem früheren Haselberg, hängen. Dieser dick gemalte Kreis wies ja eine ganz andere Farbe auf als die Punkte, die ihre Mutter eingezeichnet hatte! Er könnte also auch von jemand anderem stammen. Wieso war ihr das nicht schon früher aufgefallen? Mit einem Schlag war es so, als ob sich eine Nebelwand in Annes Gehirn auflöste: Die Karte war aus dem letzten Brief von Valeri! Ein freudiger Schreck durchzuckte sie, und Annes Gedanken wanderten langsam zurück. Sie sah sich wieder als 13-jähriges Mädchen und dachte an ihren russischen Brieffreund, der damals hier in Krasnosnamensk lebte und ein Jahr älter war als sie. Seine Adresse hatte sie von ihrer Pionierleiterin erhalten. Derartige Brieffreundschaften mit sowjetischen Pionieren oder Komsomolzen waren damals in der DDR üblich und wurden seitens der Schule gefördert. Aber für Anne war es keine Pflicht, ihr machte das Übersetzen Freude. Viele Briefe, Karten und Bilder gingen hin und her. Anne hatte sogar ein Foto von Valeri, auf dem er sie mit seinen dunklen Augen unter dem gewellten, schwarzen Haar etwas schüchtern anlächelte und das sie ganz toll fand. Daran konnte sie sich noch heute genau erinnern. Sie schmunzelte bei dem Gedanken, dass dieses Bild lange Zeit auf ihrem kleinen Bücherregal gestanden hatte und ihren Freundinnen stets Anlass für gutmütigen Spott gewesen war.
Eines Tages schickte Valeri einen Kartenausschnitt der Umgebung seines Heimatortes, den Anne ihrer Mutter Eva zeigte. Sie stutzte, ließ sich von der Tochter die russischen Begriffe vorlesen und erkannte schließlich das Flüsschen Szeschuppe, das man erstaunlicherweise nicht, wie alles andere, umbenannt hatte. Sie erklärte Anne kurz, dass sie früher, vor dem Krieg, dort ganz in der Nähe gewohnt hatte. So konkret hörte Anne das damals zum ersten Mal. Stolz und voller Freude über diese Gemeinsamkeit, die sie ja nun mit Valeri verband, teilte Anne ihm ihre neuen Erkenntnisse mit, mühsam im Wörterbuch zusammengesucht. Dann wartete sie gespannt auf Antwort, eine lange Zeit. Sonst hatte er immer am Schluss seiner Briefe geschrieben: »Ich warte auf Antwort wie die Schwalbe auf den Sommer«, und nun ließ er sie so lange warten? Monatelang hoffte Anne immer noch auf eine Nachricht, doch der Brief mit dem Kartenausschnitt sollte der letzte bleiben, und Anne war traurig und verständnislos mit ihren Fragen allein. Jetzt gingen ihr Vermutungen durch den Kopf: Hatten Valeris Eltern oder Großeltern ihm verboten, ihr weiter zu schreiben? Einem Kind von den Deutschen, die zuerst ihre alte Heimat in Russland zerstört hatten und dann vielleicht irgendwann einmal ihre jetzigen, ehemals deutschen Häuser zurückfordern könnten?
Arno holte Anne mit einer scherzhaften Bemerkung in die Gegenwart zurück, und sie erzählte den anderen die Geschichte vom Ende ihrer Brieffreundschaft. Wieder trat Stille ein, jeder hing seinen Gedanken nach. Was wohl aus Valeri geworden war? Schließlich fragte Swetlana, ob Anne den Familiennamen und die Straße ihres Brieffreundes noch wisse. Aber sie konnte sich nur an seinen Namen erinnern: Valeri Wlassow.
Auf Swetlanas Stirn erschienen tiefe Falten, bevor sie zögernd meinte: »Ich könnte es ja mal versuchen und meine Beziehungen spielen lassen. Vielleicht bekomme ich wenigstens einen Hinweis darauf, wo er jetzt wohnt, aber versprechen kann ich nichts!«
Anne freute sich. Doch ob Swetlanas Bemühungen Erfolg haben würden? Wohl kaum.
3
Arno hatte Anne angeboten, mit ihr zusammen eine Fahrt in Richtung Moosheim, dem damaligen Heimatdorf ihrer Familie, zu unternehmen. Tatjana begleitete inzwischen Mareike und Manfred als Dolmetscherin, da die beiden im Westen Deutschlands ja nicht in den verordneten Genuss eines obligatorischen Russischunterrichts gekommen waren.
Swetlana hatte Arno zwar gewarnt, dass »dahinten« größtenteils gesperrtes Armeegelände sei und man da lieber nicht herumfahren sollte. Arno lächelte überlegen: Das wolle er erst einmal selbst erkunden. Immerhin sei er hier schon mehrmals in den vergangenen Jahren gewesen und kenne sich aus, meinte er zu Anne. Doch er bemerkte ihren ängstlichen Blick und versprach, sofort bei einem Warnschild oder irgendetwas Verdächtigem umzukehren. Um zu ihrem Ziel zu gelangen, mussten sie durch Dobrovolsk, das ehemalige Schloßberg, fahren. Gleich nach dem Ortseingangsschild landeten sie auf dem weiten, fast leeren Marktplatz, der von einem riesigen russischen Ehrenmal bestimmt wurde. Anne war entsetzt, obwohl sie durch Fotos in einigen Büchern vorgewarnt war: Das sollte Mutters Kreisstadt gewesen sein, von deren Schönheit und Lebendigkeit sie manchmal erzählt hatte?
Aber Arno winkte ab, denn heute hatten sie ein anderes Ziel. Er bog in die frühere Schirwindter Straße ein, die über das alte Kirchdorf Willuhnen bis zur litauischen Grenze geführt hatte. Zunächst war die Straße noch gut, und sie fuhren in gemäßigtem Tempo an einigen älteren, teils auch neueren einfachen Häuschen vorbei, meist mit einem kleinen Garten davor. Arno machte Anne auf den Ziegeleiteich rechterhand aufmerksam, der zwischen den Bäumen am Ufer zu erkennen war. Aber sie hatte jetzt für nichts anderes Interesse, sie wollte zuerst nach Moosheim und zum Willuhner See. Ob ihnen das gelingen würde? Gespannt holte Anne einen Ausschnitt des Messtischblatts von Moosheim, das bis 1938 Jodeglienen geheißen hatte, aus ihrem Rucksack hervor. Viele Orte, deren Namen nicht »deutsch« genug klangen, wurden damals unter Hitler umbenannt. Und ein Großteil von ihnen existiert seit Kriegsende überhaupt nicht mehr, wurde dem Erdboden gleich gemacht, verschwand einfach von der Landkarte.
Bald reihte sich ein Schlagloch an das andere, immer größer und tiefer werdend, sodass ein Ausweichen kaum noch möglich war.
Ein Rest Pflasterstraße – einzige Erinnerung an Willuhnen
Arno stöhnte jedes Mal, so als ob er die »Schmerzen« seines Autos selbst spüren würde. Einen tröstlichen Anblick bot das kurze Stück der noch übrig gebliebenen Lindenallee, wenn sie auch längst nicht mehr so dicht war wie damals, als Eva im Sommer täglich mit dem Fahrrad durch ihren geliebten »grünen Tunnel« rollte. Annes Herz klopfte immer schneller. Wie weit war es noch? Bisher hatte sie zum Glück niemand aufgehalten. Mittlerweile standen nur noch vereinzelt Bäume am Wegrand. Aus Berichten von Zeitzeugen wusste Anne, dass es kurz vor dem früheren Abzweig nach Moosheim Reste der alten Pflasterstraße von Willuhnen geben musste. Da! Hier waren sie zu sehen! Nach wenigen Metern versuchte Arno, das Auto so dicht am Straßenrand wie möglich abzustellen.
Aufgeregt sprang Anne aus dem Wagen und sah sich um. Hier war es beinahe gespenstisch still, nicht einmal Vogelgezwitscher konnte man hören. Ein unheimliches Gefühl beschlich sie, und ängstlich sah sie zu den respekteinflößenden Panzerspuren hinüber, die den gegenüberliegenden Weg für Fußgänger unpassierbar gemacht hatten. Was, wenn sie hier auf Militär treffen würden? Weit und breit kein Mensch, der ihnen helfen konnte! Und ob man in dieser Einöde Handy-Empfang haben würde, um notfalls Swetlana anzurufen, war auch äußerst ungewiss. Aber Arno beruhigte Anne. Er erklärte ihr, dass dieser Schlammpfad da drüben wohl in die Richtung des früheren Dorfes Bühlen führen musste. Den Weg nach Moosheim gäbe es nicht mehr, wahrscheinlich sei er längst zugewachsen. Ja, irgendwann holt sich die Natur alles zurück.
Also würde Anne gar nicht dort stehen können, wo einmal Moosheim war? Wo Großvater mit den Worten »Nu wachst man, Gott’s Nomke!«, was so viel wie »in Gottes Namen« hieß, über die kleinen Felder ging? Wo er später die Sense schwang und Oma Brot buk? Wo ihre Mutter laufen lernte und auf den hohen Kirschbaum kletterte? Und wo ihr geliebtes Großvater-Foto entstand, das ursprünglich nicht halbiert war und auch Oma zeigte … Anne spürte einen Kloß im Hals und fühlte sich wie nach einem K.-o.-Schlag. Fragend sah sie, mit der Karte auf das Gelände weisend, zu Arno hinüber, der jedoch energisch den Kopf schüttelte.
Tapfer schluckte sie die Enttäuschung herunter und versuchte, sich von Ferne ganz auf dieses kleine, geschundene Stückchen Erde zu konzentrieren, das da vor ihr lag: eine von Büschen, hüfthohem Gras, blühenden Goldrutenflecken und blauer Kornrade durchzogene Wiesenlandschaft. Sie träumte sich ein ganzes Stück in diese wilde Natur hinein und stellte sich wenigstens vor, wie ihre Großeltern hier mit der Familie und ihren Nachbarn friedlich zusammenlebten, wie sie durch ihre Arbeit Spuren in der Erde hinterlassen hatten, auch wenn man sie heute nicht mehr sehen konnte. Im Gedächtnis der Schöpfung waren sie gewiss nicht verloren. Es machte Anne jedoch traurig, dass es hier, wo ihre Vorfahren einst lebten und auch ihre Wurzeln lagen, überhaupt kein menschliches Leben mehr gab und dass niemand diese fruchtbare Erde nutzte. Sie blickte in die verwilderte und reich blühende Landschaft, die jetzt in der Sonne, allen Tatsachen zum Trotz, ein unbeschreiblich schönes und friedliches Bild bot.