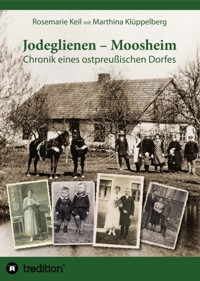2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wirkliche Strickmuster findet man in diesem Buch natürlich nicht. Es geht eher um Lebensmuster einzelner Menschen: selbst entworfen oder von Schablonen im jeweiligen Zeitgeist vorgegeben. In Geschichten, Erinnerungen, Gedichten und Träumen lässt die Autorin ein ganzes Jahrhundert lebendig werden. Teils ernst und nachdenklich, teils heiter und mit Humor "strickt" sie aus ihrem eigenen "Lebensgarn" und dem ihrer Vorfahren. Viele dieser Texte spiegeln anhand konkreter Schicksale ein Stück Zeitgeschichte der Stadt Freiberg und der umgebenden Region wider.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rosemarie Keil
Ich strick mir einenSchal aus Zeit
Geschichten und Erinnerungen
Für meine Familie,für Freunde und Weggefährten
Rosemarie Keil
Ich strick mir einenSchal aus Zeit
Geschichten und Erinnerungen
Inhalt
So eine Art von Glück – Statt eines Vorworts
Verwurzelt und verwoben
Halb zwölf in der Rinnengasse
Vier Jahre alt
Kindheit
Sommer-Waschtag
Kinderglaube
Rauchzeichen
An einem Samstag im Oktober
Die Feier „Vor dem Meißner Tor“
Das Tischgeheimnis
Altstadtabend
Es war ein Land
Die Tür zum Nichts
Das Bild meines Großvaters
Ende eines Sommers
Die Gans
Das Auszeichnungsfoto
Kindheitsbilder
Omas Spruch über der Kommode
Katjas letzter Brief
Großmutters Teller
Der Platz am Fenster
Novembertag
Großmutter
Getragen vom Fluss der Zeit
Albträume
Ost-West-Gardinchen
Vernissage oder „Des Kaisers neue Kleider“
Malheur im Eiffelturm
Ein stürmischer Tag
Das Geburtstagsecho
Eine Lektion im Muskauer Park
„Wenn Sie Geld brauchen“ oder: Szenen einer Ehe
Auf der Brücke
Frühlingserwachen
Im Schlaraffenland
Die alte Linde
Schneider-Gustavs Haus
Meine Zeit steht in deinen Händen
Das Zeit-Los
Aus Zeit
La dolce vita
Aus meinem italienischen Reisetagebuch
Von Café au lait und französischen Betten
Ein Gläschen Wein
Provence
Wasser und Stein
Lieber Kohelet
Fast zu schön
Mitten im Sommer?
Septembertag
Die Sandbank
Verwunschene Zeit
Provençialischer Markt
Glücksmoment
Im Weihnachtsland
Stollenbacken
Die schönsten Päckchen
Unser Weihnachtsbaum
Vom Heiligen Christ mit „Muh“ und „Mäh“
Die andere Weihnachtsgeschichte
Der Tag vor Heiligabend
Weihnachtskonzert in der Betstube von „Alt Elisabeth“
Dank
Über die Autorin
Man muss das tun im Leben,
was kein anderer für einen tun kann.
Edwin E. Dwinger
Woran man sich erinnert,
das kann nicht verloren gehen.
Siegfried Lenz
So eine Art von Glück – Statt eines Vorworts
Schon seit Tagen hatte sie nach den richtigen Worten gesucht. Ganz gleich, was sie tat: Ihre neue Geschichte hielt sie fest umklammert. Immer wieder probierte sie in Gedanken diesen oder jenen Satz, aber als Einstieg schien ihr bisher keiner geeignet.
Jetzt war es mitten in der Nacht, doch das dumpfe Wort-Chaos in ihrem Kopf hielt sie immer noch wach. Das fahle Licht der Laterne vor dem Fenster erinnerte sie an irgendetwas. Sie spürte, dass es mit ihrer Geschichte zu tun haben musste, aber was nur, was …
Und dann, ganz langsam, verzogen sich die Nebelfetzen in ihrem Kopf. Nun kamen Worte zum Vorschein: ihre Worte!
Sie sprang aus dem Bett, suchte ungeduldig nach einem Stift und Papier. Die altbekannte Angst trieb sie, dass dieser Satz wieder im Dunkel der Nacht verschwinden könnte, bevor er auf dem Papier stand, so wie es ihr schon manchmal ergangen war. Sie hatte sich eilig eine Jacke übergeworfen und saß nun im Schein des kalten Laternenlichts. Ihre Lampe wollte sie nicht einschalten, um diese geheimnisvolle Atmosphäre nicht zu zerstören.
Und nun schrieb sie. Die Finger konnten dem Tempo ihrer Gedanken kaum folgen. Dann stand er da, ihr erster Satz; so, wie sie ihn sich vorgestellt hatte. Plötzlich, wie von Zauberhand geführt, flog der Stift weiter über das Blatt. Der zweite, der dritte und auch der vierte Satz, alles fügte sich zu einem harmonischen Ganzen. Endlich ließ sie den Stift sinken und atmete erleichtert auf. Ihr Herz hüpfte freudig in einem schnelleren Takt, und die Grübelfalten auf der Stirn waren auf einmal verschwunden. Für einen Moment huschte ein glückliches Lächeln über ihr Gesicht.
Ja, so könnte es gehen.
Verwurzelt und verwoben
Familiengeschichten
Halb zwölf in der Rinnengasse
Nein, mit dem Glockenschlage zwölf, so wie Goethe, bin ich nicht geboren; aber doch immerhin halb zwölf. Jener 12. Februar 1951, ein Montag, muss ein frostklirrender, schneereicher Tag in Sachsen gewesen sein; so ziemlich der einzige „Reichtum“, den meine Eltern als kleine Verwaltungsangestellte im Rathaus damals hatten.
Sie wohnten zur Untermiete bei Frau Müller, einer netten, alten Dame, im 1. Stock der Freiberger Rinnengasse 1, unweit des Obermarktes. Die beiden Zimmer lagen zur Straße zu: Das eine hatte zum Heizen nur einen Herd und wurde deshalb im Sommer als Wohnküche genutzt; das andere, kleinere, war sogar mit einem Kachelofen gesegnet und winters das Wohnzimmer. Das Leben in diesen beiden Räumen muss sehr unruhig gewesen sein, denn zweimal im Jahr hieß es: mit Sack und Pack umziehen! Nämlich mit Winterbeginn von der Küche ins Schlafzimmer und vom Schlafzimmer in die Küche – nur der Öfen wegen.
Mein Geburtszimmer war, aufgrund des Herdes, die eigentlich schlechter beheizbare Küche, aber es wurde ja genügend heißes Wasser gebraucht. Meine Tante Hanni, Vaters Schwester, war schon seit dem Vorabend da. Sie holte dann, als es langsam „ernst“ wurde mit mir, in Windeseile die Hebamme, Frau Felgner, von der Annaberger Straße und dann unsere „kleine Oma“ aus ihrem sehr bescheiden eingerichteten Dachstübchen in der Schmiedestraße. An ein Telefon in der Wohnung oder wenigstens in der Nachbarschaft war damals noch nicht einmal zu denken. Ich sehe meine ostpreußische Oma Emma vor mir, wie sie mit ihren kurzen, krummen Beinen an Tantes starkem Arm durch die verschneite Eherne Schlange Richtung Innenstadt schaukelt; ihr einziges reinwollenes Kopftuch von Bruder Fritz aus Westberlin tief in die Stirn gezogen und unterm Kinn geknotet. „Gott’s Nomke“, wird sie wohl vor sich hin gemurmelt haben, denn schließlich wurde sie zum ersten Mal Oma. Diese Worte sollte ich später noch oft von ihr hören.
Mein Vater Heinz wurde kurz vor dem entscheidenden Moment energisch von der Bildfläche verbannt und ins Nebenzimmer abkommandiert. Schließlich war das hier jetzt reine Frauensache! Womit er sich da wohl die Zeit vertrieben hat? Vielleicht saß er, nervös mit den Fingern trommelnd, auf dem alten, kippligen Nussbaumstuhl; eingeklemmt zwischen Schrank und Fensterbrett, das man seiner Tiefe wegen so wunderbar als Tisch benutzen konnte. Später verbrachte ich hier unzählige Stunden in meinem zum x-ten Mal reparierten und von Großvater Otto neu gestrichenen Hochstühlchen, während ich begeistert mit Muttis Knopfsammlung spielte. Aber noch war es nicht so weit …
Nach Stunden schließlich durfte Vater mich, blitzeblank und mit schwarzen, zur „Sahnerolle“ hochgebürsteten Haaren, endlich in meinem rüschenbesetzten Steckkissen bewundern und natürlich auch zum ersten Mal fotografieren. Dann machte er sich schnurstracks mit seinem hölzernen Gehstock auf den Weg zum kleinen Blumenladen um die Ecke auf der Petersstraße und ergatterte doch tatsächlich einen Alpenveilchentopf, den er meiner Mutter Eva stolz überreichte. Mir gefielen diese Blumen wohl nicht so sehr: Ich brüllte. Noch Jahre und Jahrzehnte später konnte ich mich für Alpenveilchen kaum begeistern, da sie mir Jahr für Jahr, nur etwas in der Farbschattierung variierend, als „Überraschung“ auf dem Geburtstagstisch präsentiert wurden. Gebrüllt habe ich da bei ihrem Anblick allerdings nicht mehr, höchstens ganz leise und heimlich geseufzt. Wie sehr genieße ich es dafür jetzt, wenn an meinem Geburtstag Wohnzimmer und Diele zu einem richtigen kleinen Frühlingsgärtchen werden, und wenn es nach Narzissen, Hyazinthen und Fresien duftet! Im Februar 1951, und noch dazu im Osten Deutschlands, absolut unvorstellbar.
Am 13. Mai des gleichen Jahres allerdings war unsere erste kleine Wohnung in der Rinnengasse, dank Frau Müllers Beziehungen, üppig mit roten Rosen geschmückt, extra für Rose marie! An diesem Tag wurde ich in der Kirche St. Petri zu Freiberg getauft. Für die Bowle zur Feier erstanden meine Eltern im kleinen Gemüseladen am Obermarkt „unter dem Ladentisch“ zwei Flaschen Mehrfruchtwein. Auf die Frage des Verkäufers, ob er sie zum Transport in Zeitungspapier einwickeln solle, antwortete mein Vater, dass dies unnötig sei, denn sie hätten den Wagen draußen. Der Verkäufer „dienerte“ daraufhin meine Eltern ehrfürchtig bis zur Tür. Wenn er gewusst hätte, dass „der Wagen“ nur mein alter, hochrädriger Kinderwagen war!
Als Taufpaten wurden die Geschwister meiner Eltern eingeladen: von Vaters Seite Tante Hanni, von Seiten meiner Mutter Tante Heta, Onkel Erich und Onkel Horst. Mutters Bruder Horst war extra aus dem Westen, aus Wuppertal, über die „Zonengrenze“ angereist. Für den festlichen Anlass bekam ich ein feines, gesmoktes Kleidchen, das Mutti selbst genäht hatte. Dieses Unikat wäre heute wieder ganz modern!
Meinen Taufspruch habe ich übrigens erst 1997 selbst gelesen, als ich mir für meine bevorstehende Konfirmation ein Duplikat der Taufurkunde ausstellen ließ. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Mein Taufspruch steht in Psalm 143, Vers 10:
Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott.
Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad.
Über diesen Spruch und meinen bis heute bei weitem nicht immer ebenen Lebenspfad lohnt es sich, einmal in Ruhe nachzudenken und einiges dazu aufzuschreiben. Damals, zur Taufe, ging es mit den ersten kleinen „Unebenheiten“ schon los, denn Pfarrer Spranger wollte mich doch tatsächlich als Heinz Erich (wie mein Vater hieß) taufen! Aber alle Verwandten müssen ihn vereint wohl so entsetzt angestarrt haben, dass er seinen Irrtum erschrocken bemerkte und korrigierte. Und so durfte ich doch Rosemarie bleiben.
Vier Jahre alt
Von meinem vierten Geburtstag an bekam ich von unserer „Oma mit Brille“, der Mutter meines Vaters, jeden Monat
eine kleine „Rente“: zunächst eine Mark, in späteren Jahren dann bis zu zwanzig Mark. Das war nur möglich, weil Oma wegen ihrer schlechten Augen eine etwas höhere Rente bezog. Ich war unheimlich stolz auf meine Reichtümer, aber auch ein wenig traurig, da das Geld in gewissen Zeitabständen auf mein Post- sparbuch eingezahlt wurde. Dort war es für mich ja zunächst ein- mal verschwunden. Erst ein paar Jahre später, als ich fast schon zu groß dafür war, konnte ich mir damit einen Kindertraum er- füllen und einen Luftroller kaufen: chromglänzend, rotgeflammt und mit schwarzem Ledersitz. Leider befand sich dieser Sitz fest verschraubt über dem Hinterrad und ließ sich nicht hochklap- pen wie der meines Freundes Hans-Jürgen. Dafür hatte das Geld nicht gereicht. Aber immerhin brauchte ich mich nun nicht mehr vorn auf das Trittbrett seines Rollers zu hocken, um mitfahren zu können, sondern konnte selbst in unserem Viertel umhersausen.
Meine andere Oma, genannt „die kleine Oma“, bekam nur Mindestrente. Ihr Rentenzahltag ist mir noch heute als ein kleines Fest in Erinnerung. Am frühen Vormittag zogen wir beide los zum Rathaus, wo im Kultursaal die Rente ausgezahlt wurde. Gemeinsam reihten wir uns in die Schlange vor dem Schalter Familiennamen SCH ein, zählten die wenigen Scheine und die Münzen aus Aluminium nach und verstauten alles sorgfältig im abgeschabten, braunen Portemonnaie.
Und dann kam das Schönste: In erwartungsvoller Vorfreude lief ich mit Oma schräg über den Obermarkt zum Spielzeuggeschäft „Flax und Krümel“. Bei dieser Namensgebung hatten zwei beliebte DDR-Fernsehfiguren der 1950er- und 60er-Jahre Pate gestanden. Wir besaßen zwar damals zu Hause kein Fernsehgerät, aber zu Kindersendungen lud mich Hans-Jürgens Familie, die über uns wohnte, oft ein. Im „Flax und Krümel“ durfte ich mir am Rententag immer eine Kleinigkeit aussuchen: ein Malheft, Luftballons, bunte Murmeln, einen Ausschneide-Bastelbogen oder einen neuen Kreisel für das Spielen vor unserem Haus. Mit Vorliebe wählte ich solche Dinge, mit denen ich noch lange etwas anfangen konnte. Als weiteren Höhepunkt des Tages kochte mir Oma eines meiner Lieblingsgerichte: Plinsen (Oma sagte in ihrer ostpreußischen Mundart Flins), Apfelklöße (Äppelkielkes) oder Kartoffelbrei mit Spiegelei. Und zum nachmittäglichen „Blümchen-Kaffee“ (Malzkaffee) gab es selbstgebackenen Kuchen, mitten in der Woche!
Ob es wohl heute in unserem Land noch viele Kinder gibt, die solch kleine Feste kennen und zu schätzen wissen? Ich habe da so meine Zweifel. Es muss ja meist alles im Überfluss geben und ist nie gut, schön, schnell oder groß genug. Freunde erzählen oft, dass sie gar nicht mehr wüssten, womit sie ihren Enkeln noch eine Freude machen könnten; sie hätten ja schon alles. Schränke und Regale im Kinderzimmer platzten aus allen Nähten.
Apropos Schränke. Da drängt sich mir gerade eine Frage auf, die mich schon oft beschäftigt hat: Brauche ich all die vielen Dinge, die ich im Laufe der Zeit angehäuft habe? Da war es in meiner Kindheit doch wesentlich übersichtlicher bei uns zu Hause!
Kindheit
Kindheit ist wie
ein nie versiegender Märchenbrunnen,
aus dem man sein Leben lang schöpfen kann.
Doch man muss darüber wachen,
dass ihn niemand zuschüttet.
Denn dann erlischt der Zauber,
und die Welt wird ärmer und kälter.
Sommer-Waschtag
Vor kurzem fiel bei uns ohne Vorwarnung der Strom aus, und ich hatte gerade jede Menge Wäsche in der Maschine und im
Trockner! Was nun? Musste ich mich etwa per Hand abmühen, um alles sauber und trocken zu bekommen? Zum Glück konnte der Schaden nach einigen Stunden behoben werden, und aus mei- nem Keller tönte wieder ein munteres Rumpeln und Brummen. Dankbar empfand ich es jetzt sogar fast wie Musik.
Während ich erleichtert die Treppe wieder hinaufstieg, tauchten plötzlich Erinnerungen an meine Kindheit vor mir auf. Damals habe ich noch Waschtage wie aus einem alten Bilderbuch kennengelernt: mit Waschbrett, Wringmaschine und Mentrus, einem langen, stabilen Holzstab. Vielleicht hat meine ostpreußische Oma diesen Begriff aus ihrer Heimat mitgebracht, denn hier kennt ihn wohl niemand, nicht einmal „Herr Google“. Alle sechs Wochen schrieb sich jede Familie aus unserem Haus für drei Tage in den Waschhaus-Kalender ein. Dazu gehörte auch, dass man den Bleichplan, so hieß die Wiese zum Bleichen und Trocknen der Wäsche, und bei schlechtem Wetter den Dachboden benutzen durfte. Alles musste schließlich seine Ordnung haben, wie es schon immer war.
In den Sommermonaten waren die Waschtage stets ein kleines Fest für mich. Am Abend vor dem eigentlichen Beginn wurde die Wäsche in großen Holz- und Zinkwannen mit einem speziellen Pulver eingeweicht und mit dem Stamper ab und zu untergestukt (untergetaucht), wie Oma in ihrer Mundart immer sagte. In jenen Jahren half sie uns meist bei der großen Wäsche.
Der Stamper heißt eigentlich korrekt Stampfer, aber das sagte man wahrscheinlich weder in Ostpreußen noch in Sachsen. Diese Hilfsmittel gab es in verschiedenen Formen, wobei unserer sehr einfach war: eine Art hohler Kegel aus Zinkblech mit einem langen Holzstiel zum Anfassen. Heute kann man so ein Teil bei Ebay als „antike Vintage Deko“ bekommen, mit empfohlenem Verwendungszweck als Toilettenpapier-Halter! Doch zurück in die Mitte der 50er-Jahre.
Am richtigen ersten Waschtag wollte ich, so wie alle, schon um fünf Uhr aufstehen und war maßlos empört, wenn mich die Großen länger schlafen ließen. So hatte ich doch bereits eine Menge verpasst! Schnell schlüpfte ich in meine kleinen Gummistiefel und rannte auf den Bleichplan. Das war eine etwas erhöht gelegene Wiese in unserem Hof hinter dem Haus, die nur für die Wäsche benutzt werden durfte. Dort zu spielen war für uns Kinder völlig undenkbar: Da hätten wir ja das Gras zertrampelt!
Aber zum Waschtag durfte ich hinauf. Also lief ich eilig zu meinem kleinen, schon bereitstehenden Wäschekörbchen mit den aus der Einweichlauge herausgefischten Geschirr- und Taschentüchern. Die legte ich nun ausgebreitet, fein säuberlich in Reih und Glied, auf den Rasen. Das war gar nicht so einfach, denn ich musste daran denken, Gänge zu lassen, durch die ich später zum Begießen der Tücher entlanglaufen konnte. Gegossen wurde mit dem Schlauch oder einer Gießkanne. So, nun musste die Sonne kräftig scheinen und alle Flecken aus der Wäsche herausziehen. Eifrig goss ich immer wieder und war manchmal selbst klitschenass. Dann kam Mutti mit ihren schweren Holzklumpern angeklappert, einer Art Pantoffeln mit dicker Holzsohle, und beorderte mich gleich zum Umziehen.
Wenn die Wäsche lange genug in der Sonne gelegen hatte, wurde sie wieder eingesammelt und in den großen, gemauerten Waschhauskessel zum Kochen gesteckt. Darunter prasselte schon ein munteres Feuerchen. Manchmal, wenn es schwül war und der Schornstein nicht richtig zog, qualmte es furchtbar. Wir mussten alle husten und rochen wie die Räuchermännchen zu Weihnachten.
Nach dem Kochen wurde die heiße Wäsche mit dem Mentrus aus dem Kessel geangelt und, falls nötig, noch auf dem Waschbrett geschrubbt. Kein Wunder, dass Muttis Fingerknöchel oft ganz wund gescheuert waren. Nach dem Waschbrett trat an der ersten Wanne mit kaltem Wasser der Stamper in Aktion, und hier war endlich wieder eine Aufgabe für mich. Mit aller Kraft erfasste ich den dicken Holzstiel und stampfte auf die Wäsche ein, dass es nur so schwabbte. Zum weiteren Spülen wanderte sie anschließend mittels Mentrus-Stab von einer Wanne zur nächsten.
Zum Schluss war die Wringmaschine an der Reihe, die meist von Oma gedreht wurde. Eigentlich war das ja gar keine richtige Maschine, sondern ein Apparat aus Walzen und einer Kurbel, der das Wasser aus den Wäschestücken herauspressen sollte. Mir gab es immer Spaß zu sehen, wie die „steifen Männeln“ zwischen den Rollen zum Vorschein kamen, wo ich sie abnehmen und in den Korb legen durfte. Jetzt waren sie ja längst nicht mehr so schwer.
Aufgehängt wurde meist erst am nächsten Tag. Ich bekam auf halber Höhe zwischen den Wäschepfählen auch eine Leine gespannt, wo ich ganz allein alle Taschentücher der Familie und meine Puppenwäsche aufhängen durfte. Vor lauter Stolz war ich bestimmt zwei Zentimeter größer! Wenn wir Glück hatten und