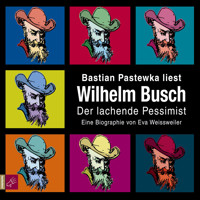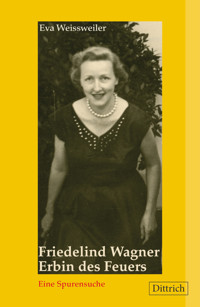
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
riedelind (geboren 1918), Tochter von Siegfried Wagner, gilt als das schwarze Schaf der Familie und Widerständlerin des Wagner-Clans. Als aufsässiges Kind von ihrer Mutter Winifred mehr gehasst als geliebt, wurde sie in strenge Internate und Diätkliniken abgeschoben. Doch Friedelind ließ sich nicht abschrecken und bildete sich zur Expertin für das Werk ihres Vaters und Großvaters Richard heran. Im selbst gewählten amerikanischen Exil schrieb sie ihren autobiographischen Schlüsselroman »Nacht über Bayreuth«, der die gesamte musikalische Welt in Aufruhr versetzte und ihre Mutter Winifred im Spruchkammerverfahren schwer belastete. 1953 kam Friedelind zum ersten Mal wieder nach Deutschland und zu den Festspielen. Neun Jahre lang betrieb sie mit einem Kreis hochkarätiger Dozenten die »Bayreuther Festspiel-Meisterklassen«. Nach dem Tod Wieland Wagners im Jahr 1966 eskalierte der Streit mit ihrem Bruder Wolfgang, der den Meisterklassen ein Ende machte und sie selbst aus dem Festspielhaus warf. Nach Stationen in England und der Schweiz starb sie 1991 in Deutschland. Eva Weissweilers akribisch recherchiertes Buch – basierend nicht nur auf Quellen, sondern auch zahlreichen Interviews mit Zeitzeugen – zeichnet ein differenziertes Bild von Friedelind Wagner als einer mutigen und kompromisslosen Frau, aber auch einer höchst kontroversen Persönlichkeit. Sie deckt zahlreiche Widersprüche auf und formuliert offene Fragen. Die Autorin initiierte 1994 den Reprint von Friedelinds seinerzeit praktisch verschollener Autobiografie »Nacht über Bayreuth«. Die vorliegende Biografie, zumindest für den Zeitraum bis 1940, kann auch als kommentierte Auseinandersetzung mit »Nacht über Bayreuth« gesehen werden. »Weissweilers akribisch recherchiertes Buch, das nicht nur auf Quellen, sondern auch auf zahlreichen Interviews mit Zeitzeugen basiert, zeichnet das differenzierte Bild [...] einer höchst kontroversen Persönlichkeit.« Bayern 4 Klassik »Spannend zu lesende Lektüre!« hr 2 Kultur - Fidelio
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Weissweiler
Erbin des Feuers
Eva Weissweiler
Erbin des Feuers
Friedelind Wagner
Eine Spurensuche
Neuausgabe 2023
Mit neuem Vorwort der Autorin
© Dittrich Verlag ist ein Imprintder Velbrück GmbH, Weilerswist-Metternich 2023
Printed in Germany
ISBN 978-3-910732-11-7
eISBN 978-3-910732-16-2
Covergestaltung: Helmi Schwarz-Seibt, Leverkusenunter Verwendung einer Abbildung
© Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth
Erstauflage © 2013 by Pantheon Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Neuausgabe
Vorwort zur Erstauflage
ERSTES KAPITEL
Siegfrieds Tochter
ZWEITES KAPITEL
Störenfriedelind
DRITTES KAPITEL
Liebe und Hass
VIERTES KAPITEL
Ein Entschluss reift
FÜNFTES KAPITEL
Exil und Krieg
SECHSTES KAPITEL
Im Niemandsland
SIEBTES KAPITEL
»Draußen vor der Tür«
ACHTES KAPITEL
»Flucht ohne Ende«
Danksagung
ANHANG
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Personenregister
Stammtafel
Vorwort zur Neuausgabe: Die ewig Unbequeme
Juli 2023. Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Wie in schönsten Friedenszeiten waren sie alle wieder da: Angela Merkel im türkisen Seidenkostüm am Arm ihres Ehemannes Joachim Sauer, Ursula von der Leyen in königsblauem Plissee, zwei prominente Tatort-Ermittlerinnen, der bayrische Ministerpräsident, wahrscheinlich alle mit Frei- oder Ehrenkarten, denn schon allein die zum optischen Vollgenuss des »Parsifal« benötigte Augmented Reality Brillen konnte sich kaum ein normaler Sterblicher leisten, weshalb auch nicht alle Plätze ausverkauft waren.
Vor hundert Jahren, im Juli 1923, stand das Festspielhaus seit fast einem vollen Jahrzehnt leer. Das Kriegsende war noch nicht lange her. Dann war kein Geld da. Stattdessen: Rasende Inflation, bittere Not. Ein Pfund Brot kostete 1.254 Mark, eine Eisenbahnfahrt von Köln nach Berlin 924.000 Mark. Aber trotzdem fand noch im gleichen Jahr ein junger Mann namens Adolf Hitler den Weg nach Bayreuth, um in der markgräflichen Reithalle zu sprechen und die Familie des von ihm verehrten Meisters zu besuchen, ein wenig linkisch wirkend in seinen Lederhosen und der etwas zu kurzen Jacke. Es war der 30. September, auch als »deutscher Tag« bekannt, eine Erfindung völkisch-nationalistischer Kreise. Turn- und Gesangvereine, Studentenverbindungen und die SA waren angerückt. Hitler wurde mit nicht enden wollenden Heilrufen empfangen. Auch die fünfjährige Friedelind war tief beeindruckt, nicht ahnend, wer dieser »Onkel Wolf«, so sein Kosename, eigentlich war.
Erst im folgenden Jahr konnten die Festspiele wieder stattfinden. Hitler war allerdings nicht dabei. Er saß wegen seines Versuches, die Republik zu stürzen, in der Festung Landsberg am Lech, wohin Winifred, Friedelinds Mutter, ihm Papier, Bleistifte, Federn und Tinte geschickt hatte, sodass er in aller Ruhe das Manuskript von »Mein Kampf« schreiben konnte. Statt seiner war Ludendorff nach Bayreuth gekommen. Es wurde die schwarz-weiß-rote Fahne gehisst. Am Schluss der »Meistersinger« erhob sich das Publikum und sang das Deutschlandlied. Jüdische Zuhörer wurden öffentlich angepöbelt. Die Presse, besonders im Ausland, war entsetzt. So ein Eklat durfte sich auf keinen Fall wiederholen. Aber es kam, wie man weiß, noch viel schlimmer.
Die Geschichte des Hauses Wagner und seiner Verstrickung in die Verbrechen des Hitler-Regimes ist in vielen Büchern und Filmen aufgearbeitet worden. Friedelinds Rolle darin bleibt extrem ambivalent. Für die einen ist sie die einzige Antifaschistin des Clans. Für die anderen Opfer patriarchaler Herrschaftsstrukturen. Für die dritten die ungeliebte Tochter einer bösen Frau. Für wieder andere eine Nestbeschmutzerin, die nicht nur ihre Mutter und ihre Brüder, sondern auch Richard Strauss, Germaine Lubin und viele andere Künstler in Misskredit gebracht hat, indem sie sie in ihrem Buch »Nacht über Bayreuth« spitzzüngig porträtierte.
Bei der Arbeit an dieser Biographie habe ich feststellen müssen, dass keines dieser Urteile zutrifft. Auf keinen Fall sollte man sie auf ihr einziges Buch reduzieren, das sie in jungen Jahren geschrieben hat, als Entwurzelte, in der Not des Exils, zum Teil im Gefängnis, überall streng überwacht, ob vom englischen oder amerikanischen Geheimdienst oder von Gestapo-Schergen, die Goebbels persönlich ihr auf den Hals gehetzt hatte, um es dem »dicken Biest« einmal richtig zu zeigen. Man sollte sie auch nicht an der berühmten Rede messen, die sie 1942 in einem New Yorker Sender für die »deutschen Hörer« gehalten hat, ein Hymnus auf den großen Menschenfreund Richard Wagner, der von den Nazis schmählich für ihre ideologischen Zwecke missbraucht worden sei. Der Text stammt nämlich gar nicht von ihr, sondern von Erika Mann, die sich gegenüber ihrem Vater damit brüstete, das dumme »Enkeltöchterchen« so richtig vorgeführt zu haben.
Um Friedelind halbwegs gerecht zu werden, muss man noch andere Quellen konsultieren: ihre größtenteils unveröffentlichten Briefwechsel, ihre Artikel in englischen und amerikanischen Zeitungen, ihre zahlreichen Interviews, in denen sie, so die Tochter Frank Wedekinds, manchmal »auf beunruhigende Art laut sagte, was sie dachte«, die Erinnerungen von Schülern und Schülerinnen ihrer Meisterklassen, Dokumente, die ihren Kampf um das kompositorische Werk ihres Vaters Siegfried belegen, den sie endlich aus dem Schatten des übermächtigen Richard herausholen wollte. Aus all dem musste ich das Fazit ziehen, dass sie voller Widersprüche war, dass sie von den einen geliebt und von den anderen gehasst wurde.
Sie war eben keine künstlerische Lichtgestalt wie ihr Bruder Wieland, keine Schönheit wie ihre Schwester Verena, kein schlauer Fuchs wie ihr Bruder Wolfgang, der es mit Geschick verstand, nach dem Krieg alte Freunde des Hauses als Sponsoren zu gewinnen, die jetzt hohe Posten in Wirtschaft und Industrie hatten: Teilnehmer am Hitler-Ludendorff-Putsch, SS-Leute und Wehrwirtschaftsführer, alle geläutert und demokratisiert, in »neuen Bayreuth« einträchtig neben Emigranten wie Bloch oder Adorno sitzend. Zu solchen Kompromissen war Friedelind nicht fähig. Schon 1939 hatte sie an ihre Tanten geschrieben, dass sie sich »nicht zermahlen« lasse: nicht von Hitler, nicht von Familienrücksichten, nicht von dem übermächtigen Mythos ihres Großvaters, den sie als Fluch und als Segen empfand. Opposition ist allerdings kein Beruf. Das war vielleicht ihre Tragik. Dass sie in den Wirren ihrer eigenen Biographie nie ihren Platz fand, sondern eine ewig Unbequeme und Unangepasste blieb, die der Familie und den Deutschen den Spiegel vorhielt, auch wenn es manchmal ein Zerrspiegel war. Aber hatte sie wirklich so Unrecht, als sie seit 1956 vehement zu mehr kulturellem Austausch mit der DDR aufrief oder 1968 vor dem Wiedererstarken einer »braunen Pest« in Deutschland warnte?
Nach dem Krieg zog sie es vor, im Exil zu bleiben, rastlos hin- und herpendelnd zwischen Amerika, England und der Schweiz. 1990 war sie ein letztes Mal in Bayreuth. Zusammen mit Leonard Bernstein, dem großen jüdischen Dirigenten, der wie sie selbst schon von tödlicher Krankheit gezeichnet war. Sie schleppten sich zusammen durch das Festspielhaus, gingen zu Wagners Grab und zur alten Synagoge, bevor sie wieder nach Luzern zurückfuhr, wo sie am Schluss ihres Lebens doch noch sesshaft geworden war. Manchmal wurde sie gefragt, ob sie kein neues Buch herausbringen wollte, eine Neuauflage von »Nacht über Bayreuth« zum Beispiel oder »Pardon my return«, eine Abrechnung mit der Bundesrepublik und dem »neuen Bayreuth«. Aber sie lehnte ab, sei es, weil sie zu krank war oder weil sich »nichts geändert« habe und sie sich »immer noch wie eine Kriminelle« verfolgt fühlte im »Land der Nazis«.
Friedelind Wagner starb im Mai 1991. Eine offizielle Rehabilitation hat sie nicht mehr erlebt. Erst im März 2022 traf der Stadtrat von Bayreuth die Entscheidung, eine nach Hans von Wolzogen, dem Mitgründer des völkischen »Kampfbundes für deutsche Kultur«, benannte Straße in »Friedelind-Wagner-Straße« umzubenennen. Für diese Entscheidung hat er sich viele Jahre lang Zeit gelassen. Nicht ganz so lang, wie das »Tausendjährige Reich« dauerte, aber immerhin.
Eva Weissweilerim Juli 2023
Vorwort zur Erstauflage
Im Winter 1992 fuhr ich im Auftrag eines großen deutschen Verlages nach Sylt, um der dort lebenden 76-jährigen Gertrud Wagner beim Aufzeichnen ihrer Erinnerungen zu helfen. Es war ein Projekt, an dem schon mehrere Autoren gescheitert waren, denn fast niemand fand ihren Ton oder war bereit, ihre Geschichte zu glauben, in der sie die eigentliche Gründerin des »Neuen Bayreuth« war und ihr Mann Wieland eine eher untergeordnete Rolle spielte. Auch mir war diese Geschichte zu einfach. Ich wollte es genauer wissen. Darum verbrachte ich viel Zeit in ihrem auf der Tenne eines Bauernhauses gelagerten Archiv, das ich erst einmal provisorisch sortieren musste, eine riesige Sammlung von Briefen, Fotos, Bühnenbildskizzen, Tagebüchern und sonstigen Dokumenten, die bis heute noch nicht annähernd ausgewertet ist.
In diesem Konvolut stieß ich immer wieder auf Briefe und Postkarten einer gewissen Friedelind, ihrer späteren Schwägerin. Sie stammten größtenteils aus den frühen dreißiger Jahren und waren oft mit »Heil Hitler« unterschrieben. Gertrud und Friedelind Wagner waren begeisterte Mitglieder nationalsozialistischer Jugendorganisationen, in denen sie eine Art zweiter Heimat fanden und die Tatsache, dass sie »nur« Mädchen waren, kompensieren konnten. Friedelind hat sich später vom Nationalsozialismus radikal distanziert.
Obwohl diese Briefe von einer engen Freundschaft zeugten – die beiden Mädchen gingen zeitweilig auf dasselbe Gymnasium –, wurde Gertrud Wagners Stimme kalt, wenn ich sie nach Friedelind fragte. Von mehreren kleineren und größeren Skandalen, in die sie verwickelt gewesen sei, war die Rede. Ansonsten: kein Kommentar. Es schien ein tiefes Zerwürfnis gegeben zu haben, dessen Ursachen mir aber damals nicht klar wurden.
Friedelind Wagner war 1991 mit 73 Jahren gestorben. Meine Erinnerung an die Nachrufe in den Zeitungen war also noch frisch. »Enfant terrible«, »schwarzes Schaf«, »Außenseiterin«, »Emigrantin« – das waren Begriffe, die immer wieder vorkamen und mich neugierig machten. Ich fragte Gertrud Wagner deshalb nach Friedelinds Buch, »Nacht über Bayreuth«, der großen Abrechnung mit ihrer Mutter und den Festspielen im Nationalsozialismus, das ich in Köln, wo ich wohne, nirgends auftreiben konnte, weder in einer Bibliothek noch antiquarisch. Nein, das Buch besitze sie nicht, sagte Gertrud Wagner. Sie habe es aus ihrer Bibliothek verbannt. Im Übrigen sei darin »alles gelogen«. Es sei »eine trübe Quelle«. So hieß es später auch in der Biographie, die Renate Schostack über sie schrieb.1
Vor kurzem fand ich in der Bayerischen Staatsbibliothek einen aus dem Jahr 1947 stammenden Brief Gertrud Wagners an Wielands ehemaligen Musiklehrer Kurt Overhoff, in dem sie das Buch ganz anders beurteilt: »Haben Sie ihr Buch gelesen? Wieland und Nickel2 bestätigen Vieles daraus aus ihrer Kindheit als Wahrheit!!! – Im Gegensatz zu Tante Winnie.«3
1993 – Gertrud Wagner und ich hatten nach schweren Meinungsverschiedenheiten beschlossen, unsere gemeinsame Arbeit nicht fortzusetzen – fand ich »Nacht über Bayreuth« dann zufällig doch noch, und zwar im Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt, die damals noch »Deutsche Bibliothek« hieß. Es war ein abgewetztes Exemplar aus dem Jahr 1945, die bei Hallwag/Bern erschienene deutsche Übersetzung des englischen Buchs »Heritage of Fire«. Ich entlieh das Buch und verschlang es. Las über die greise Großmutter Cosima, die skurrilen Tanten Daniela und Eva, die alles dominierende Mutter Winifred, den freundlichen, aber wenig durchsetzungsfähigen Vater Siegfried, über Haus Wahnfried als Abenteuerspielplatz, das erste Erscheinen des »Führers«, die Festspiele in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, die hochdramatische Mutter-Tochter-Beziehung und den Entschluss Friedelinds, Deutschland zu verlassen. Manche Nebenfiguren kamen mir blass oder auch stark überzeichnet, manche Dialoge etwas zu lang vor. Aber es gab Szenen von fast filmischer Präsenz und Plastizität, besonders Friedelinds Besuche in der Reichskanzlei oder die privaten Auftritte Hitlers am Rand der Festspiele.
Das Buch war für mich ein wichtiges Zeitdokument, und da es fast nirgends mehr greifbar war, begann ich, über die Möglichkeit eines Reprints nachzudenken. Ein junger Verleger und Autor – Volker Dittrich in Köln – war von dieser Idee sofort angetan und nahm mit Hallwag/Bern Kontakt wegen der Rechte auf. Die Antwort kam schnell. Nein, keine Einwände. Das Buch sei seit langem vergriffen und eine Neuauflage nicht geplant. Von Nachfahren oder Erben war nicht die Rede. Und da es immer hieß, Friedelind sei unverheiratet und kinderlos gewesen, recherchierten wir in dieser Richtung auch nicht weiter.
Was wir nicht wussten: sie hatte doch einen Erben, einen ehemaligen Schüler ihrer englischen Meisterklassen, Neill Thornborrow, der heute eine Konzert- und Theateragentur in Düsseldorf betreibt. Als sie Ende der siebziger Jahre von England nach Deutschland zurückging, kam er mit. Er war Pianist und arbeitete am Stadttheater Regensburg als Korrepetitor. Friedelind Wagner machte ihn zu ihrem Universalerben und übergab ihm ihr großes Archiv, in dem sich Briefschaften aus mehr als sechs Jahrzehnten befanden. Da er bislang nie damit an die Öffentlichkeit getreten war und auch nichts daraus publiziert hatte, konnten wir von diesen Hintergründen nichts ahnen. Erst im Jahr 2008, als ein heftiger Streit um die Nachfolge Wolfgang Wagners entbrannte, war sein Namen öfter im Zusammenhang mit den Festspielen zu lesen, da er als potentieller Kandidat oder Mit-Kandidat gehandelt wurde. Der Berliner »Tagesspiegel« bezeichnete ihn als »weder blutsverwandt(en) noch adoptiert(en)« Erben Friedelind Wagners,4 der »Spiegel« hingegen als ihren »Sohn«.5 Friedelinds Nichte Nike Wagner weist auf eine starke Familienähnlichkeit hin: »ein zartes, aber ausgeprägtes Wagnerprofil, wie mit dem Silberstift nachgezogen.«6
Noch bevor das Reprint von »Nacht über Bayreuth« auf dem Markt war – es war lediglich im »Börsenblatt des deutschen Buchhandels« angekündigt – bekam Volker Dittrich Post von der Hamburger Anwaltskanzlei Servatius, die Friedelind Wagners Interessen schon in den sechziger Jahren vertreten hatte.7 Sie vertrat inzwischen auch ihren Erben, Neill Thornborrow also, und gab sich als Friedelinds »Testamentsvollstreckerin« zu erkennen. Volker Dittrich wurde aufgefordert, »die Veröffentlichung der Neuauflage … mit sofortiger Wirkung zu unterlassen«, andernfalls habe er mit gerichtlichen Maßnahmen zu rechnen, die dann auch ergriffen wurden.8 Der Gegenanwalt wies das Gericht auf § 2216 BGB hin, nach dem es zu den gesetzlichen Pflichten eines Testamentsvollstreckers gehöre, die angemessene Nutzung des ihm anvertrauten Nachlasses zu gewährleisten. Das tue er aber nicht, wenn er verhindere oder zu verhindern versuche, dass »ein von der Erblasserin im Exil geschaffenes und lange Zeit in Vergessenheit geratenes Werk einem deutschsprachigen Publikum zugänglich« gemacht werde.9
Nach langem Hin und Her und viel Streit über Einzelheiten durfte das Buch 1994 schließlich doch erscheinen und ist seitdem wieder im Handel erhältlich, auch in Fremdsprachen. Es wurde in der Presse viel diskutiert und all die alten Klischees oder Etiketten – »enfant terrible«, »schwarzes Schaf« etc. – kamen dabei wieder auf den Tisch. Eine seriöse Auseinandersetzung fand nicht statt.
Seit Mitte der neunziger Jahre erschienen viele familienbiographische Bücher über die Wagners, die zum Teil von der Familie selbst, zum Teil von »externen« Autoren stammten: Gottfried Wagners »Wer nicht mit dem Wolf heult«,10 Wolfgang Wagners »Lebens-Akte«,11 Nike Wagners »Wagner Theater«,12 Renate Schostacks »Hinter Wahnfrieds Mauern«,13 Brigitte Hamanns »Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth«,14 Oliver Hilmes’ »Cosimas Kinder«15 und Jonathan Carrs »Der Wagner-Clan«.16 In allen diesen Büchern kommt Friedelind vor, aber immer nur als Nebenfigur, manchmal mit Sympathie, manchmal mit Aggressivität beschrieben und fast zur bösartigen Karikatur überzeichnet.
Als ich 2011, zwanzig Jahre nach ihrem Tod, feststellen musste, dass es immer noch keine Biographie über sie gab und dass alte Bayreuther, die man nach ihr fragte, immer noch schweigsam oder gar feindselig reagierten, beschloss ich, Neill Thornborrow noch einmal anzusprechen.
Seine Antwort war klar und ablehnend. Kein Zugang zu seinem Archiv. Jedenfalls nicht für mich. Den Zugang habe schon eine Kollegin, Eva Rieger, die er voll unterstütze. Diese Reaktion erschreckte mich nicht, denn ich wusste ja, dass die Quellenlage schwierig sein würde, ob mit oder ohne Neill Thornborrow, ein Problem, mit dem auch Oliver Hilmes, Brigitte Hamann und andere zu kämpfen hatten, die sich mit der Familie Wagner befasst haben, denn die Familienbriefe sind über die verschiedenen »Stämme« verstreut, die fast alle miteinander verfeindet sind und nur ihre Sicht der Dinge zulassen. So schreibt Brigitte Hamann im Nachwort zu ihrer fast 700 Seiten langen Winifred-Wagner-Biographie, dass sie »weder Zugang zu Winifreds Nachlass noch zu dem ihres Mannes Siegfrieds bekommen« habe.17 Zurzeit eskaliert der Streit wieder einmal. Festspielleiterin Katharina Wagner verlangt von Kusine Amelie Hohmann-Lafferentz die Herausgabe von Winifred-Wagner-Briefen, ohne die eine lückenlose Aufarbeitung der NS-Geschichte der Festspiele nicht möglich sei. Bis jetzt sind die Briefe offenbar nicht in Bayreuth angekommen.
Inzwischen ist die von Thornborrow angekündigte Biographie über Friedelind Wagner erschienen. Die Autorin, Eva Rieger, ist eine mir seit langem bekannte, von mir sehr geschätzte Kollegin, die sich vor allem auf dem Gebiet der Frauenmusikforschung verdient gemacht hat. Das Buch ist gut recherchiert und in seinem Blick auf Friedelind nicht nur glorifizierend, was vermutlich dazu geführt hat, dass Neill Thornborrow sich davon distanziert und keine Interviews dazu geben möchte. Dennoch vertritt es einen orthodox-feministischen Ansatz, der sich in Sätzen wie »vieles wäre anders verlaufen, wenn sie als Junge geboren worden wäre« zeigt und den ich in dieser plakativen Ausschließlichkeit nicht teile. Denn Friedelind Wagner war durchaus nicht nur »Opfer«, sondern hatte mehr Chancen als die meisten anderen Frauen ihrer Generation, da ihr berühmter Name ihr Tür und Tor öffnete.
Trotz eines Umfangs von über 500 Seiten spart Eva Riegers Biographie einige wichtige Themen aus, vor allem die kritische Auseinandersetzung mit Friedelinds Hauptwerk »Nacht über Bayreuth« und ihren journalistischen Arbeiten aus der Exilzeit, die nur erwähnt, aber nicht zitiert und interpretiert werden. Das gilt besonders für die brisanten Artikel im Londoner »Daily Sketch«, die Joseph Goebbels veranlassten, wütend von einem »dicken Biest« zu sprechen, das »kompletten Vaterlandsverrat« begehe.
Es fehlt auch die gründliche Aufarbeitung wichtiger Briefwechsel Friedelind Wagners, z.B. mit Arturo Toscanini, den Tanten Daniela Thode und Eva Chamberlain, mit dem Regisseur Walter Felsenstein und amerikanischen Kollegen wie Irving Kolodin und Thomas Neumiller. Manches davon wird gestreift, aber nicht wirklich durchleuchtet, obwohl gerade diese Briefe besonders authentisch sind und viel über die politische Haltung der Autorin verraten. Diese Lücken habe ich in meinem Buch zu schließen versucht, indem ich sämtliche Handschriften noch einmal in den Archiven eingesehen und aufs Neue analysiert habe, insgesamt weit über fünfhundert. Auch das vom nationalsozialistischen und englischen Geheimdienst über Friedelind Wagner gesammelte Material bedurfte einer neuen, kritischen Sichtung, die zu unerwarteten Ergebnissen führte. Ergänzt wurden diese Recherchen durch Gespräche mit Menschen, die Friedelind kannten, vor allem mit dem Schauspieler und Kapitän Christoph Felsenstein (Berlin), dem Musikwissenschaftler und Regisseur Peter P. Pachl (Berlin) und der Sängerin Anja Silja (Zürich), denen ich an dieser Stelle herzlich danken möchte. Peter P. Pachl stellte mir außerdem die umfangreiche Korrespondenz zur Verfügung, die er zwischen 1974 und 1984 mit Friedelind Wagner geführt hat. Sie war damals Präsidentin der von Pachl ins Leben gerufenen Internationalen Siegfried-Wagner-Gesellschaft, die sich um eine Renaissance der Werke ihres Vaters bemüht.
Im Rahmen meiner Spurensuche gab es aber immer wieder kleinere Abschnitte, für deren Darstellung mein Quellenmaterial nicht ganz ausreichte, so dass ich auf Zitate von Eva Rieger und Brigitte Hamann zurückgreifen musste, denen das Thornborrow-Archiv im Gegensatz zu mir zur Verfügung stand. Diese Stellen habe ich im Anmerkungsapparat deutlich gemacht und von meinen eigenen Quellen-Recherchen abgehoben.
Die Hauptquelle für die Zeit von 1918 bis 1940 ist und bleibt »Nacht über Bayreuth«, ein zwar sehr authentisches, aber nicht immer zuverlässiges Buch ist, in dem die Autorin Korrekturen ihrer eigenen Biographie vorgenommen hat. Das gilt nicht nur für die berühmte Szene, in der Winifred ihrer leiblichen Tochter androht, dass man sie »ausrotten« und »vertilgen« werde, wenn sie nicht freiwillig aus dem Exil zurückkehre, sondern auch für bestimmte politische Aussagen, besonders für Friedelinds Beziehung zu Hitler, dem Nationalsozialismus und den Juden. In den Jahren 1930 bis 1939 hat sie sich langsam von der Hitler-Anhängerin zur Hitler-Gegnerin, von der Antisemitin zur Anti-Rassistin entwickelt. Dieser Prozess findet in ihrem Buch, das für amerikanische Leser gedacht war, nicht statt. Glaubt man diesem Text, war sie vom ersten Moment an »dagegen«.
Friedelind Wagners Leben wird oft nur auf »Nacht über Bayreuth«, also auf die Zeit bis 1940, reduziert, was unfair und falsch ist. Besonders von 1959 bis 1967 leistete sie Großartiges als Leiterin der Bayreuther Festspiel-Meisterklassen, in denen sie vielen jungen Künstlern aus dem Opernfach zu einer internationalen Karriere verhalf, z.B. dem Regisseur John Dew, der Sängerin Ella Lee oder dem Dirigenten Peter Erös, um nur einige zu nennen. Besonders wichtig ist ihre Zusammenarbeit mit Walter Felsenstein und dem realistischen Musiktheater der DDR als Kontrapunkt zu Wieland Wagners abstrakt-stilisiertem Inszenierungsstil. Durch Auswertung der Korrespondenz Friedelind Wagners mit Felsenstein und Gespräche mit dessen Sohn Christoph habe ich versucht, diesen Punkt besonders herauszuarbeiten. Dabei spielt auch immer wieder das spannungsvolle Verhältnis zwischen der jungen Bundesrepublik und dem »anderen« Deutschland eine Rolle, ein Prozess, den die passionierte DDR-Reisende Friedelind Wagner aktiv beobachtet und kommentiert hat. In Friedelind Wagners Leben spiegelt sich fast das ganze 20. Jahrhundert vom Ersten Weltkrieg bis zur Wende. Sie hat die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus, das Exil, das Wirtschaftswunder, den Kalten Krieg und die Zeit der Studentenunruhen miterlebt. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine »Zeugin des Jahrhunderts«. Sie ist aber auch interessant als Mitglied einer Familie, die bis heute dauernd in den Boulevardblättern vorkommt und zu Recht als Deutschlands »berühmteste« und »berüchtigtste« bezeichnet wird, eines so glamourösen wie neurotischen Clans, der seine Traumata von einer Generation zur anderen tradiert und es nicht schafft oder vielleicht sogar nicht wünscht, den »Familiendämon« wirkungsvoll in die Flucht zu schlagen.
ERSTES KAPITEL
Siegfrieds Tochter
(1918–1930)
Cosima
Bayreuth, im Januar 1918. Der letzte Winter des Ersten Weltkrieges war so kalt, dass sich die Teiche im Hofgarten in ein Archipel von Eisflächen verwandelt hatten. In Friedenszeiten wären die Kinder hier Schlittschuh gelaufen. Aber es gab keine Schlittschuhe mehr. Man hatte fast alle Schlittschuhe von Bayreuth konfisziert, um sie einzuschmelzen und Kanonen daraus zu machen. Schlittschuhe, Bratpfannen, Türklinken, Trompeten und Nussknacker.
Manchmal sah man morgens eine hohe Gestalt, die in Pelze gehüllt langsam ihren Weg ging: Cosima Wagner, einundachtzig Jahre alt, zerbrechlich, gertenschlank, weißhaarig, eine Frau mit scharfen, klugen Gesichtszügen. Meistens hatte sie den winterlichen Park ganz für sich. Aber es kam vor, dass Männer ihren Weg kreuzten, denen ein Bein oder ein Arm fehlte, die mit starrem Blick ins Nichts sahen oder unverständlich vor sich hinstammelten. Es waren Kriegsinvaliden, Kriegsneurotiker, Kriegsstotterer, wie man sie damals nannte. Einige wurden laut und beklagten sich in bitteren Worten über ihr Schicksal. Doch Cosima legte ihnen beruhigend die Hand auf den Uniformärmel und sagte:
»Sie dürfen sich aber sagen, daß Sie mit dazu geholfen haben, die Franzosen abzuwehren!«1
Wenn Cosima von ihrem Spaziergang zurückkam, wickelte sie sich in eine warme Decke, setzte sich in einen ihrer tiefen, bequemen Chintz-Sessel und trank ein Glas Bier. Auf dem Kaminsims stand eine Büste von Richard Wagner. Aus dem Fenster ihres hübschen Biedermeier-Boudoirs sah man in den winterlichen Gemüsegarten, an dessen Ende der Meister begraben lag, ganz schlicht, unter einer grauen, mit Efeu bewachsenen Marmorplatte ohne Inschrift. Fast täglich kam ihre Tochter Eva aus der Villa Chamberlain in der Lisztstraße zu ihr herüber und schrieb Briefe, die sie ihr in die Feder diktierte:
»Mit Begeisterung sind wir hier der Vaterlandspartei beigetreten, und ich konnte es mir nicht versagen, dem Herzog Johann Albrecht meinen Glückwunsch zu der Bildung dieser Partei auszudrücken, worüber ich von ihm ein warmes beredtes Telegramm erhielt.«2
Ihre Augen waren schlecht, so dass Eva ihr vorlesen musste. Aus dem Briefwechsel zwischen Goethe und Humboldt, aus neuen Erzählungen von Gerhart Hauptmann oder aus Aufsätzen von Evas Mann Houston Stewart Chamberlain, einem Engländer, in denen es meistens um »den« Juden, seine »zersetzende« Kraft und die Überlegenheit der »arischen« Rasse über die »semitische« ging.
Winifred
Winifred, Cosimas Schwiegertochter, ist schwanger, obwohl sie eigentlich selbst noch ein halbes Kind ist, knapp einundzwanzig, eine große, mädchenhafte Erscheinung, eine »dumme Pute«, wie sie sich selbst einmal scherzhaft genannt hat. Und doch schon Herrin von Wahnfried, künftige Festspielchefin, Mutter des lang ersehnten Erben Wieland, der daheim in der Wiege liegt und vor sich hinkränkelt. Er hat Verdauungsprobleme, gegen die er Rizinus-Öl bekommt.3 Winifred schreibt in großen, krakeligen Buchstaben an den Leibarzt der Familie, um sich Rat zu holen. Nach der Geburt hat es lange gedauert, bis er anfing zu schreien. Zum Entsetzen der Ärzte war er blau angelaufen. Doch Winifred strahlte und sagte zu ihrem Mann:
»Gelt, Goldschniggelchen, nächstes Jahr kriegen wir wieder was Kleines, damit der Bub’ Gesellschaft hat und sich nicht mopst!«4
Es sind schlechte Zeiten für Babys. In den Großstädten sterben sie wie die Fliegen an Unterernährung, Spanischer Grippe, Skorbut. Die Milch ist knapp. Brot, Kartoffeln, Eier und Fleisch sind streng rationiert. Das Einzige, was es im Übermaß gibt, sind Steckrüben und Hering. Doch Winifred mit ihrem Sinn fürs Praktische weiß sich zu helfen. Sie quartiert die Familie ins so genannte »Junggesellenhaus« um, ein Nebengebäude, das leichter und billiger zu heizen ist als das riesige Wahnfried, verwandelt den vom Meister konzipierten Park in einen Gemüsegarten, schafft ein paar Hühner an, tauscht, handelt, schachert, wenn nötig, auch mit Juden. Es gibt ungefähr dreihundert in der Stadt, mit denen sie sich größtenteils gut versteht, darunter den Schuhhändler Zwirn, der die feinen dünnen Turnschuhe, die »Schleichala« macht, den Textilkaufmann Dessauer gleich neben dem Rathaus oder den Besitzer des »Nürnberger Basars« ein paar Häuser weiter auf der Richard-Wagner-Straße.
Imponierend, wie sie es schafft, alle durchzubringen, diese feingeistigen, durch und durch unpraktischen Menschen, Schwiegermutter Cosima, Ehemann Siegfried, dessen Schwester Eva Chamberlain und deren Mann Houston, den englischen »Rasse«-Theoretiker und Wagnerianer, dazu noch die vielen Dienstboten, die man sich mitten im Krieg immer noch leistet, eine Pflegerin, eine Köchin, ein Küchenmädchen, einen Diener, zwei Zimmermädchen, einen Gärtner, ein Kinderfräulein … Nein, dank Winifred muss hier niemand hungern. Siegfried ist sogar ein bisschen zu dick, denn er liebt deftige fränkische Kost, nur sie selbst, die es am nötigsten hätte, kann nichts essen und erbricht sich während dieser zweiten Schwangerschaft immer wieder, so dass ihr Mann manchmal tadelnd zu ihr sagt:
»Aber Winnie, das gute Essen!«5
Siegfried
Drüben, im »Junggesellenhaus«, das später »Führerbau« heißen würde, sitzt Cosimas Sohn Siegfried an einem seiner Flügel und komponiert. Er ist neunundvierzig Jahre alt, nervös, überreizt, raucht viel und trinkt Unmengen von Kaffee. Eigentlich ist er unkompliziert, witzig und lebensfroh. Aber jetzt quälen in schwere Sorgen. Mit Beginn des Krieges hat er das Festspielhaus schließen müssen. Kostüme und technische Einrichtungen drohen zu verrotten. Die Künstler und zahlenden Gäste bleiben aus. Er hat kaum noch Einnahmen. Dazu kommt, dass der Urheberrechtsschutz für die Werke seines Vaters abgelaufen ist und alle Welt Wagner spielen darf, ohne dafür zu bezahlen.
Sein neustes eigenes Werk heißt »Der Schmied von Marienburg« und spielt im frühen 15. Jahrhundert in Westpreußen. Friedelind, Stieftochter des Bürgers Willekin, trifft sich heimlich mit ihrem Geliebten, einem Ordensritter. Doch der Stiefvater stört das Rendezvous und jagt den Rivalen mit Waffengewalt in die Flucht. Unter Einsatz ihres Lebens geht Friedelind auf die Suche nach ihm, findet ihn schließlich und überzeugt ihn, dem Priestergelübde zu entsagen.
Siegfried Wagner hat sich dem Genre der »Volksoper«, dem »harmlosen, sinnigen, deutschen Lustspiel«6 in der Tradition von Marschner und Weber verschrieben, weil er nicht will, dass man eines Tages über ihn sagt: »Ah, er ahmt seinen Vater nach, dieser Zwerg!«7 Anfangs hatte er damit großen Erfolg. Sein Opus 1, »Der Bärenhäuter«, wurde 1899 in vielen Städten aufgeführt, u.a. von Gustav Mahler in Wien. In nur einer Spielzeit erreichte es siebenundsiebzig Aufführungen, ein wahrer Kassenschlager. Es wurde sogar ins Englische, Französische und Ungarische übersetzt. Besonders publikumswirksame Teile wie der »Teufelswalzer« oder der »Muffelmarsch« erklangen in Kurkonzerten und Kaffeehäusern. Doch je mehr die Zeit fortschritt, umso mehr litt er unter der Konkurrenz komponierender Zeitgenossen, die andere, modernere Wege beschritten, expressionistische Textvorlagen benutzten und den Rahmen der Tonalität zu sprengen begannen, während er, ein Schüler Engelbert Humperdincks, bewusst bei der Melodie, der »schönen« Melodie blieb und für seine Libretti märchenhafte oder historische Stoffe benutzte, die so seltsame Titel hatten wie »Banadietrich«, »An allem ist Hütchen schuld« oder »Sonnenflammen«. Viele Kritiker und Kollegen verurteilten seine Werke, ohne sie jemals gehört zu haben. Es genügte ihnen, dass er der Sohn Richard Wagners war, weshalb er als Komponist lieber schweigen sollte.
»Achtbare Musik, nicht mehr; so etwas wie die Hausaufgabe eines Schülers, der bei Richard Wagner studiert hat, aus dem sich aber der Lehrer nicht viel machte«, spottete Claude Debussy.8
Es war nicht schwer, sich über ihn lustig zu machen, denn er sah nicht sehr männlich, nicht sehr heroisch aus, mehr Karikatur als Abbild seines berühmten Vaters. War dazu noch homosexuell, woraus er kein Hehl machte, »ein Heiland aus andersfarbiger Kiste«,9 der »tänzelnd und parfümiert mit etwas zu hohem Kragen auf etwas zu hohen Absätzen über diese schöne Erde« schritt, wie es der bekannte Publizist Maximilian Harden einmal ausdrückte.10 Schwager Chamberlain wünschte sich, es gäbe jemanden, der nach Berlin führe, um den »widerwärtigen Saujuden Harden« in der Redaktion seiner Zeitschrift »Die Zukunft« zu erschießen.11
War es nur Spaß, wenn Siegfried die schwangere Winifred zur Rede stellte, weil sie das teure Essen immer wieder von sich gab? Oder ekelte er sich etwa vor ihrem dicken Bauch und ihren geschwollenen Brüsten? Sie war zwar noch jung, aber nicht naiv, auch wenn sie sich selbstironisch als »dumme Pute« bezeichnete und von Cosima wie ein Schul- oder Dienstmädchen behandelt wurde. Natürlich wusste sie, dass Siegfried Beziehungen zu Männern hatte, dem jungen englischen Komponisten Clement Harris, dem Sänger Theodor Reichmann, dem Maler Franz Stassen, der sogar Trauzeuge bei ihrer Blitzhochzeit war. Natürlich ahnte sie, warum das »Junggesellenhaus« »Junggesellenhaus« hieß. Warum er auch jetzt noch für Tage und Wochen allein nach Berlin fuhr und »ganz erholt und angeregt durch die geistige Ablenkung durch kunst- und geistreiche, nette Menschen« wieder zurückkam.12
Aber was zählte das noch? Er war ja jetzt Vater. Als sie im Januar 1917 mit dem neugeborenen Wieland nach Hause kam, saß Cosima im japanischen Festgewand auf einem Sessel und nahm den Kleinen beglückt auf den Schoß. Dann setzte sie sich an den Flügel und spielte ein paar Takte aus dem Siegfried-Idyll, das Wagner zur Geburt seines einzigen Sohnes komponiert hatte.
Und jetzt, kaum ein Jahr später, schon wieder ein Kind. Siegfried wünschte sich diesmal ein Mädchen. Wenn sein Wunsch in Erfüllung gehen sollte, wollte er es wie die Heldin aus dem »Schmied von Marienburg« Friedelind nennen.
Friedelind
Der Winter ist in Bayreuth besonders trostlos, aber im Frühjahr verwandelt sich der Hofgarten in ein Paradies. Auf den Kanälen und Teichen zeigen sich die ersten Wasservögel, die bequemen Spazierwege sind »in lichtgrüne Schleier gehüllt und am tiefblauen Himmel wechseln Sonne und Mond sich strahlend ab«.13 So hat es Siegfrieds Halbschwester Daniela, eine von Cosimas Töchtern aus der Ehe mit dem Dirigenten Hans von Bülow, einmal beschrieben.
Auch das Frühjahr 1918 war mild, eine Erlösung nach der monatelangen Kälte. Trotzdem glich der Gang durch die Stadt einem Albtraum. Im Hofgarten war ein Flugzeug abgestürzt. Die Fenster der Stadtkirche waren zertrümmert, und die Pfeifen der abgebrannten Orgel lagen auf der Straße, wo die Bürger vorsichtig ihre ersten Spaziergänge machten. Am 21. März hatte die deutsche Westoffensive begonnen. Cosima schwärmte: »Man glaubt, ein sagenhaftes Heldengedicht zu erleben, und Hindenburg erscheint einem wie ein Halbgott.«14 Mehr als 230 000 deutsche Soldaten fielen in diesem »Heldengedicht«, in dem zum ersten Mal Chlor- und Giftgas eingesetzt wurden und junge Männer in ihren Schützengräben erstickten.
Am Gründonnerstag früh um sechs packte der Leibarzt der Familie, Doktor Ernst Schweninger, die in den Wehen liegende Winifred in einen Wagen und brachte sie ins Städtische Krankenhaus. Bis zur Geburt dauerte es einen vollen Tag. Es war der 29. März 1918, Karfreitag, für Christen eigentlich ein Trauertag, doch Friedelind würde ihn immer positiv deuten. Sie sei im Frühling geboren, ein »Karfreitagskind«, und alle Blumen auf der »Karfreitagswiese« gehörten ihr.15 Sie kam mit den Füßen zuerst auf die Welt und stieß sofort einen kräftigen Schrei aus, hatte dicke Pausbacken, große Augen und die langen Finger von Uropa Liszt, Cosimas Vater. Winifred war stolz auf das Prachtkind. »Ein Riesenosterei«, schrieb sie an eine Freundin.16
Mutterliebe
Solange die Kinder klein waren, kümmerte Winifred sich gewissenhaft um ihr physisches Wohl, stillte sie, fragte Doktor Schweninger, wann sie zufüttern dürfe, kochte Spinat- und Karottenpürree, kontrollierte ihr Gewicht, ihren Stuhl, ihre ersten Schritte und führte sogar Buch darüber, genau, wie sie es auf der »Frauenschule« gelernt hatte. Doch kaum waren sie etwas größer, wurden sie an Emma, das Kindermädchen, delegiert, ein unverheiratetes »Fräulein« vom Lande, das sie wickelte, fütterte und auf den Schoß nahm, ihnen patriotische Lieder vorsang und sie bei Fliegerangriffen und Gewitter beschützte. Wieland würde später erzählen, er habe ihr näher gestanden als seiner Mutter und sich weinend auf der Toilette eingeschlossen, wenn sie Ausgang hatte.17
Winifreds Verhalten war nicht ungewöhnlich für ihre Kreise, in denen es als unnötig, ja als unschicklich galt, sich mit dem Nachwuchs mehr zu beschäftigen als unbedingt nötig. Wozu gab es schließlich Dienstboten? Wozu Hauslehrer? Auch Cosima hatte nicht viel Zeit mit ihren Kindern verbracht, sondern sich ganz ihrem »Lebenswerk«, Richard Wagner, gewidmet.-
Winifred übernahm diese Rolle. Für den Mann da zu sein. Alles andere seinetwegen zurückzustellen. Ihr gemeinsames Ziel hieß: Wiederaufbau der Festspiele. Sie war immer um ihn, meinte, ihn beraten, mit ihm reisen und seine Post erledigen zu müssen, Aufgaben, die früher seine Schwestern, Daniela und Eva, übernommen hatten. Für die Kinder könne im Notfall jemand anders sorgen, für den Mann doch schlecht18 meinte Winifred, wobei es ihr sicher auch darum ging, ihn vor der homosexuellen »Gefahr« abzuschirmen.
Cosima, die von ihren Eltern Franz Liszt und Marie d’Agoult gleich nach ihrer Geburt zu einer Amme gegeben worden war, hatte nie erlebt, was das ist: Mutterliebe. Winifred auch nicht. Ihre Mutter starb, als sie zwei Jahre alt war. Sie war Schauspielerin und Malerin gewesen, deutsch-dänischer Herkunft, mit einem Journalisten, Tropeningenieur und Theaterkritiker verheiratet, dem Engländer John Williams, einem Abenteurer und Schuldenmacher, über den nur wenig bekannt ist, außer, dass er aus Wales stammte19 und drei Kinder aus erster Ehe hatte.20 Auch er starb früh – »an einer Leberkrankheit«, heißt es gelegentlich, was wohl heißen soll: Er war Trinker.
In dem großen Film, den Hans Jürgen Syberberg 1975 über sie machte,21 erzählt Winifred offen und anschaulich über diese Jahre. Dass sie keine Erinnerung an ihre Eltern mehr habe, jahrelang hin- und hergeschoben wurde, zum Großvater, zu entfernten Verwandten nach Deutschland. Aber überall störte sie. Sie war einfach zu unerzogen und zu wild. »So wurde ich prompt nach England zurückgeschickt, und man steckte mich kurzerhand in ein Waisenhaus in East Grimstead – St. Margarete’s Orphanage. Dort wuchs ich aus der ›nursery‹ in die Schule hinein.«22
Ein Waisenkind aus Sussex
Im Syberberg-Film schweigt sie über ihre Waisenhaus-Zeit. Auch ihr Enkel Gottfried bestätigte mir, sie habe, so redselig sie auch war, nie über diese Zeit gesprochen.23 Nur einer Urenkelin erzählte sie kurz vor ihrem Tod, dass man ihr die Zunge mit scharfem englischem Senfpulver eingerieben habe, wenn sie beim »Lügen« ertappt worden sei.24 Was sie nicht erzählte, war, dass Kirche und Staat Legionen von englischen Waisenkindern deportieren ließen, nach Afrika, Kanada, Neuseeland, Australien, angeblich, um »guten weißen Bestand« in das Empire zu bringen, während sie in Wahrheit als billige Arbeitskräfte missbraucht wurden.25 Vielleicht entging Winifred diesem Schicksal nur, indem sie krank wurde. Sie entwickelte eine schwere Hautkrankheit, Neurodermitis wahrscheinlich, was den Umzug in ein trockenes, kontinentales Klima notwendig machte.
So kam sie mit neun Jahren zu den Klindworths, einem alten, kinderlosen Musikerpaar, fanatischen Wagnerianern und Vegetariern, die in der Obstbausiedlung »Eden« bei Oranienburg lebten. Die meisten »Edener« waren Antisemiten. Nur wer »deutsch«, »völkisch« und »arisch« war, durfte hier »siedeln«. Auch die Klindworths teilten diese Ansicht und übermittelten sie der kleinen Winifred, die unter Wagner- und Volkslieder-Klängen lernte, was ein »Jude« ist.26
Doch auch die Klindworths gaben sie wieder fort. Erst nach Hannover, wo sie anständig Deutsch lernen sollte, dann nach Berlin zu einem Musiker, der sich wahrscheinlich an ihr verging,27 dann in das »Lademann’sche Institut« in der Nähe von Braunschweig, wo es fast so schlimm war wie im englischen Waisenhaus: schwere Prügel, Schläge auf das nackte Gesäß, Preußentum, in die Kinderseele gebrannt. Es folgten weitere Stationen, wo sie Kochen, Zeichnen und Kinderpflege lernte. Dann, kurz vor Ausbruch des Weltkrieges, die Adoption, die aber nichts daran änderte, dass sie Engländerin blieb, im Krieg als »feindliche Ausländerin« galt, sich regelmäßig bei der Polizei melden musste und den Raum Großberlin nicht verlassen durfte.
Das war die Winifred, die Siegfried im Sommer 1914 kennenlernte und knapp ein Jahr später in Wahnfried heiratete. Sie war achtzehn, er sechsundvierzig. Sie eine schlanke, herbe, englische Schönheit, er ein kleiner, schon fast weißhaariger, zum Bauchansatz neigender Mann, der gern weiße Hosen, zitronengelbe Pullover und teure Breeches trug. Vor lauter Glück, endlich eine Familie gefunden zu haben, ahnte sie anfangs wohl noch nicht, dass er sie nur auf Druck seiner Schwestern heiratete, denn es galt zu beweisen, dass er nicht homosexuell war. Außerdem brauchte Bayreuth unbedingt einen männlichen Erben, der den Namen »Wagner« trug und das Meisterwort »Kinder, schafft Neues« in die Tat umsetzen würde.
Wahnfried-Idyll
5. November 1918. Karlsruhe. Großherzogliches Hoftheater, ein Prachtbau aus dem Jahr 1808, in dem schon Hector Berlioz aufgetreten ist. Fritz Cortolezis dirigiert die Uraufführung von Siegfried Wagners Opus 7, »Schwarzschwanenreich«. Seit 1910 hat das Stück in der Schublade gelegen. Erst jetzt, in den letzten Kriegstagen, kommt es zur Aufführung. Es spielt im Dreißigjährigen Krieg, in der Zeit der Hexenverbrennung, handelt von lüsternen Teufeln, schwarzen Schwänen, blutroten Wolken, von Folter, Scheiterhaufen, Hypnose, Inquisition, von einer Magd, die ihr Kind, eine Missgeburt, umgebracht und im Wald verscharrt hat, wo es jedoch plötzlich zum Leben erwacht und seinen verkrüppelten Arm anklagend aus der Erde hebt. Schon auf der Generalprobe hatte sich gezeigt, dass diese Szene zu weit ging.28 Den Hofdamen, die im Publikum saßen, wurde schlecht, so dass sie aufstanden und das Theater unter Protest verließen, auch wenn das Ganze »nur« eine Angstvision war, die der Mutter von ihrer Umwelt aufgedrängt wurde. Siegfried sah sich genötigt, die Szene zu ändern. Aber der Beifall blieb trotzdem lau. Es gab nur wenige Wiederholungen.29
Noch am gleichen Tag bricht die Revolution aus. Matrosen der deutschen Hochseeflotte in Kiel machen den Anfang. Kurt Eisner proklamiert die bayrische Republik, in der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte die Macht übernehmen. Das Volk hat genug vom Krieg. »Kaiser zur Thronentsagung entschlossen«, melden die Zeitungen. Auch König Ludwig III. von Bayern tritt ab. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird Reichskanzler.
Für Winifred – gerade selber erst »deutsch« geworden – bricht eine Welt zusammen. Während viele Frauen nicht wissen, ob ihre Männer lebend aus dem Krieg zurückkommen werden, kann sie nicht fassen, dass er wirklich zu Ende ist, und schreibt an ihre Freundin Helene: »Herr Gott, wer hätte eine solche Wendung für möglich gehalten! Wie stolz war man auf sein deutsches Vaterland, und wie schämt man sich, dass solche Erniedrigung durch den Wurm im Inneren möglich wurde.«30
Und trotzdem. Am 24. Dezember wird Weihnachten gefeiert, auch in Wahnfried. Es ist Cosimas 81. Geburtstag. Zur Feier des Tages trägt sie ausnahmsweise nicht Schwarz, sondern Grau. Siegfried hat ein lustiges »Wahnfried-Idyll« komponiert, das wie eine Parodie auf das »Siegfried-Idyll« seines Vaters wirkt. Kugeli! Kugeli! Dudeldazwi! Munter ist’s jetzt in Wahnfried früh. Kaum kräht der Hahn sein Kiriki, machen die Kleinen ihr erstes Pipi! Es gibt zwar noch keinen Stollen und keine Gans, aber das Kindermädchen Emma Bär hat ein paar Spielsachen besorgt und auf einem Tisch für die Kinder verteilt. Friedelind kann schon sitzen. Wieland läuft auf dicken, unsicheren Beinchen durch den Raum. Selbst Chamberlain, der Kämpfer für Recht, Rasse und Ordnung, ist gerührt und schreibt nach dem Fest an einen Freund:
»Voran ging nur das Evangelium und eine ganz wundervolle Andacht Luthers; dann aber herrschten der zweijährige Willfy31 und die achtmonatige Mo.32 Letztere saß aufrecht in ihrem Wagen, dicht am Baume mit weit offenen großen Augen, einen jeden anlachend und ihre Spielsachen energisch um sich werfend oder in den Mund steckend.«33
Wolfgang
28. Juni 1919. Vertrag von Versailles. Eigentlich hätten die Wagners jetzt ihren Frieden mit der jungen Republik schließen können. Denn sogar der sozialdemokratische Reichspräsident Philipp Scheidemann war empört über »dies dicke Buch, … mit dem einem ganzen großen Volke die Zustimmung zur erbarmungslosen Zerstückelung abgepreßt werden soll(te)!«34 Aber die Wagners kannten nur Schwarz oder Weiß. Freund oder Feind. Die Republik war ihr Feind und die Sozialdemokratie ein Produkt jüdisch-bolschewistischen Ungeistes. Punktum.
August 1919. Schon wieder ein Kind. Cosima ist stolz. »Es wurde mir wieder ein Enkel geschenkt«, schreibt sie an einen fürstlichen Freund. »Er soll Wolfgang Manfred Martin heißen, demnach unter dem Schutzpatronat von Goethe, dem Hohenstaufen und Luther stehen; mit Rührung betrachte ich dieses kleine Wesen, dessen Entwicklung ich nicht erleben soll, das aber – ich bin dess’ sicher! – in ernster Stunde meinen Segen über sich fühlen wird.«35 Es war eine schwere Geburt nach vielen Stunden der Qual für die Mutter. Dazu die Angst um das Kind, das in Steißlage zur Welt kam und fast erstickt wäre. Kaum zu Hause, bekam es Lungenentzündung, während draußen eine schwere Grippe-Epidemie tobte, die vierte oder fünfte in diesen Jahren. Und trotzdem ging Winifred, kaum dass sie abgestillt hatte, wieder auf Konzertreise mit Siegfried. Offenbar hatte sie Angst. Mehr denn je. Denn seit dem »Zusammenbruch« der alten Ordnung gab es in jeder größeren Stadt Bars, Kneipen und Kabaretts, in denen Kokain, Morphium und Absinth konsumiert wurden und in denen Sex zwischen Männern kein Tabu mehr war, auch wenn das Gesetz ihn noch immer streng untersagte.
Doch ähnlich wie Cosima, die sich immer zwischen Mann und Kindern hin- und hergerissen fühlte, fiel es ihr schwer, diese Reisen zu genießen. Sie quälte sich mit Ängsten um ihre Babys, während die Musik, die Siegfried dirigierte, wie im Traum an ihr vorbeirauschte: »Sonnenflammen«, »Der Bärenhäuter«, »Banadietrich« und das furchterregende »Schwarzschwanenreich«, diesmal ohne verkrüppelten Kinderarm … Wolfgang, ihr Jüngster, habe zwar etwas zugenommen, sehe aber merkwürdig blass und elend aus, schrieb sie an Doktor Schweninger.36 Bis sie es nicht mehr aushielt, nach Bayreuth zurückkehrte und Siegfried den Rest der Reise allein machen ließ.
Das Kind war in alarmierendem Zustand. Brechdurchfall. Apathie. Fast ein Pfund Gewichtsverlust. »Er ist sehr abgemagert und sieht nicht wie ein Viertel Jahr aus, sondern wie vier Wochen.«37 Schweninger eilte von München nach Bayreuth, nahm sich ein Zimmer im »Anker« und kümmerte sich tage- und nächtelang um den kleinen Jungen, der ohne sein Eingreifen wahrscheinlich gestorben wäre.
Warum schweigt Bayreuth?
»Warum schweigt Bayreuth im Sommer 1920?«
Siegfried explodierte, wenn man ihm diese Frage stellte, und nannte in verschiedenen offenen Briefen die Gründe: Kohlennot, Wohnungsnot, Zwangseinquartierungen, Mangel an Unterkünften, Rationierung der Lebensmittel. Wie sollte man die Festspielgäste unterbringen, wie sie ernähren?
Umso größer die Provokation, dass ausgerechnet jetzt, im Krisensommer 1920, das Konkurrenzunternehmen der Salzburger Festspiele eröffnete. Und dass dabei wieder einmal die »Juden« das Sagen hatten: Max Reinhardt als Intendant und Hugo von Hofmannsthal, dessen »Jedermann« aufgeführt wurde. Wie war es möglich, dass man in Salzburg schaffte, was in Bayreuth unmöglich schien? Doch nur mit »jüdischem« Kapital, »jüdischer« Vetternwirtschaft, »jüdischer« Schieberei! Schon seit längerem spricht man in Wahnfried von einem gewissen Hitler, der im Februar 1920 im Münchener Hofbräuhaus aufgetreten ist und vor mehr als zweitausend Zuhörern das Parteiprogramm der NSDAP verkündet hat: Befreiung vom Versailler Diktat, Anschluss Österreichs an Deutschland, Rückerwerb Südtirols und der Kolonien, nieder mit dem jüdischen Kapital, mit der Republik, mit den Juden.
»Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Staatsbürger kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.«38
Das ist genau das, was man auch in Wahnfried denkt. Man wird Hitler und seine Leute wohlwollend beobachten.
2. Dezember 1920. Geburt von Verena, ein besonders niedliches, blondes Kind, viel hübscher als die robuste, lebhafte Friedelind, die schon jetzt so laut ist, dass man sie »Krachlaute« nennt. Winifred hätte gern noch mehr Kinder gehabt. Doch Siegfried sagt, er habe nun seine Pflichten erfüllt, und verlässt das Eheschlafzimmer, worauf Winifred aufhört, auf ihr Gewicht zu achten, und sich in ein walkürenhaftes Kolossalweib verwandelt.
Und trotzdem. Der Mythos von der heilen deutschen Familie wird hochgehalten. Gerade jetzt. Wozu gut passt, dass alle Kinder bis auf Wieland semmelblond sind. Ein Fotograf wird engagiert, das ganze Quartett im Wahnfried-Park aufgenommen. Friedelind, vollmondgesichtig, mit dem Baby auf dem Schoß. Wolfgang blondgelockt wie ein Engel, unsicher lächelnd. Wieland im Hintergrund. Er hat einen dunklen, mädchenhaften Pagenkopf mit langem Pony, trägt ein weißes Matrosenkleid über kurzen Hosen, sieht feiner und aristokratischer aus als die anderen, aber auch ein bisschen beleidigt und irritiert, so, als wisse er gar nicht, was er eigentlich auf dem Foto verloren hat. Aber egal. Man wird Postkarten drucken lassen und in alle Welt schicken, um für das arische Unternehmen der »Wagners« zu werben. Denn man braucht Geld, viel, viel Geld. Mit Kindern und Dienstboten umfasst die Familie fünfzehn Personen. Siegfried macht Konzertreisen über Konzertreisen, Berlin, Stockholm, Bergen, Kopenhagen, auf denen Winifred ihn nur noch selten begleitet. Es hat ja doch keinen Zweck und ist viel zu teuer. Deshalb ermahnt sie ihn, nur ja recht sparsam zu sein. Nicht ins Gasthaus zu gehen, sondern bei Freunden oder im Hotelzimmer zu essen. Sie behandelt ihn wie ein Kind, schickt ihm »Fressalien« nach, Sandwiches, Würste, Kuchen, Marmelade. Er soll alles aufessen oder verschenken. Keinesfalls wegwerfen. »Solltest Du was an Wurst übrig behalten, bring es ja wieder mit …, denn wir sind selber sehr knapp dran!«39
Chinesen, Juden und »Neger«
Um diese Zeit wurde Siegfried Wagner von einem harten Kern fanatischer Wagnerianer bedrängt, eine »deutsche Festspiel-Stiftung Bayreuth« zu gründen, die sich im Mai 1921 in Leipzig konstituierte. Um die Wiedereröffnung der Festspiele zu finanzieren, beschloss man, für Patronatsscheine zu werben, und brachte dazu einen Aufruf in Umlauf, in dem es hieß, dass Wagners Schaffen, der »reinste, erhebendste Ausdruck germanisch-deutscher Volksart«, unter den »Trümmern des Zusammenbruchs« begraben liege und nur von wahrhaften Deutschen gerettet werden könne, was im Klartext heißen sollte: nicht von Juden.40 Der Chefredakteur der rechtsradikalen »Deutschen Zeitung«, August Püringer, forderte sogar einen regelrechten »Arierparagraphen«, wie es damals »bei vielen deutschen Vereinen üblich war«.41 Das war zu viel. Zumindest für Siegfried Wagner. Er war zwar, was »die« Juden betraf, ganz der Sohn seiner Eltern und pflegte von Jugend an Antisemitismen von sich zu geben,42 hatte aber auch enge jüdische Freunde wie den Musikschriftsteller Ludwig Karpath oder den Bankier Eduard Speyer.43 Deshalb beeilte er sich, Püringer einen offenen Brief zu schreiben, in dem es hieß, Richard Wagner habe die Juden in seinen Schriften immer wieder »angegriffen und beleidigt«. Umso schöner sei es, dass sie seine Musik trotzdem verehrten und sich freundschaftlich hinter die Bayreuther Sache stellten. Es sei weder »menschlich«, noch »christlich«, noch »deutsch«, ihnen die Tür zu verschließen, sie auszugrenzen. Im Bayreuther Festspielhaus gebe es keinen Rassismus, auch nicht, was die Auswahl der Künstler angehe. Ob ein Mensch »Chinese, Neger, Amerikaner, Indianer oder Jude« sei, spiele für ihn keine Rolle.
Friedelind las diesen Brief erst, als ihr Vater längst tot war. In ihrem »ungeheuren Gerechtigkeitssinn«44 war sie sehr stolz darauf und zitierte ihn immer wieder als Beleg für seine Judenfreundlichkeit. Sie übersah allerdings, dass er am Schluss doch wieder antisemitische Töne anschlug und seine Lieblingsthese von der jüdischen Vetternwirtschaft und der Dominanz der Juden im Opernbetrieb anbrachte: »Wenn ich Jude wäre, würden meine Opern in allen Theatern aufgeführt werden. Wie die Dinge aber nun liegen, müssen wir warten, bis wir tot sind.«45
Barfuß in Bayreuth
Friedelind war vier, als die Familie aus dem Junggesellenhaus wieder nach Wahnfried umzog, das, endlich beheizbar, von Winifred in den alten, gepflegten Zustand zurückversetzt worden war, im Zentrum der große Saal mit Wagners Flügel, Schreibtisch und Bibliothek. Rundherum Kinderzimmer, Ankleideräume, Bäder, Bügelzimmer, Speisezimmer, gusseiserne Wendeltreppen und sogar ein Aufzug, der die im Souterrain liegende Küche mit dem Esszimmer verband. Da der »Meister« ein großer Hundefreund gewesen war, lebten fast immer Hunde im Haus, die, kaum dass sie tot waren, durch neue ersetzt wurden. Der amtierende Hund von 1922 war der Skye-Terrier Putzi, Vertreter einer edlen englischen Rasse, die schon von Queen Victoria geschätzt worden war.
Friedelind beschreibt Wahnfried als Kindheitsparadies, in dem ihre Geschwister und sie sich mit Hühnern, Pferden und Hunden balgten, Nachlaufen an Wagners Grab spielten oder die Gäste ärgerten. Manchmal durften sie mit der Omama Doktor spielen, ihr den Puls fühlen, sie mit Teelöffeln füttern, ihr das weiße Haar öffnen und kämmen, durften in dem großen, zweistöckigen Salon herumtollen, zwischen Marmorstatuen von Lohengrin, Siegfried, Tannhäuser, Tristan, Stolzing und Parsifal, an denen sie ihre Jacken, Mäntel und Mützen aufhängten. »Wir taumelten glücklich durch unsere sorglosen Tage, bezaubert, doch nie in Furcht versetzt durch unsere atemberaubenden Vorfahren.«46
»Bunter Hund in Bayreuth.« So hat Friedelinds Neffe Gottfried mir einmal seine Kindheit in Wahnfried beschrieben. Immer etwas Besonderes, eine Ausnahme sein, immer von den Bürgern der Stadt beachtet werden. Keine »normale« Entwicklung möglich. So ähnlich ging es auch Friedelind und ihren Geschwistern. Sie waren berühmt und berüchtigt, weil sie barfuß auf der Straße herumliefen, sich mit Leidenschaft prügelten und ein raues, oberfränkisches Bauerndeutsch sprachen, das so gar nichts vom Geist Richard Wagners zu atmen schien. »Man erzählt sich von den Kindern Anekdoten wie von königlichen Prinzen früher«, schrieb die Neu-Bayreutherin Lotte Warburg in ihr Tagebuch. »Die Geschäfte preisen etwas an, indem sie nicht sagen ›Seine Königliche Hoheit hat es genauso … bestellt‹, sondern … ›mein Junge hat sich heute furchtbar geprügelt mit dem kleinen Wagner‹.«47
Ein junger Gast, Erich Ebermayer, Rechtsanwalt und Erfolgsautor aus gutem Hause, war entsetzt über das Benehmen der Kinder, denen jede Erziehung, jede »gute Stube« zu fehlen schien. Friedelind sei die Schlimmste gewesen, laut und rechthaberisch, ohne Respekt vor Fremden, mit Tischmanieren, die jeder Beschreibung gespottet hätten. »Der Gast«, heißt es bei ihm, »ist ein Freund Siegfrieds. Er erlaubt sich an diesem Mittag eine kritische Bemerkung zu einem Inszenierungsplan, den Siegfried ihm eben dargelegt hat. Er hat seine Bemerkung noch nicht zu Ende gebracht, als die Neunjährige an seiner Seite ihm haltlos und wütend einen Löffel heißer Suppe ins Gesicht schleudert. Der Gast erklärt Siegfried empört, dass er nicht neben einem Kind zu sitzen wünsche, das sich derart bei Tisch benähme. Aber Siegfried straft Friedelind nicht. Er lächelt. Er beruhigt den Gast. Er meint, es sei doch reizend, wie Friedelind für ihren Vater eintrete. Die Neunjährige triumphiert und duckt sich erst unter dem strafenden Blick Winifreds.«48
Siegfried hatte keine ausgeprägte Beziehung zu seinen Söhnen, vielleicht weil er Angst hatte, dass sie ihn eines Tages als Künstler überflügeln könnten. Umso mehr liebte er seine älteste Tochter, seine Friedelind, die zwar bei weitem nicht so anmutig und »schön« wie Verena war, aber in erfrischender Opposition zu ihrer Mutter stand und fast immer lachte und gute Laune hatte. So kam es, dass er sie zu seiner engsten Vertrauten machte und ihr Dinge erzählte, die viel zu hoch für sie waren, über seine Reisen, seine Jugendträume, seine Kompositionspläne und seine Libretti, vielleicht auch über seine Probleme mit Winifred. Es war die Zeit, in der sie vorhatte, ihren Vater zu »heiraten«, eine Idee, der er offenbar nicht widersprach. »›Eines Tages wirst du die Festspiele führen‹«, zitiert sie ihn in ihrem Buch. »… ›Natürlich‹, stimmte ich zu. ›Willst du mich nicht heiraten?‹ Es war nicht einfach, mir zu erklären, warum ein kleines Mädchen seinen Vater nicht heiraten kann.«49
Hitlers Antrittsbesuch
Frühjahr 1923. Inflationszeit. Ein Pfund Brot kostet 1254 Mark, eine Eisenbahnfahrt von Köln nach Berlin 924 000 Mark. »Zum ersten Male«, notiert der Bayreuth-Chronist Herbert Conrad, »weilt der Führer noch als Unbekannter … in Bayreuth und wohnt im Hotel Anker. Vor dem ›Anker‹ erwartet ihn eine große Menschenmenge, nimmt ihn begeistert in Empfang und geleitet ihn im Triumphzug zum Parteilokal. Das geräumige Gastzimmer kann … die Menschen nicht fassen, die ihren Führer … hören wollen. Sie stehen noch dichtgedrängt vor dem Haus in der Kanzleistraße.«50
Friedelind schreibt, es sei schon damals, »an einem strahlenden Maimorgen des Jahres 1923«,51 gewesen, als Hitler zum ersten Mal in die Villa Wahnfried kam. Nach Winifreds Aussagen und den Ermittlungen der Spruchkammer im Verfahren gegen sie war es aber erst im Herbst, genauer: am 1. Oktober.
Angenommen also, es sei im Oktober gewesen, einen Tag nach dem »Deutschen Tag«, an dem die Bayreuther auf die Leopoldshöhe pilgerten, um der Opfer des Ersten Weltkrieges zu gedenken. Hitler hatte abends in der markgräflichen Reithalle gesprochen und danach den todkranken Houston Stewart Chamberlain besucht, dessen Büchern er zentrale »Einsichten« zum Thema »Rasse« verdankte. Für den nächsten Tag hatte er sich bei den Wagners zum Frühstück angemeldet. Was dann geschah, liest sich bei Friedelind so:
»Ein junger Mann sprang aus dem Wagen und ging auf uns zu. Er sah recht gewöhnlich aus in seinen kurzen bayerischen Lederhosen, den dicken Wollsocken, einem rotblau karierten Hemd und einer kurzen blauen Jacke, die um seinen mageren Körper schlotterte; … Er schüttelte Mutter … die Hände und folgte schüchtern … in das Musikzimmer und in die Bibliothek. Voll Ehrfurcht starrte er auf die kristallene Opiumpfeife, die Cosima geschenkt worden war; er blieb vor einer Schmetterlingssammlung stehen, die Richard Wagner in Neapel auf der Straße gekauft hatte, betrachtete lange die Platte von Großvaters letzter photographischer Aufnahme, die gegen das Licht aufgehängt war.«
Erst im Garten habe er sich ein wenig freier gefühlt und von seinen politischen Plänen gesprochen, unter anderem von einem Staatsstreich, den seine Partei für Ende des Jahres plane, um der Weimarer Republik ein Ende zu machen. Dabei sei seine Stimme lebhafter und lauter geworden, während ihre Geschwister und sie ihn umringt hätten wie ein Kreis »kleiner, verzauberter Vögel«.52
Staatsstreich
9. November 1923. Der geplante »Staatsstreich«, von dem Hitler den Wagners erzählt haben soll, wird Realität. Es ist der Marsch auf die Münchener Feldherrnhalle, der Hitler-Ludendorff-Putsch, der Versuch, die Weimarer Republik zu stürzen. Für den nächsten Tag war ein Konzert im Odeon-Saal geplant, ein reines Wagner-Konzert mit Werken von Vater und Sohn. Winifred und Siegfried waren in der Stadt, als der Putsch losging, wohl kaum zufällig, meinen kritische Stimmen, ein Verdacht, den Winifred selbst genährt hat, indem sie später vor dem Richard-Wagner-Verband deutscher Frauen erklärte: »Der 8. November sollte ja der Auftakt zur nationalen Revolution und der Umkehr werden. (Siegfried sollte) das Festkonzert dirigieren und war mit mir zu den Proben in München!«53 Gegen diese Version spricht allerdings, dass ein großes Konzert mit Proben und Pressearbeit Monate Vorlaufzeit braucht, besonders, wenn international gefragte Solisten mitwirken wie in diesem Fall der dänische Heldentenor Lauritz Melchior.
Doch wie auch immer: Aus dem Konzert wurde nichts. Denn unmittelbar nach der Hauptprobe kam es zum Schusswechsel zwischen Putschisten und Polizei. Siegfried und Winifred waren dabei, als das Feuer eröffnet wurde.
Es habe ein riesiges »Durcheinander« geherrscht, schreibt Friedelind, die Berichte ihrer Eltern zusammenfassend. Sie hätten nicht gewusst, was mit Hitler und Ludendorff, den beiden Anführern, geschehen sei. Winifred sei nach dem Putsch wieder zurück nach Bayreuth gefahren, Siegfried aber über die Grenze nach Innsbruck, wo der ebenfalls beteiligte Hermann Göring schwer verletzt in einem Krankenhaus lag und von »seiner schönen schwedischen Frau«54 gepflegt wurde. Siegfried habe den beiden, die völlig mittellos gewesen seien, Geld geliehen, damit sie weiterreisen und ihre Rechnungen bezahlen konnten. »Dies war meines Vaters einziger Beitrag zur Nazi-Bewegung.«55
Auch Siegfried reiste weiter und las in vielen Städten aus seinen »Erinnerungen«, die gerade erschienen waren, eine Hommage an die homoerotische Liebe und seinen Jugendfreund, den Maler und Komponisten Clement Harris, mit dem er als junger Mann eine Schiffsreise nach Südostasien gemacht hatte.56 In seiner schwülen, exotischen Poesie und seiner erstaunlichen Offenheit lässt der Text viel von der Zerrissenheit seines Autors ahnen, die er selbst allerdings heftig bestreitet. Winifred dürfte sich kaum darüber gefreut haben, dass die Kinder und sie nicht einmal en passant darin vorkamen, sondern nur im Schluss-Satz kurz erwähnt wurden: »Ich freue mich meiner schönen, heiteren, klugen Gattin, ich freue mich über die vier Kinderchen, ich freue mich, dass ich zur Heimat eine solche hübsche, gemütliche Stadt wie Bayreuth habe.«57
Winifred fuhr also zurück in die »hübsche, gemütliche Stadt« und verteilte Flugblätter, auf denen sie leidenschaftlich für Hitler warb, hielt Volksreden im »Lokal der Hitlerleute«, wurde von der Polizei gewarnt, sich politisch zu exponieren, tat es trotzdem und schrieb sogar einen offenen Brief, in dem sie erklärte, dass »die« Wagners immer zu Hitler halten würden, ob in Tagen des Glücks oder in Tagen der Not.58 Hitler war inzwischen verhaftet worden und saß bis auf weiteres in der Festung Landsberg am Lech ein, wo er mit anderen Putschisten auf seinen Prozess wartete. Zuerst schickte Winifred ihm Geld, Kleider und Süßigkeiten. Dann aber hatte sie eine bessere Idee, ihm nämlich Papier, Bleistifte, Federn, Tinte und Radiergummis zu stiften, so dass er den ersten Band von »Mein Kampf« schreiben konnte. Friedelind und ihre Geschwister halfen beim Einpacken und freuten sich an den vielen bunten Päckchen, die so aussahen, als habe der Weihnachtsmann sie gerade gebracht.59
Und Siegfried? Er war hin- und hergerissen. Einerseits beeindruckt von der Courage seiner jungen Frau, anderseits bestürzt über ihren fanatischen Ton, der jede Vorsicht vermissen ließ und der empfindlichen Bayreuther Sache nur schaden konnte.60 »Das war jetzt schon mehr als kindliche Spielerei«, resümiert Friedelind. »Er wusste, dass er Mutter eigentlich veranlassen müsse, ihre Beziehungen zu den Nazis aufzugeben, konnte jedoch nicht streng mit ihr sein. Er machte aber damals die einzig bittere Bemerkung, die ich je von ihm gehört hatte: ›Winnie vernichtet alles, was ich so verzweifelt aufzubauen versuche.‹«61
Mutter und Tochter
Als die Eltern im Januar 1924 eine große Amerika-Reise machten, wurde Friedelind zu Freunden nach Dresden geschickt, dem bekannten Musikwissenschaftler Eugen Schmitz und seiner Frau, die sie nach Kräften verwöhnten. Bei ihrer Rückkehr erwartete sie der erste schwere Verlust ihres Lebens. Putzi war tot. Putzi, ihr geliebter Skye-Terrier, war im Springbrunnen des Wahnfried-Gartens ertrunken. Sie weinte tagelang und begrub ihn am hinteren Ende des Wahnfried-Gartens in der Nähe von Wagners Grab, wo auch Russ, Wagners Lieblingshund, der Neufundländer »ruht(e) und wacht(e)«. Bruder Wolfgang fragte ergeben, ob er ihr helfen dürfe zu graben.62 Noch verstanden die beiden sich gut. Aber das würde nicht immer so bleiben.
Schöne und traurige Kinderspiele. Eine Zeit, die sich ihrem Ende näherte. Denn Friedelind wurde in diesem Jahr eingeschult und lernte den so genannten Ernst des Lebens kennen, stillsitzen, beten, Gedichte aufsagen, Aufgaben machen – das alles war einem freiheitsliebenden Kind wie ihr zuwider. Zuerst arrangierte sie sich noch und bekam gute Noten. Doch nach einiger Zeit geriet sie in die klassische Wagner-Falle: Einerseits war sie stolz auf ihren Status als »Enkelin«, der ihr das Gefühl gab, sich nicht anstrengen zu müssen. Andererseits wollte sie einfach nur »Friedelind« sein, nicht aus der Reihe tanzen, Freundinnen haben, die üblichen kleinen Scharmützel mit Lehrern ausfechten und genauso hart angefasst werden wie die anderen. »Es ist abscheulich«, zitiert sie sich selbst, »wie Sie Ihre Bosheit an den Kindern auslassen, die sich nicht wehren können … Warum lassen Sie Ihre Bosheit nicht an mir aus?«63
Die Bayreuther Grundschullehrer waren ratlos und überfordert. Winifred auch. Siegfried mischte sich wie immer nicht ein und überließ die »Erziehungsgewalt« seiner Frau. Was sollte sie nur machen mit dieser Tochter, die immer wilder, immer schwieriger, immer dicker wurde, ein breites Bauerngesicht und so krause Haare hatte, dass man sie nicht einmal anständig kämmen konnte?
Die Tanten, Daniela und Eva, fühlten sich durch das wilde Kind an Isolde, ihre verstorbene Schwester, erinnert und sagten hinter vorgehaltener Hand: »Genau wie Loldi!« Winifred aber wurde manchmal von blinder Wut gepackt, nahm ihr das Fahrrad ab, mit dem sie so gern durch Bayreuth fuhr, rief bei jeder Gelegenheit strafend »Mausi!« und wiederholte an ihr, was sie selber im Waisenhaus von East Grimstead »gelernt« hatte, strenge Züchtigungen, ein rigides Ess-Regime, Liebesentzug und ein ganzes Sortiment immer wieder neuer Demütigungen, bis hin zur Aussperrung bei Wasser, Brot und eisigem Schweigen.64
Opernfieber
Am 22. Juli 1924 wurden die Festspiele wiedereröffnet, so dass Winifred Tag und Nacht in Aktion war. Siegfried überließ ihr die Verwaltung des spärlichen Etats, die Verhandlungen mit Dirigenten und Sängern, die Einladung der Presse und die Unterbringung der großenteils honorarfrei agierenden Künstler. Er selbst versuchte, immer höflich und freundlich zu bleiben. Wenn geschimpft werden musste, schickte er sie vor. Er hielt das nicht aus. »Alleine macht ihn das zu kaputt«,65 schrieb Winifred an eine Freundin. So hatte sie keine Zeit, strafend nach ihrem schwarzen Schaf »Mausi« zu rufen, das unbeaufsichtigt im Festspielhaus herumtollte und vom Theater- und Opernfieber erfasst wurde. Sie wollte nicht, wie andere Kinder, Arzt, Lokomotivführer oder Eisenbahnschaffner werden, sondern Wagner-Regisseurin. Nichts anderes. Sie liebte das Festspielhaus, »dieses einfache, rote Backsteingebäude zwischen den Tannen«, das nach Wagners Entwürfen gebaut war, die Unruhe vor Probenbeginn, das Hämmern der Schreiner, die Geschäftigkeit der Anstreicher, den Geruch nach frischer Farbe und Terpentin.66 »Eine Wagner« zu sein, sei damals ihre »Nationalität«, ihre »Religion« gewesen, schreibt sie später an Toscanini. »Mein ›Land‹ war immer Bayreuth – so lächerlich wie das klingen mag … Wenn ich ein Kind hätte, würde ich es genauso erziehen und würde mich enttäuscht fühlen, wenn es … ›unwagnerisch‹ würde.«67
In Miniatur-Kostümen, die Tante Daniela in Auftrag gegeben hatte, lief sie als Fricka, Freia oder Brünnhilde durch den Wahnfried-Garten, führte mit Bruder Wolfi Gäste an Wagners Grab und kassierte zehn Pfennig dafür, beschimpfte den dänischen Heldentenor Lauritz Melchior als »Fettschwein« und bestaunte die vielen »Rolls Royces und Daimlers«, die man plötzlich in den Straßen der Stadt sah.68 Eins aber störte sie. Dass immer nur Richard Wagner aufgeführt wurde, niemals Siegfried