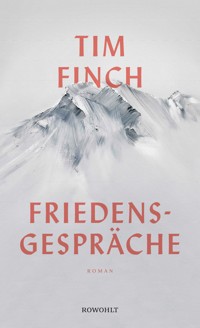
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Friedensverhandlungen auf dem Zauberberg: Edvard Behrends ist ein erfahrener Diplomat, hochgeschätzt für sein Geschick, Friedensabkommen zu vermitteln, egal wie verhärtet die Positionen sind. Nun soll er Frieden stiften zwischen zwei Bürgerkriegsparteien aus dem Nahen Osten, mit denen er in einem abgelegenen Berghotel in den Tiroler Alpen festsitzt. Doch die frische Bergluft zeigt keine heilende Wirkung, die Verhandlungen gehen nur schleppend voran, und die verfeindeten Fraktionen drohen immer wieder mit ihrem Abbruch. Echter Fortschritt ist eine Hoffnung, aber noch nicht in Sicht. Zuflucht sucht Edvard in der Musik, der Natur, der Literatur – und bei Anna, die für ihn alles bedeutet, mit der er sich verbunden fühlt wie mit niemandem, die omnipräsent ist und so quälend abwesend. «Tim Finch hat einen wundervollen Roman geschrieben, so knapp wie gewaltig, so humorvoll wie traurig. Auf eindringliche Weise verzeichnet er, was es bedeutet, Frieden zu schließen, mit anderen ebenso wie mit sich selbst.» Colum McCannn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tim Finch
Friedensgespräche
Roman
Über dieses Buch
Friedensverhandlungen auf dem Zauberberg: Edvard Behrends ist ein erfahrener Diplomat, hoch geschätzt für sein Geschick, Friedensabkommen zu vermitteln, egal, wie verhärtet die Positionen sind. Nun soll er Frieden stiften zwischen zwei Bürgerkriegsparteien aus dem Nahen Osten, mit denen er in einem abgelegenen Berghotel in den Tiroler Alpen festsitzt. Doch die frische Bergluft zeigt keine heilende Wirkung, die Verhandlungen gehen nur schleppend voran, und die verfeindeten Fraktionen drohen immer wieder mit ihrem Abbruch. Echter Fortschritt ist eine Hoffnung, aber noch nicht in Sicht. Zuflucht sucht Edvard in der Musik, der Natur, der Literatur – und bei Anna, die für ihn alles bedeutet, mit der er sich verbunden fühlt wie mit niemandem, die omnipräsent ist und so quälend abwesend.
«Tim Finch hat einen wundervollen Roman geschrieben, so knapp wie gewaltig, so humorvoll wie traurig. Auf eindringliche Weise verzeichnet er, was es bedeutet, Frieden zu schließen, mit anderen ebenso wie mit sich selbst.» Colum McCann
Vita
Tim Finch war Pressechef beim führenden Thinktank IPPR, vorher beim Refugee Council. Er arbeitete als Journalist bei der BBC, als Korrespondent in Westminster, und schreibt u.a. über Migrationsfragen. Heute lebt er als freier Schriftsteller in London.
Johann Christoph Maass, geboren 1973, war Schlagzeuger, bevor er Literaturwissenschaften studierte. Er arbeitet als freier Übersetzer in Berlin. Zuletzt hat er Bücher von Jonathan Lethem, Howard Jacobson, Antonio Ruiz-Camacho und Tom Perrotta übertragen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «Peace Talks» bei Bloomsbury Publishing, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Peace Talks» Copyright © 2020 by Tim Finch
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Conrad Jon Godly
ISBN 978-3-644-00277-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Claudia
Ich bin der Welt abhandengekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben.
Sie hat so lange von mir nichts vernommen,
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben.
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält.
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.
Ich bin gestorben dem Weltgewimmel,
Und ruh in einem stillen Gebiet.
Ich leb in mir und meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied.
friedrich rückert, Ich bin der Welt abhandengekommen
Aus der Welt gekugelt
Jeden zweiten Tag absolviert eine Gruppe von uns frühmorgens, gleich als Erstes, dieselbe Fünf-Kilometer-Runde. Sie ist gewissenhaft ausgeschildert und, gerade noch eben so, als «moderat» klassifiziert: Die anspruchsvolleren Abschnitte werden von längeren, gemütlicheren abgelöst.
Am Treffpunkt wird stets erhebliches Aufhebens gemacht, um Schnürsenkel, Fleecepullis, Gehstöcke und Energieriegel. Aber von dem Augenblick an, in dem wir uns anschicken, das Schneefeld hinter dem Hotel zu queren, löst sich Gereiztheit in nichts auf. Im Knirschen der Stiefel auf der Schneedecke drückt sich das Hochgefühl aus, das uns alle erfüllt, ausgelöst davon, draußen zu sein in der makellosen Kälte des frühen Morgens, hoch oben in den Bergen Tirols.
Wir machen die Runde nur dann nicht, wenn weißer Nebel die Welt vor unseren Augen auslöscht, was gnädigerweise nicht häufig vorkommt, denn an diesen Tagen laufen die Verhandlungen nie so gut wie sonst. Dann frühstücken wir eher spät, versteckt hinter den Seiten der International Herald Tribune, der Times, der Frankfurter Allgemeinen und anderen Zeitungen. Es war Baudelaire (ich habe es im Netz nachgesehen), der sich über diesen «widerlichen Aperitif» mokierte, den «der zivilisierte Mensch jeden Tag zu seiner Morgenmahlzeit» genieße. «Sittlichkeitsdelikte, Folterungen (…), ein Rausch von allgemeiner Grässlichkeit.» Recht hat er, aber das Wort Aperitifhat mich stets irritiert. Zum Frühstück? Als symbolistischer Dichter womöglich.
Vielleicht um Baudelaire Respekt zu zollen, ziehen einige von uns von Zeit zu Zeit ein Buch der Zeitung vor, trotz der Schwierigkeit, es beim Essen aufgeschlagen zu halten. Auch ausgeklügelte Arrangements mit Salz- und Pfefferstreuern, French-Press-Kannen, Milchkännchen und unbenutztem Besteck funktionieren eigentlich nie so richtig. Das gebundene Buch kommt hier zu seinem Recht, wie ich finde, mit seiner besseren Aufschlagbarkeit gewissermaßen, während das Taschenbuch, im Bett so praktisch, für den Frühstückstisch einfach zu leicht ist. Was die aktuellen Lektüren betrifft: Ich habe gesehen, was dich freuen wird, dass mehr als ein Exemplar des Zauberberg in Angriff genommen wurde (wir sind ein berechenbarer Haufen), einschließlich eines, und hier copy und paste ich erneut, .
(Es war einer der jüngeren Kollegen, der mich darauf hinwies. Ich bin so weit entfernt davon wie eh und je, des Arabischen mächtig zu sein, leider, eindeutig ein Nachteil in diesem Metier, ungeachtet meines nominellen Standings. Fortwährend frage ich mich: Wie lange noch, bis mir die Puste ausgeht? Und was folgt dann? Der Ruhestand in irgendeiner Form, denke ich mal; einst eine semibehagliche Aussicht, mittlerweile allerdings eigentlich ausschließlich gefürchtet.)
Kein Vertreter der beiden Delegationen isst, läuft oder spricht mit uns außerhalb der formalen Sitzungen. Sie sind im Hotel in separaten Stockwerken untergebracht. Sie beten, ebenfalls getrennt, in eigens dafür vorgesehenen Räumen. Die Mahlzeiten nehmen sie im Hauptspeisesaal ein, aber in ausgewiesenen Bereichen an entgegengesetzten Enden. Ich achte genau darauf, beiden Parteien jeden Tag einen guten Morgen zu wünschen, und sie erwidern den Gruß respektvoll.
Um für einen Moment auf den Zauberberg zurückzukommen. Es irgendwann einmal zu erwähnen («Ich habe gesehen, dass Sie …») könnte sich bei dem betreffenden Verhandlungspartner als hilfreich erweisen: Kleine Dinge wie diese tun das manchmal. Doch die Tatsache, dass er ein so wunderbares Englisch spricht, und das so ostentativ, gibt mir zu denken. Sendet er mittels seiner Lektüreauswahl irgendein Signal? Und falls ja, welches?
Vermintes Gelände, wohin man schaut, Liebling, höre ich dich sagen.
Nachdem wir auf unserem Weg über das Schneefeld in Schwung gekommen sind, müssen wir auf einer kleinen Holzbrücke Vorsicht walten lassen, da die Holzbohlen vereist und daher tückisch sein können. Die Brücke kreuzt einen Bergbach, auch wenn seine Stromschnellen und Tümpel den Großteil der Wochen über, die wir hier sind, überraschenderweise eingefroren waren, als ob eine Winterhexe sie mit ihrem Zauberstab berührt hätte.
Aber lass mich das «als ob» mal gleich wieder streichen. Dass dahinrauschendes Wasser in eine solche lautlose Schockstarre versetzt werden kann, ist nicht einfach schnöder Vereisung geschuldet, sondern ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier Magie am Werk ist. Dann, so ist der Lauf der Dinge, führt uns der Pfad in eine abgezirkelte Fichtenschonung, der so gar nichts Magisches innewohnt. Die Bäume sind nummeriert, und es riecht nach Sägeschuppen und Holzhandlung. Dann überqueren wir eine asphaltierte Straße, und vor einer Reihe moderner Chalets stehen BMWs und VWs mit Skiern und Snowboards auf den Dachgepäckträgern.
Aber das ist es dann auch gewesen. Danach führt unser Weg fort vom Glitter des Resorts, hinein in wildere Kiefern- und Tannenwälder, hin zu einem der steileren, felsigeren Anstiege, bis wir nach einer gewissen Zeit die Baumgrenze des Berges erreichen und mit einem atemberaubenden Panorama von Wipfeln belohnt werden. Die dünne Luft prickelt in den Lungen und brennt im Gesicht. Der Himmel ist sattblau, einzig die sich verflüchtigende Spur eines Flugzeugs sorgt für einen hauchzarten Streifen himmelblauer Tönung.
«Chef», sagt jemand, klopft mir mit einer schweren Bärentatze auf die Schulter.
«Ja?», sage ich.
Der Bann muss stets gebrochen werden.
«Nicht übel, der Blick, oder?»
Wie gesagt.
Meine Dauerpräsenz in der Wandergruppe – ich habe nicht einen Tag gefehlt – tut dem Gemeinschaftsgefühl keinen Abbruch, davon bin ich überzeugt. An Morgen, an denen ausgelassenere Stimmung herrschte, habe ich mich an den Schneeballschlachten beteiligt und mich wie die anderen mit dem hinter der Theke geklauten Metalltablett an dem Hang mit der siebenprozentigen Neigung versucht. Mein Purzelbaum in eine Tiefschneesenke hat für erhebliche Belustigung gesorgt. Dennoch trifft es zu, dass ich versuche, kein Teil jener losen Grüppchen zu sein, die sich formieren und auflösen, die plaudern und lachen, während wir den Berg hinaufsteigen. Ich bleibe lieber etwas zurück oder gehe voraus, in Gedanken versunken. Und natürlich muss man sich in gewissem Maß seiner Funktion, seiner Position bewusst sein, selbst eingemummt auf dem Berg. Eine gewisse Distanz muss immer gewahrt bleiben.
Ich bringe dich zum Lachen, ich merke schon. Na denn, sehr gut, denn du solltest nicht auch nur einen Augenblick lang denken, dass ich deprimiert sei oder einsam. Natürlich vermisse ich dich. Permanent.
Der höchste Punkt unserer Wanderung ist erreicht, wenn wir bei der kleinen Kapelle ankommen – und dort ein paar Minuten lang Pause machen –, die dort steht, wo sich der ausgewiesene Pfad gabelt, wobei die andere Route zum Pass über den Berg und hinein ins nächste Tal führt.
An einem Samstag schlugen einige von uns diesen Pfad ein, wir hielten uns dabei für sehr wagemutig. Was würden wir auf der anderen Seite des zerklüfteten Kamms entdecken? Die Gipfelstation eines Skilifts, wie sich herausstellte. Mit einer lärmenden Cafeteria, die an eine Autobahnraststätte erinnerte, umsäumt von einer Palisade aus grellbunten Skiern. Wir fuhren mit der Gondel hinab in das andere Resort und mussten dann eine Stunde lang mit dem Bus zurück in unser Dorf fahren. Die meiste Zeit über auf einer doppelspurigen Schnellstraße, in dichtem Verkehr und bei Schneeregen. Es war ein Rüstzeit-Tag.
Die Kapelle ist ein reizendes, rustikales Bauwerk. Sie steht unter einen Felsüberhang geduckt und hat ein gewelltes, mit Schindeln gedecktes Dach, geschmückt von einem einfachen Kreuz. Ansonsten ist es eine Holzhütte, durch die Jahreszeiten geschmackvoll verwittert. Im Innern stehen grobe Holzbänke und ein Tisch mit einem Holzkreuz, es gibt ein einzelnes Buntglasfenster, in abstraktem Design, in Gedenken an einen Mann aus der Gegend, der im Alter von nur 22 Jahren bei einem Autounfall starb. Außerdem brennt ein ewiges Licht, eine Öllampe, und das, wie es die Sitte will, permanent, bis ans Ende der Tage. Da jedes der tadellos gepflegten Gräber auf dem Friedhof der Dorfkirche allabendlich von einer Kerze beleuchtet wird, ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass jemand – vielleicht dieselbe Person – täglich den Berg hinaufwandert und sich auch um dieses einzelne Lichtlein kümmert. Doch wir haben nie auch nur eine Menschenseele bei der Kapelle gesehen, noch nicht einmal Stiefelabdrücke auf dem Pfad dorthin, bis auf unsere eigenen. Mit Skiern vielleicht?, schlägt jemand vor. Langlauf? Ich hingegen bevorzuge den Gedanken, dass es jemanden gibt, der will, dass wir dieses ewig brennende Licht für ein kleines Wunder halten und daran glauben.
Was immer wir auch glauben, wir alle halten einen Augenblick inne, um nachzudenken. In erster Linie über persönliche Dinge, aber auch, da bin ich sicher, über die Bedeutung unserer Mission. Von diesem Adlerhorst hoch oben über dem Resort können wir gerade so die Dächer des Hotels und des Tagungszentrums ausmachen. Von diesem Moment an beginne ich, mich immer aufs Frühstück zu freuen. Und auf die Aufgaben des Tages.
Der Abstieg hat dann eher ernüchternden Charakter, wohl kaum zu vermeiden. Aber das, wovon ich dir erzählen wollte, ereignete sich auf unserer heutigen Wanderung während des Abstiegs. Alle waren ziemlich gelangweilt. Nicht nur von der Wanderung, sondern auch davon, hier zu sein. Das Tauwetter begleitende Tropfgeräusche waren zu hören, was aber einzig den Effekt hatte, uns daran zu erinnern, wie lange diese Gespräche bereits schon andauern. Sich immer und immer wieder im Kreis drehen, an denselben Punkten beginnen und landen, aber trotz aller Anstrengungen nicht vom Fleck kommen … Ich habe damit zu kämpfen, merke ich.
Und da war es dann. Ein starkes Seil, festgeknotet an einem kräftigen Ast, der über eine tiefe Rinne hing, das felsige Bett durch eine weiche Schneedecke abgepolstert. Wir hatten das Seil vorher nie gesehen, dabei hätten wir es bei all den Malen, als wir die Stelle passiert hatten, nicht übersehen können. Ein paar Kinder aus der Gegend mussten es, winterlicher Aktivitäten überdrüssig und voller Vorfreude auf den Frühling, am Abend zuvor aufgehängt haben. Länger werdende Abende: noch so eine Sache.
Wir mussten es selbstredend in Beschlag nehmen: dieses unerwartete, angenehm aufregende, vor allem aber neue Element unseres frühmorgendlichen Ausgangs. Statt die Rinne mittels der Fußgängerbrücke zu überqueren, schwangen wir uns abwechselnd hinüber wie Tarzan. Einige von uns, vielleicht um sich Mut zu machen, stießen dabei sogar den Tarzan-Schrei aus.
Joooo-oddle-oddle-ooooooooo-joddle-oddle-ooooooo
Ein seltsames Geheul, wenn man es recht bedenkt, das doch eher alpin klingt denn affenartig, was eher den europäischen Wurzeln Johnny Weissmüllers geschuldet ist – oder, um genau zu sein, János Weißmüller (geb. 1904 in Szabadfalva, Österreich-Ungarn) – als einer Kindheit unter Primaten, sprich mit Cheeta (oder Cheetah, Cheta oder Chita – die eigentlich Jiggs hieß). Wie du dir denken kannst, war unser kleines Abenteuer das bestimmende Thema in der Gaststube. Und hier noch ein weiterer erstaunlicher Fund – ebenso aus dem Internet –, den ich mit den anderen teilte und der für Erheiterung sorgte: nämlich dass ein gewisser Edgar Rice Burroughs sich den Tarzan-Schrei hatte sichern lassen, weshalb jedes Joooo-oddle-oddle-ooooooooo-joddle-oddle-ooooooo streng genommen eine Urheberrechtsverletzung darstellt.
Aber warum erzähle ich dir das alles? Weil ich dich wissen lassen wollte, dass ich es unversehrt auf die andere Seite schaffte. Ich war ehrlich gesagt ziemlich stolz auf mich, auch wenn es keine sonderlich große Distanz war und die Gefahr bei so viel Schnee zu vernachlässigen. Trotzdem ereignete sich ein Unfall, der dann doch recht dramatisch ausfiel. Was passierte, war, dass die vorletzte Lianenkünstlerin, um im Bild zu bleiben – ein oder zwei von uns benutzten die Brücke –, sich bei der Aktion die Schulter auskugelte. Was wohl damit zu tun hatte, dass sie sich zu lange am Seil festhielt und sich dann den Arm überdehnte, als sie schließlich losließ.
Der Plosivlaut, als das Schultergelenk aus der Pfanne sprang, war in unerträglicher Eindeutigkeit zu hören. Unsere Kollegin – Berenice ist ihr Name – schrie vor Schmerz auf und fiel uns dann buchstäblich vor die Füße. Auch ich gehörte zu denjenigen, die – anders kann man es nicht beschreiben – zurückzuckten. Wir konnten ihr Leid nicht ertragen; wie es uns selbst durchfuhr. Unsere instinktive Reaktion war nicht Mitleid, sondern Ekel, eine Reaktion, die viel über die menschliche Natur aussagt – unser Unvermögen, unseren Egoismus hintanzustellen. (Ich muss sicher nicht erwähnen, dass diese Dinge in der Gaststubeeher nicht zur Sprache kamen.)
Aber wir wurden auch Zeugen der anderen Seiten der menschlichen Natur, wo sich die besseren Engel aufschwingen. (Ich habe übrigens Pinkers Buch hier gerade noch einmal gelesen, als Mittel gegen den widerlichen Aperitifgewissermaßen.) Einer von uns nahm das Heft in die Hand, Hans, ein dänischer Berichterstatter, der sich als ausgebildeter Ersthelfer entpuppte. Nur wenige knappe Anweisungen waren nötig, und Berenice lag flach auf dem Boden, bereit für den Eingriff. Dann kniete er sich hin, das rechte Bein gegen ihre Schulter gedrückt, und ließ den Arm mit einem beherzten Ruck und einer Art Drehbewegung wieder an Ort und Stelle schnappen. Das Manöver ließ an das Zusammenspiel von Ruder und Dolle denken: der fuchtelnde Arm, ein kurzes, schauerliches Knirschen, gefolgt von der reibungslosen, beinahe schmeichelnden Bewegung des Gelenks.
Außer dem öligen Schweißfilm auf ihrer Oberlippe deutete nichts in Berenices Gesicht auf Schmerzen hin, nachdem es nur Augenblicke zuvor ausschließlich aus Schmerz bestanden hatte. Man hatte tatsächlich das Gefühl, es würde ihr sogar schwerfallen, sich Schmerzen vorzustellen, selbst in ferner Zukunft, von der jüngsten Vergangenheit einmal ganz abgesehen, derart stark empfand sie die Erlösung davon. (Was vermutlich an ihrem erhöhten Adrenalinpegel lag.) Sie musste davon abgehalten werden, ihren jüngst versehrten Arm um den Kopf zu legen, um zu beweisen, wie vollständig seine Wiederherstellung gelungen war. Und Hans musste einige Überzeugungsarbeit leisten, bis sie sich bereit erklärte, den Arm in einer provisorischen Schlinge ruhigzustellen.
Das war’s. Im Großen und Ganzen kein Drama. Und ich will auch nicht andeuten, dass man aus dem Vorkommnis eine Lehre ziehen könnte. Man hat Berenice starke Entzündungshemmer verschrieben, aber wir glauben, dass sie morgen schon wieder wie gewohnt arbeiten kann. Ansonsten blieb der Tag ohne besondere Vorkommnisse. Die Gespräche ziehen sich weiter hin. Ich versuche, bei Laune zu bleiben.
Du fehlst mir.





























