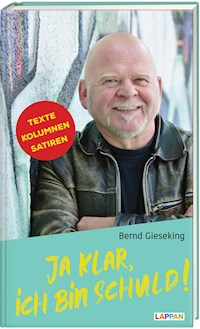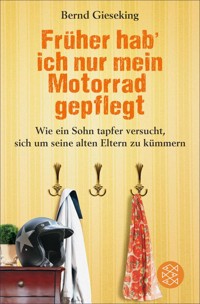
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Von einem, der auszog, um seinen alten Eltern zu helfen Eines Tages ein Anruf, der alte Vater ist gestürzt, »Serienrippenbruch«. Autor und Kabarettist Bernd Gieseking wird klar: Er muss sich um seine alten Eltern kümmern. Ins Häuschen zu ziehen wäre ihm gefühlt zu eng, so stellt er einen Wohnwagen in den Garten. Einen Sommer lang will er helfen, sich um Haus und Hof kümmern. Aber er merkt schnell: Die Eltern sind fitter als befürchtet und er selbst langsamer als gedacht. Er lernt: Um wirklich zu helfen, muss er früh aufstehen! Ein sehr rührendes Buch über das Älter werden der Eltern und die stete Sorge um ihre Autonomie. Und ein humorvoller Bericht über ein außergewöhnliches »Experiment«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bernd Gieseking
Früher hab' ich nur mein Motorrad gepflegt
Wie ein Sohn tapfer versucht, sich um seine alten Eltern zu kümmern
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd, München
Coverabbildung: www.buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490406-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki
Widmung
Prolog mit Rippenbruch
Caravan Of Love
Am Rapsfeld der Erkenntnis
Leben hinter der Gardine
I Like To Move It
Rider On The Storm
Der Weckruf des Fasans
Der schöne Johnny
Regenrinnen kennen kein Entrinnen
Satanische Fersen
Als Gott die Krankheiten verteilte
Ärzte und andere Zumutungen
Ein Freund, ein guter Freund
Ilses Gardinenpredigt
Das Tonnen-Barometer
Das Luder
Wenn zwei sich streiten, braucht es keinen Dritten
Kabelsalat
Verdammt lang her
Ein Bett am Kornfeld
Mit 17 hat man noch Träume
Himmeln in Kutenhausen
Der Abspringer
Irgendwann ist immer das erste Mal
Der stärkste Mann der Welt
Der Besuch der jungen Dame
Die Giesefinks
Sohn auf Rädern
Hundstage
Rollaattori für Kutenhausen
Unter Flusspiraten
Augen zu und durch
Das Kind meiner Eltern
Die Eltern der anderen
Meine Mission als Sohn
Epilog
Dank
Raija: Ich frage mich, ob wir zwei auch mal so werden?
Olli: Du meinst so alt?
Raija: Und so glücklich!
Olli: Da bin ich mir ganz sicher!
Aus: Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki
Für Ilse und Hermann
Prolog mit Rippenbruch
Künstlergarderoben sind die traurigsten Orte der Welt, obwohl hier schon die berühmtesten Leute gesessen haben. Diese Räume sind auf schlimme Weise neutral. Grelle Neonröhren leuchten zu beiden Seiten der Spiegelreihe. Der einzige Trost ist das »Catering«, die Verpflegung. In der Catering-Wunschliste für meine Kabarett-Tourneen heißt es ausdrücklich: »Keine Süßigkeiten!!« Trotzdem stehen hier zwei gefüllte Schalen auf dem Schminktisch, einmal Weingummi und Lakritz, Schokolade in der anderen. Der Veranstalter scheint mir die Grausamkeit der hiesigen Garderobe mit Naschzeug versüßen zu wollen.
Wer als Gast an einem Theater auftritt, findet kaum Platz zwischen den Kostümen, Tiegeln und Töpfen des Schauspielers, der einem diesen Platz gnädig überlassen musste. Ist das Gastspiel, wie heute bei mir, in einer dieser Mehrzweckhallen aus den 70ern, kann man in der Garderobe die Kargheit und Enge einer Gefängniszelle nachempfinden. Meistens befinden sich diese Räume im Keller, sind oft ohne Tageslicht und vorwiegend in Ocker gehalten. Wie wir aus dieser Beklemmung heraus gutes Theater oder Kabarett spielen sollen, weiß ich nicht. Vielleicht agieren die Künstler auf der Bühne besonders gut, weil sie sich freuen, in dieser Zeit nicht in ihrer Theaterzelle einsitzen zu müssen. Die Schauspieler – und auch ich – hoffen inständigst, dass eine Zugabe erklatscht wird, damit wir möglichst spät erst wieder zurückkehren müssen in diese Unterwelt der Theaterkünste.
In Kleinkunstbühnen sind die Wände zumindest mit Plakaten der bisherigen Gastspiele gepflastert, und man sieht die Bilder der Kolleginnen und Kollegen, als sie noch jung waren. Oft genug hängt dort auch eins von einem selbst. Wenn ich auf diesen frühen Fotos sehe, wie schlank ich mal war, lasse ich sofort die Finger von den Süßigkeiten, die ich ohnehin nicht haben wollte. »Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt auch nicht darin um!«, sagt meine Mutter immer. Deshalb habe ich das Süße streichen lassen. »Streichen lassen!«, denke ich mit einem müden Blick auf die Wände. Und nehme dann doch eins von diesen verteufelt verführerischen Lakritzstückchen. Am liebsten esse ich die dunkelbraun ummantelten. Es ist wie beim Alkoholiker. Du kannst Wochen trocken sein, wenn das erste Bier vor dir steht, nimmst du auch das zweite. Nun liegt ein Vampir obenauf im Schälchen, mit roten Fruchtgummiflügeln und einem Körper aus Lakritz. Und ich weiß, wie lecker der schmeckt.
Noch dreißig Minuten bis zu meinem Auftritt. Ich notiere am Rand meiner Zeitung: »Konfusion, der große ostwestfälische Weise, sagt: ›Wer nicht zum Tiger in den Käfig steigt, der wird auch nicht von ihm gefressen!‹« Konfusion ist eine Kunstfigur, die ich absurde Lebensweisheiten und Trostreiches verkünden lasse. Einer meiner ersten Sätze für Konfusion lautete: »Das Schöne am Erinnern ist, es hilft gegen das Vergessen!« Erfunden habe ich Konfusion damals im Rahmen der CDU-Spendenaffäre: »Wer auf trockenen Straßen geht, hat auch keinen Dreck an den Füßen!« Natürlich habe ich diesen weisen Eremiten in meiner Heimat angesiedelt – Ostwestfalen.
Meinen Text für heute Abend habe ich längst »memoriert«. Jetzt warte ich auf meinen Auftritt, blättere in Zeitschriften und neuesten Meldungen auf dem iPhone. Ich sitze auf einem harten Stuhl und denke an gestern, als in der Umkleide wenigstens ein altes Ledersofa stand für ein kurzes Power-Napping. Ein Leben in Garderoben. Zumindest sind im Laufe der Jahre die Hotels besser geworden, in denen wir übernachten. Aber auch nicht immer. Ich versuche, mich auf diesen Abend zu konzentrieren. Das Theater ist fast ausverkauft. Der Veranstalter rechnet damit, dass die letzten Karten an der Abendkasse weggehen. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Das ist gut, sonst muss man das Publikum erst einmal erobern.
Mein Handy klingelt. Es ist 19 Uhr 42. Normalerweise würde ich jetzt nicht mehr drangehen, so kurz vor dem Auftritt. Auf dem Display steht: »Anonym«. Also ein Anruf mit Nummernunterdrückung. Nur eine einzige Telefonnummer in meinem gesamten Freundeskreis ist so programmiert: die meiner Eltern, Ilse und Hermann. Es ist selten, dass die beiden anrufen. Meistens melde ich mich, gern auch von unterwegs, wenn es passt, in den langen Stunden auf der Autobahn von Spielort zu Spielort.
Es sind zwar nur noch wenige Minuten, bis ich vor das Publikum trete, aber für ein kurzes Gespräch mit ihnen ist immer Zeit. Sie können nicht wissen, an welchen Tagen ich auf die Bühne muss. Außerdem habe ich seit einigen Jahren die Befürchtung, es könne plötzlich »etwas passiert« sein, wenn ich auf das Display schaue und einen verpassten Anruf von »Anonym« aufleuchten sehe. Auch wenn die zwei es nicht gerne hören, vom Alter her müssen sie mindestens als »betagt« gelten. Also nehme ich den Anruf an.
»Moin – hier is de Ölste!«
Hier ist der Älteste – von zwei Söhnen. Wir sprechen miteinander immer wieder Plattdeutsch, die beiden untereinander fast ausschließlich. Mein zehn Jahre jüngerer Bruder wurde schon ausschließlich in »Hochdeutsch« erzogen. Platt war plötzlich aus der Mode, wer es sprach, wurde fast stigmatisiert und galt schnell als dumm. Das hat sich erfreulicherweise wieder komplett gewandelt, und heute gilt die Sprache als Kulturgut.
Die Stimme meiner Mutter: »Hallo? Bernd? Hier ist die Regierung.«
Mit diesen Worten meldet sie sich seit Jahren.
»Tach, Ilse!«
»Watt moakest du güst?«, fragt sie.
»Was ich grad mache? Ich sitze in einer Garderobe. Ich muss gleich auftreten.«
»Ach so. Dann will ich gar nicht stören. Dann lass uns man morgen telefonieren!«
»Wieso? Was wolltest du denn, Mama?«
Sie antwortet schnell: »Ach nix. Machen wir morgen!«
Ich werde misstrauisch: »Is’ was?«
»Nee, es ist nichts.«
»Warum rufst du dann an? Ist was passiert?«
»Jedenfalls nichts Schlimmes!«
»Aha. Und was ist so Harmloses passiert?«
Sie muss lachen: »Ach, nichts weiter!«
»Mama! Irgendwas ist doch!«
»Ja, aber damit brauchst du dich jetzt nicht belasten. Du musst doch gleich spielen! Das hat Zeit bis morgen.«
»Mudder, dann denke ich auf der Bühne die ganze Zeit darüber nach, was mich jetzt nicht belasten soll.«
Ich höre nachdenkliches Schweigen.
Irgendwann sage ich: »Ilse! Raus damit.«
»Hermann ist heute gestürzt. Aber es ist nichts passiert. Es sind nur ein paar Rippen gebrochen.«
»Ein paar kaputte Rippen ist also ›nichts passiert‹?«
»Na ja. Er stöhnt ganz schön. Trotzdem, da musst du dir keine Sorgen drüber machen!«
Das versuche ich erst gar nicht. In meinem Kopf jagen sich die Gedanken: »Wie viele sind denn durch?«
»Drei ganz und eine angebrochen.«
»Donnerwetter!«
»Da müssen wir jetzt nicht länger drüber reden. Also, bis dann!«
So schnell lasse ich mich nicht abschütteln: »Ist Hermann im Krankenhaus?«
»Vorsichtshalber. Damit er sich keine Lungenentzündung holt.«
»Ich habe morgen frei. Ich komme vorbei.«
»Deswegen musst du nicht extra durch Deutschland jachtern!«
»Ist egal. Ich muss gleich raus auf die Bühne. Bist du selber okay, Ilse?«
»Ich? Wieso? Ich hab mir ja nichts gebrochen.«
»Vielleicht machst du dir Sorgen um unser’n Vadder?«
»Um den? Wenn der nicht vor seine Füße guckt?«
»Das klang eben aber etwas anders. Kannst du ruhig zugeben, Ilse.«
»Ach! Wenn drei Rippen durch sind, ist das kein Beinbruch! Ich wollte dir jetzt nur Bescheid sagen, weil du immer schimpfst, wenn wir nichts sagen!«
»Danke!«
»Und nu sieh zu, dass die Leute auch was zu lachen haben! Sonst kommen die nämlich nicht wieder! Getz röge di!«
»Mama!«
»Ja. Bis morgen!«
Caravan Of Love
Ich liege im Hotelzimmer auf dem Bett und schalte durch die Sender. Das übliche Ende eines Tourneetages. Mittlerweile ist es drei Uhr morgens, und der Rest Weißwein ist lauwarm. Der darf im Glas bleiben. Ich bin müde, kann aber trotz der Erschöpfung durch den Auftritt nicht schlafen. Ich muss immer wieder an Hermanns Sturz denken. Der Arme! Rippenbruch, und es ist nicht nur eine durch. Jeder Atemzug wird ihn schmerzen, jede Bewegung. In seinem Alter wird es dauern, bis das alles wieder zusammengewachsen ist.
Meine Eltern sind inzwischen reichlich in den Jahren, wie man bei uns sagt. Hermann ist Mitte 80, Ilse Ende 70. Beide sind natürlich Ruheständler, aber ihr arbeitsreiches Leben setzt sich fort. Haus und Hof wollen in Schuss gehalten sein, und vor den Nachbarn gibt man sich hier auf dem Dorf keine Blöße, da werden oft genug die Blätter einzeln vom Rasen gepickt, Verblühtes abgeschnitten, und immer wird neu gepflanzt, umgesetzt, repariert, gestrichen, geschraubt und gedübelt. Sie halten sich wacker, obwohl beide reich gesegnet sind mit »Malessen«, das ist Ostwestfälisch für Malaisen, Krankheiten. Mein Vater wird immer krummer und braucht Gehhilfen, Ilse leidet unter Hörstürzen. Trotzdem scheinen sie unverwüstlich zu sein, das zeigt sich besonders in ihrem Witz und Humor. Als Paar beharken sie sich einerseits in jahrzehntelang geübter Streitlust, andererseits stellen sie in ihrem Miteinander, in ihrer Verlässlichkeit selbst ehemalige Traumpaare wie Brad Pitt und Angelina Jolie locker in den Schatten. Brangelina schafften gerade mal zehn Jahre. Meine Eltern stehen kurz vor der diamantenen Hochzeit: sechzig Jahre! Außerdem haben sie zwei Söhne großgezogen, meinen Bruder Axel und mich.
Wir sind mit jeweils Anfang zwanzig ausgezogen zum Studium, Axel nach Mönchengladbach, ich nach Kassel, nachdem wir beide zuvor eine Ausbildung gemacht hatten, Axel als Bürokaufmann in einem Fotogeschäft, ich eine Lehre als Zimmerer. »Unser« Axel, wie man hier sagt, ist dann vor Jahren nach Finnland ausgewandert. Der Liebe wegen ist er zu Viivi gezogen und lebt seitdem in Lahti. Nicht nur wegen der Entfernungen sind wir zwei Jungs in unseren Erwachsenenjahren eher selten zu Hause gewesen, bis auf den obligatorischen Weihnachtsbesuch. Wir waren in unseren eigenen Universen unterwegs: Musik, Rockabilly, Country, Kunst und Kultur interessierten uns mehr als Kutenhausen, unser Heimatdorf.
Nun liege ich in diesem Hotel und schalte im TV-Programm hin und her zwischen »The Big Bang Theory« und »Zwei rechnen ab«, einem alten Western mit Kirk Douglas und Burt Lancaster. Ich muss lachen, denn meine Eltern rechnen auch dauernd miteinander ab. Ilse, meine sonst so großherzige Mutter, hält unserem Hermann einerseits gern die alten Sünden vor. Andererseits rechnen die beiden bis heute akribisch das Haushaltsgeld ab und führen Buch darüber. Ilse sagt: »Es gibt mein Geld und unser Geld!«
Die TV-Bilder laufen, ich nehme sie gar nicht richtig wahr, höre kaum die Dialoge, bin mit meinen Gedanken bei meinen Eltern. Ich bekomme Hermanns Sturz nicht aus dem Kopf, und ich sorge mich natürlich. Fragen tauchen auf: Muss man was tun? Mein inneres Autokorrektursystem formuliert das sofort um in: Müsste ich was tun? Eine Idee wabert seit zwei Stunden durch meinen Kopf. Sehr unscharf noch. Vage denke ich: Ich müsste mich mal kümmern! Aber wie? Irgendwann falle ich in leichten Schlaf.
Als ich wach werde, läuft bereits das Frühstücksfernsehen. Es ist 8 Uhr 25. Ausgeschlafen fühlt sich anders an. Zwischen den neuesten Sport-Doping-Meldungen verzückt Peter Großmann die frühmorgendliche TV-Gemeinde mit seinem beruhigenden Brandt-Zwieback-Lächeln. Meine nächtlichen Sorgen kämpfen sich vom Unterbewusstsein zurück ins Bewusstsein, und als ich unter der Dusche stehe, auch meine zaghaft formulierte Idee: Ich muss mich um meine alten Eltern kümmern. Aber wie soll das gehen? Ich wohne in Dortmund, sie in Minden. Ich muss zu Auftritten fahren, die eher südlich als nördlich liegen.
Am Frühstückstisch kritzele ich, statt zu lesen, verschiedene Hausansichten auf den Rand meiner Zeitung. Ansichten, die dem Haus meiner Eltern ähneln. Der Platz wird langsam knapp. Ich versuche, das Gebäude von der Seite zu zeichnen, von hinten. Man achtet oft viel zu wenig auf die Rückseiten der Dinge, denke ich. Von Skulpturen zum Beispiel. Es lohnt, dass man einmal drumherum geht. Ich notiere: »Konfusion sagt: ›Du kennst jedes Ding erst wirklich, wenn du es auch von hinten gesehen hast!‹« Was ist die Rückseite meiner Idee? Was sind die Folgen? Ich zeichne noch eine Art Draufsicht unseres Grundstücks. Meine Überlegung nimmt ein wenig Gestalt an, aber dann verlaufen die Konturen wieder ins Ungefähre.
Ich bringe mein Gepäck ins Auto. In diesem Moment brummt das Handy. Meine ferne Freundin schickt eine SMS, unser tägliches Ritual am Morgen. Wir wohnen in verschiedenen Städten, sie in Hannover, ich in Dortmund. Eine untypische Distanzbeziehung. Wochenendbeziehung kann man das nicht nennen, denn da bin ich oft auf Tournee. Aber es läuft. Sehr gut sogar. Sie heißt Rita. Wir haben uns auf Gomera kennengelernt. Als wir dort zum ersten Mal gemeinsam in den unendlichen Sternenhimmel geschaut haben, taufte ich sie, zuerst heimlich, »mein leuchtender Stern des Südens«. Ich wusste nicht, dass es ein ähnlich betiteltes Fan-Lied des FC Bayern gibt, aber was interessiert einen Ostwestfalen schon die Umdeutung eines Sternenbildes durch Fußballfans? Aus Wikipedia weiß ich inzwischen, dass es gar keinen »Stern des Südens« gibt, sondern nur ein »Kreuz des Südens«. Egal. Rita ist für mich das hellste Sternenbild am Firmament meines Lebens. Als ich sie das erste Mal sah, ging für mich die Sonne auf. Von meiner Seite war es Liebe auf den ersten Blick. Sie musste mehrmals hinschauen.
Rita schreibt: »Guten Morgen! Wie war dein Auftritt? Wohin fährst du heute?«
Ich tippe: »Nach Hause.«
»Zu Hause« ist für mich immer der Ort, an dem ich mich am Abend ins Bett legen werde.
Sie tippt: »Dortmund?«
Ich tippe zurück: »Nee, Minden. Hermann ist gestürzt, ist aber nicht viel passiert.«
Sofort klingelt mein Telefon. Rita braucht Details. Sie ist inzwischen ein festes Familienmitglied. Das ist nicht immer gut für mich. Meine Eltern sind mit ihr zusammen nun schon zu dritt. Und sie sind sich oft erschreckend einig, besonders wenn es mich betrifft.
»Bernd, was ist los?«
Ich erzähle ihr, was ich weiß. Viel ist das nicht.
Rita fragt erschrocken: »Und was jetzt?«
Pause.
»Weiß ich auch nicht. Ich hab die Nacht kaum geschlafen. Ich knobele da an etwas rum. Ich glaube, man müsste sich mal kümmern.«
»Man oder du?«
»Das ist hier ziemlich deckungsgleich, glaube ich.«
Dann erzähle ich ihr von meinen ersten Überlegungen.
»Wissen deine Eltern das schon?«
»Nee, hab ich ja grad erst überlegt. Also, ich fange an, mir Gedanken zu machen.«
»Aha. Und was denkst du da so?«
Ich sage zögerlich: »Ich hab da mal was aufgezeichnet.«
»Aufgezeichnet?«
»Ja, das Haus und so. Mit einer … Planskizze.«
»Planskizze?«
»Ja, Plan und Skizze!«
»Aha.«
»Am Zeitungsrand.«
Rita sagt: »Das klingt ja fast schon nach einem sehr gut durchdachten Plan.«
Auch wegen solcher Sätze liebe ich sie. Wir lachen. Dann schweigen wir wieder.
Schließlich fragt sie: »Und was ist das Ergebnis dieser Zeichnerei?«
»Na ja, dass man die Dinge auch mal von hinten betrachten muss.«
»Du sprichst in Rätseln, Bernd.«
Nun formuliere ich den Gedanken erstmals aus: »Vielleicht sollte ich mal ein paar Tage vor Ort sein bei ihnen.«
»Ist das jetzt nur eine Idee, oder willst du das wirklich machen?«
Gute Frage, denke ich. Und schweige. Was für eine gute und präzise Frage, denke ich.
»Da grübele ich jetzt mal drüber nach.«
»Gut, ruf mich an, wenn du es genauer weißt!«
Ich steige ins Auto, programmiere im Navi das Krankenhaus Minden als Ziel und starte den Wagen. Ich denke über die Lebenssituation meiner Eltern nach und schleiche deshalb mit unfassbar langsamen 110 Stundenkilometern über die Autobahn. Ich halte an drei Raststätten hintereinander und zapfe mir jeweils einen Kaffee XXL aus dem Automaten. Dreimal bin ich kurz davor, mir eine große Tüte Weingummi zu kaufen. Wenn ich nervös bin, hilft diese Nervennahrung eigentlich optimal, sie bekämpft die Krise mit Süße. Aber ich widerstehe jedes Mal. Es reicht schon, wenn meine Veranstalter inkonsequent sind. Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen. Wie kann ich meinen Eltern helfen?, frage ich mich. Was ist sinnvoll? Was ist nötig?
Ich überhole drei Lkws und ein Wohnwagengespann. Ich stelle fest, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie der Alltag meiner Eltern aussieht. Was sind ihre täglichen Pflichten? Wobei brauchen sie Hilfe? Was kann ich tun? Wie könnte ich helfen? Was würden die beiden mich tun lassen? Wie viel an Einmischung lassen sie zu?
Schon wieder zwei Wohnwagen, ich blinke links. Die Autobahn ist voll, und ich muss erst den Verkehr auf der Überholspur vorbeiziehen lassen. Sind schon Ferien?
Wenn ich das mit der Hilfe tatsächlich irgendwie umsetzen will, wie kann ich dabei meine eigene Arbeit weiterführen? Auftreten, schreiben, an Besprechungen hier und da teilnehmen, meine Programme proben. Kann das auch alles funktionieren, wenn ich eine Zeitlang in Minden wohne? Minden liegt nicht gerade im Zentrum meiner Tätigkeiten. Ich muss immer wieder ins Rheinland, oft in die Region Rhein-Main, gegenüber meinem Wohnort Dortmund verdoppele ich im Grunde die Entfernungen. Ab und an geht es noch weiter südlich, bis runter zum Bodensee, in die Schweiz. Das hatte ich noch gar nicht bedacht. Denn das wäre ja die Konsequenz all dieser Überlegungen: Ich müsste länger vor Ort sein – mit allen Folgen. Ich kann nicht dauernd zwischen Dortmund und Minden hin und her fahren. Und nur mal hier und da für einen halben Nachmittag zu kommen wäre keine richtige Unterstützung.
Ich überhole einen Traum von Wohnwagen in Tropfenform: die berühmte »Knutschkugel« im Retrodesign, mit Alu-Blechen, stylisch an den Kanten gelb abgesetzt. Sieht toll aus. Müsste lustig sein, mit so etwas in den Urlaub zu fahren. Aber seit meiner Lehre, ich habe einen Gesellenbrief als Zimmermann, hasse ich Gespannfahren. Für mich war es eine Qual, wenn wir einen Dachstuhl richteten und ich den Lkw zur Baustelle fahren musste mit dem aufgeladenen Holz, das bis auf den sogenannten Nachläufer ragte. Ich bin miserabel im Rangieren.
Ich zwinge meine Gedanken zurück zum eigentlichen Problem. Sicher wäre es nötig, meinen Eltern zu helfen. Aber ganz praktisch, wie soll das gehen? Mit zwei, drei Tagen ist das tatsächlich nicht getan. Ich müsste mindestens mal für sechs oder sogar acht Wochen kommen, das wäre sinnvoll. Erst lächele ich kurz bei dem Gedanken, mal wieder länger in meiner Heimat zu sein, aber dann erschrecke ich sofort: So lange? Bei meinen Eltern? Und überhaupt: Ist das jetzt alles nur eine heroische Überlegung, die ich lieber keinem verrate, weil ich in zwei Tagen vielleicht schon einen Rückzieher machen werde? Aus Bequemlichkeit. Aus Angst vor den Konsequenzen. Aus Sorge um meine eigene Überforderung. Es gibt genug in meinem Leben, was ich so schon nicht auf die Reihe bekomme, und die vierteljährliche Steuervoranmeldung ist nur eines davon.
Bin ich gerade etwas zu spontan? Zumindest Rita weiß nun schon von der Idee. Und wo sollte ich wohnen? Ich kann doch nicht bei »Unseren« im Haus wohnen. Mein Kinderzimmer unterm Dach gibt es schon lange nicht mehr, es ist ein Lagerraum geworden für Dinge, die wir Jungs – vielleicht unverschämterweise – zu Hause immer noch unterstellen. Das Zimmer meines Bruders ist nun das Gästezimmer, aber abgesehen davon ist es nun mal das Zimmer meines Bruders. Bei meinen Eltern ist mir alles – wie soll ich es sagen? –, und spreche das für mich erstmals so konkret aus: Es ist mir zu eng. Ich stelle fest: Dieses Haus ist gar nicht vorbereitet auf mich!
Dabei mag ich es, wie Ilse und Hermann ihr Heim gestaltet haben. An den Wänden finden sich Erinnerungen an ihre Familien, an ihre Söhne, Fotos, die wir Jungs auf unseren Reisen gemacht haben, von Axel Motive aus Amerika, von mir arktische Eislandschaften. Es hängen, ungewöhnlich vielleicht für die Generation meiner Eltern, satirische Zeichnungen und Cartoons, Plakate zu Ausstellungen von Martin Perscheid und Gerhard Glück. Auf den Fluren stehen präparierte Tiere, Bussard, Elster, Frettchen, aber auch Objekte komischer Kunst, ein Mobile voller Männlein, die mit den Trägern ihrer Unterhemden an Kleiderbügeln hängen, umgesetzt nach einem Cartoon von Eugen Egner. Hier stehen reichhaltig gefüllte Bücherregale, teils mit Werken aus dem »Bertelsmann Lesering«, eine Gesamtausgabe von Émile Zola, jede Menge Konsalik, der »Humoristische Hausschatz« von Wilhelm Busch, aber auch Neues ihrer aktuellen Favoriten wie Fritz Eckenga, Biographien von Reinhard Mey und Ilses Lieblingswesternheld Billy Jenkins und anderen, von Fliegerin Elly Beinhorn, deren früh verstorbener Ehemann, Rennfahrer Bernd Rosemeyer, mein Namensgeber ist. Und auch wenn es eitel klingen mag, meine Bücher stehen ebenfalls dort. Dazu Zinnteller und Pokale, Schützenvereinserfolge der beiden, Holzfiguren und Bierkrüge von Hermanns Reisezeit als Zimmermann. Das alles ist schön, trotzdem fühle ich mich im Haus, wenn ich wirklich mal über Nacht bleibe, irgendwie nicht wohl. Ich gehe daher seit Jahren ins Hotel, wenn ich die beiden besuche. Aber das wäre in diesem Fall keine Lösung. Ich bin ja nicht Udo Lindenberg, der im Hamburger »Atlantic« residiert, wenngleich ich im Mindener »Lindgart« kein bisschen schlechter behandelt werde, in dieser Mischung aus Vertrautheit und Fürsorge, dass man sich als Gast wirklich beheimatet fühlen kann. Wenn ich tatsächlich länger bei meinen Eltern sein will, wäre der ständige Weg aus der Stadt und wieder zurück einfach zu weit und zu unpraktisch. Ich würde mit den beiden dann auch im Garten sitzen wollen, Wein trinken und hören, wie sie ebenso charmant wie spitz über die Nachbarschaft erzählen, ohne danach mit dem Taxi fahren zu müssen. Vielleicht sollte ich ein Zelt in den Garten stellen? Ich lache laut über den Gedanken, allein hier in meinem Auto.
Schon wieder ein Wohnwagen. Ein riesiger. Der hat fast amerikanische Ausmaße. Wie man mit so einem Teil rangiert, ist mir ein Rätsel. Ich überhole und setze den Blinker nach rechts. Im Rückspiegel schaue ich noch einmal kurz auf das Gefährt. In diesem Moment kommt die Erleuchtung. Ich denke: Wohnwagen! Und plötzlich weiß ich: Das ist die Lösung! Ein Wohnwagen! Den könnte ich bei uns in den Garten stellen, links neben die Blautanne. Das müsste problemlos gehen. Aber wo bekomme ich einen her? Kann man den leihen? Bestimmt. Kenne ich jemanden mit Wohnwagen? Leider nein, trotzdem: Ich bin völlig begeistert. Damit wäre jedes Wetter egal, ich wäre nah am Haus und doch nicht drin. Hätte keine unnützen Wege. Vor lauter Euphorie fahre ich plötzlich 130. Ich bin unterwegs auf der A7 Richtung Norden, Richtung Minden, Richtung Krankenhaus. Der Verkehr läuft ausnahmsweise fließend. In diesem Moment wird im Radio tatsächlich der alte Song von den Housemartins angekündigt, »Caravan of Love«. Gutgelaunt singe ich mit: »Every woman, every man, join the caravan of love, stand up, stand up …«
Die Karawane der Liebe. Ein Wort, zwei Bedeutungen. So einen »Caravan der Liebe« hätte ich gern für meinen angedachten Aufenthalt im Garten meiner Eltern, am liebsten eine Knutschkugel, wie ich sie gerade überholt habe. Wenn das keine Zeichen sind! Alles Fügung!, denke ich.
Ich fahre die nächste Raststätte an, setze mich auf eine Bank und rufe Rita an.
»Ich habe mir was überlegt.«
»So?«
Ich mache eine Kunstpause und sage dann: »Ich ziehe für ein paar Wochen nach Minden.«
Jetzt folgt eine lange Pause.
Dann fragt Rita vorsichtig: »Zu deinen Eltern?«
»Ja. Aber nicht ins Haus. Das wär mir zu nah aufeinander.«
»Willst du ins Hotel?«
»Nee, auch nicht. Das ist zu weit weg. Dann müsste ich immer morgens aus der Stadt raus ins Dorf und abends zurück. Das wäre mir zu viel Rumgegurke.«
Sie prustet ins Telefon: »Willst du etwa zelten?«
»Nicht ganz. Aber den Gedanken hatte ich zuerst auch. Nein, ich stelle mir einen Wohnwagen in den Garten.«
»Einen Wohnwagen? Du bist verrückt.«
»Findest du?«
Rita lacht. »Und wo soll der hin?«
»Zwischen die beiden Bäume, an die Hecke links.«
»Und deine Arbeit? Deine Wohnung in Dortmund? Du wolltest ein Buch schreiben. Du musst auf Tournee. Was weiß ich nicht alles. Ich meine, ich will dir das auf keinen Fall ausreden. Aber wie soll das gehen?«
Ich schweige.
»Hast du dir das gut überlegt, Bernd?«
Schon wieder eine gute Frage.
»Sagen wir: überlegt!«
Meine Eltern wohnen seit ihrer Hochzeit in Kutenhausen, einem Dorf nördlich von Minden, knapp 1800 Einwohner, mit dem Nachbardorf Todtenhausen eng verbunden wie mit einem Zwillingsbruder. Es gibt einen gemeinsamen Sportverein und die gemeinsame Kirche, nur die Schützenvereine konkurrieren.
Minden liegt im nordöstlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen, in weiten Teilen umschlossen von Niedersachsen. Überfuhr man früher die Landesgrenze, merkte man das sofort: Das Straßenpflaster wurde schlechter. Wir sind hier in Ostwestfalen-Lippe. Die Menschen sind legendär und ticken komplett anders als die sinnlos karnevalisierenden Rheinländer. Der Ostwestfale an sich ist ein furchtloser, knorriger, oft auch schweigsamer Geselle mit großem Appetit und noch größerem Humor.
Unsere Siedlung, die »Müsse«, liegt inmitten von Feldern, um die die Dorfgrenzen von Kutenhausen und Todtenhausen mäandern. Zwischen Müsseweg und Lammerweg verlaufen unsere Buchfinkstraße, die Elsternstraße und der Ostweg. Aus Süden kommend ist in unserer Straße links Feld, rechts Bebauung. In etwa der Mitte stößt von rechts die Elsternstraße auf die Buchfinkstraße. Direkt hinter dieser Einmündung wohnen wir auf einem Eckgrundstück. Biegt man rechts in die Elsternstraße ein, liegt zur Linken die Längsseite unseres Hauses. Dann kommt eine einzeln stehende Garage, dahinter unsere Gartenbude. Ich kann das so ausführlich beschreiben, weil ich nicht glaube, dass Einbrecher und Wohnungsdiebe dieses Buch lesen werden, und wenn doch: Bei uns gibt es wirklich nichts zu holen.
Fährt man geradeaus an der Einmündung vorbei, liegt neben unserem Haus noch ein kleines eingesätes Grundstück. Früher war das ein Garten, der bewirtschaftet wurde, heute ist es Rasen, umstanden von Büschen. Vom Nachbargrundstück trennt uns hier eine hohe Hecke. Mitten auf der Rasenfläche, jeweils im Drittelstrich, stehen zwei mächtige Nadelbäume, eine Blautanne und eine Lärche. Im hinteren Teil, neben der Lärche, ist ein kleiner »Freisitz«. Es gibt also relativ viel Platz rundum und eigentlich keinen Nachbarn, dem man unmittelbar in die Fenster schauen würde. Oder umgekehrt der uns. Zwei kleine Treppen führen zur Haustür an der Buchfinkstraße und hinten aus der Küchentür hinaus in den Garten.
Hier ist das Reich der Giesekings, selber aufgebaut, mit der ein oder anderen Unterstützung von Familie und Nachbarn, der Keller mit eigenen Händen ausgeschachtet, ohne Bagger, Ilse fuhr Schubkarre um Schubkarre mit Erde und Lehm aus dem Bauloch heraus.
Heute ist unser Haus zumindest im Sommer fast eine Art Kiosk, bestens frequentiert, aber natürlich ohne Verkauf. Der Ostwestfale ist gastfreundlich und der Kühlschrank jederzeit gefüllt. Immer wieder schauen Nachbarn vorbei und setzen sich in den Garten. Sie bringen meist etwas zu trinken mit, aber meine Eltern sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Die eine trinkt nur Rotwein, die Nächste nur Weißen, ein anderer nie Alkohol, sondern immer Cola, die Nachbarin gegenüber am liebsten Grapefruit-Mix mit Weißbier, die Nächste ausschließlich Rotkäppchen-Sekt. Die meisten aber trinken alles. Und »Kurze« fast jeder. Alle wissen das voneinander, und irgendeinen Wunsch nicht zu berücksichtigen bei diversen Nachbarschaftsfeiern in den jeweiligen Gärten gilt als Affront. Gerne gehen die aus der Elsternstraße zum Sonnenuntergang noch mal kurz ums Eck vor zur Buchfinkstraße, und an jedem Silvesterabend kommen hier am Kreuzungspunkt viele zusammen, um bei uns am Mäuerchen Raketen steigen zu lassen.
Seit 1964 wohnen wir in diesem Haus. Von hier aus gelangt Hermann mit seinem Rollator zum Zahnarzt oder Hausarzt und zu den anderen wichtigen Dorfstationen, vor allem zur Lottoannahmestelle (sehr wichtig!) mit Post (weniger wichtig). Daneben gibt es noch eine Tankstelle mit Werkstatt und Waschstraße, außerdem zwei Apotheken. Die meisten Kneipen haben im Laufe der Jahre aufgegeben, eine ist nun eine Pizzeria, eine andere ein kleines Hotel garni, das auch von Radlern des Weserradwegs frequentiert wird. Die können sogar bei uns in der Siedlung Aufnahme finden. Insgesamt drei Familien haben, nachdem die Kinder aus dem Haus oder Eltern und Großeltern verstorben waren, inzwischen ein »Bed and Breakfast«, »Bett und Frühstück« eingerichtet.
Von früher drei Bäckereien existiert nur noch eine, Schlomanns, mit dem besten Schwarzbrot der Welt. Die legendäre Fleischerei Potthoff ist in neuen Händen, und es gibt zwei Supermärkte, einen in Kutenhausen, Edeka, einen in Todtenhausen, Netto. Es gibt eine Holzhandlung, einen Schuster mit Schuhverkauf im übernächsten Dorf, in Friedewalde, Schweizer, bei dem ich seit ewigen Zeiten meine geliebten Holzclogs kaufe. Das Versicherungsbüro im Nachbardorf Stemmer wird von meinem alten Freund Uli geführt, bei dem wir eigentlich fast alle versichert sind. Es gibt sogar ein eigenes kleines Industriegebiet, eine Fensterfabrik, zwei Dachdeckereien, eine Zimmerei, ein kleines Gesundheitszentrum und Bootswana, Freds Kanuladen. Eigentlich ist alles da, was die Welt braucht.
Nach Rita rufe ich Ilse an: »Hast du schon was Neues gehört?«
»Nee, wieso? Ich fahre erst am Nachmittag ins Krankenhaus.«
»Dann bin ich auch da.«
Ilse wird laut: »Quatsch. Da sind nur ein paar Rippen durch bei Hermann.«
»Trotzdem!«
»Möst du sülms wierten!«
»Jau, weit ick ohk! Ilse, noch was anderes.«
»Zügig. Der Garten wartet nicht ewig!«
»Ilse, ich hab mir was überlegt.«
»Was denn?«
»Ich habe überlegt, ich komme mal für ein paar Wochen nach Hause.«
Ilse stutzt: »Wie jetzt? Wohin nach Hause?«
»Zu euch!«
»Zu uns? Warum das denn? Du bist doch in Dortmund zu Hause.«
»Meine Tournee ist demnächst vorbei. Dann kommen nur noch Einzeltermine, und ich kann meine Zeit besser einteilen. Ob ich in Dortmund bin oder in Minden, das ist dann eigentlich egal.«
»Wegen Hermanns Rippen?«
»Sagen wir, auch deswegen. Ich hab gedacht, ich könnte mich mal nützlich machen.«
»Das wäre das erste Mal!«
»Immerhin. Besser spät als nie!«
Ilse sagt: »Das ist doch Blödsinn. Wo willst du überhaupt wohnen? Bei uns etwa?«
»Nee.«
»Du kannst doch nicht die ganze Zeit ein Hotel bezahlen.«
»Das stimmt. Aber ich habe da eine Idee.«
Ilse sagt leicht schnippisch: »Da bin ich aber gespannt.«
»Wohnwagen!«
»Was?!«
»Wohnwagen! Ich miete mir einen Wohnwagen.«
»Du spinnst!«
Ich frage: »Warum das denn?«
Sie holt tief Luft: »Was sollen denn die Leute sagen?«
»Haben die uns jemals interessiert?«
»Das nicht, aber die denken doch, dass wir im Haus keinen Platz für dich haben!«
»Es geht die überhaupt nichts an, wo ich schlafe!«
Ilse fällt wieder ins Plattdeutsche: »Nee, datt nich, ower …«
»Was aber, Ilse?«
»Owerlech di datt!«
Ich bleibe standhaft: »Keine Sorge. Hab ich mir überlegt.«
Pause. Und dann kommt dieser bei meiner Mutter immer wieder überraschende Moment zwischen dem Kopfschütteln über meine jeweiligen neuen Pläne und einem überraschenden Lösungsansatz. Der Wechsel von Protest zu Pragmatismus.
Ilse sagt: »Doris hat einen Wohnwagen.«
Doris ist unsere Nachbarin »von gegenüber«. Ihr Mann war ein guter Bekannter von mir aus Jugend- und Schwimmbad-Zeiten. Er starb vor ein paar Jahren. Zwischen unseren Familien gibt es eine herzliche Nachbarschaft, bei Reisen werden Kaninchen und Post versorgt und täglich morgens Jalousien raufgezogen und abends runtergelassen. Wegen der Einbrecher – leider gab es im Dorf tatsächlich schon welche. Die beiden waren begeisterte Camper, und Doris führt das nun alleine fort und hat enge Freundschaften auf einem Wintercampingplatz in der Lüneburger Heide. Den Sommer über steht der Wohnwagen bei ihr auf dem Hof, gegenüber unserer Garage. An Doris hatte ich gar nicht gedacht. Aber es stimmt: »Warum in die Ferne schweifen, sieh doch, das Gute liegt so nah!« Ich hatte zwar von der besagten »Knutschkugel« geträumt, aber mir die Fahrt mit Wohnwagen und das Rangieren sparen zu können überzeugt mich sofort.
Ilse fährt fort: »Die brauchst du aber gar nicht fragen. Die verleihen den nicht. Also, den haben die früher nicht verliehen, und Doris wird das jetzt auch nicht machen.«
Ich sage: »Ja, wenn das keinen Sinn hat, dann frage ich sie natürlich gar nicht erst.«
Stunden später treffen wir uns im Krankenhaus. Hermann ist nicht da.
»Muss ich mich sorgen?«, frage ich meine Mutter und deute auf das leere Bett, an dessen Fußende Hermanns Name geschrieben steht.
»Der ist noch zu einer Untersuchung.«
»Und, wie ist es bei dir?«
»Bei mir ist alles gut.« Sie schaut mich an: »Willst du das wirklich machen? Mit dem Wohnwagen?«
»Ja klar«, sage ich.
»Darfst du das denn?«
»Ach so, ich muss euch erst mal um Erlaubnis fragen?«
»Besser wär das!«
Ich räuspere mich: »Ilse, geliebte Mutter …«
»Halblang!«
Ich rede weiter: »Darf ich ein paar Wochen einen Wohnwagen in euren Garten stellen?«
»Da musst du deinen Vater fragen.«
»Seit wann muss ich Hermann fragen?«
»Ja, mir ist das egal.«
Ich jubiliere innerlich, denn das bedeutet fast schon »ja«!
Dann, nach kurzem Überlegen fragt sie: »Und wo soll der hin?«
Irgendwie kommt mir die Frage bekannt vor.
»Zwischen die beiden Bäume, an den Zaun, der an Gräsers Grundstück steht.«
Gräsers, unsere Nachbarn zur Linken. Der Umgang mit ihnen ist eher kühl und beschränkt sich aufs Grüßen.
»Da steht der eigentlich ganz gut!«
Ich staune. Das ist fast schon die endgültige Bewilligung meines Zuzugsantrags.
Ich hake nach: »Das heißt: ja?«
»Mach doch, was du willst.«
Das bedeutet: Ja! Eindeutig!
»Danke!«
Dann gibt sie mir einen Zettel. Mit einer Telefonnummer. Darunter steht »Doris«. Ich sehe Ilse an: »Ich denke, Doris brauche ich gar nicht erst zu fragen?«
»Na ja, vielleicht kannst du sie ja trotzdem mal anrufen. Fragen kostet nichts.«