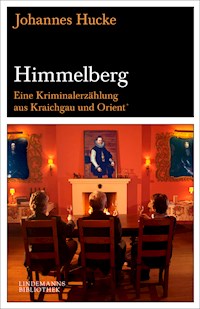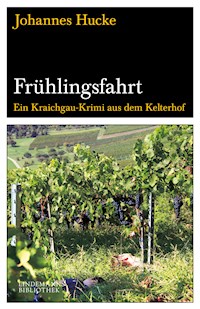
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lindemanns Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Der Kelterhof zwischen Kraichgau und Stromberg gelegen, ist ein Weingut, wie es idyllischer kaum sein kann. Weshalb um alles in der Welt liegen eines schönen Morgens während der Weinlese gleich zwei Tote im Weinberg der Schäufeles? Johannes Hucke, Autor der erfolgreichen Wein-Krimis "Rotstich" und "Die Brettener Methode" sowie des "Kraichgauer Weinlesebuches", blättert seine neuen spannenden Roman in der Rückschau auf: Er erzählt von einer schicksalhaften Freundschaft, von einer romantischen Frühlingsfahrt, die durch das Neckartal über Bad Rappenau schließlich ins beschauliche Großvillars führt, von allerlei Genüssen, die der Heimat heilig sind. und von einer zwischenmenschlichen Konstante, deren zerstörerische Energie dem friedlichsten Nachbarn keine Ruhe gönnt: Rache!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verbunden mit herzlichem Dank
für die Gastfreundschaft, widme ich das Buch
Ute und Armin Schäufele vom Kelterhof –
und die Lindemanns widmen es Gudrun Jung,
mit der sie eben dort schon so manch
leckeres Gläslein gebechert haben.
Lindemanns Bibliothek
Literatur und Kunst im Info Verlag
dieser Band herausgegeben von
Constanze und Thomas Lindemann
Band 139
Titelfoto: Thomas Rebel
Redaktionelle Mitarbeit: Kurt Fay
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise,
ohne Genehmigung des Verlages nicht gestattet.
© 1. Auflage 2011 · Info Verlag GmbH
Käppelestraße 10 · 76131 Karlsruhe
www.infoverlag.de
ISBN 978-3-96308-030-2
Johannes Hucke
Frühlingsfahrt
Ein Kraichgau-Krimi
aus dem Kelterhof
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Johannes Hucke, geboren 1966, hat mit seinem„Kraichgauer Weinlesebuch“(2007, 2. Auflage 2009) die Landschaft zwischen Schwarz- und Odenwald vinologisch erschlossen. 2010 folgte der Kraichgau-Krimi„Rotstich“ (2. Auflage 2010) und 2011 ein Krimi zu Peter-und-Paul: „Die Brettener Methode“. Als Theaterautor ist er erfolgreich u. a. mit dem Wein-Theaterstück „Kellersequenz“. Weitere Veröffentlichungen im Info Verlag:„Bergstraße Weinlesebuch“(2008),„Südpfalz Weinlesebuch“(2009), außerdem mit Holger Nicklas„Strafraum“, ein KSC-Krimi (2009, 2. Auflage 2010) und„Totland“, KSC-Krimi Nr. 2 (2010), die Unternehmensgeschichte„Das Beste aber ist das Wasser“(2010),„Frankfurter Stückchen. Ein Märchen aus der neuen Altstadt“ (2010), „Neckarstadt Western. Der durchgeknallte Mannheim-Roman“ (2010)und„Libellen greifen selten zu Labello“, Gedichte (2010).
Frühlingsfahrt
Es zogen zwei rüstge Gesellen
zum erstenmal von Haus,
so jubelnd recht in die hellen,
klingenden, singenden Wellen
des vollen Frühlings hinaus.
Die strebten nach hohen Dingen,
die wollten, trotz Lust und Schmerz,
was Rechts in der Welt vollbringen,
und wem sie vorübergingen,
dem lachten Sinn und Herz. –
Der erste, der fand ein Liebchen,
die Schwieger kauft Hof und Haus;
der wiegte gar bald ein Bübchen,
und sah aus heimlichem Stübchen
behaglich ins Feld hinaus.
Dem zweiten sangen und logen
die tausend Stimmen im Grund,
verlockend Sirenen, und zogen
ihn in der buhlenden Wogen
farbig klingenden Schlund.
Und wie er auftaucht vom Schlunde,
da war er müde und alt,
sein Schifflein, das lag im Grunde,
so still war’s rings in der Runde,
und über den Wassern wehts kalt.
Es singen und klingen die Wellen
des Frühlings wohl über mir;
und seh ich so kecke Gesellen,
die Tränen im Auge mir schwellen –
ach Gott, führ uns liebreich zu dir.
Dieses Gedicht, von Joseph von Eichendorff „Die zwei Gesellen“ betitelt,
erhielt in Robert Schumanns Vertonung die Überschrift „Frühlingsfahrt.“
Zwei Tote
Ein betäubender Trestergeruch hängt in den Gassen, als Edelbert Schicke mit dem Weinbergstraktor durch das Kraichgau-Dorf Großvillars rumpelt. Schicke schnuppert zufrieden – es ist sein Lieblingsduft. Mehr noch als am zarten Aroma junger Nüsse, an Flieder und Maiglöckchen, selbstgekochter Tomatensuppe, Rührei mit Schnittlauch und frisch gebackenem Brot erfreut er sich an diesem tausend Erinnerungen in ihren Verstecken aufstöbernden Herbstgeruch, wenn in jedem Hof die Moste gären und an den Hügeln ringsum die Trauben in der Oktobersonne dünsten. Für Edelbert wie für alle Weinbauern, ihre Angestellen und Helfer sind dies die höchsten Feiertage im Jahreslauf. Erntedankstimmung? Ja, auch, durchaus. Aber nur in den Pausen, wenn Ute Schäufele die heißen Würste in den Weinberg zur Lesemannschaft bringt und das eine oder andere Glas vom kellerkühlen Vorjährigen den Durst aus den Hälsen scheucht. Oder aber am frühen Morgen, vor dem Lesetag, wenn noch nicht alle Sinne auf die anstrengende, diffizile Arbeit konzentriert sind: Dann teilt sich unwillkürlich etwas mit von der weihevollen Atmosphäre der Reife, die frühere Generationen ohne Schwierigkeiten mit Gottes Segen in Zusammenhang zu bringen wussten.
In der Nähe des wunderhübsch renovierten Weinberghäuschens der Familie Schäufele stellt Schicke den schmalen Trecker ab. Vom Herbstfest gestern Abend sind keine Spuren mehr zu finden. Alle haben mitangepackt, Tische, Bänke, Flaschen hin- und wieder weggeschleppt; nicht ein Papierchen liegt mehr auf dem kleinen Festplatz. – Noch einmal will er den Spätburgunder in Augenschein nehmen. Jeden Tag, bisweilen mehrmals, ist er zuletzt gemeinsam mit Armin, dem Hausherrn des Kelterhofs, in den Weinberg hinaufgestiegen. Das Gespräch hatte stets einen ähnlichen Wortlaut.
„Sollen wir mal langsam?“
„Hm. Vielleicht noch ein, zwei Tage?“
„Hm. Vielleicht noch mal den Wetterbericht konsultieren?“
Der Wetterbericht! Vergleichbar allenfalls den Hochseefischern im Atlantik oder den Tabakbauern Mittelamerikas, versteht sich die Gilde der Winzer auf Wetterprognosen; es ist diese Abhängigkeit von oftmals minimalen Veränderungen der Witterung, zumal in der Zeit vor der Ernte, die ein Höchstmaß an Kenntnis, Weitsicht und Gespür erfordert. Alle haben sie das schon erlebt: Plötzliche Kälteeinbrüche, Hagel, Nässe, aber auch Trockenheit, zu viel Wind, zu wenig Wind ... all diese Faktoren entscheiden über die Qualität ganzer Jahrgänge oder gar über die Existenz von Betrieben.
Nein, heute ist es so weit: Jetzt ist er dran. Genug in der Sonne gelümmelt, ab damit und in die Presse! Edelbert Schicke zückt unwillkürlich das Refraktometer, nähert sich einem dieser makellos dunkelroten Henkel, pickt ein Träubchen heraus und zerquetscht es. Tatsächlich: Noch ein Grad Oechsle mehr als gestern. Vollreif sind diese Trauben ja seit Wochen; doch Armin Schäufele hat etwas Außergewöhnliches mit diesem Spätburgunder vor: Er soll Kraft haben, soll zum Erstwein, zum Flaggschiff des Gutes aufsteigen – ein muskulöser, ein männlicher Pinot Noir wird daraus werden, eine trockene Auslese, reifend in Barriques aus heimischer Eiche, zu Teilen eigens gefertigt von den kundigen Händen französischer Küfer. Während Schicke das Refraktometer trockenwischt, fällt ihm etwas auf: In der Reihe der schimmernden Burgundertrauben ist etwas in Unordnung geraten. Was soll nun das? Da hegt und pflegt man die Lage mit aufwändiger Laubarbeit und auf einmal kommt so ein Strolch daher und reißt die Drähte runter! Erbost geht Edelbert Schicke auf die lädierte Stelle zu – und taumelt im gleichen Augenblick zurück. Zwischen den herrlichen Früchten, leuchtend im Frühlicht, hängt ein blutiger Menschenkopf. Der Arbeiter im Weinberg hat nur kurz hingesehen; unwillkürlich schlägt er die Hand vor Mund und Augen. Doch die Zehntelsekunde hat genügt um zu erkennen, dass da ein lebloser Mensch im Weinberg kauert, halb über die Drähte gebeugt, mit einer gewaltigen Wunde im Kopf. In der Rückwärtsbewegung drängt es Edelbert, doch noch einmal hinzusehen. Kein Zweifel, ein Toter. Oder eine Tote? Das ist aus der Entfernung nicht zu erkennen; entstellt sieht die Leiche aus, umgeben von farbigem Weinlaub und den schönsten Trauben. Um alles in der Welt: Was hat dergleichen in Großvillars zu suchen, einem der friedlichsten Örtchen im Rund, wo seit Jahrhunderten keine Gewalttat mehr vorgekommen ist?
Geschüttelt von Ekel und Entsetzen, wendet sich Edelbert Schicke ab, läuft auf den Trecker zu ... und stolpert. Hart schlägt er hin, rappelt sich sofort wieder hoch. Dabei stellt er fest, dass sich sein Fuß in einem anderen Fuß verfangen hat: Kaum zwei Meter von ihm entfernt liegt eine weitere Leiche: Der Mund ist aufgerissen, die Beine sind verkrümmt, und der Rumpf sieht aus wie mitten entzweigeschnitten. Neuer Schrecken durchfährt den Ahnungslosen. Mit einem Aufschrei schnellt er empor, von einem einzigen Gedanken beflügelt: Weg hier, rasch ins Dorf, die Leute verständigen, die Polizei! Zittrig tastet Edelbert nach seinem Handy. Es fällt ihm aus der Tasche. Er will Armins Nummer wählen, aber die Finger gehorchen nicht.
„Ruhig, ganz ruhig weiteratmen“, zwingt er sich zum Innehalten. Tastend schiebt er sich voran, gegen den Brechreiz ankämpfend. Endlich am Traktor angekommen, zieht Schicke den Schlüssel aus der Hosentasche. Doch kaum, dass er aufsteigen will, hört er etwas, das ihm zum dritten Mal die Nackenhaare sträubt.
Von drüben, offenbar aus dem Wengerthäusle, dringt eine Stimme, erst leise, dann immer deutlicher vernehmlich: „Hallo? Hallo?“
Es folgt ein Pochen. Von da drinnen. Im Wengerthäusle befindet sich also noch jemand. Wer wird das wohl sein, wenn hier draußen zwei Tote liegen? Edelbert lässt den Schlüssel stecken, wendet sich ab. Hilfesuchend blickt er sich um. Nichts, niemand. Nur die beiden entsetzlich zugerichteten Körper.
Da hört er es wieder: „Hallo? Hallo?“
Jetzt hält ihn gar nichts mehr. In großen Sätzen hastet der Geplagte zu Tale, mitten durch die Reben hindurch, weg von dieser greulichen Stelle, die noch vor kurzem sein Lieblingsaufenthalt, sein Inbegriff von Idylle und Glück gewesen ist.
Kaum hat er eine kleine Strecke im Galopp zurückgelegt, hört er es noch einmal aus dem Häuschen schreien: „Hilfe! Bleiben Sie doch stehen! Hallo!“
Ha, so weit kommt’s noch ... Nein, nicht mit ihm! Darauf fällt er gewiss nicht rein. Wer weiß, was zu dieser Menschenansammlung von Lebenden und Toten im besten Weinberg des Kelterhofs geführt hat, das mögen andere aufklären – und zwar von der Polizei. Einstweilen gilt nur: Rette sich, wer kann!
Als er die Landstraße erreicht, sieht er von ferne einen Kleintransporter auf sich zukommen. Edelbert winkt, ruft verzweifelt: „Anhalten! Halt!“ Aber der Mistkerl im gelben Lieferwagen fährt einfach weiter, Richtung Bretten, beschleunigt sogar noch. Schicke flucht.
Schwitzend, völlig außer Atem, trifft er endlich im Ort ein. Als er schon überlegt, ob er beim erstbesten Haus an die Tür pochen soll, biegt eines der Erntefahrzeuge vom Kelterhof an der Kirche ums Eck. Mit beiden Armen winkend wie ein Verhungernder mitten in der Tundra, wenn nach Wochen der Hubschrauber auftaucht, eilt Edelbert Schicke auf die Leute zu. Im Anhänger sitzen lauter Bekannte aus dem Ort, einige kommen sogar von weiter her, bis aus Karlsruhe, um an den Erntefreuden teilzuhaben. Edelberts Kumpel Heiner sitzt am Steuer des leistungsstarken Traktors.
„Nicht weiterfahren! Nicht!“
Verwirrt hält der Fahrer neben dem Aufgeregten an, ohne den Motor auszuschalten. „Was hast denn?“
„Da obe, da obe ... im Wengertshäusle: Da ... da liege zwei Dote! Un einer isch noch im Hüttle un klopft!“
Ein Halbtoter
Beginnen wir noch einmal ganz woanders, sozusagen von vorn: im Frühling, wo alles beginnt, was Anspruch auf Vorhandensein erhebt. Wo alles Leben sich erneuen soll, um mit frischem Mut seinen Weg anzutreten – es sei denn, es ist bereits am Ende angekommen. Die Dichter aller Zeiten haben behauptet, es sei besonders grausam, im Frühling zu sterben. Es sei nämlich unzumutbar, teilnahmslos beiseite zu treten, wenn alle sich freuen und ihre Verjüngung bejubeln. Trauernd durch erblühende Alleen zu ziehen, unbeteiligt, doppelt ausgegrenzt, doppelt allein – solch ein Schicksal wäre doch wirklich keinem zu wünschen!
Diese traurigen Helden auf der Schattenseite des Frühlings, ja, die gibt es freilich auch; von einem solchen müssen wir erzählen, wenn wir die Geschichte erzählen wollen, die am Wengertshäusle zu Großvillars so brutal zu Ende ging. Doch geschieht ja auf Erden nicht alles nach bewährtem Muster, wie dies unsere stets nach Sinn und Verstehen trachtende Einbildungskraft uns vorgaukeln mag; bisweilen treffen Dinge aufeinander, die voneinander nichts ahnen konnten, und vermengen sich im Kontrast, so dass am Ende kein Freund der Wahrheit mehr zu behaupten wagt, man habe kommen sehen, was geschah ...
Beginnen wir in einem Vorort von Heidelberg, einem jener Stadtteile, die ihre Existenz allein dem Nimbus und der Attraktivität der sandsteinroten Universitätsstadt zu verdanken haben. Hier wohnen Leute, die wohl die Nähe zum Traditionellen suchten, die nimmermehr sagen würden, sie lebten im Emmertsgrund oder auf dem Boxberg oder in irgendeiner namenlosen Neubausiedlung Richtung Wieblingen; nein, es steht ja „Heidelberg“ in ihrer Adresse – und dieser Name glänzt wie ein Ehrenzeichen hinter der nur Eingeweihten auf Anhieb entschlüsselbaren Postleitzahl. – Warum die besagten Rand-Heidelberger kein Domizil in der Mitte bezogen haben oder doch in besser beleumundeten Wohngebieten wie Neuenheim oder Handschuhsheim, ist leicht erklärt: Es fehlte an Kontakten, an Ersparnissen, vielleicht auch an Geschicklichkeit. Freilich, kaum dass man Quartier in der Banlieu bezogen hat, redet man sich aufs Praktische hinaus: die besseren Parkmöglichkeiten, die hervorragende Infrastruktur, die Familienfreundlichkeit.
Von einer solchen Familie wollen wir berichten, genauer: von ihrem Oberhaupt ... wobei in unserem Falle durchaus keine Bezeichnung weniger zuträfe. Nikolaus Henn (er hieß einmal Grashof mit Nachnamen, bevor er sich verehelichte), langjähriger Mitarbeiter einer Dachziegelfirma im Innenbetrieb, braver Familienvati, Mitglied im ökumenischen Kirchenchor, Besitzer mehrerer goldener Kundenkarten, lebte seit vierzehn Jahren in einer dieser ästhetisch wenig mitreißenden, gleichwohl mit Privatparkplatz und Mini-Gärtchen ausgestatteten Behausungen im Weichbild Heidelbergs. Kaum hatte Annedore – seine Annedore – in den Heiratsantrag eingewilligt, waren die Planungen für einen Umzug aus der Altstadt hinaus in eine „familiengeeignete“ Wohngegend begonnen worden. Für Nikolaus’ Geschmack war das sehr schnell vor sich gegangen; er hätte sich gerne noch Zeit gelassen – mit der Hochzeit, mit dem Umzug, mit dem Kind. Viel lieber hätte er noch ein paar Jährchen damit verbracht, Annedores im Übermaß vorhandene Lieblichkeit ungestört zu genießen.
Doch Annedore hatte bereits genossen – und zwar ausgiebig, was sich zu Nikolaus’ Erschrecken in unaufhörlichen Konfrontationen mit ehemaligen Liebhabern niederschlug. Wo auch immer sie miteinander unterwegs waren, in Bahnhöfen, Eisdielen, Supermärkten, unablässig trafen sie auf sonderbar schluffige Gestalten, die allesamt ausnehmend vertraut mit ihr taten. Nikolaus wagte Anzeichen von Eifersucht zu zeigen, doch seine Auserwählte lachte ihn aus, was für ein Spießer er doch sei. – Nun, die begehrte Frau, inzwischen deutlich über dreißig, war eindeutig in die Familiengründungsphase eingetreten. Zu diesem Behufe mochte ihr Nikolaus als formbarer Kindsvater, geduldiger Ernährer und fügsamer Hanswurst erscheinen. Auf einmal bekamen die Dinge ihr eigenes Tempo, und er konnte sich mitunter nur noch bestürzt umsehen, bevor er verwirrt hinterdrein hastete. Was ihm dabei in keiner Weise bewusst war: In der Sekunde der Eheschließung im Rathaus am Heidelberger Marktplatz begann die Geschichte seiner Verstoßung.
Wir treffen auf Nikolaus Henn an jenem Abend Ende März, welcher für ihn mit einem unerwarteten, dabei außerordentlich folgenreichen Einschnitt beginnen sollte. Annedore hatte Kerzen angezündet, zwei Stück, die sie zu beiden Seiten des Küchentischs aufstellte. Sie tat das manchmal: die Wohnung schmücken, das Alltägliche mit einer Idee von Festlichkeit impfen – doch gewöhnlich nur dann, wenn sie Besuch empfing und niemals, wenn nur Nikolaus zugegen war. Annedore nötigte Nikolaus, Platz zu nehmen. Erwartungsvoll kam er der Aufforderung nach. Erwartungsvoll? Wahrhaftig! Nikolaus wartete immer noch. Seit vierzehn Jahren war er der Auffassung, Annedore würde doch einmal erkennen, dass er der Richtige für sie sei – auch wenn während dieser knapp anderthalb Jahrzehnte wenig, nein, so gut wie nichts davon zu spüren gewesen war. Sie setzte sich ihm gegenüber und begann zu sprechen. Auch das war selten: Annedore begann selten Gespräche. Wenigstens nicht mit Nikolaus – es sei denn, es handelte sich um Dienstleistungen wie Renovierungsaufträge, Fahrten zum Baumarkt oder den täglichen Transportservice für Valentin, den dreizehnjährigen Sohn.
„Du hast’s uns aber hübsch gemacht“, begann Nikolaus in seiner schüchternen Weise; aufgrund verschiedentlicher herber Erfahrungen traute er sich nicht einmal mehr, Komplimente auszusprechen.
„Hör mal zu“, schnitt ihm Annedore das Wort ab und goss sich einen Schafgarbentee ein. „Ich wollt dir was sagen.“
„Da bin ich aber gespannt.“
Ein knapper, gewohnt sauertöpfischer Blick traf ihn. Dennoch, wie gesagt, er hoffte noch. Wie ungeschickt von ihm ...
„Ich hab heut auf dem Markt mein’ schpirituelle Lebenspartner kenneg’lernt.“
Eigentlich sagte sie „Lääbnspattna“, denn kaum dass die Ehe seinerzeit geschlossen worden war, verfiel sie dauerhaft in das Idiom der Gegend, wo sie aufgewachsen war: Oberschwaben. Vorher, in der Zeit des Kennenlernens, hatte Annedore nur hochdeutsch gesprochen; zumindest vermeinte sich Nikolaus daran erinnern zu können, wie fein und bedacht diese Stimme geklungen hatte, niemals plump oder motzig oder gar aggressiv. Das hatte sich dann rasch geändert. Nun aber saß er ihr gegenüber und lächelte. Hatte er nicht richtig zugehört? Beinahe. Nach wie vor in der trügerischen Überzeugung befangen, nur ihm allein stehe die Etikettierung „Lebenspartner“ zu, hatte er das hingeschnodderte „auf dem Markt“ („auf’m Maekt“) schlicht überhört. Erst als Annedore präzisierte „Er heißt Ramon“, begann Nikolaus zu begreifen.
Nun verhielt es sich ja so, dass Nikolaus’ Gattin seit langem gewissen mysteriösen Tätigkeiten oblag, die man gemeinhin der Sphäre der Esoterik zurechnet. Nikolaus konnte mit solchen Dingen nichts anfangen, sah jedoch keinerlei Gefahr darin. In seiner Betrachtungsweise war Annedores Schwärmerei für alles Indische, aber auch Indianische, bald Ostasiatische, bald Zentralafrikanische ein Hobby wie Turmspringen oder Rollhockey. Sicher, es füllte sich das gemeinsame Häuschen nach und nach mit allerlei Zierrat, dem er selbst wenig abgewinnen mochte – überall schummerten Salzlampen, blinkten Energiesteine, baumelten Traumfänger, worin er sich meistens verfing, von der Decke herab – , doch hatte er ohnehin nach wenigen Wochen des Zusammenlebens registriert, dass er sich auf dem Gebiete der Inneneinrichtung wohl komplett werde anpassen müssen.
Hatte Annedore (zu Nikolaus’ Befremden) schon kurz nach der Hochzeit ihr soziales Leben weitgehend eingestellt, den Kontakt zu all den Freundinnen und vor allem Freunden, die sie noch zu WG-Zeiten in großer Zahl besucht hatten, abgebrochen, so begann sie nach und nach, immer mehr „Seminare“ mit schwer ergründlicher Thematik zu besuchen. „Sei dir selbst eine Insel“, so lautete der Titel jener ersten Wochenendveranstaltung, von der Annedore sogar ein wenig erzählte. Danach erzählte sie nichts mehr.
„Was meinst du denn?“, fragte Nikolaus leise. Und Annedore rollte die Augen. Seine Begriffsstutzigkeit war für sie schon immer Anlass für Spott und Zurückweisungen gewesen. Gemäß einer verachtungsvollen Gewohnheit rollte sie also ihre Augen, zog die Stirne kraus und erläuterte unmissverständlich, dass sie sich scheiden lassen wolle, übrigens so schnell als möglich. Ein gemeinsames Leben, es sei ja ohnehin recht fade gewesen, komme für sie nicht länger in Frage. Sohn Valentin bleibe selbstverständlich bei ihr. Der Kontakt zum Erzeuger (damit meinte sie Nikolaus) werde selbstredend fair geregelt, sie denke an eine Zweidrittel-Eindrittel-Aufteilung. Schon morgen solle sich Nikolaus auf Suche nach einer geeigneten Wohnung für ihn selbst begeben, bitteschön weit genug entfernt, aber nicht zu weit, der Kindsbetreuung wegen, die gerade auch nachts zu erfolgen habe. Die monatlich zu entrichtende Unterstützungssumme belaufe sich auf 664,42 Euro; sie habe sich erlaubt, den Betrag schon einmal zu berechnen.
Nikolaus glotzte von einer Kerzenflamme zur anderen, räusperte sich mehrmals und brachte nur ein piepsendes „Aber warum denn?“ heraus.
Annedore war sein Schicksal ... wenngleich in ganz anderer Hinsicht als er sich dies einst ausgemalt hatte. Durch eine Kommilitonin hatte er sie kennengelernt. Annedore machte damals in zweiter Ausbildung eine Lehre als medizinisch-technische Assistentin. Schon ihr Äußeres erschien ihm über alle Maßen auffällig und liebenswert: ihre langen, hellbraunen Haare, die grazile Gestalt, das feingeschnittene Gesicht – und dann dieses Lächeln! Jenes allen irdischen Gram vergessen machende Lächeln ... Was Nikolaus aber am meisten wunderte, war Annedores Freundlichkeit. Wie konnte das zusammengehen: Solche Schönheit und solch bescheidenes, empfindsames, teilnahmsvolles Benehmen? Nikolaus war ganz verstört, als er sie zum ersten Mal persönlich sprach; eine derartige Sanftheit und Würde und Gewandtheit war ihm nie zuvor untergekommen – mehr noch, er hätte glatt geleugnet, dass dergleichen überhaupt irgendwo existieren könne! Ausgestattet mit eher wenig Selbstbewusstsein, erlebte er Annedores Aufgeschlossenheit, ihr Interesse an seinen Gedanken und Hoffnungen, als beständige Ermunterung. Jana gegenüber, der Vertrauten seines Herzens, einer Kameradin aus frühesten Kindertagen, eröffnete er alsbald seine Absicht, Annedore für sich zu gewinnen. Gelegentlich einer Geburtstagsfeier stellte er die beiden einander vor – und Jana riet dem Seelenfreund zu. Ja, diese zarte Annedore, die musste die Richtige für ihn sein, eigens geschaffen, um Nikolaus glücklich zu machen!
Zu seiner größten Überraschung schien Annedore einer Verbindung nicht abgeneigt. Es keimte zunächst wohl nicht die allergrößte Leidenschaft in ihr, doch bezeigte sie stete Zuneigung, ging bereitwillig auf allerlei Vorschläge ein, verabredete sich gern mit ihm. Man schlenderte durch Heidelbergs Wälder, es war ein beständiges Lächeln und Erzählen und Herumschäkern.
Mit dem ersten Kuss freilich begann eine Verfinsterung, die kein Außenstehender hätte erwarten können, Nikolaus am allerwenigsten. Es stellte sich heraus, dass Annedores sprichwörtliche Sanftheit immer nur für diejenigen reserviert blieb, die sie flüchtig kannte, die Nachbarn, die Bekannten, die Geschäftskollegen, die Liebhaber, aber auch für Passanten, die nach dem Weg fragten, für Kinder oder auch für Kunden des Ausbildungslabors, wo sie bald eine Festanstellung fand. Nie aber, unter keinen Umständen schenkte Annedore ein wenig von ihrer Huld denjenigen, die sie als zu ihr gehörig empfand, als Familie. „Hausteufel und Straßenengel“, dieser alte Spruch von tiefer systemischer Weisheit, traf derart vollständig auf Nikolaus’ Erwählte zu, dass man hätte meinen können, es handle sich um eine private Parodie.
Zunächst reagierte Nikolaus mit Bitten und Flehen, sodann mit Tränen und Zornesausbrüchen. Annedore blickte vorwurfsvoll, denn sie war schwanger und schalt Nikolaus ob seiner Selbstverliebtheit. Das war natürlich etwas ganz anderes! Der junge Mann entschuldigte sich tagelang, so etwas habe er ja nicht ahnen können, was da vorging ... und versprach, Annedore fürderhin in allem beizustehen, was sie von ihm verlangte. – Je mehr die beiden eine Hausgemeinschaft bildeten, in Erwartung eines dritten Mitbewohners, desto klarer trat ein weiterer Wesenszug Annedores hervor, welcher für den werdenden Vater eine Serie zusätzlicher Zurücksetzungen bedeutete. In keinem einzigen Fall zeigte sich Annedore kompromissbereit: Das Häuschen wurde nach ihren Vorstellungen eingerichtet, der Tageslauf hatte ihren Vorlieben zu entsprechen. Dabei bewies sie einen Nikolaus fremden Sinn für Reinlichkeit, besser: für Sterilität, der Nikolaus so seltsam vorkam, dass er all das Gewische und Gesauge für eine vorübergehende Manie hielt. Er selbst durfte weder saugen noch wischen; er machte es nicht gut genug. Als einmal beim Duschen zwei Wassertropfen auf die Waschmaschine hinübergespritzt waren, kam Annedore herbeigestürzt, rollte die Augen und wischte die Tröpfchen seufzend weg. Nikolaus wollte lachen – Wassertropfen im Bad, das musste doch erlaubt sein! Wie sehr er sich täuschen sollte.
Man hätte nun erwarten können, dass sich eine gewisse Zufriedenheit bei Annedore einstellte, da doch alles, was geschah, vollständig nach ihrem Willen verlief. Weit gefehlt: Kaum waren sie eingezogen in das antiseptisch funkelnde Vororthäuschen, wurde sie von einer zähen Depression befallen, die nicht mehr wich – bis zu dem Tage, da sie auf dem „Maekt“ ihren „schpirituelle Lääbnspattna“ kennenlernte.
Sämtliche Stufen, im gesamten Treppenhaus, hatte Nikolaus mit Rosen belegt, als Annedore mit dem kleinen Valentin aus der Geburtsklinik zurückkam. Sie latschte drüberweg und schimpfte: „Un wär soll des nachher alles wegbutze, hä?“
Geschäftskollegen, Verwandte, einige Vertraute, die es damals immerhin noch gab, glaubten ihm nicht, wenn er von solch absurden Qualen berichtete.
„Du musst sie erst einmal für dich gewinnen“, schlug Jana vor. Nikolaus nahm das ernst; in der Folge fügte er sich Annedores Befehlen restlos, wodurch er nach und nach all seine anderweitigen Kontakte einbüßte, zuerst zu seinen Kumpels, dann zur eigenen Familie, ohnedies nur noch lückenhaft vorhanden, schließlich zu Jana selbst.
Kurzum, Nikolaus führte ein Elendsleben in Abhängigkeit und Überanpassung. Der einzige soziale Raum, der ihm zum Austausch noch verblieb, war seine Arbeitsstelle. Die Schreibtischtätigkeit empfand er zwar als bedrückend langweilig, auf Dauer gar unerträglich für den kreativen Geist, der er einmal gewesen war; doch Annedore hielt erwartungsgemäß nichts von einem Stellenwechsel, der das geregelte Einkommen gefährden könnte. Sie selbst war nur noch stundenweise werktätig, widmete sich andererseits mit Akribie der Erziehung Valentins, vor allem freilich der Säuberung seiner Kleidung.
Nun, zweifellos, nach Ablauf einiger harter Monate, während derer Nikolaus so gut wie gar nicht geschlafen hatte, entwickelte der Vater starke Gefühle für den Sohn und verbrachte seine gesamte Freizeit damit, den Kleinen im Wägelchen durch die Gegend zu schieben, denn die Mutter lag zu Hause und brauchte ihre Ruhe, denn sie war ja depressiv, leicht reizbar und – wer weiß! – am Ende brachte sie sich noch um.
Aus dieser Hölle aus Ängsten und Isolation fand Nikolaus nicht mehr heraus. Seine einzige Hoffnung galt tatsächlich dem Tage, da Annedore endlich wieder so werden würde, wie er sie kennengelernt hatte. Und wahrhaftig, da gab es Stunden, in denen schien es möglich, da entschuldigte sie sich gar für ihr grobes Benehmen, zieh sich selber der Lebensfeindlichkeit, gar der Grausamkeit, äußerte, sie wisse überhaupt nicht, weshalb sie so hexenhaft handle, brach in Tränen aus und ließ sich trösten. Dies freilich stärkte Nikolaus darin, die kurz darauf folgenden Anschuldigungen, alles Leid, das Annedore zu tragen habe, sei nur durch ihn auf sie gekommen, umso williger zu ertragen.
„Du bist en Hannebambel!“, hatte Oschi, ein Kumpel aus Darmstädter Studientagen, die Freundschaft zu Nikolaus beendet.
„Wie kann man sich nur so wegschmeißen?“, hatte ihn Jana gescholten, bevor sie sich für immer von ihm zurückzog.
„So einen Jammerlappen wie Sie hat es bei uns in der Firma noch nicht gegeben“, hatte ihn sein Chef abgefertigt, als Nikolaus, nach einem von Annedores Wutausbrüchen dominierten Wochenende, gewagt hatte, dem Vorgesetzten sein Leid zu klagen. „Sie müssen sich neu positionieren, mein Guter! Nur ein ebenbürtiger Partner hat eine Chance auf Achtung. Merken Sie sich das.“
Nikolaus wusste das ja. Immer wieder hatte er den Versuch unternommen Annedore selbstbewusster gegenüberzutreten, ihr ein für alle Mal zu verdeutlichen, dass er kein Sklave sei. Sie wusste es besser. Sie heulte und tobte, bis der kleine Valentin verängstigt und tränenüberströmt aus dem Kinderzimmer getappst kam, die Kuscheldecke an sich gepresst. Nein, das war das Allerschlimmste, Unerträglichste: dass nun auch noch der Kleine unglücklich wurde! Und mit neuer Hingabe widmete sich Nikolaus den Wünschen seiner kühlen Gemahlin. Bald leistete er gar keinen Widerspruch mehr, einzig darum bemüht, dem geliebten Kind eine glückliche Zeit vorzuheucheln. – Aber war das denn geheuchelt? Lachte der Winzling nicht auffallend viel? Entwickelte er sich nicht prächtig? In der Tat, daran konnte kein Zweifel sein. Valentin gedieh! Er wurde ein empfindsamer, dabei durchsetzungsfähiger, liebevoller, dabei energischer, intelligenter, dabei uneitler Prachtkerl. Dafür hatte sich alles gelohnt: Nikolaus’ Opfer hatte einen Sinn gehabt. Bis zu dem Abend mit den beiden Kerzen.
„Du ... du meinst also, der, wie du sagst, spirituelle Lebenspartner, der wär nicht ich?“
Annedore prustete los: „Hä?“ Sie hatte sich angewöhnt, bei Tisch grundsätzlich nur noch mit vollem Mund zu sprechen; deswegen stopfte sie sich einen dicken Energiekeks zwischen die Zähne und begann zu lästern: „Wie kommscht denn auf so was? Ha du spinnscht ja! Heidernei, guck di doch emol oo! Du – un schpirituell! Des isch jo en Witz ...“
Das war nun allerdings richtig: Besonders vergeistigt hatte sich Nikolaus wirklich nie gefühlt, es sei denn in künstlerischer Hinsicht – aber das war lange her. Unwillkürlich erhob er sich. Narkotisiert von der Ahnung künftigen Leides, wankte er hinüber zum Kinderzimmer. Annedore rief ihm irgendetwas Abfälliges hinterher, doch verstand er es nicht, da die Energiekekse die Aussprache beeinträchtigten. Valentin lag auf seinem Sofa, hörte Musik und fummelte an einer elektronischen Apparatur herum, deren Sinn Nikolaus verborgen war. Mit belegter Stimme, umständlich, wie es seine Art war, doch einfühlsam und zärtlich begann der Vater, die schwierige neue Situation zu erläutern. Doch auch hier erlebte er eine finstre Überraschung. Unwillig dreht sich Valentin zu ihm um und blaffte: „Oh Mann Papa, das gibt’s ja wohl nicht! Merkst du auch mal was? Den Ramon kenn ich schon seit Monaten. Is’ übrigens total nett.“
Als der Dreizehnjährige die Bestürzung in des Vaters Augen sah, ergänzte er obenhin: „Naja, keine Bange, ich komm dich schon besuchen, wenn der Ramon hier eingezogen ist. Hast du eigentlich schon ’ne Wohnung?“
Mechanisch, ohne zu antworten, zog Nikolaus die Tür hinter sich zu. Irgendetwas rieselte beständig in seinem Inneren herab. Würde er demnächst zusammenbrechen? Vermutlich. Auf dem Weg in den Keller nahm er, ohne es recht zu bemerken, ein Lämpchen mit, das ihm Annedore hingestellt hatte. Ach ja, sein Kellerreich und die Treppe dorthin! Noch während der Stillzeit hatte ihn die junge Mutter eines Nachmittags damit überrascht, dass sie ihn in den ehemaligen Hobbykeller führte und ihm selbigen als künftigen Schlafplatz zuwies. Die Tischtennisplatte – ein wenig voreilig für das erwartete Kind angeschafft – stand zusammengeklappt an der Wand; in der Mitte prangte Annedores altes Sofa, Relikt leichterer Zeiten, wie sie sich auszudrücken beliebte, da sie noch häufig triebfreudigen Herrenbesuch empfing. Die gakelige, fleckige Liegestatt hatte sie fein säuberlich mit Spannbettbezug verdeckt – immerhin. Bis auf wenige Ausnahmen verbrachte Nikolaus die Nächte der nächsten dreizehn Jahre dort. Seine Nackenschmerzen nahmen zu, aber auch das war auszuhalten.
Das lichtlose Lämpchen in der Hand, näherte sich Nikolaus seinem Verlies. Ein weiteres Ritual Annedores bestand darin, dass sie ihm nach und nach all das, was sie einst miteinander verbunden hatte, sämtliche Geschenke, alle gemeinsam angeschafften Haushaltsdinge, jedwedes Ding, das sie auf welche Weise auch immer an den ohne Angabe von Gründen Verstoßenen erinnern mochte, auf die Treppe stellte: grundsätzlich auf die zweite Stufe von oben, Stück für Stück Demütigungen, Kennzeichen einer mitleidlosen, irreversiblen Austreibung.