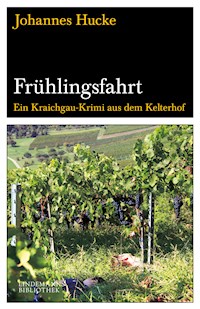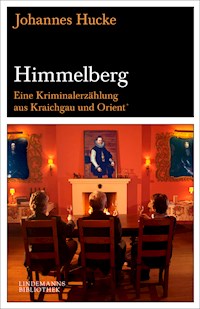Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Trotz zahlreicher Modernisierungen steht die PACKURA-KARTONAGEN-U.A.V. vor dem Konkurs. Direktor Essenwein droht das Schlimmste: Er soll an seinen Konkurrenten, die "Ballenberger World Packaging & Co. KG", verkaufen. Denen setzt er zum Schluss noch einen Floh ins Fell: Mit Hilfe der altgedienten Sekretärin Gisela Schlesinger überredet Essenwein den vor Jahren pensionierten Büro-Technokraten und Betonkopf Kurt Schmitt, als neuer kommissarischer Geschäftsleiter "die Firma zu retten." Zum Entsetzen der jungen Mitarbeiter (vor allem der Mitarbeiterinnen) dreht Schmitt das Rad um gut fünfzig Jahre zurück. Er streicht alles, was ihm überflüssig erscheint: Teamsitzungen, E-Mail-Verkehr, Coaching, Briefings, Business Dress-Codes, Incentives ... Stattdessen führt er das gute alte Kundengespräch wieder ein, den Hausbesuch, persönlichen Kontakt, gemeinsames Schnitzelessen, züchtige Dienstkleidung, Weihnachtsfeiern mit Kegelschieben – und Schreibmaschinen! Außerdem wirft er alle Designer raus und ersetzt sie durch seinen alten Spießgesellen Fredi Tierske, der Computer strikt ablehnt; stattdessen werden nun wieder hübsche Handzeichnungen für die Produkt-Werbung angefertigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes Hucke
Zurück zu Schmitt!
BÜRO-NOVELLE VOM ERWARTETEN NIEDERGANG UND UNERWARTETEN AUFSTIEG DER PACKURA KARTONAGEN U.V.A.
Dieses eBook wurde erstellt bei
Dieses E-Book wurde erstellt für Johannes Hucke ([email protected])
am 24.04.2015 um 8:01 Uhr, IP: 84.163.14.147
Inhaltsverzeichnis
Titel
Hinweise eines Fensterputzer-Fisches
Einkauf mit Satteltasche, aber ohne Fahrrad
Zwei Briefe
Überfall plus Kuss von Emma Peal
Dienstantritt mit 72: Forstarbeiten und versteckte Talente
Überfällige Entschuldigungen und eine unvergessliche Rede
Stubendurchgang und Ping-Pong mit Blick auf Altenglühen
Entlassungswelle rückwärts
Das wiedergefundene Paradies: Hohelied der Gegenstände
Horrido! Antreten zum Schnitzelfassen
Wie zerronnen, so gewonnen
Frühlingswalzer in der Tiefgarage
Fingerzeige einer Bockwurst
Impressum
Hinweise eines Fensterputzer-Fisches
„Immer derselbe Carpaccio-Quatsch! Gibt´s denn nirgendwo mehr Pellkartoffeln?“
Mit dem zum Vorzugspreis ausgewiesenen Businesslunch schien Direktor Essenwein nicht einverstanden zu sein.
„Wenn Sie Pellkartoffeln wollen“, äugte Dr. Eleonore Kahle hinter der überdimensionalen Speisekarte hervor, „hätten wir vielleicht nicht zu Ihrem Edel-Italiener gehen sollen.“
Unwillig hob Essenwein die Schultern. Sein Blick fiel auf einen Fensterputzer-Fisch, der in einem der Riesenaquarien, streng geometrisch über den weitläufigen Gastraum verteilt, seiner stumpfsinnigen Tätigkeit nachging: immer dieselbe Ecke, immer dieselbe Ecke ... Dahinter bemerkte der Direktor einen älteren Herrn, der eine auf DIN-5-Größe zusammengefaltete Zeitung las und mit seiner Lachslasagne schimpfte. Zu heiß, vermutlich.
„Ich habe den Eindruck“, setzte Eleonore von neuem an, „dass Ihre Distanz gekünstelt ist; dass Ihnen der Verkauf der Firma persönlich viel näher geht als Sie es zugeben wollen.“
„Ihnen kann ich´s ja sagen.“ Essenwein räusperte sich seltsam helltönend, der Fensterputzer-Fisch sah sich um. „So langsam verstehe ich die alten Offiziere, die für solche Fälle immer einen Revolver in der Schublade hatten. Das waren noch Ehrenmänner.“
„Na, na.“ Frau Dr. Kahles Miene changierte in Richtung Psychotherapie. „Sagten Sie nicht, Sie gehen bald in Kur? Vielleicht, dass danach ...“
„Ja, so ist es. Feigheit vor dem Feind, wenn Sie so wollen.“
Der angeschlagene Direktor winkte dem Kellner. Er brauchte jetzt Rotwein. Schweren Rotwein.
Eleonore Kahle, Wirtschaftsanwältin in dritter Generation, unverzichtbar in dieser Stadt, wenn es darum ging, kranke Firmen für gesund zu verkaufen – oder umgekehrt, je nach Bedarf – , war dem Hause Essenwein seit längerem verbunden. Hier herrschten also andere Gesetze. Wahrhaftig, das gab es! Von wegen „unbarmherzige Kampfhexe“, wie ihre wunderbar missratene Tochter sie zu titulieren pflegte. Jens Essenwein tat ihr als Mensch leid. Man stelle sich vor: als Mensch!
Das verlangte ungewöhnliche Maßnahmen.
„Wie Sie wissen“, bemühte sich die Anwältin um ein vertrauensvolles Timbre, „bin ich als Sparbrötchen verschrien. Heute aber nicht. Ich lade Sie zu einem schönen Brunello ein, ja? Und wenn Sie dann noch traurig sind ... fang´n wir an von vorn.“ Den Schluss hatte sie fast gesungen, im Heinz-Ehrhard-Stil.
„Das bin ich nicht wert“, schluckte Essenwein, der sichtlich gerührt war. „Nicht mehr.“
„Kscht!“
Wäre Eleonore wirklich eine Hexe gewesen, mit exakt dieser Bewegung hätte sie alle Trübsal vom Tisch verscheucht. So aber irritierte sie nur die streng uniformierte edelitalienische Bedienung, deren Bewegungen, mehr noch, deren Seele inklusive Erscheinungsbild von irgendwem gleichgeschaltet zu sein schien. Sie sagte tatsächlich „Oups!“, sie säuselte „Was darf ich denn Leckeres bringen?“, ließ auch das sklavische „Sehr gerne!“ nicht aus und zischte beim Servieren immer wieder „Genießen Sie eees!“
„Äh ...“ Direktor Essenwein deutete an, dass ihm übel sei. „Noch eine Generation, und das sind alles Automaten.“
„Warten Sie zwei ab, dann gibt es nichts anderes mehr, und dann merkt´s auch keiner.“
Frau Dr. Kahle schien sich nicht zu beunruhigen. Zumindest nicht, solange sie in einen so prachtvoll gereiften Brunello hineinriechen durfte.
„Und die Menschen? Was wird dann aus ...“
„Haben Sie Matrix gesehen?“
„Den Film? Och bitte, keine Science-Fiction. Nicht schon mittags.“
Nach und nach gelang es der Anwältin, ihren Schützling, der ihr in den vergangenen Jahren immer wieder fabelhafte Aufträge zugeschanzt hatte, in freundlichere Gewässer zu steuern. Statt von drohendem Konkurs, Zerschlagung, gierigen Erzfeinden quasselten die beiden bald vom Meer. Anlass war ein mit Limonen-Zesten erfrischter Schwertfisch, freilich in Mini-Ausführung, auf noch winzigeren Linguine gebettet. Ein Sonnenuntergang aus Bottarga vollzog sich in einer Tellerecke. Frau Kahle musste umschwenken; den Brunello ließ sie weiteratmen, indessen sie die Servierkraft programmierte, so schnell wie möglich einen Roero Arneis aus dem Kühlschrank zu fischen.
„Alte Römerrebe“, konnte sie einmal mehr ihr Fachwissen nicht unterdrücken. „Leichter Honigton, aber schön kräuterherb. Haben schon die großen Dichter gesoffen, Dings zum Beispiel.“
Während des erwartungsgemäß sich anschließenden Monologs über den Weinbau im Alten Rom im Vergleich zum noch älteren Griechenland nebst einem Exkurs in die frühe ägyptische Rebenkultur hatte Direktor Essenwein ausreichend Zeit, einer unerwarteten Kehrtwendung seine Beachtung zu schenken. Jener Fensterputzer-Fisch, den er kurz zuvor seiner tumb-gleichförmigen Verrichtungen wegen noch innerlich gescholten hatte, war auf einmal in eine andere Richtung unterwegs. Seinen traulichen Winkel hatte er verlassen, vielleicht für immer. Das unförmige graue Schleimvieh hatte sich auf eine schmierige Wanderschaft begeben, über ein Drittel der Glasscheibe hin, wo es mümmelnd verharrte.
Was mümmelte es eigentlich?
Keine weiteren Fragen, bitte. Die Saug- und Schmatz-Apparatur betrachtete Essenwein nicht so genau, er war ja am Essen. Doch kam es da drüben zu einem seltsamen Zusammenspiel zweier – vermutlich – unabhängiger Szenen: Das Fischlein nämlich machte genau über dem Haupt des sorgfältigen Zeitungslesers Halt und schien nun nicht mehr Fensterglas, sondern eine Stirn zu säubern, zumindest legte die Überlagerung der beiden Bilder die absurde Verknüpfung nahe.
„Interessieren Sie sich wirklich für Aquarien, oder ist Ihnen meine Gesellschaft so verdrießlich?“
Jens schrak auf.
„Um Gottes Willen, Entschuldigung, nein, ich bitte ...“ Er bemühte sich erst gar nicht, den idiotischen Einfall zu schildern – was sollte Frau Dr. Kahle von ihm denken? Zwei Teller mit zärtlich gegarten Kutteln, dem Zwischengericht, bevor man sich endlich dem rosigen Lamm-Karree (und damit auch dem Brunello) widmen konnte, lenkten die Aufmerksamkeit der Geschäftspartner aufs Wesentliche.
„Was für ein Duft! Da ist grober Senf drin. Ich sterbe ...“
„Frau Dr. Kahle, ich bin immer wieder überrascht, zu welchen emotionalen Höchstleistungen Sie fähig sind. Man verkennt Sie.“
„Ach papperlapapp, ist doch nur beim Essen so. Wenn’ s um Menschen geht, bin ich ganz Ratio. Menschen ess’ ich ja auch nicht. Noch nicht.“
Erst beim Dessert – Direktor Essenwein ließ es bei einem Espresso mit einer winzigen Eiswaffel bewenden, er war voll – , getraute sich der frisch gebackene Pleitier den entscheidenden Vorstoß zu. Es handelte sich um nichts weniger als um den Anlass zu diesem Rencontre. Zweimal setzte er an, da ebnete Eleonore schon das Feld.
„Nu’ drucksen Sie nicht rum, das passt nicht zu Ihnen. Natürlich weiß ich schon die ganze Zeit, was Sie wissen wollen, und ich weiß auch, warum Sie es wissen wollen und dass Sie nur mich fragen können, wen denn sonst? Hach, diese Kutteln! Haben hier so gar nichts von Calamares, finden Sie nicht? Also, wenn ich immer so gut Bescheid wüsste, ich könnte mir doch noch dieses bescheuerte überteuerte Bötchen da auf dem Lago di Orta leisten ...“
„Kannst du doch längst, Frau Mahlzahn“, flüsterte der Direktor in sein Innenleben hinein, wo die Worte von finsteren Wänden, bestückt mit rhythmisch blinkenden Smaragden, widerhallten. Er presste aber nur zwei Wörter hervor.
„Danke. Und?“
„Selbstverständlich darf ich nichts über die Verhandlungen verlautbaren lassen, das ist Ihnen bekannt. Ob Ballenberger den Zuschlag schon gekriegt hat, unterliegt natürlich der Schweigepflicht. Manchmal genügt aber auch ein minimaler Hinweis, nicht wahr?“
Die nach einer zeitlosen Fasson elegante Dame, deren tiefdunkles Lippenrot auch während der üppigsten Mahlzeiten kaum aufhellte, hob ein Espresso-Löffelchen in die Luft.
„Das ist oben, ja? Und das ist unten. Achten Sie einfach darauf, wie herum es liegenbleibt, wenn ich gleich eine rauchen gehe, ja?“
Jens schüttelte zustimmend den Kopf.
Er verstand zwar nicht, wozu dieses Schere-Stein-Papier-Spiel gut war – aber er hatte dann immerhin Gewissheit. Essenwein biss in das Wäffelchen und begann den Löffel zu hypnotisieren. Indes sein Gegenüber mit erfreulicher Boshaftigkeit über die „Rechtsgelehrten“ der Ballenberger Word Packaging & Co. parlierte, zeigte das Schäufelchen des Löffelchens mal nach oben, mal nach unten. Dann, mitten in einer Pointe, die der Direktor nicht kapierte, blieb das silberne Besteckchen plötzlich liegen. Es schaukelte ein wenig, wie der Verängstigte durch zusammengekniffene Augenlider erkennen konnte. Dann gab er sich einen Ruck. Sah hin. Und bestellte zwei Grappe, beide für sich.
So also ... so war die Entscheidung denn doch gefallen: Exakt auf jene Art und Weise, wie er dies seit Ende der Neunziger, als Ballenberger durchzustarten begann, befürchtet hatte. Ach was, befürchtet: Es war von Anfang an die Schreckensvorstellung schlechthin, die apokalyptische Vision, der totale Untergang. – Essenweins Packura, vom Vater übernommen als ein Musterunternehmen, gesund bis ins Dämm-Material der 421 verschiedenen Verpackungen hinein: aufgesaugt vom schlimmsten Konkurrenten ... dem unerträglichen, dem bitterzynischen, herausfordernden, so erfolgreichen wie gefühllosen Friedhelm Ballenberger! Gleicher Jahrgang wie Jens, aber viel verwöhnter; verzogen, konnte man sagen.
Jahrelang hatte die Packura die Nase vorn gehabt, vor allem in Deutschland. Aber in Osteuropa war Ballenberger schneller gewesen. Südafrika ebenfalls. Seither nannte sich dieser Drecksladen „World Packaging & Co. KG“
Pf!
Auf einer Tagung, es war sehr spät und Essenwein hatte sehr getrunken, war ihm der sehr nach Obstler riechende Kontrahent sehr nahe gerückt ... und hatte das Ende der Packura prophezeit, mit Genuss, versteht sich: das Aufgehen in seiner „Weltfirma.“
„Dem nicht!“, hatte Vater Essenwein daheim getobt, „dem nimmermehr! Sonst komm ich aus dem Grab zurück und ...“
Essenwein war ja kein Spiritist. Er glaubte auch nicht an Zeichen. Und doch ... und doch ... Wenn er je eines gelernt hatte in seinen knapp dreißig Dienstjahren, dann dies: die Lösungen sind immer schon da. Task Forces, Brainstormings und all der Moderatorenkram hatten nur den einen Sinn, Entscheidungen, die längst getroffen waren, plausibel zu formulieren; Tendenzen, die sich bereits durchgesetzt hatten, im Nachhinein zu legitimieren; Leute, die bedachtsam waren, sachte heranzuführen ans Unvermeidliche.
Kurzum, selbst Direktor Essenwein, der Spezialist für kluge Lösungsmodelle schlechthin, hatte eben noch versucht, das überdeutlich und mit einem Blick zutage Getretene zu ignorieren. Jetzt, nachdem der Espressolöffel entschieden hatte wie vor 1000 Jahren ein auf der Wegkreuzung umgekipptes Wikingerschwert, brauchte nichts mehr vertuscht zu werden: vor seinem eigenen Bewusstsein. Es stand ihm alles klar vor Augen. Er schämte sich nur ein bisschen. Ein bisschen sehr.
Als Eleonore wiederkehrte, den üblichen Nachdampf aller Pausenraucher mit sich führend, zeigte sie sich überrascht.
„Na so was! Da lasse ich Sie allein, diskret wie ich bin, weil ich denke, Sie weinen, klagen, zerraufen sich die Brust. Und jetzt? Sehen Sie aus, als hätten Sie eine Offenbarung gehabt. Allerdings, wenn ich Sie mir genauer betrachte ... dieser Engel war keiner von da oben, stimmt´s?“
„Eher nicht.“ Essenwein bemühte sich, den Triumph der Bosheit nicht in allzu großen Dosen nach außen dringen zu lassen. „Ich bin ... auch gar nicht Schuld. Der ...“ – dabei wies er mit einer Kopfbewegung zum Aquarium – „ ... hat es mir vorgesagt.“
„Der alte Mann am Tisch da drüben?“ Frau Dr. Kahle verstand mit einem Male nicht mehr viel.
„Nein, der Fensterputzer-Fisch. Allerdings ... wenn Sie es so sagen ... eigentlich alle beide. Im Duett.“
Sein Kichern hatte etwas Idiotisches. Immerhin platzte er noch nicht mit dem vulkanisch angestauten Lachen heraus.
„Ich glaube“, mischte Frau Dr. Kahle etwas mehr Dunkelblau in ihre Stimme, „das ist gar kein Fisch. Eher so ein ...“
„Nun?“
„Molch.“
„Ein Molch?“
„Oder Olm. Oder irgend so was. Diese kleinen Viecher halt. Jedenfalls, meiner Ansicht nach gibt es gar keine Fensterputzer-Fische. Die heißen anders. Ergo können Sie auch keine rettenden Ideen von einer nicht existenten Spezies erhalten haben, wie auch?“
„Rettend hab ich nicht gesagt.“
„Also“, Eleonore missdeutete die zwei Gläser Grappa und schnappte sich eins. „Was haben Sie vor?“
Jens Essenweins geradezu schmerzhaft belustigter Blick wandte sich wieder seinen Freunden hinter Glas zu. Er gluckste behandlungsbedürftig.
„Tja. Der jetzige Stand der Entwicklungen erlaubt noch keine ausführlichen Darlegungen, das müssen Sie verstehen. Aber so viel kann ich Ihnen bereits mitteilen ...“
Frau Dr. Kahle zog ihre Augenbrauen forschend so weit nach oben, dass sie zwei Paraglidern glichen, die dem Unendlichen entgegenstrebten. Und sie gewahrte, wie diese Männerhand da drüben nach ihrem, Eleonores Espresso-Löffelchen, griff ... und es ganz langsam umdrehte. So dass die Öffnung der Laffe nach oben wies.
„Aber“, konnte sich Jens Essenwein nun nicht mehr gerade halten, weil er geschüttelt wurde von etwas, das stärker war als er, „Sie können mir gerne ... bei der Formulierung ... eines Vertrages ... hihi ... helfen! Hu ... hu ... Es gilt (hier entjappste ihm der erste Laut, der ca. die Hälfte der Restaurantbesucher sich nach ihm umdrehen ließ), einen neuen ... (jetzt spritzten ihm die Lachtränen aus den Augen) kommissarischen ... Leiter einsus ... einsus ...“
Weiter kam er nicht. Aber die Bedienung kam, indigniert angesichts eines in diesen Räumen nie dagewesenen Lach-Schluchz-Anfalls eines augenscheinlich doch seit längerem erwachsenen Mannes. Es schaute jetzt auch die andere Hälfte der Gäste. Die Servicekraft stockte, einem pochierten Eierspeise nicht unähnlich.
Sie sagte nicht mal mehr „Oups!“
Einkauf mit Satteltasche, aber ohne Fahrrad
Unter dem Essig des Frühherbstregens werden alle zu Salat. In der grellbunten Keramikschüssel der Großstadt schwimmen die Leute umher wie aufgeweichte Croutons. Länger haben die Tiere Widerstand geleistet, vor allem die Vögel; ihnen traute man es am ehesten zu, mit dem Wechsel des Aggregatzustandes fertig zu werden, so mutwillig schossen sie immer durch die Luft. Jetzt sitzen sie nur noch da, in merkwürdig großen Abständen zueinander, als fürchteten sie, durch die Berührung fremder Flügel noch mehr Nässe abzukriegen. Am schlimmsten sind die Kastanien dran: Eben noch feierlich erglänzend in ihrem arroganten Möbelhaus-Mahagoni, liegen sie jetzt, von Reifen plattgequetscht, zu Hunderten auf der Fahrbahn: Sinnbilder der Vergänglichkeit irdischer Schönheit, nicht zuletzt auch des Strebens nach Glück.
Würdige schwarze Leder-, eilige spitze Stöckel-, tapsige bunte Gummischuhe zerteilen den Matsch, wie gekocht von unaufhörlich herniederrauschenden Schaumwassern, wohinein sich labberige Blättern, ersoffene Regenwürmer und Zigarettenpackungen mit und ohne Folie mischen. Diese Stadt hat es erwischt. Eine Vorstellung von der Zeit nach dem Regen hat augenblicklich niemand mehr. Sogar die Erinnerungen an den wahrhaftig sehr groß gewesenen Sommer werden schon mürbe und verlaufen hoffnungslos.
Schmitt kauft ein.
Verzeihung: Er kaufte ein. Alles, was im weitesten Sinne mit Schmitt zu tun hat, Verzeihung: hatte, musste unbedingt im Tempus des Präteritums berichtet werden. Besser noch wäre das Plusquamperfekt, die abgeschlossenste Vergangenheitsform, aber da erzählt es sich so holprig. Schmitts Leben war das personifizierte Gewesensein – zumindest seit seiner Pensionierung. Aber auch vorher, Jahrzehnte vorher, hatte sich diese Tendenz bereits angedeutet: Als er sich gegen die Einführung der Lochkarten zur Wehr setzte; als er den ersten Computer heimlich zu nahe an die Zentralheizung heranrückte; als seine Frau starb, Heidelinde, eine ehemalige Mitarbeiterin. So sehr hatte sich Schmitt, Kurt Schmitt, im Gestern und Vorgestern eingerichtet, dass man überrascht sein musste, wenn man heute leibhaftig gegen ihn stieß. Tatsächlich, er war ja noch da! Warum eigentlich? Weil er ausharrte, Tag um Tag, ohne etwas zu finden (wie er selbst gesagt hätte: zu benötigen), was dieser schnöden Gegenwart angehörte.
Der Regen aber lag ihm immer nahe: ein allen gemeinsames Geschick, eine Beeinträchtigung, die jeden betraf, ein von weit oben ergehender Befehl gleichsam, dem ein jedes gehorchen musste. Der Regen ließ die Leute zusammenrücken, auf eben jene Nähe, die Schmitt gerade noch ertrug. Man durfte sich einer sämtliche Weltanschauungen übergreifenden Solidarität sicher sein, wenn man etwa im Aufzug über „das Sauwetter“ herzog, sich darüber ausließ, wie „das Wetter doch immer mehr verrückt“ spiele, ja, über den guten, alten Petrus herzog. Stets senkten und hoben sich die Häupter der Umstehenden, und es gab beifälliges Gemurmel. Schmitt lebte auf, wenn er sich auf diese Weise etwas von jener zustimmenden Aufmerksamkeit verschaffte, die ihm sonst so selten vergönnt war.
Kaum hatte er die Dreißig erreicht gehabt, da hatte er schon als Konservativer, als unverbesserlich rückwärts gewandt, als Verhinderer und Dickschädel gegolten. Das focht ihn nicht an. Falsch: Allen anderen und vor allem sich selbst redete er ein, dass ihn Ignoranz, Widerstand, sogar Zorn und Hass niemals berühren könnten.
„Ein Guter hält´s aus“, pflegte er zu äußern.
Damit meinte er sich.
Und einige wenige, die vor seinem Urteil in der Geschichte bestanden. Alexander der Große vielleicht. Dietrich von Bern, also Theoderich der Große allemal. Und der zweite Friedrich von Preußen, auch so ein „Großer“, ganz gewiss. Bei einem weiteren Feldherrn, der deutlich später kam, wusste man nicht so recht ...
Heidelinde teilte Kurts Kurs: die selektierende, streng urteilende Verfahrensweise – und zwar aus Überzeugung! Nicht er, sie hatte seinerzeit die Initiative ergriffen und den um Jahre Jüngeren an sich gezogen. Ein erlauchtes Vergnügen: Die Schlesinger, eine noch viel jüngere, ja geradezu entsetzlich junge Unter-Unter-Unter-Sekretärin, hatte sich offensichtlich auch etwas ausgerechnet bei dem Herrn Abteilungsleiter.
Ätsch-bätsch!
Kaum war (in der Mittagspause) (ja, in der Mittagspause) die standesamtliche Trauung voll- und die eheliche Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung bezogen, begann Heidelinde das Regiment zu führen. Selbst sterilisiertes Operationsbesteck hätte sie vor Ekel nicht anzufassen vermocht, sondern einer – wie sie das tatsächlich nannte –„Sonderbehandlung“ unterzogen.
War Heidelinde schon korrekt in Angelegenheiten des Büros, so nahm ihre häusliche Reinlichkeitspenetranz rasch etwas Martialisches an. Sie putzte nicht, sie führte Strafexpeditionen durch – gegen keinen Gegner. Denn alle, die hätten weggewischt, -gewedelt, -gekratzt, -geätzt werden können (Staubkörner, Silberfische, Badequallen, Ascheflusen ...), hatten sich schon zu Beginn der zweieinhalb Jahrzehnte währenden Feldzüge in Sicherheit gebracht.
Heidelinde verlangte strengste Tagesstruktur, und sie bekam sie. Ihr Einflussbereich erstreckte sich weit über den eigenen Tod hinaus; noch heute vollzog Schmitt präzise nach dem privaten Dienstplan die Einkäufe wie zu der Zeit, da sie noch mehr oder weniger gemeinsam unterwegs waren – im Übrigen gern per Fahrrad, wiewohl sonst alle Wege mit einem überaus deutschen Auto zurückgelegt wurden. Aber in den Siebzigern hatte die Gesundheitswelle auch das Schmitt´sche Domizil erreicht. Man kaufte Obst. Man schabte Gemüse. Man bewegte sich, vorüber gehend sogar auf Trimm-Dich-Pfaden am Stadtwaldrand. Bei einem Qualitätshändler hatte Heideline zwei Fahrräder einer deutschen Marke und feste, deutsche Ledersatteltaschen erstanden. Da passte alles hinein, hatte hineinzupassen, denn der Qualitätshändler hatte es versprochen.
So kaufte man ein: Kurt blieb bei den Rädern, wiewohl sie abgeschlossen wurden und Heidelinde enterte überfüllte Feinkostläden.
Der Tradition folgend, stand Kurt Schmitt an bestimmten Werktagen heute immer noch vor bestimmten Geschäften (warum hätte er etwas an diesem Ablauf ändern sollen?), die Qualitätsledersatteltaschen überm Arm, obwohl er seit einem Sturz längst kein Fahrrad mehr fuhr ... und wartete. Ja, er wartete, denn das Warten war die dem Menschen gemäße Verhaltensweise. Freilich, es war niemand mehr drin in den Läden, auf den er hätte warten können; gefragt nach seinem sturen, etwas schrulligen Verharren, auf niemanden, aber dennoch zu warten, hätte er geschnarrt:
„Ich kann das nicht leiden, wenn die Geschäfte voll sind. Ich warrrte app, bis sie leer sind.“
Aber es fragte ihn schon lange keiner mehr.
Die Handelsgeschäfte, die er tätigte, waren nahezu allesamt konkludent, sprich: Er musste gar nichts mehr sagen. Heute war ein Dienstag, also gab es Fleischwurst. Die wurde in einem Fleischereifachgeschäft in einer Markthalle in der Innenstadt erworben. Schmitt stellte sich auf und schaute. Die Leute kamen, die Leute gingen. Jetzt war es leer genug. Doch noch ein Kunde. Warten. Noch einer. Warten. Aber jetzt. Wenn ihn die Chefin erblickte, nickte sie verbindlichst und rief irgendwohin:
„Die Fleischwurst für Herrn Schmitt!“
Alsbald packte eine beflissene Verkäuferin exakt 250 g Fleischwurst in eine Folie, die Folie in eine Tüte und reichte dieselbe, mehr oder weniger künstlich lächelnd, dem Wartenden.
„So, das macht dann ...“
Der Preis blieb über Jahre gleich. Bei Veränderungen schaute der Einkäufer missbilligend auf.
„Tja, tut uns leid. Der Strom, die Zulieferer, die ...“
„Ich weiß das,“ knirschte er und zog mit Verbitterung den Geldbeutel hervor; es war derselbe wie damals, als er noch ins Büro ging. Gute Qualität. Markenleder.
Schmitt packte die Wurst in die Satteltasche und schob sich weiter zu einem Feinkoststand vor, der die besten Salate der Stadt bereithielt. Jedenfalls sagte man so in den Siebzigern. Zu Fleischwurst gab es Krautsalat. Hier waren die Verkäuferinnen redseliger, und da konnte es auch einmal vorkommen, dass Schmitt einen Witz aus seinem Repertoire anbrachte. Es waren circa 70 Stück. Die Menge war seit etwa 1980 konstant geblieben. Hin und wieder gesellte sich bis zu seinem Ausscheiden aus der Packura ein weiterer hinzu, und ein wenig erfolgreicher konnte gelöscht werden.
Am meisten freute er sich, wenn eine mollige Blonde namens Bettina ihn bediente – so wie an diesem Dienstag im Frühherbst. Das frische Hellblau ihrer Schürze war seine Lieblingsfarbe, schon immer. Mit List unternahm er einen kommunikativen Vorstoß, der an Schäkerei grenzte.
„Ah, da ist sie ja wieder, meine Salatfee! Na, wo waren wir denn letzte Woche, hm?“
Er drohte ihr mit seinem voluminösen Zeigefinger.
„Junge Damen auf Abwegen, da geht man am besten in Deckung.“
Bettina lächelte so süßlich wie möglich und bemühte sich, die triefenden farblosen Weißkrautfäden rasch und ohne zu tropfen in das Plastikschälchen zu hieven.
„Genau 200 Gramm.“
„Sie sind ja ein Genie!“
Das war´s dann für heute.
Mehr Gespräche mussten nicht geführt werden. Es war auch genug. Schmitt entsicherte seinen Markenschirm, schob damit Passanten zur Seite, überquerte so zielstrebig, aber nicht mehr ganz so schnell wie einst den Platz zur Tiefgarage, parkte schimpfend aus und fuhr schimpfend nach Hause. Die übrigen Verkehrsteilnehmer waren größtenteils unfähig; man musste ständig auf ihre Fehler reagieren. Schmitt fuhr grimmig, beide Hände um das Lenkrad gekrallt. Sein Lieblingsschimpfwort war „Ihr Arschis!“ Allerdings hörte ihn keiner.
Die ihn wahrnahmen, winkten ab.
Bis zu seiner (eminent unfreiwilligen) Pensionierung hatte er sich als untadeliges Vorbild an Korrektheit empfunden. Schmitts Tugendschulung war zwar nicht mehr in die braunen Jahre gefallen, aber das Deutschland der Fünfziger Jahre hatte seinen Wertekodex noch nicht geändert; es war nur notgedrungen defensiv geworden. Der Zorn richtete sich nach innen. Statt andere zu versklaven, mussten die Apparaturen der Selbstzwänge verstärkt werden; der Energielevel blieb derselbe.
Über Pünktlichkeit brauchte man nicht nachdenken. Das richtige Maß an geschäftsmäßiger Höflichkeit zu bestimmen, war eine Kunst, die keiner so gut beherrschte wie er: mit zu viel machte man sich lächerlich, zu wenig konnte den Geschäftsgang hindern. Am Telefon ging es vor allem um die Schattierungen der Stimme. Schmitt rühmte sich, fünf Telefone auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Mehrere Gespräche gleichzeitig zu führen, gehörte zur Basisausstattung eines Abteilungsleiters. Im direkten Kundengespräch freilich kamen Mimik und Gestik hinzu: eine präzise Koordination hunderter Körperfunktionen, die einer gewissen Virtuosität nicht entbehrte.
Kein Ereignis in Schmitts Leben hatte ihn so getroffen wie die Beendigung seiner Diensttätigkeit bei der Packura, kurz nach seinem vierzigsten Jubiläum. Zum ersten Mal seit seiner Jugendzeit (ein Hodenhochstand) musste er zum Arzt, weil er nicht mehr atmen konnte.
„Wissen Sie was, mein Bester“, hatte der junge Schnösel unangebracht jovial gemutmaßt, „Sie haben eine berufliche Traumatisierung erlitten.“
Traumatisierung ... War das nicht die Lieblingsausrede aller Schwächlinge? Schmitt brachte sich in Sicherheit. Und beschloss, fortan alles, was mit „seiner“ Firma zu tun hatte, zu vergessen.
„Ein Guter hält´s aus.“
Das war gar nicht so einfach, vor allem nachts nicht. Tagsüber zog sich die Zeit. Es bedurfte eines exakten Tagesplans, an dessen Einhaltung nicht zu rütteln war, umso mehr, seit Heidelindes Regierungsposten verwaist war. 5:30 Uhr Aufstehen, wie gewöhnlich. 6:30 Uhr, da war der Bäckerladen noch leer, Erwerb von vier Weißmehlbrötchen. 7 Uhr Radio anschalten. Verzehr von zwei Weißmehlbrötchen mit Honig bzw. Konfitüre, dazu sechs Tassen Jakobs Krönung. 7:30 Uhr Radio ausschalten. Abspülen. Erste Zigarette, HB selbstverständlich. Studium des „Evangelischen Regionalboten.“ Vor sich hin starren. 8:30 Uhr Fahrt in die Innenstadt zum Einkaufen. 10 Uhr Rückkehr. Zweite Zigarette. Erstes Kreuzworträtsel. Dritte Zigarette. Vor sich hin starren. 12 Uhr Mittagessen inklusive Weißmehlbrötchen, dazu ein Bier, danach ein Korn oder Wacholder.
„Ah!“, machte er in die leere Küche.
Da Schmitt sich niemals ein Mittagsschläfchen gönnen würde, setzte er sich nach Tisch nur ein wenig auf die Couch. Dass er dort einschlief, hätte er niemals zugegeben. Die Nachmittage wurden gerettet durch Friedhofsbesuche. An Heidelines Grab rauchte er eine HB. Das Abendbrot bestand aus zwei Scheiben Brot und dem übrigen Brötchen; waren, bedingt durch üppiges Mittagessen, noch zwei Brötchen übrig, reduzierte sich die Anzahl der verzehrten Brotscheiben auf eine.
Ab 18:30 Uhr durfte dann der Fernseher laufen. Schmitt gehörte nicht zu den Disziplinlosen, die schon am Nachmittag – oder gar am frühen Morgen – die Glotze anschalteten. Dazu gab es drei Flaschen Bier und weitere Zigaretten.
Viel Verwandtschaft war nicht mehr übrig.
Den sehr wenigen Neffen und Nichten gegenüber verhielt er sich freundlich und aufmerksam, sparte auch nicht an Geschenken. Ostersonntag und Heiligabend verbrachte er im Haus einer Schwester, auch so manchen Geburtstag – ob zu seiner Freude, das war ihm nicht anzumerken.
„Ein Guter hält´s aus.“
Die letzten beiden Jahre bei der Packura waren dazu angetan, so gut wie alles, was er in den Jahrzehnten vorher an Anerkennung, Erfolg, Humor, Diensteifer, Kollegialität, Loyalität erlebt hatte, komplett zu annullieren. Eine Umstrukturierung? Selbstverständlich! Aber nicht nur eine; ein Katarakt von Umstrukturierungen wirbelte das Haus durcheinander, bis nichts mehr beim Alten war.
Und das ihm!
Es begann damit, dass der neue Regionalleiter Schießfurther, von Schmitt nur Schissfurther genannt, ein Günstling von Essenwein jun., der eigentlich ein feiner Kerl war, ihn zwang, einen Computerkurs zu besuchen. Als Kurt ablehnte, wurde er in eine andere Abteilung versetzt: nach verzig Dienstjahren! Entweder, man gab ihm gar nichts mehr zu arbeiten, oder aber Praktikantentätigkeiten waren zu erledigen. Dreimal wurde Schmitt beim Chef vorstellig. Aber Direktor Essenwein – so gab er vor – konnte nichts mehr für ihn tun.
Drei Monate, bevor Schmitt „aus dem Haus gejagt“ wurde, verschlechterte sich seine Arbeitssituation abermals. Er ging seines Schreibtischs verlustig. Man schubste ihn in einen Gang nahe bei der Fertigung, wo ein Drehstuhl mit aufgeplatztem Polster auf ihn wartete.
Es zog.
Die Arbeiter grüßten ihn zwar höflich, wussten aber nichts mit ihm anzufangen. Jene alten, mit denen er noch Kriegswitze ausgetauscht hatte, waren ebenfalls längst erledigt worden. Er war einsam. Es gab keine Aufgabe mehr für ihn.
Das hielt auch der Beste nicht aus.
Heidelinde lebte noch ein paar Jahre. Das war die schlimmste Zeit. Beide pensioniert, beide verbittert und neurochemisch verseucht durch das niemals weichende Kränkungsgefühl einer unehrenhaften Entlassung, mussten nun ineinander den Hauptfeind erkennen. Sonst war ja keiner mehr da. Es spielten sich Szenen ab, für die sie früher jedes junge, streitsüchtige Pärchen maßlos verachtet hätten. Heidelinde zog die Konsequenz. Sie erkrankte. Litt. Und starb.
Die vollständige Einsamkeit, die von da an wie ein im Flug erstickter Albatros von der Zimmerdecke hing, ließ sich besser aushalten als die von tosendem Hass geprägten Jahre zuvor. „Die schlimmste Einsamkeit ist die Einsamkeit zu zweit“, klang es in Schmitts Gedächtnis nach, von irgendwoher. So hatte selbst die finsterste Epoche in seinem Lebenslauf nachfolgend noch ihr Gutes gehabt.
Zwei Briefe
„Sehr verehrter Herr Schmitt,
mein lieber Kurt!
Wie die Zeit doch rennt! Vergangenen Monat stellten wir fest, dass es nun doch schon exakt fünf Jahre sind, dass Sie in Ihren wohlverdienten Ruhestand abgeschieden sind. Gelegentlich, wenn man mit den alten Kollegen ins Plauschen kommt – das ist ja nicht mehr oft – , reden wir noch von Ihnen und Ihrer schönen Zeit bei uns. Das waren Jahre, die kommen so nie wieder. Es hat sich viel verändert, nicht nur, aber auch bei uns im Hause.
Leider, leider sind Sie bisher nie bei unseren stimmungsvollen Jahresbetriebsweihnachtsfeiern aufgekreuzt – ich nehme doch an, man hat Sie eingeladen? Es geht immer recht fröhlich zu. Die alten Geschichten werden wieder und wieder erzählt, wie das so sein muss. Vielleicht überlegen Sie es sich ja und kommen doch einmal vorbei. Wir würden uns freuen.
Ich weiß, Sie waren immer ein Mann der Tat, der langes Drumherum-Reden schlecht ertrug. Deswegen gleich zur Sache. Ich habe – wir haben – ein Anliegen, wobei, Anliegen ist vielleicht noch zu gering gesagt. Auf alle Fälle ist es eine Bitte, als solche allerdings vielleicht zu groß. Sie bemerken, es fällt mir nicht so leicht, gerade weil ich weiß, dass Sie damals den Abschied doch recht schwer genommen haben. Kein Wunder, nach so einer langen Zeit! Es müssen wohl um die dreißig Jahre gewesen sein? So etwas gibt es heutzutage ja gar nicht mehr.