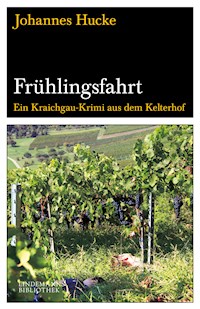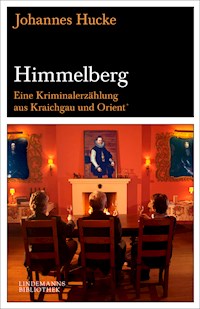Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lindemanns Bibliothek
- Sprache: Deutsch
An einem Abend im April verschwindet Gernot Junker, der bedeutendste Gartenarchitekt unserer Zeit, aus dem Schwetzinger Schlosspark. Nichts deutet auf eine Gewalttat hin. Möglicherweise spielt ein mysteriöser Fund in der Universitätsbibliothek Heidelberg eine Rolle ... Johannes Hucke, in der Region nicht zuletzt hervorgetreten mit seinen Weinlesebüchern etwa über die Südpfalz, die Bergstraße und den Kraichgau sowie mit zahlreichen Wein-Krimis und Theaterstücken, geleitet uns dieses Mal auf eine Entdeckungsreise quer durch die weltberühmte Schwetzinger Parklandschaft, durch die Zeiten und die verwilderten Gärten der Seele ... Spannung, Witz und eine Portion Phantastik grundieren diesen verspielten Krimi für Schmöker-Freunde. Zum Hauptermittler wird schließlich kein anderer als - der Leser selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit Dank an
Andreas Falz, Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg,
Dr. Ralf Richard Wagner, Schloss Schwetzingen und
Cornelius Kieser, ebenfalls Schwetzingen,
verbinde ich die Bitte um Nachsicht,
da ich im „Jagdstern“ sehr frei, ja geradezu schlampig
mit den historischen Fakten umgegangen bin,
die mir in den Interviews umfangreich
und präzise mitgeteilt wurden.
Johannes Hucke, geboren 1966, hat mit seinem„Kraichgauer Weinlesebuch“(2007, 3. Auflage 2014) die Landschaft zwischen Schwarz- und Odenwald vinologisch erschlossen. Als Theaterautor ist er erfolgreich u.a. mit dem Wein-Theaterstück „Kellersequenz“. Weitere Veröffentlichungen im Info Verlag:„Bergstraße Weinlesebuch“(2008),„Südpfalz Weinlesebuch“(2009),„Strafraum“, ein KSC-Krimi (2009, 2. Auflage 2010) und„Totland“, KSC-Krimi Nr. 2 (2010, beidegemeinsam mit Holger Nicklas), die Unternehmensgeschichte„Das Beste aber ist das Wasser“(2010),„Frankfurter Stückchen. Ein Märchen aus der neuen Altstadt“ (2010), „Neckarstadt Western. Der durchgeknallte Mannheim-Roman“ (2010),„Libellen greifen selten zu Labello“, Gedichte (2010), der Peter-und-Paul-Krimi„Die Brettener Methode“ (2011), der Winzer-Krimi „Frühlingsfahrt“ (2011) sowie die Kriminalerzählung „Aqua Asini. Maulbronner Eselswassser“ (2012). Herausgeber einer Anthologie von Kindergedichten „Wo ich hingeh, geh ich hin“ (2012). Verschiedene andere Titel sind in Vorbereitung.
Johannes Hucke
Jagdstern
Eine Schwetzinger Kriminalerzählung
Der Inhalt von „Jagdstern“ ist rein fiktional.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt.
„Schmerz, Rum und Belastung ...“
Dieses Buch ist Alexander Broese gewidmet
und sonst keinem.
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen.
Albert Einstein
Denn die Erde jagt uns / auf den Abgrund zu, / Doch der Himmel sagt uns: / Warum zweifelst du? / Kyrie eleison, / sieh, wohin wir gehn, / ruf uns aus den Toten, / lass uns auferstehn.
EKG 97.5
Der Mensch steht also in einem so nahen Verhältniß mit der Natur, daß er ihre Einwirkungen auf seine Seele nicht verläugnen kann ... Sie hat Gegenden, die bald zur lebhaften Freude, bald zur ruhigen Ergötzung, bald zur sanften Melancholie, bald zur Ehrfurcht, Bewunderung und einer feyerlichen Erhebung der Seele, die nahe an die Andacht gränzt, einladen; aber auch Gegenden, die ein niederschlagendes Gefühl unsrer Bedürfnisse und Schwäche, Traurigkeit, Furcht, Schauder und Entsetzen einflößen.
Christian Cay Lorenz Hirschfeld, 1779
Wachhäuschen.
To be taken away
Das Verschwinden des Gartenarchitekten Gernot Junker aus dem Schwetzinger Schlosspark an jenem blütenduftgetränkten letzten Aprilabend vor ein paar Jahren gibt immer noch Rätsel auf. Sonderbar genug, dass ausgerechnet zu einer solchen Stunde, da alles aus sich herausdrängt und eine jede Erscheinungsform der Natur ihrer Fülle und Vollendung zustrebt, ein einzelner Erdenbürger, gegenläufig zu allem gleichsam in sich zurückschwindet, erlischt und nie mehr wiederkehrt. Wir hüten uns, zu diesem Sachverhalt unsere Privatmeinung mitzuteilen; nicht einmal sämtliche Fakten und Beobachtungen, die uns vorliegen, wollen wir preisgeben. Doch könnte es sein, dass wir mit den folgenden Notizen einige Anregungen geben, die zu einem Verstehen zweckdienlich sind, welches den Geschehnissen, wie sie sich in Wahrheit zugetragen haben, immerhin nahekommt. – Vielleicht trefft ihr, meine lieben Freunde,aus eigenem Antrieb eine Entscheidung, auf welchem der gewundenen Wege man weitersuchen könnte, wenn ihr unsere Einlassungen studiert habt. Solltet ihr es auf diesem Gebiete tatsächlich zu neuen Erkenntnissen bringen, steht es euch selbstverständlich frei, eure Beobachtungen den zuständigen Behörden zu unterbreiten. Man wird euch dankbar sein; außer drei Zettelchen, die man zur Not als Drohbriefe bezeichnen könnte, liegt nämlich nichts Konkretes vor. Zurzeit wird nicht ermittelt; ja, es hat den Anschein, der Fall Gernot Junker mitsamt seinen eigenartigen Begleitumständen sei zu den Akten gelegt.
Wenn ein Mensch verschwindet, auch nach Tag und Jahr nicht wiederkehrt, kein Anhaltspunkt als zureichend und keine Suchbewegung als tauglich sich erweist, haben wir es für die Zurückbleibenden mit einer Gemengelage zu tun, die sich klar unterscheidet von den Gegebenheiten, welche vorliegen, wenn wir vom Tode eines Zeitgenossen erfahren. Wie wir aus zahlreichen Berichten wissen, worin sich Hoffen und Verzagen derjenigen ausdrücken, die den Verlust ertragen müssen, aufgezeichnet vornehmlich in Kriegszeiten und Phasen sozialer Unruhen, entfaltet die Leere, die Lücke, der aus dem Leben herausgestanzte Umriss eine ganz eigene, sonderbare Dynamik; die Menschen beginnen, mit dem nicht mehr Vorhandenen Umgang zu pflegen. Nach und nach gewöhnen sie sich an eine zuvor nicht vorstellbare Art der Kommunikation; schließlichunternehmen sie allerhand – Selbstgespräche, Gebete, Meditationen, die Séancen ähneln können –, um den Riss, denGraben, das klaffende Loch mit Material aus den Grenzlanden der Phantasie zu befüllen.
Verschiedentlich hat die Mythologie das Phänomen, dass jemand aus dem Leben gerissen wird, ohne beurkundet zu sterben, in Bilder und Gleichnisse zu fassen gesucht. Verliebte Nymphen, die hübsche Menschenknaben in Felsengrotten vor den Blicken der Artgenossen verbergen; grobianische Götterväter, die halberwachsene Schäferinnen in Tiergestalt überraschen und mit sich fortschleppen; Sendboten aus fernen Welten, die in unerhörter Geschwindigkeiten aus dem Unbekannten auftauchen, sich ein Menschenkind erkiesen, einpacken und ebenso schnell wieder verschwinden – in allen Kulturen existieren solche Zeugnisse, die vor allem die artistische Fähigkeit des Geistes widerzuspiegeln scheinen, unerträgliche Verluste in Sinnzusammenhänge (und seien sie noch so obskur) zu stellen.
Unter all diesen Überlieferungen aus Zeiten der Not rührt uns die Idee der Entrückung am merkwürdigsten an: So sehr liebt die Gottheit einen Einzelnen, dass sie sein Ableben nicht mehr erwarten kann; flugs, mitten aus dem Diesseits heraus, ohne Schmerzen entreißt sie den Auserwählten seiner Sphäre und überführt ihn ohne Zeitverlust in die elysischen Bereiche, wo er für unmöglich gehaltene Dinge schaut. – Ob derlei mystische Spekulationen für unsere Überlegungen, die sich mit dem Verschwinden Gernot Junkers beschäftigen, gewinnbringend sein können, sei noch dahingestellt; so viel jedoch soll verraten sein, dass er selbst, der Entschwundene, der von allen und niemandem Vermisste solche metaphysischen Sondermaßnahmen der Bedeutung seiner Person durchaus für angemessen gehalten hätte. Niemals hat er daran gezweifelt, zu den Privilegierten zu gehören – warum nicht auch in einem gewissermaßen überweltlichen Sinne?
Dies könnte nun freilich auf eine falsche Fährte führen; denn privilegiert, mit Ausnahmerechten und -vorzügen versehen, empfand sich Junker stets nur unter seinen Zeitgenossen. Zeitlebens pflegte er Umgang mit Toten – nicht im Sinne spiritistischer Übung, sondern auf wahlverwandtschaftlicher Basis. Mochten diese Bemühungen vorderhand einseitiger Natur sein, konnte sich der schon früh für alles Klassische Schwärmende doch eines steten Wissensvorsprungs sicher sein; denn sie antworteten ihm, die – ach, wie lange schon! – Dahingeschiedenen: aus ihren Werken. Für Gernot Junker hörte die Entwicklung der Kultur des Abendlandes (und damit, nach seinem Dafürhalten, des Erdkreises) mit Beethovens Neunter auf.Danach kam der allmähliche Abstieg, die Ausbeutung der angehäuften Schätze, die immer deutlicher werdende Detumeszenz.
Angesichts jener ihm so lieben, vornehmlich aus dem achtzehnten Jahrhundert gebürtigen Geistesmenschen empfand der in München zur Welt Gekommene ein unendlich schmerzhaftes Minderwertigkeitsgefühl. Las er die Schriften seiner Hausgötter Goethe, Wieland, Voss, Jean Paul, überkam ihn ein jedes Mal die Empfindung, selber nur rudimentär, stammelnd sich äußern zu können, keiner wirklichen Sprache mehr mächtig zu sein. Wie nun gar fühlte er sich unterlegen – bei allen Auszeichnungen, bei aller Lobhudelei ringsum – , wenn er in den Werken seiner um zweihundert Jahre älteren Berufskollegen blätterte. Hirschfeld, Sckell, vor allem aber die englischen Gartenarchitekten Brown, Addison, Chambers, Kent ließen ihn weit, weit zurückbleiben; ihr Stil, ihre Virtuosität und selbstsichere Gelassenheit verdeutlichten ihm Seite um Seite, dass er zu den Nachgeborenen, den Plagiatoren zählte, die ihre Stimme bestenfalls ferne gerückten Zeiten zu leihen vermochten, ohne dafür auch nur im Geringsten autorisiert zu sein.
Man konnte seltsame Erfahrungen machen mit diesem Gernot Junker. Er war und blieb ein Mann der Aufklärung, gewiss – allerdings in einem nachgerade absolutistischen Sinne. Wer ihn als konservativ oder elitär abstempeln wollte, erlebte alsbald Überraschungen, wenn er ihn plötzlich für die Sache der Unterprivilegierten, der vom System Abgemeldeten Partei ergreifen hörte; was nicht sogleich zu erfassen war: Junker tat dies im Sinne einer Mitleidsethik, die keinesfalls in Zweifel zog, dass sich die Menschen von Geburt an allzu deutlich unterscheiden. Die wenigen Wohlausgestatteten, in allen Disziplinen Begünstigten mussten über die Minderbegabten herrschen, das war ihr Schicksal – doch sollten sie Gnade walten lassen, Almosen verteilen, wo immer dies möglich war. – Ein weiterer Charakterzug des bekennenden Vernunftmenschen machte andere Vernunftmenschen staunen; wenn es um die Gestaltung der historischen Landschaftsgärten ging, entpuppte er sich als Widersacher der barocken Aufklärer, die ihr Formbewusstsein allem Naturgegebenen überzustülpen trachteten. Auf einmal trat Junker hervor mit provokanten Slogans, die aus seinem Munde bisweilen einen ähnlich überraschenden Eindruck hervorriefen wie zu Zeiten der ersten Romantiker: „Wachsen lassen!“ rief er vom Podium aus in die Menge. „Stellt euch in den Dienst der Natur, habt Ehrfurcht vor ihrer Mannigfaltigkeit, schneidet nicht kindisch daran herum, sondern erfreut euch an all der Großzügigkeit, die sie walten lässt!“
Auf der anderen Seite erschraken so manche, wenn sie mit den Maßnahmen konfrontiert wurden, die Junker gerne „in all der Großzügigkeit“ erließ, sobald er mit der Pflege einer Parkanlage betraut wurde. Da fielen dann bald rechts und links die Bäume, dort wurde wüchsiges Gestrüpp in Mengen „ausgekrautet“, ohne jede „Ehrfurcht“ vor den bisherigen fröhlichtirilierenden oder stumm dahinhuschenden tierischen Bewohnern. Wenn es galt, „den ursprünglichen Zustand“, wiederherzustellen, „das goldene Zeitalter“ zu beschwören – und das hieß selbstredend, den Plan des vormaligen Gartenarchitekten detailliert umzusetzen –, kannte Gernot Junker keine Sentimentalitäten. Ward nun aber statt des wildgewachsenen Wäldchens ein künstlicher Bachlauf angelegt, so wie vorzeiten vorgesehen, und einige schlanke Bäumchen neigten sich über den windungsreichen Lauf des Wassers, dann konnte man den Gartenkünstler sogar seufzen hören ... und nicht nur einmal gab er gefühlvolle Oden von Hölthy oder Matthisson zum Besten.
Freunde, deren Grüfte sich schon bemoosten!
Wann der Vollmond überm Walde dämmert,
schweben eure Schatten empor
vom stilllen Ufer der Lethe ...
Jene alle Arroganz übersteigende, keinen Widerspruch duldende Grobheit, die Junker meist vorwalten ließ, wenn er es mit Seinesgleichen zu tun bekam, gar wenn er staatlich bestallten Gartenamtsleitern oder Umweltreferenten die Welt, wie sie war und wie sie sein wird, erklären musste, rief freilich da und dort Befremden, Feindschaft, Widerstand hervor. Es gab nur diese eine Möglichkeit: Man hatte sich seiner Weisheit unterzuordnen. Doch war auch dies nicht allzu leicht zu bewerkstelligen; denn Unterwürfigkeit verabscheute der Mann nicht weniger als unbegründete Überheblichkeit. So sahen die meisten, die sich um ihn tummelten, ihren Handlungsspielraum von den verschiedenartigsten Zurückweisungen begrenzt. Am schlimmsten war es, wenn er schwieg; dann bettelten viele gewissermaßen darum, wenigstens mit Worten beleidigt, öffentlich bloßgestellt zu werden, um sogleich linkisch grinsend und verlegen ins Glied zurückzutreten – das war immer noch besser als dieses verachtungsvolle Schweigen, welches imstande war, ausgewiesene Spezialisten, Fachleute, die sich zumindest bis vor kurzem noch selbst dafür gehalten hatten, en gros zu diskreditieren, sozial auszulöschen.
Mithin, die immer spürbare Tendenz, andere zu verletzten und abzuqualifizieren, beruhte, wie angedeutet, auf einer inneren Verletztheit von permanenter Wirksamkeit, die Junker selbst zu erdulden hatte. Er liebte Kant, er betete ihn an – doch er verstand ihn nicht. Er kniete nieder (und dies nicht nur in übertragenem Sinne), wenn er zu Hause Beethoven hörte – denn er fühlte, wie mager er selbst im Geiste beschaffen war im Vergleich zu einem wirklichen Genie. Er grollte, er keuchte, wenn er von den Vollmachten las, die seinen Vorgängern im Bereich der Landschaftsarchitektur gewährt wurden – und musste doch selber vorlieb nehmen mit winzigen Korrekturen, von hühnerbrüstigen Umweltschützern argwöhnisch beäugten, bisweilen befehdeten kosmetischen Maßnahmen. Keine hochmögenden Potentaten waren seine Auftraggeber, sondern belanglose Amtsschimmel. Nicht Gottes freie Natur stand seiner Schaffenskraft zur Verfügung, sondern engumzirkelter Restbestand einstiger Prachtentfaltung. Nirgendwo ein Auftraggeber von Format, der ihn auf einen Hügel mitgenommen hätte, um mit weitschweifender Geste von Horizont zu Horizont zu weisen: „Da, Junker, schaff Er mir einen Garten nach Seinem besten Vermögen! An Geld soll’s nicht mangeln.“
Wenn Gernot Junker, der sich bereits in jüngsten Jahren als Assistent des alten Landeskonservators Holberich in Österreich und Bayern Meriten verdient hatte, in irgendeine Provinz gerufen wurde, wo es etwa einen verwilderten Schlosspark unter Verwendung von EU-Mitteln in Schuss zu bringen galt, verschaffte er sich bereits mit seinem ersten Auftreten Respekt. Britisch gekleidet, mit karierter Golfweste unter einem Jackett aus Harris-Tweed, angetan mit geradezu provozierend altmodischen Breeches, welche die handgefertigten Schnürstiefel bestens zu Geltung kommen ließen, gegen den beständigen Nieselregen (in der Provinz immerhin ein Moment der Zerstreuung, wie de Goncourt bemerkt hatte), geschützt von einem Doppelschirm, der das Monatsgehalt eines gewöhnlichen Stadtplaners gekostet haben mochte, so erschien er den Auftraggebern je und je auf Anhieb als ein Berufener, als ein Experte von weit überlegener Kompetenz. Wie sie mit ihren Billigklappschirmchen hinter ihm herschusselten, begierig lauschend, ei-nander der Hackordnung gemäß zurückzudrängen suchten, das hatte etwas Urkomisches, woran sich Junker nicht sattsehen konnte.
In dieser speichelleckerischen Drängelei erkannte der Meister die nervöse Obrigkeitshörigkeit des Biedermeiers und der Kaiserzeit wieder; und er spielte seine Rolle. Mit mehr Aplomp als vielleicht nötig gewesen wäre, setzte er der Unterwürfigkeit und Liebedienerei eben jenen Herrengestus entgegen, der verlangt wurde. Schon bei den Erstbegehungen der überkommenen Parkgelände sparte er nicht mit energischen Strichen auf den von übereifrigen Beamten ihm zittrig hingehaltenen Landkarten. Mit einem Blick erkannte er manchen Fehler, der sich über die Jahrzehnte herausgebildet hatte; so konnte es denn geschehen, dass schon im ersten Augenblick jener Pavillon oder diese Minigolfbahn, auf deren Erhaltung der eine oder andere gehofft haben mochte, da er liebsame Erinnerungen daran band, Junkers kritischem Gespür und kompromisslosem Tatendrang zum Opfer fiel.
Historischer Werktreue verpflichtet, bediente sich der Garten-Experte selbst im Gewande modernster Methodik traditioneller Verfahrensweisen. Mit neidvoller Bewunderung hatte er die genialischen Pläne studiert, worauf ein Chambers, ein Kent ihrer Verachtung für „französische“ Gärten herrisch Ausdruck gaben. „To be taken away“ – so karg und folgenreichlasen sich die entsprechenden Notizen, womit seinerzeit die Verwandlung eines französischen Barockgartens in das Gesamtkunstwerk eines englischen Landschaftsgartens begann. „Zu entnehmen“ oder auch „zu entfernen“ kritzelte denn eingedenk seiner Vorbilder auch ein Gernot Junker auf von überforderten Stadtgärtnern in jahrelanger Kleinarbeit erstellte aktuelle Lagepläne, bevor er in seinem Büro die Daten übertragen ließ und sich am Bildschirm der Neugestaltung, der eigentlichen Re-Novation widmete.
Schwetzingen bedeutete für Junker einen weiteren, einen lang ersehnten Schritt nach oben und nach vorn. Allerdings war hier bereits allerlei aufgeboten worden; Fachkräften von internationalem Ruf war es gelungen, einen guten, ja geradezu wünschbaren Zustand im Schlosspark wiederherzustellen.Zumal seit der aufwändigen Renovierung der Moschee vermittelte das Ensemble zum ersten Male seit Jahrzehnten den Eindruck einer an Perfektion grenzenden Geschlossenheit. Dennoch, nach diesem Auftrag hatte Junker gelechzt; weltweit waren die Parkanlagen bekannt, wesentlich geprägt vom Zweibrückener Hofgärtner Johann Ludwig Petri, sodann vom lothringischen Architekten Nicolas de Pigage, in den höchsten Rang erhoben jedoch durch Maßnahmen des verehrten Friedrich Ludwig von Sckell – so jedenfalls Junkers Fachmeinung. Doch erst jetzt, im Zusammenhang mit der Bewerbung um eine Aufnahme in den Welterbe-Bestand der UNESCO, wurde der stolze Gartenkünstler als Gutachter angefragt. Für ihn selbst stand außer Frage, dass er sich keineswegs mit einer schlichten Expertise begnügen würde; auf ein paar in den Schlund der Historie hinuntergespülte Details zu verweisen, fehlende Vasen oder weggekommene Putten, genügte keineswegs. Es musste etwas Einschneidendes, etwas Sensationelles her, womit er seinen Ruhm bekräftigen und vermehren und der Vormachtstellung auf seinem Gebiet Ausdruck verleihen würde.
So standen die Dinge, als Gernot Junker nach Schwetzingen gerufen wurde. Wenden wir uns wiederum den Begebenheiten zu, die mit seinem mysteriösen Verschwinden in Verbindung zu bringen sind, wollen wir die soeben vernommenen, seinen Charakter betreffenden Andeutungen wohl im Auge behalten. – Für den Anfang haben wir die für unsere Zwecke sinnreichste Perspektive gewählt: Wir befinden uns am Eingangsportal zum Schlosspark, am Wachhäuschen. Zwischenzeitlich wurde seitlich ein Verkaufsraum eingerichtet, wo der Besucher außerEintrittskarten auch allerlei Erinnerungsstücke, beschreibende Literatur, Parkpläne und Postkarten erwerben kann. Aus Gründen der besseren Sicht durchschreiten wir den Ehrenhof, nicht ohne die Blicke links und rechts zu wenden und die exquisite Gebäudearchitektur zu würdigen – und beziehen schließlich Stellung mitten in des Schlossmittelbaus höhlenartigem Durchgang zum Parterre mit der brausenden Fontäne.
In unserem Rücken dehnt sich der neugestaltete Schlossplatz mit seinen Brauereien und Cafés, dem rustikalen Bronze-Denkmal für den Schwetzinger Spargel, den schmalen Bäumen und der langen Allee, die vor Zeiten, maulbeerbaumbestanden, als Zentralachse geradenwegs auf Heidelberg zuführte – ein von wahrem Weitblick gekennzeichnetes Unterfangen, markiert der Punkt doch in etwa die Mitte auf der mit dem Lineal gezogenen Verbindungslinie zwischen den beiden höchsten Erhebungen der Region, dem Königstuhl im Kleinen Odenwald und der Kalmit, westlich aus der Silhouette des Pfälzer Waldes emporragend. – Vor uns erblicken wir wie durch ein Fernrohr die Hauptachse des Parks, an dessen Gestaltung so viele Hochbegabte mitgewirkt haben; am Ende dieser Reihe steht von nun an der bereits eingeführte Gartenarchitekt und Spezialist für historische Baukunst Gernot Junker. Für einen Augenblick imaginieren wir sein Denkmal am Horizont.
Es fällt leicht, uns um wenige Jahre zurückzuversetzen, ja, es stellt für uns so recht eigentlich keinen Unterschied dar, wann wir die Geschichte beginnen lassen; für heute kommt es nur auf die Perspektive an. Treten wir noch ein paar Schritte vor, beinahe zur Gänze aus der würdigen Toreinfahrt hinaus, so dass noch ein das Sichtfeld begrenzender oben gerundeter Rahmen bleibt, kann dies für unsere Zwecke einstweilen genügen.
An besagtem Abend – eventuell messen einige der Tatsache Bedeutung bei, dass es sich um den letzten Abend des April handelte – können wir, seltsam genug, just von dieser Stelle aus, die für die meisten Fremden den ersten Blick auf das Gartenkunstwerk eröffnet (die Einheimischen kennen andereZugangswege), sämtliche Personen ausmachen, die für den Tathergang einer anzunehmenden Entführung oder Gewalttat in Betracht kommen. Wie erwähnt, wir neigen keiner der im folgenden zu schildernden Auffassungen zu; es könnte jedoch für den einen oder anderen von Interesse sein zu erfahren, wer diejenigen waren und welche Gründe sie gehabt haben mögen, den Verschollenen dauerhaft aus Schwetzingen zu entfernen.
Schauen wir uns doch einmal um: Wen haben wir denn da? Dem Betrachter zunächst, gewahren wir an einem der vollerblühten Boskette der Parterres d’angloises den alten Wilhelm Waruzeck, Parkwächter seineszeichens, wie schon sein Vater und dessen Vater. Er ist augenblicklich damit beschäftigt, einige Kaugummipapierchen zwischen den bunten Anpflanzungen herauszufingern. Da er uns noch häufiger begegnen wird – sogar schon im nächsten Kapitel – und wir bei diesen Gelegenheiten mehr über ihn erfahren werden, wollen wir den guten Mann in seinem fleißigen Tun durchaus nicht stören, sondern lassen den Blick über ihn hinweggleiten, zwischen den westlichen Anlagen des Parterres hindurch bis zum Hirschbassin, wo wir den Schwetzinger Bibliothekar Traugott Rübsamen mitsamt seiner Tochter und eine Nichte antreffen.
Soeben hat die Fünfjährige die Frage gestellt, ob der (steinerne) Hund, welcher den flüchtigen weißen (steinernen) Hirschen gestellt hat, selbigen denn auch wieder loslassen werde; wann das arme Tier wohl wieder freikomme und in seine Wälder heimkehren dürfe? Doch die Erwachsenen haben auf diesen drängenden Erkenntniswunsch des Kindes nicht Acht. Mit sorgenvoller Miene erkundet sich Rübsamens Tochter Anne-Sophie über den Fortgang der sonderbaren Forschungen ihres Vaters, von denen die Nichte nichts wissen kann; missmutig und beleidigt plagt die Kleine noch ein wenig, bis sie erkennen muss, dass sie für den Moment nichts auszurichten vermag. Glücklicherweise wird ihre Aufmerksamkeit sogleich von der Gaukelei der Spiegelungen auf den Wellchen gefesselt ..., denn es ist ein sonnenreicher Abend, das schimmernde Gestirn hat sich das Brunnenwasser zum Spielgefährten erkoren, und die Fingerchen plätschern im spritzenden Gold.
Noch weiter hinten, in der Kugelallee auf- und abschreitend, erkennen wir, wenngleich nur noch als Schemen, den Versicherungsmakler Charles Peckinpah Priestley, vor einigen Jahren aufgestiegen zum Adjutanten und Hauptbevollmächtigten des amerikanischen Hotelmoguls Walter Histler. Mitnichten lässt sich das hurtige Auf und Ab des jungen Briten durchGemütsregungen erklären, die etwa durch Anmut und Herrlichkeit der Parkanlagen hervorgerufen würden; Priestley telefoniert unausgesetzt, klemmt sein Handy bald unters linke, bald unters rechte Ohr, notiert Verschiedenes in sein Merkbuch – und bietet unserem Auge somit den schärfsten Anachronismus zu der ihn umgebenden Idyllenwelt dar. Vielleicht ist er der Einzige aus diesem Kreis, der es in puncto Mode und Eleganz mit Gernot Junker aufnehmen kann.
Aber nein, wie konnten wir so etwas nur behaupten! Haben wir Annabelle Tharau denn vergessen? Unmöglich! Niemand wird sie vergessen können, der je zu ihr in Kontakt getreten ist. Wir dürfen uns allenfalls damit entschuldigen, dass wir ihre Erscheinung von unserer Warte aus kaum noch mit bloßem Auge wahrzunehmen vermögen. Ein schlicht geschnittenes, doch ausgesprochen edel fließendes karmesinrotes langes Kleid ziert am heutigen Abend ihre grazile Gestalt. Wie es sich für eine Dame ziemt, die Vorlieben für den Süden, das Meer und seine Küsten hegt, hat sie am Großen Weiher zum Picknick Platz genommen. Sie befindet sich in Gesellschaft eines Studenten, selbstverständlich aus Heidelberg, wo sie seit zweiDezennien Französisch, Latein und Ästhetik lehrt. Über den Studenten wissen wir nichts; Neider behaupten, dass die wissbegierigen Begleiter der Annabelle Tharau periodisch wechseln, doch liegen uns hierüber keine beglaubigten Tatsachenberichte vor. So viel allerdings soll gesagt sein: Der junge Mann scheint über Manieren zu verfügen. Begeisterung und Hoffnungsfreude kennzeichnen seine schöne Stirn. Wollen wir für ihn beten, dass sich nicht allzubald tiefe Sorgenfalten darauf abzeichnen werden ...
Wiewohl unter irdischen Bedingungen für unmöglich gehalten, durchdringen wir nunmehr mühelos mit unserem magischen Auge den dichten Bewuchs der Bäume und Büsche; sogar die zarten, reich geschmückten Mauern des Rokokotheaters halten unsere Sehlust nicht auf – und machen in einem Seitengang die Kulturjournalistin Frederike Parkstein-Gysenberg aus. Obschon ohne Begleiter, ist sie nicht allein; nein, nichts träfe weniger zu. Denn heute Abend werden die in alle Welt von einer Radiostation übertragenen Schwetzinger Schlossfestspiele eröffnet, übrigens, da es sich um ein Jubiläum handelt, mit eben jener Oper, die zuallererst vor zweihundertfünfzig Jahren hier aufgeführt wurde. Dass eine Parkstein-Gysenberg dabei nicht fehlen darf, wissen alle auch nur einigermaßen gebildeten Hörerinnen und Hörer des Radio-Senders; dass es zumindest ein weiteres Motiv für ihre Anwesenheit gibt, dürfte nur den wenigsten bekannt sein: Ihre Familie stammt gleich doppelt von Mätressen ab, die der einst so geliebte Monarch Carl Theodor aus der Masse der Willigen mit Gespür ausgewählt hat.
Einer weiteren Dame der Gesellschaft, wenngleich anderthalb Stufen weiter unten anzusiedeln, begegnen wir in der Nähe des „schwarzen Meerle“. Dagmar Hammelspring, in diversen Kursen der Volkshochschule ausgebildete ehrenamtliche Fremdenführerin und Vorsitzende eines örtlichen Bürgervereins, ihrer „Initschiative“, führt eine vielköpfige Seniorenreisegruppe aus Sachsen zur Römischen Ruine. Sonst fallen ihre Erläuterungen zur Wasserbautechnik der Alten deutlich üppiger, anekdotenreicher aus; ihre ungewohnte Eile hat einen bedeutsamen Grund: In kaum einer halben Stunde darf sie der Festgesellschaft den Eröffnungstrunk kredenzen, einen selbstgebrauten Cocktail unter Verwendung einiger Kräuter, die sie im Schlossgarten – ihrem Schlossgarten! – gesammelt hat.
Zuletzt erblicken wir in einem der versteckten Winkel des Parks zwei junge Burschen, gesunde, nach hohen Zielen strebende Gesellen, denen das Schicksal jüngst eine schwerePrüfung auferlegt hat: Die ungleichen Freunde lernten sich in einer Gruppe von Straffälligen kennen, die vom zuständigen Richter statt zu Arrest oder Geldstrafe zum Ableisten zahlreicher Sozialstunden verurteilt wurden. Schon die zugrundeliegenden Delikte geben uns Hinweise auf die einerseits disparaten, zum anderen durchaus wesensähnlichen Charaktere der uns so sympathisch erscheinenden Kerls. In beiden Fällen ging es um Vergeltung: Während der Dunkelhaarige (names Attila Keiler) seinem Arbeitgeber einen Kleintraktor entwedete, welchselbiger (der Traktor, nicht der Arbeitgeber) in einem Tümpel bei Alzey ein jähes Ende fand, beleidigte der Blonde (Jakob Haenschle) einen Büroleiter auf grausame Weise, ohne im mindesten Einsicht in sein Fehlverhalten zu zeigen.
Doch was ist das? Statt abgeschnittene Äste aus dem Wäldchen herauszuziehen und auf einem dafür vorgesehenen Stapel konzentriert zu deponieren, haben die beiden Übeltäter zwei Statuen von ihren Postamenten gehoben und in einem solchen Abstand zueinandergerückt, dass sie in ungefähr zu Pfosten eines Fußballtores taugen. Hoffen wir zusammen mit der ganzen zivilisierten Menschheit, dass keiner der wuchtigen Schüsse mit diesem straff aufgepumpten Kunstlederball die Makellosigkeit der Ceres und der Kalypso, denn diese beiden Gestalten aus dem Reich der Mythologie werden just zu solch profanem Treiben zweckentfremdet, beeinträchtigen wird.
Nachdem wir nunmehr, unter Zuhilfenahme einiger optischer Tricks und Kniffe, einen gewissen Überblick über die Hauptverdächtigen gewonnen haben (so es denn solche überhaupt geben sollte), müssen wir zugeben, dass sich selbstverständlich noch viele andere Gäste zu dieser Stunde im Schlosspark befanden. Jedoch, all jene standen unseres Wissens nach zu keiner Zeit in irgendeinem näheren Verhältnis zu Gernot Junker. – Es läutet. Von allen Seiten nähert sich die Gesellschaft dem entzückenden Theaterchen. Teils mit Vorfreude, teils mit Skepsis erwartet das gebildete Schwetzinger Publikum die Wiederaufführung der Oper von Ignaz Holzbauer: „Der Sohn der Wälder.“ Kurz zuvor hat sich jener Empfang im Schlossrestaurant abgespielt, von dem noch die Rede sein wird. Immer mehr festlich gewandete Gäste streben den Eingängen zu. Doch wie seltsam – einer bahnt sich in umgekehrter Richtung seinen Weg durch die Herandrängenden. Keine Frage, es handelt sich um Gernot Junker. Was ist mit ihm? Wo will er hin? Es wird sieben Kapitel dauern, bis wir hierzu eine einigermaßen zutreffende Antwort zu geben in der Lage sind.
Die Schwermut
Seinen ersten Besuch in Schwetzingen seit gut zwanzig Jahren beginnt Gernot Junker am Bahnhof der ehemaligen Sommerresidenz, die Heidelberg und Mannheim in einem ungleichschenkligen Dreieck geometrisch zueinanderstellt. Bisher ist der Tag nicht so ersprießlich verlaufen, wie sich der Landschafts- und Gartenarchitekt das vorgestellt hat. Da er Fernreisen niemals mit seinem hervorragend in Schuss gehaltenen Landrover unternimmt, sondern in solchen Fällen stets per Bahn fährt, vom Schienennetz nicht erschlossene Ziele mit dem Taxi erreichend, besitzt Junker eine Gesamtnetzkarte, erster Klasse, selbstverständlich. Doch auch der Rückzug in die privilegierten Abteile eines ICE schützt nicht immer vor den Unbilden der Gesellschaft und ihres Verkehrs; schon als er in Fulda zustieg, war der Zug überfüllt, und er musste seinen Reservierungsbeleg vorweisen, um überhaupt einen Sitzplatz zu erlangen. Zu Junkers Ärger leistete der beleibte Mitbürger, den er verscheuchte, eisern Widerstand, behauptete unter einer Gehbehinderung zu leiden und so fort.
Gernot Junker gegenüber kam ein Geschäftsreisender zu sitzen, der unablässig telefonierte, laut und bayerisch, auf diese Weise das Studium der Akten empfindlich störend. Erwartungsgemäß blieb der Expresszug kurz vor Frankfurt stehen. Durchsagen in kurzen Abständen strapazierten zusätzlich. Aus einer Reise, die mit freundlichen Eindrücken zu Sammlung und Entspannung beitragen sollte, war ein Kampf um Konzentration und Selbstbeherrschung geworden. – Die namenlos öde Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim überbrückte Junker damit, dass er seinem Ärger beim Wachsen zusah. Er fühlte sich bedrängt, verletzt, beleidigt von all der Scheußlichkeit zu beiden Seiten. Belanglose Neubausiedlungen, Müllverbrennungsanlagen, Autofriedhöfe, von schlechten oder von gar keinen Archiktekten lieblos hingeworfene Gewerbegebiete, sinnloser, unbewusster Flächenverbrauch allenthalben – so deutlich war ihm lange nicht mehr aufgefallen, was für ein hässliches Land seine Heimat geworden war.
Nur einmal, ein einziges Mal belohnte ein lieblicher Anblick Junkers Beharrlichkeit. Ein Ritual der Ehrerbietung vor diesem letzten Hoheitszeichen des Rheintals, neigte sich der Zug in einer weitgeschwungenen Kurve, und die schöne Kuppe des Melibokus, jener numinosen Kulthöhe vorzeitlicher Heiden, tauchte aus dem Elend auf ... um sogleich von den gähnenden Fabrikhallen eines Reifenhändlers veschlungen zuwerden. – In Mannheim verpasste der südwärts Reisende den Anschlusszug um wenige Minuten. Voll war es auf diesem Bahnhof, hektisch, unübersichtlich. Selbst in der mit roten Art-Déco-Sesseln und braun-beige-gestreiftem Parkett nicht einmal übel eingerichteten Lounge fand man keine Ruhe, da beständiges Kommen und Gehen und in kurzen Abständen geplärrte Verspätungsmeldungen die Atmosphäre beeinträchtigten. – Auch den Nahverkehrszug nach Schwetzingen empfand Junker als Zumutung; verklebter Boden, stickige, überheiße Luft – und überall Menschen, Menschen. Wie konnten die das aushalten, Tag für Tag? War deren Konstitution der seinen überlegen – oder waren sie einfach abgestumpft? Kurz nach der Abfahrt fiel ihm ein merkwürdiger Trichter auf, riesenhaft dimensioniert, der seine Öffnung dem leeren Himmel hinhielt. Wozu dieses auffälligste Gewächs unter all diesem jedweden Schönheitssinn verhöhnenden Schrott taugen mochte, war Junker uneinsichtig; doch es verleitete ihn zu einigen Gedanken, die der metaphysischen Unbehaustheit des Menschen unserer Tage galten. Er fragte sich, ob Kurfürst Carl Theodor, Hauptfinanzier des Schwetzinger Parks, noch gläubig gewesen sei; von Freimaurern umgeben, geschult an griechischer wie römischer Antike, Bewunderer von Lessings Versöhnungsdrama Nathan, hatte der Potentat nicht einmal davor zurückgescheut, eine gewaltige Schmuckmoschee in seinem Garten errichten zu lassen. Vermutlich, schloss Junker seinen Gedankengang, neigte der Monarch einer gewissen Privatfrömmigkeit und Vernunftreligion zu, die von okkultem Gedankengut infiziert und insofern anfällig gewesen sein mochte ...
Wie lange das dauerte, bis dieses Mannheim einmal aufhörte! Ein gleichbleibend griesgrämiger, eisgrauer Hochnebel schien jeden Ansatz von Regsamkeit ersticken zu wollen. Neckarau mit seinem brutalistisch vor die Landschaft geklebten Heizkraftwerk, Rheinau, eine lückenlose Aneinanderkettung von Industrieruinen und Siedlungswirrwarr, sodann, nicht weniger deprimierend, Schwetzingens Nordstadt, Reihenhaussiedlung an Reihenhaussiedlung. Warum, warum nur, grübelte Junker, legt der heutige Mensch so großen Wert darauf, weshalb bemüht er sich derart verbissen darum, seine Umgebung so feindlich wie irgend möglich zu gestalten, wieso haust er nur noch und will nicht wohnen, nicht leben, sich seines Erdenwallens partout nicht mehr erfreuen, kein Zeugnis ablegen für Lebensglück und Schöpfungsdankbarkeit? Diese Nachkriegszeit, hat sie denn auch nur einen einzigen Beweis zu erbringen vermocht, dass die Idee der Möglichkeit des Schönen, des von frohen Gedanken getragenen Zueinanders noch am Leben sei? Apeirokalia, der von Plato unter die schlimmsten Sünden gerechnete Hass auf alles Schöne, dürfte die einzige von keiner Umsturzbemühung angetastete Gottheit dieser Epoche geworden sein. Wie machtlos bliebe da der Einzelne, wie ephemer oder zum Verzweifeln vergeblich wäre sein Widerstand ...
Und er, Junker selbst, hat er denn wenigstens in seinem privaten Umkreis, in seinem heimatlichen Gemeinwesen etwas zu einer (von ihm in Permanenz eingeforderten) Enthässlichung beigetragen? Bewahre. Fulda – da ließ sich nichts mehr ausrichten. Die durchaus zahlreichen historischen Relikte, die erfreulichen Zeichen der verflossenen Jahrhunderte waren so umfassend aus dem Zusammenhang gebracht, so rüde durch Neubau und Straßenführung beeinträchtigt, dass jeglicher Versuch einer Rekultivierung vergeblich, ja naiv gewesen wäre. – Nach dem zeitigen Scheitern seiner Ehe überließ Junker das Reihenendhaus in Hünfeld gerne der biederen Gattin und den beiden langweiligen Söhnen und zog für anderthalb Jahre in ein Hotel. Die meiste Zeit verbrachte er sowieso im Büro, gelegen in einem Zweckgebäude ohne Aussicht. Als die finanziellen Mittel zusammenschrumpften, mietete er zwei zusätzliche Räume in jenem schwefelgelben Bürokomplex an, wo er einige seiner privaten Gegenstände unterbrachte, vor allem Fachbücher.
Seither befand sich Gernot Junker vornehmlich auf Reisen. Eine zeitlang hatte er viel in Oberitalien zu tun, was er zu langen Zugfahrten und Übernachtungen in hübschen Hotels und Pensionen nutzte. So sehr diese Art zu leben seinen Überzeugungen entsprach, es war doch nicht zu leugnen, dass seine Kräfte allmählich nachließen. Irgendwann – baldmöglichst – sollte er ein Haus erwerben, in dem er sich wohlfühlen könnte. Allerdings, das stand außer Frage, würde es ein kostspieliges Anwesen sein müssen, möglichst nach eigenen Plänen gebaut, umgeben von einem weitläufigen Garten, einem Privatpark, der seine Ansprüche zufriedenstellte. Hierzu nun bedurfte es eines Großauftrags, einer höchst reputierlichen Unternehmung von internationalem Zuschnitt, woraus ihm, wer weiß so etwas schon, vielleicht eine wohlfeile Gelegenheit erwüchse. Ein Mann von Junkers Format, das ließ sich nicht in Frage stellen, bedurfte eigentlich keines Hauses; eine Art Palais, ein Landsitz mit Auffahrt, dergleichen sollte es schon sein – dazu eine Stadtwohnung, am besten in Frankfurt. München ginge auch.