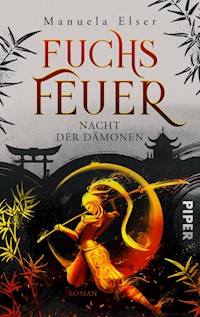
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Wundervoll
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Japanische Mythen, dämonische Yōkai und ein Mädchen, das nie eine Zukunft haben sollte – actionreiche Urban Fantasy für Fans von »Die Clans von Tokito« und Julie Kagawa »Seufzend zuckte er mit den Schultern und wandte sich erneut von mir ab. ›Wenn du das nächste Mal gegen einen Yōkai kämpfen willst, zieh dir zumindest Schuhe an.‹« Wenn die Sonne untergeht, kriechen sie aus ihren Löchern: Die Yōkai, die Geister und Dämonen Japans. Wie alle Erstgeborenen weiß Sayu, dass die Yōkai sie in der Nacht, in der sich der Mond rot verfärbt, holen werden. Als statt ihr jedoch ihre kleine Schwester Eri entführt wird, steht Sayus komplette Welt auf dem Kopf. Tagsüber muss sie sich plötzlich einem schwierigen Schulalltag stellen und kommt dabei der charmanten Mirai langsam näher. Nachts hingegen zieht sie an der Seite des mysteriösen Ryo gegen die Yōkai in den Kampf, um ihre Schwester wiederzufinden. Doch dieser Kampf hat seinen Preis und bald muss Sayu sich entscheiden: Will sie ihre Schwester retten oder die Zukunft, die sie nie hatte? »Die Geschichte hat mich von Anfang an fuchsifiziert. Ein Must-Read für alle Japan- und Urban Fantasy-Fans.« »Fuchsfeuer hat alles, was ein großartiges Buch braucht – ein außergewöhnliches Setting, eine mutige Protagonistin und ein spannendes Abenteuer.« – Christina Hiemer (Autorin) »Super spannende Urban Fantasy mit starken Protagonisten und einem Plot, der mich von Anfang an gefesselt hat. Besonders empfehlenswert für alle, die mehr über die japanische Kultur und Mythologie erfahren.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Essen, Kultur, Schulwesen, aber auch alles dafür zu tun, vor anderen nicht das Gesicht zu verlieren – all das macht das Buch noch lebendiger, als es die reine Geschichte sowieso schon ist. [...] "Fuchsfeuer – Nacht der Dämonen" entführt die Lesenden vordergründig in das mythologische Japan mit einer spannenden und packenden Geschichte voller Magie und unheimlichen Momenten. Es geht aber auch ums Erwachsenwerden, um das Finden des eigenen Werts, um das Entdecken von Liebe und Zuneigung und dem eigenen Platz in der Welt. Das ist lebendig, spannend und packend geraten, hält aber ruhige und emotionale Momente parat. Sehr lesenswert!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Fuchsfeuer – Nacht der Dämonen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Giessel Design
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Kapitelzierden: Milena Spiegel
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Kapitel 1
Die Toten schlafen in der Wildnis
Kapitel 2
Vom Morgen einer bunten Welt
Das Grab der Glühwürmchen
Zeitloses Mädchen und verschlossener Junge
Kapitel 3
Von Fenster zu Fenster
Das Mädchen und das Biest
Kapitel 4
Die Wahrheit liegt im Blut
Dein Name ist …?
Kapitel 5
Das Mädchen, das den Sternen folgt
Im Wald der Glühwürmchen
Kapitel 6
Die irreguläre Schülerin der Fukakusa-Oberschule
Morgen werde ich sterben und du wirst erwachen
Kapitel 7
Das Erwachen der Kriegerin
Kapitel 8
Das Mädchen, das die Sonne berührte
Unsere Träume in der Dämmerung
Kapitel 9
Ich hatte wieder denselben Traum
Kapitel 10
Tränen der Vergangenheit
Der Aufstieg (und Fall) eines Bücherwurms
Kapitel 11
Geisterjagd
Kapitel 12
Lies oder stirb!
Deine Lüge im Mai
Sekunden in Moll
Kapitel 13
Sayus bizarres Abenteuer
Kapitel 14
Blauer Frühlingstrip
Das Flüstern der Wellen
Der Klang des Himmels
Kapitel 15
Der unsterbliche Regen
Kapitel 16
Nachts verwandelte ich mich in ein Monster
Das Mädchen, das durch die Zeit (und gegen die Wand) flog
Die Stadt, in der es nur mich nicht gibt
Kapitel 17
Dunkler als Schwarz
Unbenannte Erinnerung
Kapitel 18
Ich traf dich nach dem Ende
Das Flüstern des Herzens
Kapitel 19
Das Schwert des Unsterblichen
Kapitel 20
Der Wind hebt sich
Auch wenn die Welt morgen endet
In diesen (und anderen) Teilen der Welt
Kapitel 21
Die Geschichte der heimlichen (nicht so) Heiligen
Kapitel 22
(Nicht mehr) perfektes Blau
Wer weiß schon, wie blau der Himmel ist
Orange: (meine) Zukunft?
Kapitel 23
Den Namen jener Blume, die wir damals gesehen haben, wissen wir immer noch nicht
Kapitel 24
Mein Herz möchte schreien
Drei Stunden des Glücks (oder auch nur eine)
Ich werde dieses Gefühl eines Tages vergessen (aber nicht heute)
Kapitel 25
Das letzte Exil
Lebe wohl, andere Welt. Wir sehen uns (vielleicht) morgen
Im Tal des Windes
Das Schloss jenseits des Spiegels
Wir waren da
Das war alles, das ich brauchte
Kapitel 26
10 Jahre später
Nachwort
Begriffsregister
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für alle, die nicht wissen, was sie wollen.
Es gibt keinen richtigen Weg.
Nur den eigenen.
Kapitel 1
Die Toten schlafen in der Wildnis
In ein paar Stunden war ich weg. Nicht nur weg aus diesem Haus. Weg.
Ich zuckte zusammen, als das Türschloss hinter mir klackte. Dabei hatte ich meine Mutter selbst gebeten, abzuschließen, damit meine kleine Schwester nicht in mein Zimmer kommen konnte.
Und obwohl ich nicht wusste, was mich erwartete, begannen meine Mundwinkel zu zucken. Heute war es so weit. Kein Bangen, kein Warten mehr. Mein Herz pochte nervös, und gleichzeitig fühlte ich mich geladen. Das, worauf ich mich mein ganzes Leben vorbereitet hatte, würde bald hier sein.
Es konnte sich nur noch um Stunden handeln!
Mit vor Aufregung zitternden Fingern zog ich mein Handy aus der Tasche, doch bevor ich auch nur eine Zeile schreiben konnte, vibrierte es. Riku war mal wieder schneller als ich gewesen.
Was hältst du von Kitsune?, fragte sie in ihrer Chatnachricht.
Seufzend ließ ich mich auf meine Matratze fallen und griff nach dem einzigen Schulbuch, das immer neben meinem Bett lag. Das Shūgaishō, das Handbuch über Geister und Dämonen. Kitsune waren Fuchsgeister, so viel war mir klar. Ich hatte mich jedoch nie näher mit ihnen befasst. Alles, was ich wusste, war, dass sie Menschen Streiche spielten.
Sind nicht sehr stark, antwortete ich, während ich die Seite über die Wesen überflog. Riku wollte immer etwas werden, das mit reiner Muskelkraft Häuser versetzen konnte. Gestern hatte sie noch begeistert von Oni mit gruseligen Fratzen und Fangzähnen erzählt.
Ihre Magie schon, kam prompt zurück. Würde zu dir passen.
Ich verdrehte die Augen und war froh, dass Riku meine Reaktion nicht sehen konnte. Sie war überzeugt, dass wir nicht einfach verschwinden, sondern uns in Yōkai verwandeln würden. In jene Geister und Dämonen, die jede Nacht Japan unsicher machten, seit sich der Riss zwischen den Welten geöffnet hatte.
Ich war mir da nicht so sicher. Es gab viele Theorien, was heute Nacht mit uns passieren würde, und jede davon war unwahrscheinlicher als die andere. In Wahrheit wusste es einfach niemand.
Noch einmal musterte ich das Bild des Kitsune, das ich aus den Unterrichtsstunden kannte. Ein neunschwänziger Fuchs verwandelte sich in ein tanzendes Mädchen mit einem schelmischen Lächeln auf den Lippen. Immerhin schien sie Spaß zu haben. Ich griff erneut nach meinem Handy und sah dabei auf die Uhr. Bald war es halb sieben und die Sonne würde untergehen.
Kitsune wären okay, tippte ich. Ich wollte sie nicht ausgerechnet heute noch einmal erinnern, dass ihre Theorie nicht mehr als, na ja, eine Theorie war.
Na eben. Das Emoji neben ihren Worten lachte, und zwei Sekunden danach kam direkt noch eine Nachricht. Riku musste die Uhrzeit ebenfalls bemerkt haben. Wir sehen uns im nächsten Leben. Komm nicht wieder zu spät.
Ich bin nie zu spät, du bist nur immer zu früh, schrieb ich zurück, aber ich hatte bereits keinen Empfang mehr.
Ich warf mein nun nutzloses Handy neben mich und kniete mich auf mein Bett. Beinahe automatisch glättete ich erst meine Haare und faltete dann meine Hände in meinem Schoß. Wie meine Mutter es stets tat, wenn wichtiger Besuch kam.
Ich konnte meine Finger allerdings nicht ruhig halten und strich immer wieder nervös über meinen Handrücken. Wie lange würden sie brauchen? Eine Minute? Zwei Stunden? Die ganze Nacht?
Würde es wehtun?
Mein Blick wanderte wieder zu dem Lehrbuch, von dem ich wusste, dass es keine Informationen über die heutige Nacht beinhaltete. Niemand konnte Genaueres über die Nacht des roten Mondes sagen, außer denen vor uns. Und die waren weg.
Draußen vor dem Fenster versank die Sonne langsam hinter den Dächern und hüllte mein Zimmer in bronzenes Licht. Mit der Dämmerung veränderten sich die Straßen von Kyoto.
Die modernen Straßenlampen flackerten, bevor sie ausgingen und sich verformten. Ihre dünnen Stangen bogen sich und zogen sich zusammen, bis sie zu steinernen Fackeln wurden. Die verflochtenen Kabel, die über den Straßen hingen, entwirrten sich wie Schlangen, die sich noch einmal aufbäumten, dann lösten sie sich auf. Eine Stille breitete sich aus, die in dieser Stadt sonst nie so endgültig war. Irgendwo hörte man immer jemanden rufen, lachen oder ein Auto vorbeifahren. Doch nun war da nichts.
Ein Schauer wanderte über meinen Rücken.
Mit den Sonnenstrahlen verschwand meine Welt und wurde zu der der Yōkai. Als könnte man sehen, wie sich der Kiretsu, der Riss, der unsere Welten miteinander verschmolzen hatte, ausweitete.
Für einen Moment starrte ich auf die Straße unter mir, sah von links nach rechts. Überprüfte, ob ich einen Yōkai entdecken konnte, der sich gerade auf den Weg zu uns machte. Die Stadt vor mir rührte sich nicht. Sie schien genauso wie ich den Atem anzuhalten.
Ich stieß die Luft zwischen den Zähnen aus und sprang auf, ohne zu wissen, was ich tun sollte. Irgendetwas musste ich allerdings machen, ich konnte nicht einfach nur warten, bis sie mich holten.
Mit zusammengebissenen Zähnen trat ich auf das Fenster zu und griff nach dem Hebel, spürte das kalte Metall unter meinen Fingern. Sollte ich wirklich …? Mein Atem dröhnte viel zu laut in meinen Ohren, während ich unschlüssig dastand.
Dann schüttelte ich meinen Kopf. Nein. In dieser Nacht würde ich keine Angst vor den Yōkai haben. Ich wusste, dass sie wegen mir kommen würden. Ich war nirgendwo sicher. Und genau deswegen fühlte ich mich so sicher wie noch nie zuvor.
Beinahe erwartete ich, dass der Bannzauber unseres Hauses mich zwingen würde den Fenstergriff loszulassen. Mich an das Verbot meiner Eltern erinnerte, nach Sonnenuntergang nicht hinauszugehen. Doch nichts geschah. Auch nicht, als ich das Fenster aufschob.
Vorsichtig setzte ich einen Fuß hinaus, und zum ersten Mal in meinem Leben atmete ich kühle Nachtluft ein. Es roch nach dem brennenden Öl der Fackeln und frisch geschnittenem Gras, nach Freiheit.
Ich merkte kaum, wie sich meine Socken für einen Moment an den Schindeln des Vordachs verfingen, als ich mich auf die Knie sinken ließ. Starrte nur wie gebannt nach oben in den Sternenhimmel.
Er war wunderschön.
Natürlich hatte ich die Sterne schon mehrmals durch mein Fenster betrachtet. Aber es war etwas ganz anderes, sie hier unter freiem Himmel zu sehen. Ihr Leuchten schien so viel kräftiger, magischer. Selbst der rot leuchtende Mond über mir wirkte durch ihr Strahlen weniger bedrohlich.
Ein kleines Lächeln stahl sich auf meine Lippen, während ich wartete. Ich konnte mir keinen schöneren Abschied von dieser Welt vorstellen.
Kapitel 2
Vom Morgen einer bunten Welt
Ich schreckte hoch.
Warme Sonnenstrahlen kitzelten mein Gesicht, Vögel zwitscherten, und ein kühler Wind fuhr durch meine Kleidung. Irritiert blinzelte ich und rieb mir über die Augen.
Ich kniete immer noch auf dem Vordach unseres Hauses. Die Ziegel drückten sich unangenehm durch meine Jeans, obwohl sich meine Beine taub anfühlten, und mein Nacken war steif von der Position, in der ich geschlafen hatte. Aber … ich war noch hier.
Wie war das möglich?
Erneut rieb ich mir über die Augen und schlug mir dann mit den flachen Händen gegen die Wangen. Doch es gab keinen Zweifel, ich war noch hier.
Ruckartig sprang ich hoch, aber meine Beine gaben unter mir nach. Durch das lange Sitzen mussten sie eingeschlafen sein, und ich taumelte unelegant durch das Fenster zurück in mein Zimmer.
Mein Bett mit dem blauen Sternenmuster war nach wie vor unberührt, und das Shūgaishō lag auch noch aufgeschlagen neben meinem Kissen. Nichts hatte sich verändert, und doch war alles anders.
»Mama«, schrie ich. »Papa!«
Ich musste es ihnen sagen. Meiner Schwester Eri und … Riku!
Beinahe wäre ich über meine eigenen Füße gestolpert, als ich nach meinem Handy griff und ihre Nummer wählte.
»Mama, Papa«, schrie ich, während es klingelte. Niemand hob ab. Riku schlief wohl noch oder feierte bereits mit ihrer Familie. Es musste der erste Akatsuki seit dem Kiretsu sein, an dem die jugendlichen Erstgeborenen nicht geholt worden waren. Die erste Nacht, in der der magische blutrote Vollmond der Dämonendämmerung die Yōkai nicht übermächtig gemacht hatte.
Ich schüttelte meine Füße aus, und zwang mich ein paar Schritte vorwärts.
»Mama, Papa«, brüllte ich weiter, und hämmerte gegen meine Zimmertür. »Ich bin noch hier!«
Donnernde Schritte näherten sich auf der anderen Seite.
»Sayuri?«, hörte ich die erstickte Stimme meiner Mutter.
»Ist das ein Trick?«, murmelte mein Vater misstrauisch. Aber ich konnte bereits hören, wie der Schlüssel über Metall schabte, wie das Schloss leise klackte.
Ich konnte nicht warten, bis sie die Tür öffneten, sondern riss sie auf.
»Wie …«, stieß mein Vater aus, seine dunklen Augen vor Schreck geweitet. Seine leicht ergrauten Haare ließen ihn in seinem schlabbrigen, abgetragenen Pyjama alt wirken.
Warme Tränen rannen mir übers Gesicht, als ich mich in seine Arme warf, und gleichzeitig auch meine Mutter näher zog. Ich hatte überlebt. Ich, eine Erstgeborene, war noch hier, obwohl der Akatsuki geschienen hatte. Obwohl ich nach Sonnenuntergang draußen gewesen war.
»Ich weiß es nicht.« Ich löste mich aus der Umarmung. Eri würde es nicht glauben können. Ich sah sie schon vor mir, wie sie allen erzählte, dass sie gesehen hatte, wie ich die Yōkai besiegte. Auch wenn gar keine hier gewesen waren.
Meine Füße hatten zum Glück endlich aufgehört zu kribbeln, und ich rannte zu der Tür mit der krakeligen Aufschrift Eris Welt.
»Überraschung!«, rief ich, als ich, ohne zu klopfen, eintrat.
Stille antwortete mir. Ihr Bett mit den bunten Blumendecken darauf war leer, und ihr Stoffdinosaurier, mit dem sie heimlich schlief, lag auf dem Boden.
»Eri?«, fragte ich, und meine anfängliche Freude verschwand, als ich langsam auf ihren Schrank zutrat, in dem sie sich so oft versteckte. Doch im Gegensatz zu sonst kam sie nicht herausgesprungen, um mich zu erschrecken.
Meine Eltern stürzten an mir vorbei, durchwühlten ihren Raum, und riefen immer wieder ihren Namen, auch während sie unten nach ihr suchten. Doch meine Füße waren wie festgefroren, ich konnte mich nicht mehr rühren.
Ich hatte mich geirrt. Die Yōkai hatten nicht aufgehört. Es war nicht vorbei.
Sie hatten Eri geholt.
Das Grab der Glühwürmchen
Ich merkte kaum, wie die Zeit verstrich. Irgendwann musste mich jemand aus dem Zimmer geführt haben. Denn nun saß ich an unserem Tisch im Wohnzimmer, einem älteren Mann in kantig geschnittener Uniform mit hellblauem Hemd und dunkelblauer Hose gegenüber.
»Muramoto Sayuri, war Ihre Schwester bei Ihnen im Zimmer?«, hörte ich seine Stimme durch das Rauschen in meinen Ohren sagen. Aber ich konnte ihm nicht antworten. Eri war fort.
»Nein. Ich habe es von außen abgeschlossen.« Meine Mutter kam in mein Blickfeld. Ihre Augen waren gerötet, ihr Gesicht erbleicht. Ich hatte sie noch nie so fassungslos gesehen.
Der Mann vor mir kratzte sich am Kopf. Ich wusste, dass er sich vorgestellt hatte, ich konnte mich nur nicht mehr daran erinnern. All unsere Vorkehrungen, um Eri zu schützen, von denen man uns immer gesagt hatte, sie wären nicht notwendig, weil Eri eine Zweitgeborene war. Das Abschließen unserer Zimmer, der Bann, den wir in ihre Tür hatten ritzen lassen … Alles umsonst.
»Wie war der Abend sonst? Etwas Ungewöhnliches? Ein Ritual vielleicht?« Der Mann sah mich weiterhin an, und ich wusste, ich sollte antworten, mein Schweigen brechen. Ich wollte es auch. Aber mein Kopf war leer.
»Wir haben uns verabschiedet. Von Sayuri.« Ich konnte meinen Vater nicht sehen, doch ich hörte an seiner Stimme, dass er weinte. Weinte ich? Langsam hob ich meine Hand an meine Wange. Trocken.
»Haben Sie ansonsten etwas anders gemacht als üblich?« Der Mann sah von einem zum anderen.
Ja.
»Nein.« Die Stimme meines Vaters brach.
Ich habe auf unserem Vordach geschlafen. Ich war nicht im Haus.
»Nichts, wir haben etwas gegessen, Räucherstäbchen angezündet und versucht, uns bereit zu machen.«
Wir hatten alle gewusst, was passieren würde. Wir hatten gewusst, dass man den Yōkai nicht entkam. Man konnte nicht weglaufen. Nicht zu Akatsuki.
Sie fanden einen immer.
Der Mann vor mir beugte sich über die Zettel, die vor ihm lagen, und erst jetzt bemerkte ich meinen Namen darauf. Unser offizieller Stammbaum. »Muramoto Sayuri ist Ihre leibliche Tochter?«
Die Frage fühlte sich an wie ein Schlag ins Gesicht, und das Rauschen in meinen Ohren verschwand.
»Was wollen Sie damit andeuten?«, fragte meine Mutter, und plötzlich bekamen ihre Wangen wieder mehr Farbe.
»Viele Familien versuchen …«
»Wir nicht!« Ihre Stimme war eisig geworden. »Das führt nur dazu, dass man zwei Kinder verliert.«
»Sie sprechen aus Erfahrung?« Zum ersten Mal wandte der uniformierte Mann seinen Blick von mir ab, wollte die Antwort nicht von mir wissen.
»Ich hatte einen Adoptivbruder und eine Schwester, den Fall können Sie in Ihren Akten nachsehen.« Die Silben klangen abgehackt und in ihren Augen glänzten Tränen, die sie energisch wegwischte. Mein Mund klappte auf. Ich wusste, dass sie ihre Schwester verloren hatte, meine Großmutter sprach häufig darüber. Doch niemand hatte je von einem Bruder erzählt.
Der Mann vor mir blätterte durch unsere Dokumente. Er schien nicht zu wissen, was er als Nächstes tun sollte.
»Und ihr seid euch wirklich sicher, dass Muramoto Sayuri die Erstgeborene ist? Es kommt nicht selten vor, dass Eltern ihren Kindern nicht die Wahrheit erzählen.« Der Beamte sah dabei nicht von seinen Papieren hoch, so als wüsste er selbst, wie unhöflich er gerade war. Ich merkte, wie sich meine Hände zu Fäusten ballten.
»Worauf wollen Sie hinaus?«, knurrte meine Mutter bedrohlich, obwohl ich mir sicher war, dass sie das bereits wusste. Die Fassungslosigkeit war nun endgültig verschwunden.
Der Beamte sank in seinem Stuhl zusammen. »Könnte es sein, dass Eri die Ältere war? Dass eigentlich sie …«
Ich sprang auf, mein Stuhl kratzte laut über den Boden, und ich schlug mit den Händen auf den Tisch. Alle wandten sich zu mir um und ich merkte, dass ich zitterte. »Sie hätten mich holen müssen«, stieß ich gepresst aus und sah in die Augen des Beamten. »Eri ist zwölf. Ich bin siebzehn. Sie kann nicht älter sein!«
Ich spürte die Blicke meiner Eltern auf mir und meine Hand zuckte hoch an meinen Mund. Der Mann vor mir war ein Beamter, so hätte ich nicht reagieren dürfen. Ruckartig fuhr ich herum und stürmte die Treppe hinauf in mein Zimmer. Die Tür schlug laut krachend hinter mir zu.
Die Yōkai hätten mich holen müssen. Es ergab überhaupt keinen Sinn, dass ich noch hier war. Ich war die Erstgeborene, diejenige, die sich seit Jahren darauf vorbereitet hatte. Die ihr ganzes Leben gewusst hatte, dass mit dieser Nacht alles endete.
Nicht Eri.
Der Mann unten hatte nur seinen Job gemacht, das wusste ich. Er versuchte an seinem Protokoll festzuhalten, um herauszufinden, was geschehen war. Wieso ich noch hier war, während alle anderen geholt worden waren. Aber es gab kein passendes Protokoll für diese Situation. So etwas passierte nicht. Kam nicht vor.
Seit vor knapp vierhundert Jahren der Kiretsu, der Riss zwischen den Welten, entstanden war, wurden in Japan alle zehn Jahre alle erstgeborenen Jugendlichen von den Yōkai geholt. Damals hatte man in Panik die Grenzen geschlossen. Und selbst nachdem sie Jahrhunderte später wieder geöffnet worden waren, ließ man Touristen zu dieser Zeit nicht ins Land. Stattdessen schickten viele, die Familie im Ausland hatten, ihre Kinder dorthin. Nur half das nichts. Die Yōkai fanden einen immer.
Ich war die Ausnahme.
Ich war die Einzige, die ihre jüngere Schwester verloren hatte.
Meine Hand zitterte, während ich mein Handy an mein Ohr presste. Über mir konnte ich ein Rumsen gefolgt von einem Kratzen hören, was ich jedoch ignorierte. Die Geräusche konnten nur von dem Kamikiri stammen, der sich seit Jahren tagsüber in unserem Dach verkroch. Ein Yōkai, der zwar seltsam, allerdings ungefährlich war. Ich konzentrierte mich nur auf das Geräusch meines wählenden Telefons, als könnte ich es so zwingen, dass mein Anruf durchkam.
Seit sich der Beamte verabschiedet hatte, war niemand mehr gekommen, und wir hatten das Haus nicht verlassen. Immer noch dröhnte das schrille Tuten der Leitung in meinen Ohren, doch keiner hob ab.
Ich wusste, dass ich die Einzige war. Dass sie Riku geholt hatten. So viel hatte mir die Reaktion des Beamten verraten. Aber ein Teil von mir hoffte, dass er sich irrte. Dass aus irgendeinem Grund diesmal nur Zweitgeborene entführt worden waren und Riku noch hier war.
Bei dem Gedanken zog sich mein Magen zusammen. So sollte ich nicht denken. Das war egoistisch. Und gleichzeitig konnte ich nicht anders, als hoffnungsvoll in die Stille meines Handys hineinzulauschen.
Doch das Telefon in meiner Hand tutete nur erneut.
Es klopfte an meiner Tür.
»Sayuri?« Mein Vater.
Ich presste meine Kiefer zusammen und legte auf. Es war der zwanzigste Anruf, ich hatte gewusst, wie er ausgehen würde. Trotzdem kostete es mich einiges an Mühe, das Handy in meiner Hosentasche verschwinden zu lassen. »Ja?«
Die Tür öffnete sich und mein Vater stand unbeholfen im Türrahmen. Seine Augen waren immer noch gerötet und er trug nun einen schwarzen schmucklosen Kimono. Er wirkte nervös. »Also … ich weiß, wir haben nie über das Danach gesprochen.«
Ich nickte. Es hätte auch keinen Sinn ergeben, schließlich hätte es alle nur einmal mehr daran erinnert, dass ich dann nicht mehr da sein würde. Dennoch wusste ich, dass am Tag der grünen Hoffnung, dem Tag nach dem Akatsuki, eine Zeremonie abgehalten wurde. Keine richtige Bestattung, es gab ja keine Toten. Nicht wirklich zumindest. Nur einen Abschied.
»Du musst nicht mitkommen«, murmelte er und wich meinem Blick aus. Sein Unbehagen versetzte mir einen Stich, doch ich versuchte das Gefühl zu ignorieren. Es hatte nichts mit mir zu tun. Nicht direkt … oder?
Wenn ich zu der Zeremonie ging, waren dort die Geschwister meiner Freunde. Die Eltern meiner Klassenkameraden. Sie alle würden erfahren, dass ich noch hier war.
Aber vielleicht war ich nicht die Einzige.
Die Stimme in meinem Kopf klang so hoffnungsvoll, dass es wehtat. Gleichzeitig erinnerte ich mich jedoch an den Beamten. An seine Fragen, seine Verwirrung. Die anderen würden dieselben Fragen stellen. Warum ich? Warum niemand anderes?
Mein Blick wanderte an meinem Vater vorbei zu Eris Tür. Die Schriftzeichen, mit denen sie ihren Namen all die Jahre zuvor auf die Tür gemalt hatte, sahen so verwackelt aus wie immer und kein Singen oder Poltern war daraus zu hören.
»Ich komme mit«, murmelte ich und ging an meinem Vater vorbei zu meinem Schrank. »Für Eri.«
Nachdem ich mich umgezogen hatte, brachen wir gemeinsam auf. Der Weg zum Fushimi Inari-Schrein, dem größten Schrein in unserem Stadtviertel, fühlte sich unendlich lang an. Normalerweise hatten wir die Strecke zu Fuß zurückgelegt oder waren für zwei Stationen in den Bus gestiegen, wenn wir zu müde waren. Diesmal nahmen wir jedoch das Auto, eine Kiste auf dem Rücksitz neben mir. Eris Kiste.
Meine Mutter fuhr langsam, versuchte den anderen Trauernden auszuweichen, die auf der Straße gingen. Manche hatten schwarze Anzüge an, die meisten trugen jedoch ähnlich dunkle Kimonos wie wir. Ihre Köpfe zuckten in unsere Richtung, als wären sie überrascht. Vielleicht waren wir die Einzigen, die mit dem Auto kamen. Ein paar von ihnen runzelten die Stirn. Hatten sie mich gesehen? Wussten sie Bescheid? Es war jetzt späterer Nachmittag und wenn es um Yōkai ging, verbreiteten sich die Neuigkeiten stets wie ein Lauffeuer.
Ein Kind hob die Hand, zeigte auf mich, dann ein zweites. Zum Fushimi Inari-Schrein kamen hauptsächlich Leute aus der Umgebung, aus unserer Nachbarschaft. Leute, deren Kinder mit Eri in die Schule gegangen waren, die mich zumindest schon einmal gesehen hatten.
Ein Teil von mir wollte wegsehen, so tun, als würde ich ihre Finger nicht bemerken. Es waren nur Kinder. Aber meine Augen brannten, während ich sie niederstarrte. Eri hatte sich nie abgewandt, wenn es nichts gab, wofür sie sich schämen musste.
Als meine Mutter auf dem großen und trotzdem überfüllten Parkplatz stehenblieb, drehte sich mein Vater mit besorgtem Blick zu mir um. Ich nickte ihm zu. Ich konnte das schaffen. Ich würde das schaffen. Für meine Eltern.
Mit zusammengebissenen Zähnen stieg ich aus dem Auto, die Kiste fest umklammert. Es gab nicht mehr länger eine Glasscheibe zwischen mir und den Menschen, die mich so unverhohlen anstarrten. Musterten. Abschätzten. Bis sie meinen Blick bemerkten und sich peinlich berührt abwandten. Der kleine Funke Hoffnung, dass ich nicht die Einzige war, dass ich hier noch andere Erstgeborene treffen würde, erlosch.
Beinahe automatisch durchsuchte ich die Menge nach Rikus Familie, obwohl ich mich gleichzeitig davor fürchtete, sie zu sehen. Was würde ihre Mutter sagen? Was ihr Vater? Und ihr kleiner Bruder? Er war noch so jung. Er würde nie verstehen, wieso ich noch hier war und seine Schwester nicht. Ich verstand es ja nicht einmal selbst.
Doch ich sah nur die jüngere Schwester unseres Schulsprechers mit feuchten Wangen neben ihrer Cousine, die ihr Kinn nach vorne geschoben hatte. Die Eltern der beiden starrten mich finster an. In ihren Augen lag nichts von der Trauer, die ich sonst überall sah. Sie wirkten wütend.
Wir traten gemeinsam auf den Schrein zu und je näher wir kamen, desto mehr zornige Gesichter bemerkte ich. Und sie alle fixierten mich. Meine Mutter straffte ihren Rücken und richtete sich auf, so wie sie es immer vor dem Besuch meiner Großeltern tat. Mein Vater trat näher an mich heran und drückte kurz meine Hand, bevor wir durch das Torii, den roten Torbogen am Eingang, gingen. Die dicken Säulen rechts und links mit der brückenartigen Verbindung hoch über unseren Köpfen wirkten noch imposanter als sonst. Je näher wir dem rot-weißen Hauptgebäude des Schreins kamen, desto mehr hatte ich das Gefühl, in die Knie gehen zu müssen. Die Kiste lag schwer in meinen Händen, während wir die wenigen Stufen hochstiegen.
Das düstere Licht im Schrein war angenehm für meine brennenden Augen, aber selbst hier spürte ich die Blicke der anderen Familien auf mir. Meine Schritte hallten in meinen Ohren wider, als ich mich nach vorne schob. Überall drehten sich Leute nach mir um, nach der Person mit der Kiste. Nach der, die nicht hier sein sollte. Keiner von ihnen sagte jedoch etwas.
Als wir vorne ankamen und ich endlich die Gedenkstätten sehen konnte, wurden meine Knie weich. Noch stand dort ein Foto von mir, wie ich vor dem Osaka-Aquarium in die Kamera winkte. Ich lachte, während hinter mir der berühmte Walhai vorbeizog.
»Gib mir die Kiste, Sayuri«, murmelte meine Mutter sanft, und das Gewicht verschwand aus meinen Händen. Mein Vater trat vor, nahm mein Bild und zog es aus dem Rahmen heraus, legte stattdessen behutsam das von Eri hinein.
Ich konnte Leute tuscheln hören, verstand jedoch kein einziges Wort. Eris Gesicht lachte mir nun entgegen, ihre halblangen schwarzen Haare wehten im Wind, obwohl die Schaukel, auf der sie saß, stillstand. Ich hatte das Foto geschossen. Nachdem ich ihr erzählt hatte, wie hoch ich bei meinem Stockkampf-Turnier verloren hatte und warum.
Ursprünglich hatte sie das Bild gehasst, weswegen ich es drucken ließ und im Wohnzimmer aufgehängt hatte. Sie war so wütend gewesen. Als ich es dann doch abnehmen wollte, hatte sie es jedoch selbst wieder dorthin gehängt.
Mit zusammengebissenen Zähnen trat ich vor. Legte das Stofftier meiner kleinen Schwester neben die DVD ihres Lieblingsfilms und eine ihrer Zeichnungen, die meine Mutter bereits drapiert hatte.
Kaum dass wir wieder hinunter in die Menge traten, öffnete sich eine Tür und ein Mönch kam herein. Seine weite Kleidung streifte beinahe den Boden und eine Brille zierte seinen ansonsten kahlen Kopf. Die Leute verstummten sofort und wir knieten uns hin. Es wurde so still, dass man die Gebetsketten um den Hals des Mönches leise rasseln hörte.
Hinter ihm traten zwei Miko in ihren weiten rot-weißen Gewändern hervor. In den Händen hielten die Angestellten des Schreins brennende Räucherstäbchen, deren süßlicher Geruch sich langsam im Raum ausbreitete.
Als er seine Stimme erhob, wäre ich beinahe zusammengezuckt. Ich kannte die Melodie von Sutras, wusste, wie sie klangen, auch wenn ich sie nicht verstand. Die lang gezogenen tiefen Töne, die höher wurden, bevor sie wieder absanken. Diesmal hatten sie jedoch etwas Finales an sich. Als wären die Worte ein Schlag in meine Magengrube.
Das alles hier war falsch. Eri sollte hier sein. Ich sollte das hier nie sehen, nie erleben.
Ich presste meine Lippen zusammen, um das dem Mönch nicht entgegenzuschreien. Ihn nicht zu fragen, ob bei dem Schutzbann, den sein Kollege vor Wochen bei uns angebracht hatte, etwas schiefgelaufen war. Ob sich jemand verschrieben hatte und es deswegen zu der Verwechslung gekommen war.
Gleichzeitig rannen mir die Tränen über die Wangen, denn ich wusste, dass nichts davon helfen würde. Eri war bei den Yōkai, und niemand kehrte von den Dämonen und Geistern zurück.
Ich merkte kaum, wie der Mönch auf Japanisch zu sprechen begann, von den vergangenen Leben erzählte. Ich wollte das nicht hören. Ich kannte Eri. Ich brauchte keine Erinnerung, um zu wissen, wie sie war.
Es kam mir vor, als hätte sie erst vor wenigen Tagen das Radfahren erlernt, das sie so gern tat. Als hätte ich eben erst das Strahlen in ihrem Gesicht gesehen, wenn ihre kantig geschnittenen Haare zurückgeweht wurden. Ein Abbild davon, dass sie die manchmal selbst abgeschnitten hatte, wenn der nächste Friseurtermin zu lange auf sich warten ließ.
Beinahe erwartete ich zu sehen, wie sie sich nach vorne schob, den Mönch beiseitestieß und allen verkündete, dass sie unseren Streitkräften gegen die Yōkai beitreten und mich retten würde. Etwas, wofür sie stets belächelt wurde, aber von dem ich wusste, dass sie es wirklich tun würde. Getan hätte. Eri hatte nie falsche Versprechungen gemacht. Sie hatte durchgezogen, was auch immer sie sich vornahm, so wie Riku. Manchmal war es mir fast logischer vorgekommen, dass die zwei Geschwister waren und nicht Eri und ich.
Und nun waren beide fort.
Der Mönch war bei Rikus Bild angelangt. Ihre kurzen Haare standen ihr zu Berge, und sie hielt stolz einen Pokal in die Höhe. Irgendwie schaffte sie es, gleichzeitig fröhlich und entschlossen auszusehen. Als würde sie die Welt herausfordern, es mit ihr aufzunehmen.
An diesem Tag hatte sie das Staatsturnier in Jōdō gewonnen. Sie war so stolz gewesen. Auch wenn sie immer über Yōkai gescherzt hatte, wusste ich, dass sie eigentlich immer Jōdōka werden, ihren Kampfsport zum Beruf machen wollte. Sie hatte das Foto sicher selbst ausgesucht. Ihre Eltern hätten sie lieber in einem Kimono gesehen.
Ich konnte meine Augen nicht von dem glücklichen Gesicht meiner Freundin abwenden, während der Mönch zum nächsten Bild schritt.
Komm nicht wieder zu spät, hatte Riku gesagt. Und jetzt kam ich gar nicht.
Zeitloses Mädchen und verschlossener Junge
Nach der Zeremonie konnten meine Eltern den Blick nicht von Eris Bild abwenden. Regungslos standen sie davor. Mein Vater hatte meiner Mutter einen Arm um die Schultern gelegt. Sie zitterte, als würde sie weinen, doch da waren keine Tränen.
Aus den Augenwinkeln sah ich Rikus Familie in der Menge. Ihre Mutter hatte ihre Haare traditionell hochgesteckt und trug einen schwarzen Kimono mit ebenso dunklem Obi um die Hüfte. Im Gegensatz zu sonst war dieser breite Gürtel allerdings nicht ganz glatt, als hätte sie ihn in Eile gebunden.
Rikus Vater hatte hingegen seine Uniform an, bei deren Anblick sich meine Hände verkrampften. Eine Erinnerung daran, wie machtlos wir gegen die Yōkai waren. Selbst die Yōban, die Yōkai-Spezialeinheit der Polizei, war zu Akatsuki nutzlos. Über die Köpfe der anderen konnte ich Rikus Bruder nicht sehen, ich war mir allerdings sicher, dass er bei seinen Eltern war. Keine Familie verbrachte diesen Tag ohne ihre Kinder.
So gut ich konnte, schob ich mich zwischen den anderen Trauernden hindurch und folgte Rikus Verwandten, als sie den Schrein verließen, versuchte sie einzuholen. Plötzlich kam ich jedoch nicht mehr vorwärts. Obwohl vor den Stufen der Schreinanlage weniger Leute waren, schien die Menge immer dann einen Schritt zu machen, wenn ich einen machte. Der Weg, der eben noch frei gewirkt hatte, schloss sich jedes Mal, sobald ich mich dahin wandte.
»Frau Kobayashi, Herr Kobayashi«, rief ich, um auf mich aufmerksam zu machen.
Rikus Mutter drehte ihren Kopf, und für eine Sekunde war ich mir sicher, dass sie mich gehört haben musste. Selbst durch die Menge hindurch konnte ich die Tränen sehen, die ihre Schminke verrinnen ließen. Eine Emotion flackerte über ihr Gesicht, aber sie wandte ihren Blick bereits wieder ab, sodass ich nicht sagen konnte, ob sie mich gesehen hatte. Vorwärts kam ich immer noch nicht. Es wirkte beinahe so, als würden sich alle gegen mich stellen, mich bewusst aufhalten.
Mein Atem dröhnte laut in meinen Ohren und mein Herz begann zu pochen. Ich war nie auffällig gewesen, nie herausragend. Riku war diejenige, die sich ins Rampenlicht schob, ich blieb lieber dahinter. Doch jetzt lagen wieder alle Blicke auf mir, wie schon vor der Zeremonie. Manche wirkten verwirrt, neugierig. Andere hingegen waren wütend, und ich wusste, was sie dachten, noch bevor sie den Mund öffneten.
»Wie hast du es gemacht?«, keuchte eine Stimme und durchbrach so das Schweigen der Leute, die mir den Weg versperrten. Es war Herr Fujihara, der nur wenige Straßen von uns entfernt wohnte. Er hatte seinen Sohn an die Yōkai verloren.
»Wo ist Eri?«, fragte jemand, und mein Herz, das eben noch laut gepocht hatte, erstarrte. Ich kannte diese Stimme, und ich wünschte, ich könnte ihr antworten. Es war Kimiko, Eris beste Freundin seit dem Kindergarten. Ihre dunklen, kinnlangen Haare waren zerzaust und ihre Lippen bebten.
»Ich …«, stotterte ich.
»Du willst es uns nicht verraten?«, unterbrach mich eine weitere Stimme, und ich erkannte Frau Ueda. Sie hatte nur ein Kind mit ihrem verstorbenen Ehemann. Ihre nun siebenjährige Tochter würde in zehn Jahren geholt werden. »Willst du uns …«
Plötzlich packte jemand meine Hand und ich wurde mitgerissen. Ich stolperte, trat irgendjemandem auf den Fuß und rammte jemanden mit meiner Schulter. Aber ich wurde weitergezogen, an den gerufenen Fragen vorbei. Mein Herz pochte in meiner Brust und mein Atem ging schnell, doch die Person wurde erst langsamer, als wir in einer Seitengasse hinter dem Torii verschwanden.
Ich sank in die Knie, meine Hände vor dem Gesicht, und atmete tief durch. In meinen Gedanken sah ich Kimiko vor mir. Wo ist Eri?
Ja, wo war sie?
»Alles okay?«, fragte eine Stimme, und ich sah hoch. Dunkle Augen blinzelten mir besorgt entgegen, und ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Ein Mädchen stand vor mir. Lose Strähnen ihrer schwarzen, zerzausten Haare hingen ihr ins Gesicht, und ihr Kimono war so unsauber gebunden, dass selbst meine Mutter die Stirn gerunzelt hätte. Sie war nicht älter als ich, doch sie schien nicht im Geringsten eingeschüchtert von dem, was gerade passiert war.
»J-ja«, stotterte ich.
»Solche Arschlöcher«, stieß sie dann aus, und ich zuckte zusammen. Es war selten, dass jemand so sprach. »Was gibt denen das Recht, dich so in die Enge zu treiben?«
»Sie trauern«, rechtfertigte ich instinktiv meine Nachbarn. Kimiko, die nur ihre Freundin wiederhaben wollte.
»Du aber auch«, seufzte sie, und streckte mir dann die Hand entgegen.
Zögerlich griff ich danach und ließ mich hochziehen. Ich wollte etwas erwidern. Ich sollte mich zumindest bedanken, dass sie mir geholfen hatte. Doch kein Wort kam mir über die Lippen.
»Sayuri?« Die schrille Stimme meiner Mutter ging mir durch Mark und Bein. Die Panik darin. Die Angst, dass ich fort war.
»Ich …«, setzte ich an.
»Geh schon, sonst machen sie sich Sorgen.« Das Mädchen lächelte, und der Hauch von Grübchen erschien auf seinen Wangen.
»D-danke«, murmelte ich und setzte mich in Richtung des Schreins in Bewegung, als ich meinen Vater ebenfalls rufen hörte.
»Wir sehen uns«, sagte das Mädchen noch, wodurch mir bewusst wurde, dass ich nicht nach seinem Namen gefragt hatte.
Erleichterung stand in den Gesichtern meiner Eltern, als ich bei ihnen vor dem Torii ankam.
»Ich wollte nur …«, setzte ich entschuldigend an, doch sie winkten ab.
»Alles okay, wir haben uns nur Sorgen gemacht.« Dabei warf meine Mutter einen eisigen Blick in Richtung eines Mannes, der an uns vorbeiging. Hatten meine Eltern das Verhalten der Leute bemerkt? Hatten sie es sogar selbst zu spüren bekommen?
Gemeinsam nahmen sie mich in ihre Mitte und schlangen ihre Finger um meine Hände. Wie früher, als ich noch klein war. Als könnten sie mich so vor den Menschen schützen, die uns mit finsteren Mienen folgten. Sobald sie den strengen Gesichtsausdruck meiner Mutter sahen, wandten sich jedoch alle hastig ab. Bis auf einen.
Weiter hinten, am Rand des Geländes, wo Bäume neben einem weiteren Torii emporragten, stand ein Junge und starrte mir entgegen. Der Blick aus seinen dunklen Augen schien mich zu durchbohren, als er sich mit meinem kreuzte.
Herausfordernd hob ich mein Kinn. Wenn er etwas zu sagen hatte, sollte er. Neben meinen Eltern fühlte ich mich sicher, ich konnte mich allem stellen.
Doch der Junge stand nur schweigend da und musterte mich. Dann hatte er anscheinend genug gesehen. Mit undeutbarer Miene wandte er sich ab und verschwand in der Menge der trauernden Familien.
Kapitel 3
Von Fenster zu Fenster
Ausgelaugt starrte ich an die Decke über mir. Mein Zimmer fühlte sich so leer, so surreal an. Selbst das Bett, auf dem ich seit der Rückkehr von der Gedenkfeier mit Jeans und T-Shirt lag, kam mir unwirklich vor.
Ich war noch hier.
Ich hatte das Unmögliche geschafft. Nur wie und zu welchem Preis? Eri war fort, und ich hatte keine Freundin mehr, mit der ich darüber reden, die ich um Rat fragen konnte. Nie hätte ich meine kleine Schwester eingetauscht, ihr Leben für meines riskiert.
Frau Uedas Worte hallten durch meinen Kopf. Du willst es uns nicht verraten? – Wenn ich könnte, würde ich mehr als das. Ich würde alles rückgängig machen. Selbst gehen, bevor sie Eri holten. Ich wollte leben, natürlich wollte ich das. Aber nicht so. Nicht anstelle von Eri oder ohne Riku. Als Einzige, die zurückblieb.
Ein dumpfes Geräusch über mir ließ mich zusammenzucken.
Der Kamikiri.
Ich schoss hoch, ignorierte das Yōkai-Handbuch Shūgaishō, das nach wie vor auf dem Boden lag, und trat an meinen Schreibtisch. Noch war die Sonne nicht untergegangen, seine Zeit noch nicht gekommen.
Mein Gesicht spiegelte sich blass in der Scheibe meines Fensters, und selbst durch die schemenhaften Linien sah ich, wie rot die Haut um meine Augen war. Wie geschwollen meine Lider. Aber etwas in meinem Blick kam mir anders vor. Ernster. Härter.
Meine langen Haare hingen in einem losen Zopf meinen Rücken hinunter und erinnerten kaum noch an die Frisur, die ich zur Zeremonie getragen hatte. Entschlossen versenkte ich meine Finger darin und packte meine Schere.
Mein Spiegelbild starrte mich wütend an, während ich die Haare Stück für Stück knapp über dem Haarband abschnitt. Ich sah mehr, als ich fühlte, wie die Tränen über meine Wangen liefen. Für Riku, für Eri. Und für meine Eltern, die ihre jüngste Tochter verloren hatten.
Als ich fertig war, färbte sich der Himmel vor meinem Fenster bereits rot und meine Tränen waren getrocknet. Ich hatte genug getrauert, genug geheult.
Es war an der Zeit, etwas zu tun.
Mit meinen Fingern fest um den abgeschnittenen Haarzopf geschlossen, öffnete ich mein Fenster. Eine kühle Brise wehte durch meine nun deutlich kürzeren Strähnen, die sich ungewohnt leicht anfühlten und mich am Ohrläppchen kitzelten. Ich presste meine Lippen aufeinander.
Es war eine dumme Idee. Beinahe alle Mythen und Legenden erzählten wieso. Erst vor ein paar Wochen war eine Rede der Yōban im Fernsehen ausgestrahlt worden, die vor solchen Einfällen und den tödlichen Folgen gewarnt hatten. Nur besagten dieselben Geschichten auch, dass man den Yōkai nicht entkommen konnte, und irgendwie war ich genau das. Trotzdem schnappte ich mir mit der freien Hand die Nagelpistole, mit der ich vor Wochen meinen Schreibtisch repariert hatte, und steckte sie in meinen Hosenbund. Ich hatte Schwierigkeiten, über meinen Schreibtisch hinauszuklettern, ohne ein Büschel zu verlieren. Doch ich brauchte sie alle.
Behutsam setzte ich einen Fuß auf das Vordach. Erst gestern hatte ich hier gesessen und auf mein Verschwinden gewartet, aber es fühlte sich an wie ein Jahrzehnt. Meine Schritte waren vorsichtiger, unsicherer. Auch weil ich fürchtete, der Wind würde mir die Haare aus den Fingern wehen.
Es war nicht gerade einfach, mit nur einer freien Hand auf das Dach zu klettern. Ächzend spannte ich meine Bauchmuskeln an, stemmte meine Beine gegen die Hausfassade und zog mich hoch. Es war sicher kein eleganter Anblick, aber wen kümmerte das schon?
Die Dachschindeln knirschten unter meinen Füßen, als ich mich aufrichtete. Ich hatte keine Ahnung, wie stabil sie waren. Ich zwang mich allerdings, nicht darüber nachzudenken, nicht stehen zu bleiben.
Ich wusste nicht genau, wo im Dachstuhl der Kamikiri lebte. Es musste knapp außerhalb des Bannzaubers über meinem Zimmer sein, sonst würde ich ihn nicht so häufig hören. Ich ließ meinen Blick über die Dachziegel schweifen. Erst schienen sie genauso ebenmäßig und perfekt wie die Dächer in der Umgebung. Dunkle geschwungene Schindeln, die ein Wellenmuster ergaben. Doch da, nur wenige Schritte von mir entfernt, befand sich ein Loch. Kein großes. Es sah fast so aus, als hätte jemand den Abstand zwischen den Dachschindeln erweitert, sodass man sich zwar durchzwängen konnte, es jedoch nicht hineinregnete. Langsam kroch ich näher und lauschte. Die Dunkelheit hinter dem Loch blieb still.
Eine Sekunde lang starrte ich unschlüssig auf meine abgeschnittenen Haare. Kamikiri waren ungefährlich. Sie schnitten einem vielleicht eine schräge Frisur, aber sie zogen einem nicht die Haut ab und tricksten auch keine Menschen aus. Dennoch schluckte ich, bevor ich mit meiner leeren Hand in das Loch hineingriff. Immerhin war es trotz allem ein Yōkai.
Erst fühlte ich nichts außer Kies und Dreck. Ich konnte nichts erkennen, und es war weiterhin nichts zu hören. War der Kamikiri vielleicht doch schon losgezogen, wohin auch immer er nachts ging? Hatte ich mich geirrt? Dann spürte ich plötzlich etwas, und eine Gänsehaut kroch langsam meine Arme hoch.
Das Etwas in meiner Hand war kalt wie das Dach selbst und fühlte sich an wie fest zusammengeflochtene Haare, die heftig pulsierten. Der Impuls, sofort wieder loszulassen, zuckte durch meine Finger, doch ich presste meine Kiefer zusammen und zog an.
Der Yōkai stieß Laute aus, die ich noch nie zuvor gehört hatte, als ich ihn aus seinem Loch zerrte. Das kleine, kaum kniehohe Wesen hatte Scheren anstelle von Händen und dunkle Haut, von deren spürbarer Haarstruktur nichts zu erkennen war. Sein rundes Gesicht hatte etwas von einer Krähe, deren langer Schnabel geschärft worden war, und kurze, federartige Haarbüschel wuchsen aus seinem Hinterkopf. Mit großen gelben Augen starrte er mir wütend entgegen.
»Wer wagt es …?« Die Stimme des Kamikiri war erstaunlich tief, brach allerdings immer mal wieder nach oben aus, als würde er versuchen zu verstecken, wie schrill sie eigentlich war.
»Ich würde Ihnen gern einen Handel vorschlagen«, stieß ich in höflichem Japanisch aus und unterdrückte den Impuls, mich zum Gruß zu verbeugen.
»Wir verhandeln nicht mit Menschen«, fauchte der Kamikiri und schlug gleichzeitig mit seiner Scherenhand nach mir. Meine Finger, die den Yōkai umklammert hielten, rutschten etwas ab, doch ich verzog keine Miene. Mit wir musste er Kamikiri meinen, denn es gab viele bekannte Yōkai, die Handel eingegangen waren. Und nur wenige Menschen hatten das überlebt.
»Ich hab Haare!« Ich versuchte zu ignorieren, wie absurd das klang, während ich ihm meinen abgeschnittenen Haarzopf zeigte.
Der Kamikiri hielt in der Bewegung inne. Seine ohnehin schon riesigen Augen weiteten sich, und ich hörte, wie er tief einatmete. »Frisch geschnitten. Lang, naturbelassen, kaum Spliss.«
Er klang wie ein Weinkenner, der den Geschmack des Weines analysieren wollte, dem allerdings im Grunde egal war, welcher es war. Er wollte den Wein, oder wie in dem Fall, die Haare.
»Was willst du dafür?« Sein Blick lag so plötzlich wieder auf mir, dass ich beinahe zurückgewichen wäre. In seinem Schnabel blitzten rasiermesserscharfe Zähne, während er meine kantige Kurzhaarfrisur musterte. »Wir können nur Haare schneiden.«
»Antworten«, sagte ich mit fester Stimme.
Ungläubig blinzelte er mir mit seinen gierigen Augen entgegen. »Antworten? Damit können selbst Kamikiri dienen. Gib mir die Haare!« Im Gegensatz zu den Sätzen davor zeigte er sogar auf sich, als er nach den Haaren verlangte. Als wäre das Wissen zwischen ihnen geteilt, jedoch nicht ihr Essen. Wahrscheinlich hätte ich mehr von ihm verlangen können. Doch es gab nichts, womit mir ein Kamikiri sonst helfen konnte.
Ich hielt den Yōkai ein Stück höher, sodass ich ihm direkt in seine riesigen Augen starren konnte, ohne dass er mich mit seinen Scherenhänden erreichte. »Was passiert mit den Erstgeborenen?«
Der Kamikiri begann erneut zu zappeln und streckte sich nach meinem abgeschnittenen Haarzopf. »Niemand kann sie befreien! Gib mir lieber die Haare!«
Ich schüttelte den Yōkai. Als ob ich nicht wüsste, dass … Moment. Er hatte befreien gesagt. Nicht zurückholen oder retten. Befreien. Das hieß, weder Eri noch Riku waren tot. Noch nicht.
»Wo wurden sie hingebracht?«, fragte ich und hielt den Zopf noch weiter von ihm weg.
»Wir wissen das nicht, aber niemand kann sie befreien. Gib. Mir. Die. Haare!«
»Wenn du nicht antwortest, bekommst du keine Haare!«
»Nein«, kreischte der Kamikiri und zappelte nun so heftig, dass meine Finger begannen abzurutschen. »Alles, was wir wissen, ist, dass Erstgeborene geholt werden. Nichts Genaues, ich will nur Haare. Gib sie mir!«
»Solange du nichts verrätst, bekommst du keine Haare!«
»Selbst wenn wir es wüssten, man kann sie nicht befreien«, wiederholte der Yōkai keifend und fixierte mich wütend. Sein Blick wanderte dabei immer wieder zu meinem Haarzopf.
»Aber …«, stieß ich frustriert aus und merkte, wie sich eine Schwere über meine Schultern legte, die mich kleinlaut werden ließ. »Es ist ein Fehler passiert.«
»Daiyōkai machen keine Fehler.« Die Stimme des Kamikiri war plötzlich fest, beinahe mitfühlend.
Ich erstarrte und merkte, wie mich die Kraft in meinen Fingern verließ. Das konnte nicht sein!
Der Kamikiri fiel mir mit einem Rums aus der Hand und ich hörte ihn schimpfen, doch es kam mir so weit entfernt vor. Die abgeschnittenen Haarsträhnen glitten durch meine Finger. Ich hielt sie nicht zurück. Er musste sich irren; was er da sagte, konnte unmöglich die Wahrheit sein. Und trotzdem hallten die Worte durch meinen Kopf, immer und immer wieder.
Es kümmerte mich nicht mehr, dass die Sonne bereits unterging, dass ich nichts bei mir trug außer einer Nagelpistole. Nicht einmal Schuhe. Wie in Trance kletterte ich zurück aufs Vordach, von dort weiter das Haus hinunter, und lief los. Ich sah nicht, wohin ich rannte, spürte den Asphalt unter meinen Füßen kaum. Wollte nur weg, weg von dem Kamikiri, meinen Eltern und meinem Zimmer, das sich so seltsam leer anfühlte.
Daiyōkai machen keine Fehler.
Die Daiyōkai waren die ranghöchsten Yōkai, die stärksten ihrer Art. Und nicht nur hatten sie meine Schwester entführt, sie hatten nie vorgehabt, mich zu holen. Sie wollten immer Eri. Es war immer nur um Eri gegangen. Aber … das konnte nicht sein. Oder?
Das Mädchen und das Biest
Als ich keuchend stehen blieb, leuchteten über mir bereits die Sterne. Ich kannte das Viereck vor mir, auf dem sich tagsüber ein Spielplatz befand. Es war derselbe, auf dem ich das Foto von Eri gemacht hatte, das sie so sehr gehasst hatte.
Ich schüttelte mich. Hier wollte ich nicht bleiben. Wollte nicht daran erinnert werden, was ich verloren hatte. Energisch setzte ich mich wieder in Bewegung. Blau leuchtende Steinfackeln erhellten die Straßen, durch die ich ging. Ich sollte umkehren. Das wusste ich. Aber ich konnte einfach nicht. Zuhause gab es diese Leere, das Fehlen von Eri. Hier gab es nur mich. Obwohl mich immer wieder das Gefühl beschlich, dass mich jemand aufhalten müsste. Ein Yōban, der mich daran erinnerte, dass ich in einem modernen Haus hinter Bannzaubern sein sollte. Nicht hier in einer Straße, die aussah wie aus einem historischen Drama. Oder ein Yōkai vom Rang des Kamikiri, der mir erklärte, dass ich hier nicht überleben konnte.
Ein schlabberndes Geräusch ließ mich herumfahren. An einer der Fackeln, nur wenige Meter von mir entfernt, hing eine kleine Gestalt, die Zunge tief in dem blauen Feuer. Einzelne Haare standen von dem viel zu großen Kopf ab und der nackte Bauch wurde von mehreren Speckringen umrundet. Gierig schlabberte das Abura-Akago die dunkle Flüssigkeit, sodass sie bereits seitlich wieder aus dessen Mund rann. Das Geräusch hatte etwas von einem grunzenden Schwein und einem trinkenden Hund zugleich.
Erst jetzt wurde mir klar, dass die altertümlichen Lampen mit Öl betrieben wurden.
Die Kreatur, die Ähnlichkeiten mit einem hässlichen Baby hatte, drehte sich gemächlich zu mir um, die Zunge immer noch im Feuer. Unwillkürlich zuckte meine Hand zur Nagelpistole. Das Wesen grunzte allerdings bloß, bevor es sich erneut seiner Lampe zuwandte.
Diese Yōkai waren häufig bei Öllampen zu finden und leckten das Öl heraus, was nervig, jedoch nicht gefährlich war. Für Menschen interessierten sie sich nicht.
Langsam setzte ich mich wieder in Bewegung. Die Kiesel unter meinen Füßen stachen bei jedem Schritt durch meine Socken, und der kühle Wind, der durch die Kirschbäume am Straßenrand fuhr, ließ mich frösteln.
Ein tiefes Ächzen ließ mich erneut zusammenzucken. Der Boden unter mir schien zu beben, und ein Schauer rann meinen Rücken hinab. Was auch immer es war, es war nah. Ganz langsam drehte ich mich um und schnappte nach Luft.
Da, wo die Straße endete und eine Wiese begann, hatte sich ein Berg von einer Gestalt erhoben. Seine breiten Schultern glänzten im Mondlicht, als wären sie metallbeschlagen, und in seinen riesigen Pranken hielt er einen gigantischen, kantigen Knüppel mit spitzen Stacheln. Dicke Haarbüschel ragten von seinem Kopf nach oben, die an den Schläfen von geweihartigen Hörnern unterbrochen wurden. Selbst von hier konnte ich lange Stoßzähne aus seinem Maul hervorstehen sehen.
Ich wollte wegrennen, aber meine Füße waren wie festgefroren.
Noch nie zuvor hatte ich einen Yōkai aus nächster Nähe gesehen, und heute waren es sogar drei. Nur würde sich dieser hier nicht mit meinen Haaren zufriedengeben. Blut-Oni hießen nicht ohne Grund so.
Ein tiefes Rumpeln lag in der Luft wie Donner in der Ferne. Erst ein paar Sekunden später wurde mir klar, dass der Yōkai schnupperte. Kalter Angstschweiß rann mir den Rücken hinunter, als ich sah, wie er mich mit seinem Blick fixierte. Ich griff erneut nach der Nagelpistole an meinem Hosenbund. Sie kam mir lächerlich im Vergleich zu der Kreatur vor, doch sie war alles, was ich hatte.
Der Oni stürzte vor, und ich wusste, dass weglaufen sinnlos war. Dieser Yōkai bewegte sich trotz seiner Größe irrsinnig schnell. Ein gezielter Schuss in eines seiner Augen würde ihn sicher nicht töten, vielleicht konnte ich ihn damit jedoch ablenken. Entkommen, während er vor Schmerz aufjaulte.
Du beherrschst die Technik, aber dein Timing ist furchtbar, hatte Riku mal zu mir gesagt. Du setzt zu früh an. Warte ein bisschen länger und schlag erst dann zu.
Ich war mir nicht sicher, wie gut sich dieser Moment mit dem Oni mit einem Jōdō-Wettkampf vergleichen ließ, doch ich zog meine behelfsmäßige Waffe.
Die Fackeln am Straßenrand färbten die rote Haut des Oni violett und sein goldener Schmuck um die Hüfte blitzte auf. Grunzende Atemlaute dröhnten in meinen Ohren und meine Knie wurden weich.
Ich würde nicht treffen.
Langsam hob ich die Nagelpistole.
Ich musste treffen.
Der Oni schwang seinen Knüppel, einen Kanabō, wie mir plötzlich einfiel, während ich versuchte, eines seiner Augen, direkt neben seiner Nase über seinem weit aufgerissenen Maul, anzuvisieren. In meinem Kopf zählte ich seine Schritte, schätzte die Distanz ab, so wie es unser Sensei uns beigebracht hatte. Nur war meine Waffe kein Jō und ich hatte noch nie auf etwas schießen müssen.
Meine Hände zitterten, aber ich zwang mich, sie ruhig zu halten. Ich drückte ab.
Das mechanische Geräusch der Nagelpistole hallte in meinen Ohren wie eine Explosion wider. Wie in Zeitlupe sah ich den Nagel den letzten Meter auf den Yōkai zuschießen. Dann traf der Metallstift sein Ziel und … prallte ab. Es kam mir beinahe vor, als würde ich ein leises Bling hören. Der Oni schien davon nichts zu merken. Die Spitze des Nagels hatte seine Netzhaut nicht einmal ansatzweise durchbohrt.
Mit einem Schrei holte der Yōkai aus und sprang auf mich zu. Sein Kanabō sauste zischend durch die Luft, und ich warf mich zur Seite. Krachend schlug der Knüppel da ein, wo ich eben noch gestanden hatte, und hinterließ einen Krater im Boden. Ein spitzer Schrei hallte über die Dächer der Stadt hinweg. Das Biest fuhr herum, und der Schrei verstummte, als ich merkte, dass ich es war, die schrie. Mit seinen kleinen gelblichen Augen starrte er mich an, als wäre er verwirrt darüber, dass er mich nicht erwischt hatte. Dann schüttelte er sich und holte erneut aus.
»Beweglich«, hörte ich ihn grummeln.
Erneut hob ich meine Nagelpistole und drückte ab. Diesmal sah ich nicht einmal, wo der Metallstift hinflog. Bloß das leise Bling war zu hören, während der Knüppel wieder auf mich zukam. Wie beim Training warf ich mich zurück und machte eine Rückwärtsrolle, um Abstand zwischen uns zu bringen. Der Luftzug seiner Waffe brachte mich jedoch aus der Bahn, und ich landete mit den Knien unsanft auf dem steinernen Untergrund.
Ein stechender Schmerz durchzuckte meinen Arm. Ein langer, glänzender Nagel steckte darin. Er musste sich aus der Nagelpistole gelöst haben. Tränen schossen mir in die Augen und meine Sicht verschwamm. Ich würde diesen Kampf nicht gewinnen, doch weglaufen konnte ich auch nicht.
Der Schemen des Yōkai vor mir holte aus und ich versuchte mich wegzurollen. Aber mein verletzter Arm gab unter mir nach. Ohne etwas durch meinen Tränenschleier zu sehen, warf ich mich zur Seite, den Luftzug von seinem Kanabō bereits im Nacken.
Nur haarscharf verfehlten mich die Stacheln des Knüppels, der sich in den Boden neben mir grub. Doch bei dem Versuch, mich aufzurappeln, wurde ich wieder nach unten gezogen. Meine Kleidung hatte sich unter der schweren Waffe verfangen. Speichel tropfte auf mich hinunter, während der Oni sich mit glühenden Augen über mich beugte, seine dunklen Klauen nach mir ausgestreckt.
»Nicht so schnell«, rief plötzlich eine Stimme, und Metall blitzte vor mir im Mondlicht. Schwarzes Blut platschte auf den Boden, und der Yōkai riss brüllend seinen Arm zurück.
Wie aus dem Nichts tauchte vor mir ein Junge auf. In seinen Händen hielt er ein langes, leicht gebogenes Schwert, das im Mondlicht rötlich schimmerte. Als wäre immer noch Akatsuki, obwohl die Dämonendämmerung letzte Nacht vorübergegangen war. Seine dunklen Gewänder wirkten mitgenommen, zerrissen und seine Haare waren zerzaust, aber er lächelte.
Der Oni sog rasselnd die Luft ein und legte den Kopf schief, fast so, als würde er nachdenken. »Mensch …?«
Dann verschwand plötzlich der Zug an meiner Kleidung, als er seinen Kanabō erneut hochriss. Er beachtete mich nicht mehr, fixierte nur noch den Jungen. Mit einem Schrei schwang der Yōkai seinen Knüppel nach ihm. Doch der blockte die wuchtige Waffe inmitten der Bewegung. Ein heftiger Windstoß wehte durch meine Haare, und ein metallisches Klirren hallte in meinen Ohren wider.
Nach allem, was ich wusste, müsste das Katana des Jungen nachgeben. Aber sein Schwert hielt dem Druck stand. Mit einer Kraft, von der ich nicht wusste, woher er sie nahm, stieß der Junge den Oni zurück. Der Yōkai brüllte auf eine Art, die Schauer über meinen Rücken jagte, und holte taumelnd erneut aus.
Ich wusste, ich sollte laufen. Mich umdrehen und wegrennen. Doch ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Der Junge vor mir war kaum älter als ich, hatte jedoch anscheinend keine Angst vor dem Biest. Stattdessen schien das Lächeln auf seinem Gesicht noch breiter geworden zu sein, als er erneut nach vorn trat. Diesmal ließ er den Knüppel an seiner Klinge abgleiten, als wäre der bloß ein dünnes Schwert, entkam so dem Angriff, und mit einer schwungvollen Bewegung durchtrennte er die Achillessehne des Yōkai.
Der Schrei des Oni dröhnte durch meine Ohren, während er in die Knie ging. Mit flatternden Gewändern sprang der Junge hoch, sein Schwert blitzte noch einmal rot auf, dann schnitt er dem Wesen den Kopf ab. Dumpf schlug dieser mit dem Gesicht voran auf dem Boden auf und rollte in meine Richtung. Seine gelben Augen starrten mich immer noch finster an, als er zum Stehen kam.
Der Junge packte den Kopf an seinen Haaren und besah ihn sich, als würde er nach etwas suchen. Doch nach ein paar Sekunden warf er ihn in die Wiese neben der Straße und wandte sich zum Gehen. Das Lächeln auf seinem Gesicht war verschwunden.
»Oi«, rief ich, selbst davon überrascht, wie fest meine Stimme dabei klang.
Der Junge hielt mitten in der Bewegung inne und drehte sich nach mir um. Er musterte mich einen Moment, die Stirn etwas in Falten gelegt, als hätte er vergessen, dass ich hier gewesen war.
»Wie hast du …?« Ich verstummte, als sich unsere Blicke trafen. Er war der Junge von der Zeremonie. Der, der mich so angestarrt hatte.
Er zog eine Augenbraue hoch. »Den Oni besiegt?«
»Ja.« Man konnte Yōkai bannen, aber töten? »Das ist unmöglich.«
»Damit auf jeden Fall«, sagte er mit einem mitleidigen Blick auf die Nagelpistole in meiner Hand. »Nur ein Yōkai kann einen Yōkai besiegen.«
Das rote Blitzen seiner Klinge tauchte vor meinem geistigen Auge auf. »Also ist dein Schwert …?«
»Es hat die Kraft eines Yōkai. Wäre es einer, wäre ich schon längst tot.«
»Wo hast du das her?«
»Ganz schön viele Fragen«, murmelte er leise. »Wenn ich es dir sage, verrätst du mir dann auch dein Geheimnis?« Einen Moment lang musterte er mich mit seinen dunklen Augen, suchte nach Antworten. Doch ich presste meine Lippen zusammen.
Seufzend zuckte er mit den Schultern und wandte sich erneut von mir ab. »Wenn du das nächste Mal gegen einen Yōkai kämpfen willst, zieh dir zumindest Schuhe an.« Dann verschwand er genauso schnell, wie er aufgetaucht war.
Ich sah auf meine Füße hinunter. Er hatte recht. Zumindest das hätte ich tun sollen. Selbst wenn ich nicht hatte kämpfen wollen, es war unheimlich leichtsinnig, mich so in die Nacht hinaus zu begeben.
Ein sanftes Klingeln aus dem Körper des geköpften Oni ließ mich zusammenfahren. Angsterfüllt starrte ich ihn an. Beinahe erwartete ich, dass er sich selbst kopflos auf mich stürzen würde. Doch stattdessen sah ich nur ein Leuchten am Lendenschurz des Yōkai. Ich wandte mich ruckartig ab. In dieser Nacht war genug passiert, um noch an der Leiche einer Kreatur herumzuwühlen, die mich beinahe getötet hatte. Aber das Klingeln wurde lauter, eindringlicher, und es kam mir so vor, als würde das Licht ebenfalls stärker werden.
Langsam schlich ich mich näher, den Griff fest um die Nagelpistole. Egal wie nutzlos sie war, sie war das Einzige, was ich hatte. Meine Zehen krümmten sich in den Socken, als ich vorsichtig gegen den Leichnam trat. Der massive Körper rührte sich nicht. Der Oni war immer noch tot.
Ich beugte mich vor und betrachtete das Leuchten. Es sah aus wie ein kleiner Ball aus weiß glühenden Flammen, festgebunden an einem der Gürtel des Oni. Das Bedürfnis, der Kugel zu helfen, schwoll in meiner Brust. Meine Hand streckte sich beinahe wie von selbst, als ich die Leuchtkugel losband. Sie fühlte sich warm an, weich und gleichzeitig glatt wie Glas. Irgendwie war ich erleichtert, als ich sie abtastete. Sie war unversehrt. Auch wenn ich nicht wusste, wie eine Leuchtkugel beschädigt sein konnte.
Der Wald. Ich musste in den Wald.
Ein Kreischen ließ mich erneut zusammenzucken, und ich stürmte los. Meine Füße brannten bei jedem Schritt, und ich spürte ein Stechen in der Seite, während ich schnappend Luft holte. Es war schon lange her, dass ich Seitenstechen bekommen hatte, aber ich konnte mich nicht dazu bringen, normal zu atmen. Tränen, von denen ich selbst nicht wusste, woher sie kamen, rannen mir über die Wangen, doch ich wischte sie nicht weg. Meine Hände waren zu Fäusten geballt. Ich wollte nur eines, nach Hause.
Zum Wald. Dahin, wo die berühmten tausend Torii des Fushimi Inari-Schreins standen.
Ich blieb abrupt stehen. Nur wenige Laternen leuchteten auf dem Pfad vor mir. Wind kam auf und raschelte in den Ästen der wuchernden Büsche am Wegesrand. Kaum Häuser waren noch zu sehen. Ich kannte diese Straße, nur führte sie nicht zu mir nach Hause. Sie führte in den Wald des Fushimi Inari-Schreins. In den Wald, der mit seinen roten Toren normalerweise Touristen anzog, nachts jedoch voller Yōkai war.
Stirnrunzelnd machte ich kehrt und rannte weiter. Der Wind wurde kälter und ließ mich in meiner viel zu dünnen Kleidung frieren. Die Fackeln nahmen zu und wieder ab. Meine Muskeln protestierten, und ich geriet ins Straucheln, als die asphaltierte Straße in eine Art Trampelpfad überging. War ich wirklich so weit von zuhause weg? Ich hatte nicht auf meine Schritte geachtet.
Erneut blieb ich stehen. Wieder befand ich mich auf einem Weg, diesmal mit Treppen, der zum Wald führte. Hatte ich mich gerade in meiner eigenen Stadt verlaufen?
Grummelnd rannte ich zurück und ignorierte das Stechen in meiner Seite. Es war diesmal nicht mehr weit. Da vorne war der alte, vermoderte Laden, der tagsüber ein Convenience Store war. Doch als ich daran vorbeilaufen wollte, stolperten meine Füße und beinahe wäre ich gefallen. Erneut setzte ich mich in Bewegung, um endlich nach Hause, in den Wald zu gehen. Meine Beine überkreuzten sich, und diesmal fiel ich wirklich. Wie im Training rollte ich mich ab und schoss wieder hoch.
Schwer atmend stand ich da und starrte auf das Ende der Straße. Es war, als würde die eine Hälfte von mir nach Hause wollen, die andere allerdings in den Wald. War ich verflucht? Verzaubert? Hatte mich der Junge doch nicht gerettet, sondern zu einem Leben im Wald verdammt? Das ergab doch gar keinen Sinn. Oder?
Was hatte der Fremde davon, wenn ich zu den Torii ging? Wartete dort bereits ein besonders hungriger Yōkai auf mich? Was, wenn ich nie wieder nach Hause zurückkehren konnte? Meine Eltern beide Töchter verloren, weil ich einfach losgelaufen war?





























