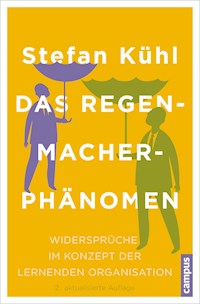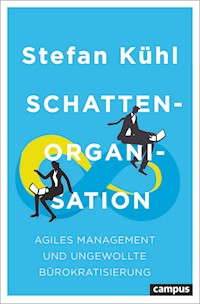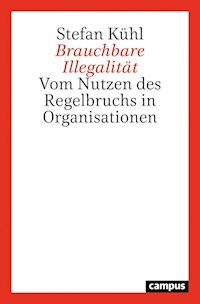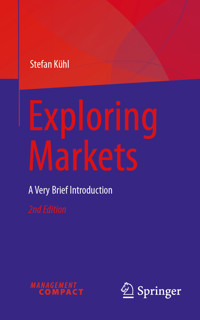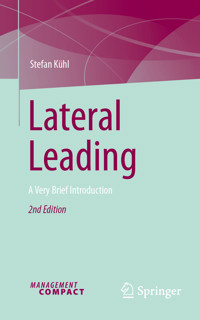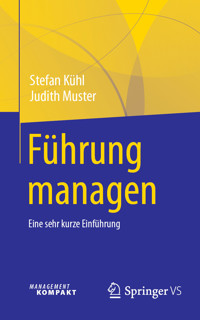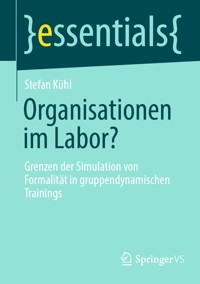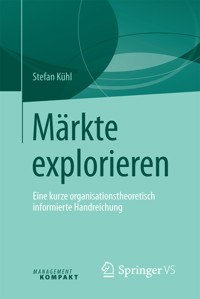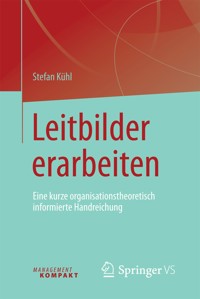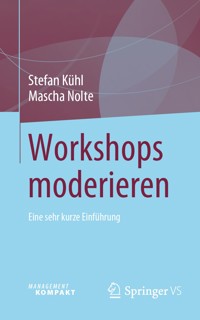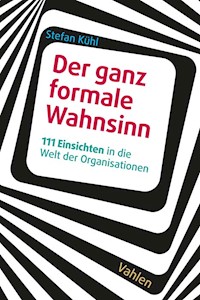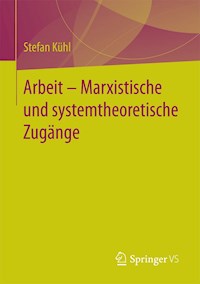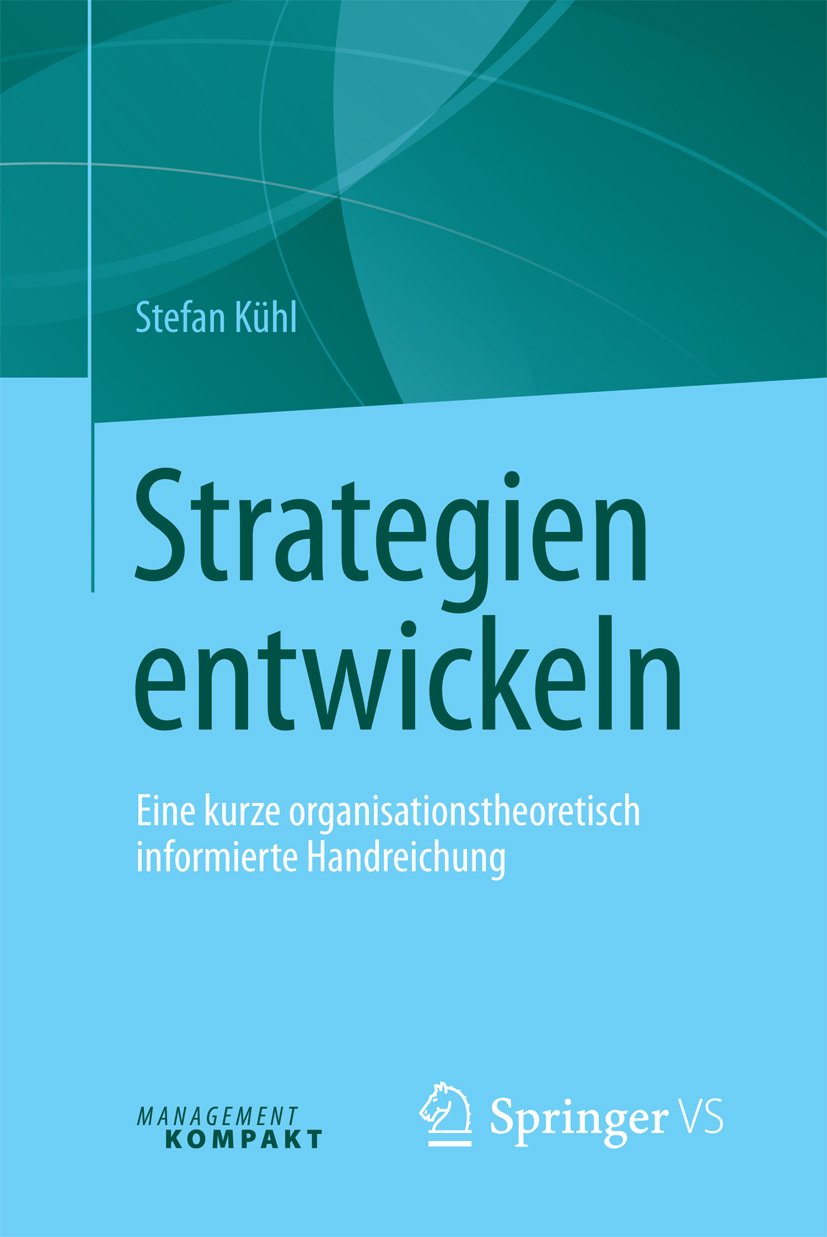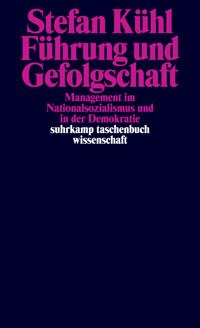
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Moderne Managementkonzepte zeigen überraschende Parallelen zu nationalsozialistischen Vorstellungen. In seinem neuen Buch argumentiert Stefan Kühl, dass diese Ähnlichkeiten nicht auf personalen Kontinuitäten vom NS-Staat zur Bundesrepublik beruhen. Gerade prominente Nationalsozialisten, die den Führungsdiskurs in der Nachkriegszeit prägten, mussten darauf achten, nicht mit der NS-Ideologie in Verbindung gebracht zu werden. Heutige Verfechter einer sinnstiftenden Zweckausrichtung, starken Gemeinschaft und transformationalen Führung haben keine Sympathien für die Idee einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft. Aber sie ignorieren die Wurzeln zentraler Managementprinzipien und übersehen, wie stark sie Konzepte propagieren, die bereits von Nationalsozialisten vertreten wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Stefan Kühl
Führung und Gefolgschaft
Management im Nationalsozialismus und in der Demokratie
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2469
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78263-7
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
1. Einleitung – Management zwischen Kontinuitäten und Brüchen
Über inhaltliche und personelle Kontinuitäten
Über die Faszination eines weitgehend vergessenen Managementmodells
Zweifel an der Kontinuitätserzählung
Zu unterschiedlichen Bauarten von Managementkonzepten
Zur Zielsetzung einer Analyse von Führungsdiskursen
Vom
NS
-Staat bis heute – Übersicht über den Argumentationsgang
2. Gemeinschaft als Organisationsmodell – zum nationalsozialistischen Verständnis von Führung
2.1 Die nationalsozialistische Ideologie der Volksgemeinschaft
Die Volksgemeinschaft als Rassegemeinschaft
Vorstellungen einer völkischen Großraumordnung
2.2 Die Volksgemeinschaft im Kleinen – zur Umsetzung der Volksgemeinschaft in Organisationen
Zur Kristallisation von Gemeinschaft in Organisationen
Die Idealisierung der Arbeit als Basis der Gemeinschaftsbildung
Die Bedeutung der informalen Erwartungsbildung im Gemeinschaftskonzept
2.3 Zum Zusammenhang von Gemeinschaft und Führung
Zur nationalsozialistischen Konzeption von Führung
Führung als Dienst an der Gemeinschaft
Zur Bedeutung von Hierarchie in der nationalsozialistischen Führungskonzeption
3. Zur Bauart eines Managementkonzepts – Die Wiederentdeckung der Formalstruktur
3.1 Die Führung über Ziele durch die Delegation der Handlungsverantwortung
Die freie Mittelwahl im Rahmen vorgegebener Ziele
Die Steuerung von Organisationen über Zweckprogramme
3.2 Die Wiederentdeckung der Hierarchie in der Nachkriegszeit
Die Führungsverantwortung der Vorgesetzten
Die Absicherung der Führungsansprüche in der Hierarchie
3.3 Sicherstellung der Formalität durch Stellenbeschreibungen
Die Bedeutung einer präzisen Stellenbeschreibung
Die Anerkennung der organisationalen Hierarchie als Mitgliedschaftsbedingung
3.4 Der Prototyp eines auf Formalität basierenden Organisationsmodells
4. Dramaturgische Kontinuitäten und inhaltliche Brüche – zur Machart eines Managementkonzepts
4.1 Die autoritäre Führung in Abgrenzung zum kooperativen Führungsmodell
Die Abgrenzung gegenüber autoritärer Führung in der
NS
-Zeit
Die Übernahme des Fortschrittsmodells in der Nachkriegszeit
Der autoritäre Managementstil als allgemein akzeptierte Kontrastfolie
4.2 Die historische Herleitung eines Managementprinzips
Die militärhistorischen Referenzen in der
NS
-Zeit
Die Reaktivierung eines militärhistorischen Referenzpunktes
Die preußischen Militärreformer als allgemein akzeptierter Referenzpunkt
4.3 Harmonie als Referenzpunkt eines Führungsmodells
Die Volksgemeinschaft als harmonische Sozialgemeinschaft
Die Vorstellung partnerschaftlicher Organisationsmodelle
Über die Kritik zur Rechtfertigung des Kapitalismus
4.4 Die gesellschaftliche Verankerung eines Führungskonzeptes
Die Propagierung des nationalsozialistischen Staatsverständnisses
Ein Führungsmodell zur Förderung der Demokratie
Die Wendung der staatstheoretischen Perspektive
4.5 Über den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit
5. Über die überraschende Ähnlichkeit zweier Managementkonzepte
5.1 Der gleiche Grundgedanke zweier Managementdenker
Die Popularisierung einer Idee zur Steuerung von Organisationen
Das zweckrationale Organisationsmodell
5.2 Die unterschiedlichen Bedeutungen formaler Erwartungen
Neugierige Bricolage versus systematische Integration
»Management by«-Konzepte versus ganzheitliches Management
5.3 Die unterschiedlichen Einstellungen zum Konzept der Gemeinschaft
Die Propagierung von Gemeinschaftsvorstellungen bei Peter Drucker
Das unterschiedliche Verständnis von Führung
5.4 Zur unterschiedlichen Einschätzung zweier Managementkonzepte
6. Das Verpassen der Renaissance der Gemeinschaftsidee – persönliche Verstrickungen als Lernverhinderungsmechanismus
6.1 Die Wiederkehr des Gemeinschaftsgedankens in der Debatte über die Organisationskultur
Die Grundlagen des Konzepts der Organisationskultur
Die Renaissance gemeinschaftlich orientierter Führungskonzepte
Die Einordnung des Konzeptes der Organisationskultur
6.2 Der verpasste Anschluss an die Debatte über Organisationskultur
Die Skepsis gegenüber Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsklimas
Sachorientierung statt Personenorientierung
6.3 Die Kritik an Überbürokratisierung, Hyperformalisierung und Ressortdenken
Die Ansatzpunkte für eine Kritik des Harzburger Modells
Die Vernachlässigung organisationskultureller Komponenten
Einordnung der Kritik am Harzburger Modell
6.4 Die Verdrängungsfalle – die Gefahr einer systematischen Verdrängung
7. Wie man aus Nationalsozialisten Demokraten macht
7.1 Von der Verklärung der Informalität zur Hoffnung auf Formalität
Vom Modell der Informalität zu dem der Formalität
Der überraschende Wechsel im grundlegenden Aufbau einer Konzeption
7.2 Aufweichung von Konsistenzzwängen in der Selbstdarstellung
Die Anforderung an die Selbstdarstellung in der Sachdimension
Möglichkeiten der Publikumssegregation in der Sozialdimension
Die Selbstdarstellung in der Zeitdimension
7.3 Die Funktion eines Beschweigens der Vergangenheit
Der Triumph einer beschwiegenen Vergangenheit und seine Funktion
Die Erwartung der Enthaltung von jeder nationalsozialistischen Sympathiebekundung
Zum Kipppunkt einer Nützlichkeit des Beschweigens
8. Die Renaissance aus überraschenden Richtungen
Anhang
Zum soziologischen Zugang und zur empirischen Basis
Bücher, Artikel und Beiträge
Gesetze und Verordnungen
Archivmaterialien
Fotografien
Videos
Zeitzeugeninterviews
Archive
Literaturverzeichnis
Sachregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
9
1. Einleitung – Management zwischen Kontinuitäten und Brüchen
Ja, vielleicht verhält es sich sogar so, daß dieser völlige Mangel an Kontakt mit der Nazi-Mentalität es mir zunächst schwer oder unmöglich machte, eben diese Mentalität wirkungsvoll zu bekämpfen. Unser Haß wird wohl nur dort aktiv und militant, wo wir eine gewisse Nähe zum Gegner spüren. Man bekämpft nicht – oder doch nicht mit vollem Einsatz –, was man verachtet. […] Diese Nazis – ich verstand sie nicht. Ihre Journale – »Stürmer«, »Angriff«, »Völkischer Beobachter« oder wie der Unflat sonst noch heißen mochte – hätten ebenso gut in chinesischer Sprache erscheinen können. Ich kapierte kein Wort.[1]
Der Schriftsteller Klaus Mann
Führung spielt in der nationalsozialistischen Ideologie eine zentrale Rolle. Auch wenn Adolf Hitler nie eine konsistente Theorie der Führung vorgelegt hat, wurde doch schon in seinem Mitte der 1920er Jahre entstandenen Buch Mein Kampf deutlich, wie er sich die Führung in der nationalsozialistischen Bewegung – und darüber hinaus in einem nationalsozialistischen Staat – vorstellte.[2] Mit seinem Grundsatz »der unbedingten Führerautorität« brachte Hitler seine Ablehnung des demokratischen Mehrheitsprinzips zum 10Ausdruck, das seiner Meinung nach den Führer »zum Vollstrecker des Willens der Meinung anderer« degradiere.[3]
Bei Führung komme es, so Hitler, zuallererst auf die »Persönlichkeit« an.[4] Diese müsse durch eine »Verbindung von Fähigkeit, Entschlußkraft und Beharrlichkeit« gekennzeichnet sein. Die Überzeugungskraft dieser »Persönlichkeit« drücke sich im »Fanatismus« aus, mit der sich Anhänger ihr unterordnen.[5] Führung heiße, so die Kurzformel, »Masse bewegen können«.[6]
Folglich sei, so Hitler, das erste Fundament von Führung »stets die Popularität« gegenüber der Gefolgschaft. Aber eine Autorität, die nur auf Popularität basiere, sei »schwach, unsicher und schwankend«. Zur Absicherung bedürfe es deswegen eines zweiten Fundaments, der »Bildung von Macht«, die in letzter Konsequenz auch Ausdruck in Gewalt finden könne. Wenn sich Führungsansprüche durch Popularität und Macht über längere Zeit stabilisiert hätten, dann bilde sich »Tradition« als drittes Fundament aus und bewirke, dass die »Autorität als unerschütterlich« betrachtet werde.[7]
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten diente die von Hitler formulierte Vorstellung nicht mehr nur als Leitbild für die Führung der NSDAP, der SA oder der SS, sondern als Orien11tierungsrahmen für alle Organisationen im NS-Staat.[8] Ministerien sollten sich an diesen Führungsprinzipien orientieren, Verwaltungen sich auf diese umstellen, Armee und Polizei sich darauf ausrichten, Universitäten sich entsprechend umstrukturieren und die Unternehmen sich daran halten.[9]
Die Prominenz des Führungskonzeptes in der Selbstbeschreibung des NS-Staats führt zwangsläufig zur Frage, in welcher Form nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes an diese Denkweise angeschlossen wurde. Wie stark hatten sich die nationalsozialistischen Konzeptionen von Führung in den zwölf Jahren des NS-Staates festgesetzt? Wie groß war der Akzeptanzverlust durch die Niederlage im Zweiten Weltkrieg? Wo hat es im Übergang vom NS-Staat zur Bundesrepublik Deutschland Kontinuitäten im Denken über Führung gegeben und wo gab es deutliche Brüche?
Über inhaltliche und personelle Kontinuitäten
Ein zentraler Forschungsstrang zum Nationalsozialismus geht von inhaltlichen Kontinuitäten des NS-Staates zur Bundesrepublik Deutschland aus. In unterschiedlichen Feldern wie der Rechtsprechung, der Familienpolitik, der Gesundheitsfürsorge, der Militärführung und dem Unternehmensmanagement ließen sich, so die These, die Wirkungen der nationalsozialistischen Ideologie bis in die heutige Zeit nachweisen.[10] Die Nationalsozialisten hätten nicht »einfach verloren, sondern in einem wahrhaft unheimlichen Sinn 12viele ihrer Hauptziele durchgesetzt«. Gesiegt hat »in dieser schwarzen Perspektive« letztlich »das NS-System«, weil nicht wenige der nationalsozialistischen Vorstellungen in der Nachkriegszeit in Erfüllung gegangen sind«.[11] »Der Nationalsozialismus«, so das Diktum Theodor W. Adornos, »lebt nach.«[12]
Vertreter der Kontinuitätsthese gehen nicht davon aus, dass die NS-Ideologie einfach bruchlos fortlebte. Sie interessieren sich vor allem dafür, wie diese an die neuen Verhältnisse angepasst und dadurch transformiert wurde. Die NS-Ideologie presse sich, so der Sozialphilosoph Nikolas Lelle, in »entnazifizierte Formen« und könne gerade dadurch bis heute weiterwirken. Trotz dieser Transformationen sehe man sich beim Blick auf den NS-Staat und die Bundesrepublik Deutschland jedoch zwangsläufig mit einer »Wiederkehr des Ähnlichen« konfrontiert.[13] Kurz: Nazis waren auch in der Bundesrepublik Deutschland Nazis – bloß, dass sie ihre Auffassung an die neue staatliche Ordnung anpassten.
Als Fundament für die vielfältigen inhaltlichen Kontinuitätslinien wird die starke personale Kontinuität bei den Funktionseliten vom NS-Staat zur Bundesrepublik Deutschland angesehen. Diese Kontinuitäten sind bereits auf den ersten Blick frappierend. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es nur wenige Jahre gedauert, bis Funktionäre des NS-Staates erneut Schlüsselstellen in Wirtschaft, Politik, Recht, Wissenschaft, Medizin und Massenmedien besetzt hatten.[14] In der frühen Bundesrepublik war in einigen Ministerien und Ver13waltungen der Anteil früherer NSDAP-Mitglieder bereits höher als zu Beginn der 1940er Jahre.[15]
Über die Faszination eines weitgehend vergessenen Managementmodells
Den Vertretern der Kontinuitätsthese dient die nationalsozialistische Vorstellung von Führung als prominenter Beleg für ein anhaltendes nationalsozialistisches Denken in der Bundesrepublik.[16] Die von Hitler entwickelte Vorstellung von Führung habe, so die These, auch nach dem Ende des NS-Staates »fröhliche Urstände« gefeiert und würde unter dem Begriff des Managements bis in die heutige Zeit nachwirken.[17] Mit Blick auf neue Managementkonzepte würde, so der Historiker Johann Chapoutot, ins Auge fallen, wie »modern manche Aspekte des Nationalsozialismus« seien. Zwar hätte es im Nationalsozialismus noch keine »Tischkicker, Yoga-Kurse oder Chief Happiness Officers« gegeben, aber das »Prinzip und der Geist« seien in der Wirtschaft des NS-Staates die gleichen gewesen – »Wohlbefinden, wenn nicht gar Freude als Faktoren der Leistungsfähigkeit und Produktivitätssteigerung«.[18]
Festgemacht wird die These einer Kontinuität des Denkens über Führung oft an einer Person, die in der geschichtswissenschaftli14chen Forschung über den Nationalsozialismus für Jahrzehnte kaum beachtet wurde – Reinhard Höhn.[19] Höhn gehörte zu den zentralen Staatsrechtlern des NS-Staats, war ein Theoretiker der rassistischen Lebensraumpolitik der Nationalsozialisten, spielte als Leiter des Hauptamtes »Lebensgebietsmäßige Auswertung« eine wichtige Rolle beim Aufbau des Sicherheitsdienstes der SS und wurde noch kurz vor Kriegsende zum SS-Oberführer befördert.[20] Trotz dieser Bedeutung für den NS-Staat hat er in der Forschung lange Zeit weniger Aufmerksamkeit bekommen als seine zeitweiligen Vorgesetzten Reinhard Heydrich und Heinrich Himmler.[21]
15Das inzwischen wachsende Interesse der Forschung an Höhn hängt damit zusammen, dass man an seinem Beispiel Brüche und Kontinuitäten von der Weimarer Republik über den NS-Staat bis zur Bundesrepublik Deutschland nachvollziehen kann.[22] Nachdem er in der Weimarer Republik als Schüler im Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund aktiv war und als Student eine steile Karriere im antisemitischen Jungdeutschen Orden gemacht hatte, wurde er nach dem Übergang der Macht auf die Nationalsozialisten zu einer der wichtigsten Figuren in dem von Himmler etablierten Sicherheitsapparat, um nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich zum einflussreichsten Managementvordenker in der frühen Bundesrepublik zu avancieren.[23]
Höhn, der sich schon in der NS-Zeit wiederholt zu Fragen der Führung geäußert hatte, vermarktete in der Nachkriegszeit sein detailliert ausgearbeitetes Konzept unter dem Begriff der »Führung im Mitarbeiterverhältnis«. Dessen Verständnis erschließt sich nicht sofort, weil unklar bleibt, wie die Führung von Vorgesetzten ohne ein Verhältnis zu den Mitarbeitern aussehen soll. Damit drückt 16Höhn jedoch aus, dass in modernen Organisationen keine »Untergebenen«, sondern vielmehr nur noch »Mitarbeiter« existieren sollten. Diese Mitarbeiter seien »Kräfte«, die im Rahmen allgemeiner Richtlinien fähig seien, »selbständig denkend und handelnd« Entscheidungen zu treffen.[24]
Der Einfluss dieses Führungskonzepts in der Nachkriegszeit war enorm. Nach dem Zweiten Weltkrieg schulten Höhn und seine Mitarbeiter über mehrere Jahrzehnte Hunderttausende von Führungskräften und hatten darüber erheblichen Einfluss darauf, wie in der jungen Bundesrepublik über Führung nachgedacht wurde.[25] Fast jede Führungskraft kam irgendwann mit Höhns Konzept in Kontakt, das in Anlehnung an den Sitz seiner Führungsakademie in dem niedersächsischen Kurort Bad Harzburg auch »Harzburger Modell« genannt wurde.
Zweifel an der Kontinuitätserzählung
In der Forschung dominiert die These, dass Höhn die Vorstellungen, die er als Vordenker in Himmlers Reichssicherheitshauptamt und als einer der Chefideologen des NS-Staats entwickelt habe, in seinem Harzburger Modell lediglich an die neuen Sprachregelungen angepasst, aber an zentralen Führungsprinzipien des NS-Staats festgehalten habe.[26] Zwischen »seinen Reden und Schriften vor 171945« und »dem, was er nach 1956 lehrte«, sei, so die verbreitete Auffassung, »keinerlei Bruch zu erkennen«, sondern »vielmehr eine beeindruckende Kontinuität« seiner Ideen.[27] Im Harzburger Modell sei letztlich das »negative NS-Erbe in ›entnazifizierten‹ Formen« erhalten worden.[28] In der radikalsten Form dieser These wird Höhn als »eine Art Josef Mengele des Rechts« präsentiert, der für den NS-Staat juristische Konzepte erdacht habe, »um die Gemeinschaft zu erneuern und Europa neu zu ordnen«. Diese Überlegungen seien dann weitgehend auf das führende Managementkonzept der Bundesrepublik Deutschland übertragen worden.[29]
Auf den ersten Blick klingt diese inhaltliche Kontinuitätserzählung plausibel. Reinhard Höhn nutzte bei der Propagierung seines Managementmodells in der Bundesrepublik Deutschland argumentative Figuren, die er bereits in seinen Schriften in der NS-Zeit verwendete. So gebrauchte er zur Rechtfertigung seines Führungsverständnisses in der Nachkriegszeit historische Vorbilder in Form preußischer Militärreformer. Er nutzte sie als Kontrastfolie zu der 18aus seiner Sicht überholten autoritären Führung des absolutistischen Staats, die er auch schon in der NS-Zeit als für nicht mehr zeitgemäß befunden hatte.
Auf den zweiten Blick fällt jedoch auf, dass Höhn sein Organisationsverständnis und damit auch sein Führungskonzept nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes grundsätzlich umgestellt hat. Im NS-Staat basierte sein Verständnis von Führung auf einem völkisch aufgeladenen Konzept der Gemeinschaft, aus dem sich Führer naturwüchsig herausbilden. Ansprüche auf Führung könnten, so seine Vorstellung, nicht mit Verweis auf eine formale Stellung in einer Organisation gerechtfertigt werden, sondern müssten durch die Akzeptanz der Geführten gewonnen werden. Nach dem Krieg gab er das Konzept einer in der Gemeinschaft verankerten Führung auf und gründete sein Führungsverständnis stattdessen auf die Absicherung von Vorgesetzten in der formalen Struktur der Organisation.[30]
Drei Gründe sind dafür maßgeblich verantwortlich, dass vielen Forschern dieser grundlegende Bruch in seinem Führungsverständnis entgangen ist. Der erste Grund ist, dass besonders Historiker auf eine organisationstheoretische Rekonstruktion der unterschiedlichen Konzepte von Führung verzichten.[31] Zwar werden die Vorstellungen von Führung anhand von Publikationen in der NS-Zeit und in der Nachkriegszeit referiert, sie werden aber nicht mit Hilfe der Organisationstheorie in Bezug auf zentrale Elemente rekonstru19iert.[32] So wird erkannt, dass das zentrale Führen über Ziele schon im Führungsverständnis des Nationalsozialismus zu finden ist, aber die grundlegend unterschiedliche Legitimationsbasis wird übersehen.
Der zweite Grund ist die Vernachlässigung der Erkenntnisse über Entstehung, Diffusion und Niedergang von Managementmoden. Dadurch gibt es eine Tendenz, die Kontinuitäten und Brüche des Führungsverständnisses im NS-Staat und in der Bundesrepublik Deutschland primär aus der Konsistenz und dem Wandel staatlicher Rahmenbedingungen zu erklären. Managementkonzepte wie das Harzburger Modell, die sich allein aufgrund ihrer Erprobung in der Praxis »verbrauchen«, dadurch zunehmend an Legitimität verlieren und letztlich verschwinden, bekommt man ohne die systematischen Überlegungen zu Managementmoden nicht in den Blick. Erst wenn man die Forschung zu Managementmoden genauer betrachtet, kann man differenzieren, worauf die üblichen Halbwertzeiten von Managementkonzepten bei Entstehung, Diffusion und Niedergang zurückzuführen sind und inwiefern sie von Führungskonzepten durch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst werden.[33]
Ein dritter Grund ist die fehlende internationale Perspektive in der historischen Forschung zu nationalsozialistischen Führungsmodellen.[34] Wir wissen relativ gut darüber Bescheid, wie sich Vorstellungen über Führungen in einzelnen Sprachräumen durchgesetzt haben, aber wenig darüber, wie ähnliche Ansätze in verschiedenen Sprachräumen entstanden sind und welche Diffusionsprozesse es über Sprachgrenzen hinweg gegeben hat.[35] Dies ist umso über20raschender, als das Phänomen der Diffusion von Konzepten und Denkweisen durch die organisationswissenschaftliche Forschung eine hohe Prominenz bekommen hat.[36] Es ist zwar inzwischen anhand von Detailstudien die vergleichsweise langsame »Amerikanisierung« des Managements in der Bundesrepublik nachgewiesen, die Entwicklung des Harzburger Modells als spezifische, bundesrepublikanische Konzeption ist aber mit diesen Forschungen nicht systematisch in Beziehung gesetzt worden.[37] So wird von Forschern 21über kooperative Führungsmodelle zwar erkannt, dass unabhängig voneinander in der Bundesrepublik und den USA ein weitgehend identisches Führungskonzept entstanden ist, die vergleichenden Analysen bestehen aber überwiegend aus sterilen Gegenüberstellungen in betriebswirtschaftlichen Standardwerken.
Zu unterschiedlichen Bauarten von Managementkonzepten
Um die Führungsvorstellungen im NS-Staat und in der Bundesrepublik rekonstruieren zu können, muss zwischen zwei grundlegend verschiedenen Konstruktionsweisen von Managementmodellen unterschieden werden. In der einen Vorstellung wird versucht, Effizienz, Effektivität und Innovation durch ein Höchstmaß an Formalität zu erreichen, während in der anderen zur Erreichung dieser Ziele auf ein Höchstmaß an Informalität gesetzt wird.[38] Wenn man sich die Vorliebe der Managementliteratur für auf Buchstaben reduzierte Modellbezeichnungen anschaut – »Modell X«, »Modell Y«, »Modell J« –, dann könnte man an dieser Stelle von einem »Modell F« und einem »Modell I« sprechen.
Im »Modell F« – dem Modell Formalität – ist es das Ziel, über genaue Rollendefinitionen eine möglichst hohe Zahl an Verhaltens22erwartungen an die Organisationsmitglieder schriftlich zu fixieren und rechtlich zu kodifizieren. Die Erfolgsformel wird in der immer weiteren Detaillierung und Perfektionierung formaler Rollenerwartungen gesehen. Die Existenz von an Personen gebundenen, informalen Erwartungen in Organisationen wird zwar zur Kenntnis genommen, doch gibt es ein Bestreben, möglichst viele von diesen in formale Rollenerwartungen zu übersetzen. Die Menschen sollen, so die Vorstellung, wie Rädchen im Getriebe funktionieren. Metaphern, die für dieses Organisationsmodell verwendet werden, sind dann auch konsequenterweise Maschine, Mechanismus, Apparat oder Betriebssystem.[39]
Bei Managementkonzepten, die auf dem »Modell F« aufsetzen, wird auf eine zentrale Besonderheit von Organisationen abgezielt – nämlich die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft unter Bedingungen stellen zu können. Wenn man Mitglied einer Organisation sein will, muss man bereit sein, die formalen Erwartungsstrukturen der Organisation zu akzeptieren. So lässt sich spezifizieren, zu welchen Zeitpunkten man in den Räumlichkeiten der Organisation anwesend sein muss, was während der Anwesenheit zu tun ist, auf welche anderen Organisationsmitglieder man zu achten hat und welche man ignorieren kann. Es handelt sich bei den formalen Erwartungsstrukturen um die »entschiedenen Entscheidungsprämissen«, die man akzeptieren muss, wenn man Mitglied der Organisation bleiben will.[40]
Im »Modell I« – dem Modell Informalität – sollen sich auf der Basis von Personenvertrauen möglichst viele Erwartungen in Organisationen informal ausbilden.[41] Die Erfolgsformel besteht nach Ansicht der Verfechter dieses Modells darin, dem Drang zu einer zunehmenden Durchformalisierung der Verhaltenserwartungen in immer detaillierteren Rollenbeschreibungen zu widerstehen. 23Die Notwendigkeit formaler Rollenerwartungen wird zwar nicht negiert, diese sollen aber nur einen Rahmen für die auf Personenvertrauen basierenden, informalen Erwartungen bilden. Die Menschen sollen – so die Kurzformel – im Mittelpunkt der Organisation stehen. Metaphern, die für dieses Organisationsmodell verwendet werden, sind Organismus, Gemeinschaft, Lebenswelt oder Kultur.[42]
Managementkonzepte wie das Modell I bauen auf der Erkenntnis auf, dass es in der Welt der Organisation weit wilder zugeht, als es die gut kommunizierbare Formalstruktur suggeriert. Unter »Informalität« werden dabei die bewährten Trampelpfade verstanden, die in einer Organisation immer wieder beschritten werden. Das »Informale«, das »Unterleben« und die »Kultur« sind Festlegungen auf die Art und Weise, wie in Organisationen entschieden werden soll. Es geht dabei um Entscheidungen, die nicht durch einen Unternehmensvorstand, einen Parteitag oder ein religiöses Oberhaupt zustande kommen, sondern die sich als Gewohnheiten eingeschlichen haben. Die Orientierung an diesen »nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen« kann nicht als Mitgliedschaftsbedingung eingefordert werden, prägt aber häufig das Verhalten der Mitglieder mindestens genauso stark wie die formalen Erwartungen der Organisationen.[43]
Seit Ende des 19.Jahrhunderts bringen Managementvordenker allgemeine Handlungsempfehlungen für die Steuerung von Organisationen vor, in denen die Schwerpunkte entweder auf die Potentiale der Formalität oder der Informalität gelegt werden.[44] 24Man kann die Geschichte von Managementkonzepten deswegen als einen Wechsel nicht nur zwischen Abbau und Reduzierung von Hierarchien oder zwischen der Ausdifferenzierung oder Auflösung von Abteilungsgrenzen, sondern besonders zwischen Formalität und Informalität beschreiben.[45]
Anfang des 20.Jahrhunderts war der Taylorismus dabei sicherlich der erste bedeutende Versuch, Effizienzvorteile durch eine weitgehende Formalisierung der Organisationsrollen mit Wenn-dann-Regeln – sogenannten Konditionalprogrammen – zu erreichen.[46] Die nach dem Zweiten Weltkrieg prominenten Modelle der Führung im Mitarbeiterverhältnis und der Führung über Zielvereinbarungen lösten sich zwar von der Vorstellung, dass Organisationsmitglieder durch möglichst genaue Konditionalprogramme geführt werden sollten, setzten aber weiterhin auf die Möglichkeiten der Formalisierung – in diesem Fall durch die Festlegung genauer Zweckprogramme für alle Rollen in einer Organisation.[47]
Als Reaktion auf die Versuche weitgehender Formalisierung bildeten sich immer wieder auch Organisationskonzepte aus, die auf die Ausbildung informaler Erwartungen setzten.[48] Anfang des 2520.Jahrhunderts entstanden zuerst Konzepte der kooperativen Werksgemeinschaft und darauf aufbauend der nationalsozialistischen Betriebsgemeinschaft, in denen der Schwerpunkt auf die Ausbildung von personengebundenen, kollegialen Erwartungen bei der Erledigung von Aufgaben gelegt wurde.[49] In der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts kamen dann Modelle einer »vergemeinschaftenden Personalpolitik« auf, in denen die Bedeutung der Person in den Mittelpunkt der Erwartungsbildung gestellt wurde.[50] Diese fanden zuerst in Japan, dann in den USA und schließlich in Europa unter dem Begriff der »Organisationskultur« große Aufmerksamkeit.[51]
Die grundlegende Unterscheidung zwischen den Managementmodellen, die durch eine möglichst detaillierte Beschreibung der formalen Struktur Erwartungssicherheit bieten wollen, und denen, die auf die Ausbildung informaler Strukturen setzen, um Orientierungshilfe zu leisten, ermöglicht es, Kontinuitäten und Brüche des Führungsdiskurses im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik zu beschreiben.
Zur Zielsetzung einer Analyse von Führungsdiskursen
Das Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel von Führungskonzepten im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik herauszuarbeiten, welche zentralen Vorstellungen von Führung sich in der modernen Gesellschaft ausgebildet und wie sie sich mit der Zeit verändert haben. Führung und das – häufig auch abgrenzend verwendete – Synonym des »Managements« waren dabei immer mit 26grundlegenden Vorstellungen der Funktionsweise von Organisationen verbunden.[52] Eine Auseinandersetzung mit Führungskonzepten ist also immer auch eine Auseinandersetzung mit dominierenden Vorstellungen von Organisationen.
Dabei darf man sich die Führungsideologie im Nationalsozialismus nicht als ein hermetisch geschlossenes Gedankengebäude vorstellen. Anders als in der Sowjetunion mit seiner ausgearbeiteten marxistisch-leninistischen Staatsdoktrin gab es im Nationalsozialismus nicht den »orthodoxen Katechismus«, an welchen sich alle zu halten hatten.[53] Stattdessen vermengten NS-Ideologen wie Höhn Elemente wie Rassenreinheit, Volksgemeinschaft und Führerprinzip zu einer nationalsozialistischen Weltanschauung, ohne diese immer einer systematischen Konsistenzprüfung mit den häufig unterbestimmten Grundideen Hitlers zu unterziehen. Aber bei allen unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen im Detail bildete sich eine Führungsideologie heraus, die als Leitbild für Organisationen im NS-Staat diente.
In der Bundesrepublik Deutschland waren die Vorstellungen zur Führung dann noch einmal deutlich heterogener als im NS-Staat. In einem demokratischen Staat werden zwar Grundprinzipien der Führung in staatlichen Organisationen wie Ministerien, Verwaltungen und Polizeien über Gesetze und Verordnungen geregelt, aber es gibt in der Regel keine staatlichen Vorgaben, welche Formen von Führung entwickelt werden sollen. So bilden sich in Demokratien unterschiedliche Vorstellungen von Führung in Organisationen aus, die häufig in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Aus dieser Perspektive ist eher überraschend, dass sich in der frühen Bundesrepublik mit dem Harzburger Modell ein dominantes Konzept etablieren konnte.
27Der Umgang mit der Entwicklung von Führungsdiskursen in der modernen Gesellschaft ermöglicht den Zugriff auf die übergeordnete Frage, wie der Wechsel von Staatsformen vonstattengeht, wenn in der Regel die Personen in einem Staatsgebiet die gleichen bleiben. Besonders interessant ist dabei das Verhalten derjenigen, die in der abgelösten Staatsform eine tragende Rolle eingenommen hatten. Wann passen sich Führungseliten den Anforderungen der neuen Staatsform an? Unter welchen Bedingungen halten sie an ihren ursprünglichen Positionen fest und gehen in einen aktiven Widerstand gegen die neue staatliche Ordnung? Wann gehen sie desillusioniert und frustriert in eine Form innerer oder äußerer Emigration?
Die deutsche Geschichte ist unter diesem Gesichtspunkt der Anpassung an veränderte staatliche Ordnungen besonders interessant. In kaum einem anderen Staat lassen sich so viele grundlegende Wechsel von Staatsformen und die entsprechenden Reaktionen auf diese beobachten. Nur wenige Jahrzehnte brauchte es in Deutschland für einen Wechsel von einer Monarchie zu einer parlamentarischen Demokratie, der Errichtung einer nationalsozialistischen Diktatur und der Aufspaltung Deutschlands in einen am Modell der parlamentarischen Demokratie orientierten, durch eine kapitalistische Wirtschaftsordnung geprägten Staat einerseits und die auf einem faktischen Einparteiensystem basierende und weitgehend planwirtschaftliche Deutsche Demokratische Republik andererseits.
An den Positionen Höhns lassen sich Kontinuitäten und Brüche in der Konzeption von Führung über die verschiedenen Staatsformen hinweg wie durch ein Brennglas analysieren. Dieser Fokus auf das Denken und Handeln einer einzelnen Person mag als soziologischer Ansatz überraschen,[54] denn eine soziologische Analyse inter28essiert sich in der Regel nicht für konkrete Personen, sondern für Semantiken und Strukturen.[55] Von dieser soziologischen Grundhaltung wird hier bewusst abgewichen, weil durch die Fokussierung auf eine Person Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Führungsverständnisses in einem totalitären Regime und einem demokratischen Staat erfasst werden können.
Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Analyse, wie Vorstellungen von Führung in Reden, Artikeln und Büchern konstruiert wurden.[56] Es wäre aber ein grundlegender Fehler, den Diskurs mit der Führungspraxis in den Organisationen selbst zu verwechseln.[57] Bei den Diskursen über Führung handelt es sich um Semantiken, die nur sehr lose mit den Praktiken der Führung in Organisationen verbunden sind.[58] Ein bürokratiekritischer Führungsdiskurs 29bedeutet nicht zwangsläufig, dass Organisationen von einer engen regelorientierten Steuerung auf eine Führung über Ziele umstellen. Eine Rhetorik des Hierarchieverzichts hat nicht zwangsläufig zur Folge, dass in Organisationen auf den Mechanismus der formalen Anweisung verzichtet wird. Häufig passen sich Organisationen an den jeweiligen aktuellen Diskurs lediglich auf ihrer Schauseite an. Überraschenderweise bleibt die formale Seite durch eine Umstellung der allgemein akzeptierten Sprachregelung häufig unberührt. Weil die formale Struktur die veränderten Führungsdiskurse oft nur indirekt berührt, sind auch die Auswirkungen auf die informalen Erwartungshaltungen vergleichsweise gering.[59]
Dieses Buch wendet sich an Leserinnen und Leser, die sich dafür interessieren, wie sich Vorstellungen von Führung seit der NS-Zeit verändert haben. Die Arbeiten der meisten Praktiker, aber auch vieler Forscher über Führung sind in den allermeisten Fällen auffällig ahistorisch. Zwar wird gelegentlich darauf verwiesen, dass die Frage, wie Organisationen geführt werden sollen, schon von chinesischen, indischen oder römischen Philosophen behandelt wurde, aber die Wurzeln von Führungskonzepten werden in der Regel nicht detailliert offengelegt. Diese Geschichtsblindheit ermöglicht es, im Managementdiskurs Konzepte wie transformationale Führung, authentische Führung oder dienende Führung als etwas grundlegend Neues zu verkaufen, weil die Ähnlichkeiten zu Führungskonzepten unterschiedlicher staatlicher Ordnungen wie der Monarchie, der Demokratie, dem Nationalsozialismus oder dem Staatssozialismus im Dunkeln bleiben.
30
Vom NS-Staat bis heute – Übersicht über den Argumentationsgang
Das nationalsozialistische Organisationsverständnis basierte auf der Ablehnung der verhassten staatlichen Bürokratie der Weimarer Republik. Für die Nationalsozialisten war die formale, bürokratische Planung Ausdruck eines »jüdischen Denkens«, das die ganze Gesellschaft erfasst habe. Stattdessen sollten sich Organisationen an der Idee einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft orientieren. Führende nationalsozialistische Staatstheoretiker wie Reinhard Höhn forderten eine Orientierung an höheren, sinnstiftenden Zwecken, betonten die Bedeutung von kameradschaftlichen Gemeinschaften und propagierten die Idee einer charismatischen, transformationalen Führung (Kapitel 2).
Nach dem Zusammenbruch des NS-Staates achtete Höhn darauf, dass das von ihm entwickelte Modell einer Führung im Mitarbeiterverhältnis nicht mit seiner während der NS-Zeit vertretenen Ideologie der Volksgemeinschaft in Verbindung gebracht werden konnte. Im Unterschied zu seinen damaligen Vorstellungen, die auf informale Erwartungsbildung setzten, vertrat er in der Nachkriegszeit das Prinzip einer strikten Durchformalisierung der Organisation. Zwar betonte er die Spielräume, die die Mitarbeiter bei der Erreichung der ihnen gesetzten Ziele haben müssten, in vielen Facetten entsprach sein Konzept aber dem bürokratischen Idealtypus Max Webers (Kapitel 3).
Höhn recycelte durch die Abgrenzung gegenüber der autoritären Führung den Verweis auf die preußischen Verwaltungs- und Militärreformer sowie die Propagierung eines harmonistischen Organisationsverständnisses in seinem Führungsmodell Argumentationsfiguren, die er schon in der NS-Zeit verwendet hatte. Bei einer oberflächlichen Betrachtung könnte man den Eindruck gewinnen, dass Höhn mit seinem Harzburger Modell an seine früheren Konzepte anknüpfte. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch deutlich, wie grundlegend er sein Führungsmodell an die Ansprüche der parlamentarischen Demokratie in Deutschland anpasste, indem er die gesetzlich abgesicherte Fixierung formaler Erwartungen betonte (Kapitel 4).
Wie stark Höhn sein Konzept von Führung gegenüber seinen Modellen in der NS-Zeit umstellte, wird im Vergleich mit dem im 31englischen Sprachraum lange Zeit dominierenden Führungskonzept deutlich. Peter F. Druckers Idee eines »Management by Objectives« und Höhns Konzept einer »Führung im Mitarbeiterverhältnis« basierten beide darauf, dass die Mitarbeiter selbst über die Mittel zur Erreichung der vorgegebenen Ziele entscheiden können. Höhn setzte dabei aber viel stärker als Drucker auf eine Formalisierung organisationaler Erwartungen über präzise Stellenbeschreibungen. Drucker, der aus einer jüdischstämmigen Familie kam, konnte als Kritiker des Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit jedoch viel unbefangener als Höhn an seinen früheren Vorstellungen von Gemeinschaft festhalten (Kapitel 5).
Anders als das immer noch populäre Führungsmodell Druckers erlebte Höhns Harzburger Modell seit den 1970er Jahren einen fast beispiellosen Bedeutungsverlust. Die Zahl der Seminarteilnehmer brach ein, die Harzburger Akademie musste Insolvenz anmelden und kaum eine Führungskraft bezieht sich heutzutage noch auf die Führung im Mitarbeiterverhältnis. Dieser Niedergang hängt aber nur zu einem kleinen Teil mit der zunehmenden Skandalisierung der Rolle Höhns im Nationalsozialismus zusammen. Verantwortlich war vielmehr, dass er sein Modell nicht an neue Trends im Management anpassen konnte, weil diese zu sehr seinen im Nationalsozialismus propagierten Vorstellungen ähnelten. Die Renaissance der Idee, dass Gemeinschaft durch eine besondere Organisationskultur hervorgerufen wird, das Comeback der Vorstellung einer charismatischen, transformationalen Führung und die Wiederbelebung des Gedankens, dass sich Organisationen an einem übergeordneten Sinn ausrichten, konnte Höhn deswegen nicht nachvollziehen (Kapitel 6).
Wie sehr viele andere überzeugte Nationalsozialisten konnte sich Höhn nach dem Zweiten Weltkrieg als Demokrat neu erfinden. Selbst hohen NS-Funktionären wurde es in der Bundesrepublik ermöglicht, ihre Karriere fortzusetzen, wenn sie bereit waren, sich jeder offenen Sympathie für die nationalsozialistische Ideologie zu enthalten. Diese unter Bedingung der Anpassung gestellte Integration von ehemaligen Nationalsozialisten hatte paradoxerweise eine stabilisierende Wirkung auf die damals noch fragile Demokratie. Höhn ist sicherlich nur eines der prominentesten Beispiele für eine solche stabilisierende Wirkung (Kapitel 7).
Die Wiederbelebung der Idee der Gemeinschaft, die erneut auf32kommende Orientierung an einem übergeordneten, sinnstiftenden Zweck und das Comeback der charismatischen Führung im Managementdiskurs hat nichts mit einer Sympathie für die nationalsozialistische Ideologie zu tun. Durch die Ignorierung der historischen Wurzeln von Organisationsprinzipien drohen die Verfechter neuer Führungskonzepte aber zu übersehen, wie stark sie Konzepte bewerben, die in vielen Facetten den Vorstellungen ähneln, die von den Nationalsozialisten propagiert wurden (Kapitel 8).
33
2. Gemeinschaft als Organisationsmodell – zum nationalsozialistischen Verständnis von Führung
Der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewußt übernommen wurden.[1]
Der Philologe und Romanist Viktor Klemperer
Die Idee der Gemeinschaft ist in vielen historischen wie aktuellen Managementkonzepten relevant. In der Gemeinschaft würden Menschen nicht mehr nebeneinanderher leben, sondern sich verbunden fühlen und gegenseitig unterstützen. Anstatt verhärteter Konflikte im Inneren komme es in Gemeinschaften zu vertrauensbasierten Mechanismen der Konfliktlösung, die das Leben für alle erleichterten. Die Menschen seien zwar auch in der Gemeinschaft nicht gleich, aber die Zugehörigkeit nivelliere die Statusunterschiede und biete den Menschen so eine Heimat. Das Ergebnis sei eine innere Geschlossenheit, die es der Gemeinschaft ermögliche, nach außen mit Stärke aufzutreten.[2]
Das Prinzip der Gemeinschaft beruht auf der Faszination des Zusammenlebens in kleinen sozialen Gebilden.[3] Familien, Verwandtschaften, Freundschaften, Nachbarschaften, Sippen und Stämme basieren auf einer genauen Kenntnis der anderen Angehörigen und können sich so über personenbezogene Erwartungen 34stabilisieren.[4] Das führt dazu, dass sich in diesen kleinen Systemen besonders enge Formen des Zusammenhalts ausbilden, die dann als Leitbild auf größere Gebilde übertragen werden können.[5] Gemeinschaft wird dabei nicht ausschließlich auf Vorstellungen von kleinen, auf personenbezogener Kommunikation basierenden Systemen wie Liebesbeziehungen, Kleinfamilien oder Freundesgruppen projiziert, sondern findet sich auch in Zielvorstellungen von Protestbewegungen, religiösen Zusammenschlüssen, patriarchal geführten Unternehmen, selbstverwalteten Betrieben, sozialistischen Parteien oder totalitären Diktaturen.[6]
Schon in den ersten sozialwissenschaftlichen Zugriffen wird der Begriff der Gemeinschaft durch die Gegenüberstellung zur Gesellschaft geschärft.[7] Während der »gemeinschaftliche Wille«, so der 35Soziologe Ferdinand Tönnies, in der durch Gemeinwohl bestimmten Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundschaft zu finden sei, seien die Menschen in der Gesellschaft voneinander getrennt und würden sich deswegen nur an ihrem persönlichen Nutzen ausrichten.[8] Gemeinschaft, so der Soziologe Max Weber im Anschluss an diese Überlegung, basiere auf einer durch Tradition oder Emotion ausgelösten, subjektiv gefühlten Zusammengehörigkeit. Die Gesellschaft dagegen baue auf einem rational motivierten Interessensausgleich auf.[9]
Verfechter der Gemeinschaftsidee, die sich häufig auf die Überlegungen Tönnies’ berufen, stellen die beiden Konzepte nicht nur analytisch gegenüber, sondern favorisieren die Gemeinschaft als überlegenes Konzept.[10] Sie entstehe »organisch« und sei deswegen im Prinzip »gut«, während die Gesellschaft »künstlich« geschaffen werde und deswegen als »schlecht« zu bewerten sei.[11] Sie beklagen die Zerstörung der Gemeinschaft durch die anonymisierenden Mechanismen der modernen Gesellschaft, weshalb sie eine Rückkehr zu gemeinschaftlichen Prinzipien fordern.[12]
36In Managementkonzepten wird diese normativ aufgeladene Unterscheidung von Gesellschaft und Gemeinschaft auf Organisationen übertragen. Das Problem sei, dass die höhere Mobilität, verstärkte Urbanisierung und verschärfte Arbeitsteilung die klassischen Haltepunkte des Menschen in der Verwandtschaft und Nachbarschaft erodieren lasse und gleichzeitig die Organisationen das Bedürfnis nach Gemeinschaft immer weniger befriedigen würden.[13] Im Fokus der Kritik steht besonders der »seelenlose Taylorismus«, der mit seiner »rationalen Fassade« nur mühsam die Spannungen und Widerstände eines durchrationalisierten Betriebes verbergen könne.[14] Besonders die »unter innerer und äußerer Zerrissenheit des modernen Lebens leidende Generation« spüre deswegen ein »tiefes Verlangen nach neuer Gemeinschaft und organischer Zusammenfügung«.[15]
Damit verbindet sich die Kritik an einer Erosion der Gemeinschaft mit der Klage, dass in den Organisationen zu viel gemanagt und zu wenig geführt werde.[16] In durchformalisierten, bürokratisierten Organisationen würden Entscheidungen nur noch über die Hierarchien durchgesetzt. Manager würden Mitarbeiter nicht mit ihrer Persönlichkeit überzeugen, sondern Konformität allein mit Verweis auf ihre formalen Weisungsbefugnisse durchsetzen. Dagegen würden sich in auf Gemeinschaft setzenden Organisationen die Prinzipien der Führung quasi naturwüchsig ausbilden. Personen, die am stärksten vom Zweck der Organisation beseelt und die am ehesten in der Lage seien, alle anderen mitzureißen, würden in Führungspositionen gelangen und von den anderen in dieser 37Stellung auch akzeptiert werden. Man mag diese Personen durch hierarchische Positionen absichern, für die Durchsetzung der Führungsansprüche sei dies aber nicht nötig.
Welche Rolle spielte nun diese seit dem frühen 20.Jahrhundert verbreitete Vorstellung von Gemeinschaft und Führung in der nationalsozialistischen Ideologie der Volksgemeinschaft?
2.1 Die nationalsozialistische Ideologie der Volksgemeinschaft
In der deutschsprachigen Diskussion wurde die Idee der »Gemeinschaft« sehr früh mit dem Konzept des »Volkes« verknüpft.[17] Die »Volksgemeinschaft« war, so die Vorstellung, nichts anderes als das »Volk in Gemeinschaft«. »Gemeinschaftsgedanke« und »Volksgedanke« fielen faktisch zusammen.[18] »Das Volk« sei die Gemeinschaft, »in welcher der Deutsche sich erfüllt«.[19]
Mit dem Ersten Weltkrieg wird der Begriff der Volksgemeinschaft in Deutschland zu einem »inflationär gebrauchten«, häufig »irrational aufgeladenen« Begriff, mit dem das Streben »nach einer neuen Form des gemeinschaftlichen Lebens« zum Ausdruck gebracht werden sollte.[20] Die Volksgemeinschaft wurde eine »politi38sche Sehnsuchtsformel«, mit der die Aussicht auf ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl verbunden werden konnte.[21] Darin wurde die Hoffnung nach neuen »Bindungen der Sitte, des Stils, der Kultur« und, damit eng verbunden, »der Kameradschaft, des Führertums und der Gefolgschaft« zum Ausdruck gebracht.[22]
Als »beherrschende politische Deutungsformel« nach dem Ersten Weltkrieg war das Konzept der Volksgemeinschaft an eine Vielzahl von politischen und religiösen Diskursen anschlussfähig.[23] Es wurde von fast allen politischen Parteien und religiösen Richtungen in der Weimarer Republik genutzt.[24] Anarchisten, Sozialdemokra39ten und Liberale verwendeten es genauso wie Konservative und Nationalsozialisten.[25] In der katholischen Soziallehre spielte es genauso eine Rolle wie in der evangelischen Ethik und in den jüdischen Moralvorstellungen.[26]
Auch wenn der Begriff der Volksgemeinschaft die Bevorzugung des Volkes gegenüber dem Individuum hervorhob und eine Zugehörigkeit jenseits von Klassengrenzen suggerierte, blieb er doch unbestimmt genug, um an unterschiedliche politische und religiöse Diskurse anzuschließen. Mit Claude Lévi-Strauss kann man bei der Volksgemeinschaft von einem doppelten »flottierenden Signifikanten« sprechen.[27] Sowohl die Bedeutung des »Volkes« als auch des Begriffs der »Gemeinschaft« sind so nebulös, so flottierend, dass damit ganz unterschiedliche Vorstellungen assoziiert und die Begriffe von Kontext zu Kontext unterschiedlich benutzt werden können.[28]
Zweifellos waren die Nationalsozialisten diejenigen, die den Begriff der Volksgemeinschaft am konsequentesten in ihrer eigenen Ideologie verankerten.[29] Die Volksgemeinschaft werde, so 40der Staatssekretär im Reichsministerium des Inneren Wilhelm Stuckart, »vom Nationalsozialismus in den Mittelpunkt allen Seins gestellt«. Sie sei die »einzige menschliche Gemeinschaft, die umfassend und selbständig ist, die für sich besteht und sich aus sich selbst erneuert«.[30] »Nationalsozialistische Volksgemeinschaft« sei, so Joseph Goebbels, »die erzielte Verständigung der Volksgenossen untereinander, mithin der Ertrag sozialistischen Denkens.«[31]
Die Volksgemeinschaft als Rassegemeinschaft
Die nationalsozialistische Ideologie baute auf einer Bestimmung der Volksgemeinschaft als »einer rassisch bestimmten Blutsgemeinschaft« auf.[32] So spricht sich Reinhard Höhn als einer der prominen41ten Verfechter der nationalsozialistischen Volksgemeinschaftsidee dafür aus, dass das Konzept der »Volksgemeinschaft« zwangsläufig über die Kategorie der Rasse zu bestimmen sei. Voraussetzung für das »Recht in der Gemeinschaft leben zu können«, sei die »Einheit des Blutes«.[33] Darin »liege die ungeheure Bedeutung der Rasse und des Blutes für die Gemeinschaftsbildung«.[34]
Die Ideologie der Nationalsozialisten basierte auf der Ausgrenzung von vermeintlich »Gemeinschaftsfremden« aus der von ihnen über Rasse und Blut definierten Volksgemeinschaft.[35] Wenn die »Volksgemeinschaft« als »Rassegemeinschaft« verstanden wird, fallen in der Logik der Nationalsozialisten automatisch alle Personen heraus, die den mehr oder minder willkürlich bestimmten Rassekriterien nicht entsprechen. Im Sinne der rassistischen Ideologie der NS-Zeit könne man nicht mit einem aus Afrika stammenden Menschen das »Erlebnis der Volksgemeinschaft« haben, weil »gleiches Denken, Fühlen und Handeln in einem Volk« von »rasse- und artmäßigen Anlagen bedingt« werde.[36]
Bei der rassistischen Aufladung des Konzepts der Volksgemeinschaft macht sich die für die nationalsozialistische Ideologie typische Verknüpfung von ethnischem und eugenischem Rassismus 42bemerkbar.[37] Der ethnische Rassismus richtete sich gegen Personengruppen, die als »rassisch andersartig« definiert werden. Dazu wurden im NS-Staat in einer schon damals eigenwilligen Interpretation von Rasse auch Personen gezählt, deren Eltern oder Großeltern jüdischen Glaubens gewesen waren.[38] Der eugenische Rassismus richtete sich gegen Personen, die von den Nationalsozialisten zur eigenen Rasse gezählt wurden, aber aufgrund von körperlichen und geistigen Behinderungen, psychischen Erkrankungen oder sexueller Orientierung als genetisch minderwertig betrachtet wurden. Für Höhn war es selbstverständlich, dass der Staat durch Zwangssterilisation und Heiratsverbote in »das Leben des Einzelwesens« eingreifen müsse, wenn »seine Erbmassen dem Gesamtvolkstum schädlich« seien.[39]
In dieser durch ethnischen und eugenischen Rassismus geprägten Ideologie der Volksgemeinschaft war die Option angelegt, dass Personen, die nicht den vorgegebenen Rassekriterien entsprachen, vernichtet werden müssen.[40] »In der eigenen Volksgemeinschaft«, so der Soziologe Helmut Schelsky kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, zeige sich der nationale Sozialismus »als Liebe zum Ganzen, nicht aber als Mitleid mit dem einzelnen Menschen«.[41] »Wahrer Sozialismus« sei es, »Leute, die für das Volk 43ihre Leistung nicht erfüllen oder es gar schädigen, auszuschalten oder sie sogar zu vernichten«.[42]
Vorstellungen einer völkischen Großraumordnung
Das rassistisch aufgeladene Verständnis von »Volksgemeinschaft« war in der NS-Ideologie eng mit der Vorstellung einer »völkischen Großraumordnung« verbunden.[43] »Das Reich der Volksgemeinschaft« habe, so Höhn auf dem Höhepunkt der territorialen Expansion des Deutschen Reiches, von vornherein »eine gewaltige innerdeutsche Missionskraft« besessen und zu »jenen Stürmen der Begeisterung des sich zu einem Volk und einer völkischen Ordnung bekennenden Deutschtums in Europa« geführt. »Dieser gewaltigen Idee gegenüber« seien »die künstlichen Schranken staatlicher Souveränität« verschwunden.[44]
Der imperialistische Gedanke wird deutlich, wenn Höhn erklärt, dass das nationalsozialistische Regime »in seiner Stellung 44nach innen als das Reich der Volksgemeinschaft« und »in seiner Stellung nach außen« »als Lebenskern des europäischen Großraumes« zu verstehen sei. »Beides«, so Höhn, habe »seine Stellung als Reich der Volksgemeinschaft und als Kern dieses Lebensraumes« »auf das engste miteinander verbunden«. »Die Volksgemeinschaft« liefere »die Lebensgrundlage für das Reich«, den »Kraftspender, die Quelle seiner völkischen und rassischen Kraft, die Grundlage dafür, dass es Lebenskern des Großraumes überhaupt sein kann«.[45]
Diese Vorstellung diente als ideologische Rechtfertigung für die immer aggressiver werdende Besatzungspolitik des NS-Staates.[46] Das »auf der Basis der Volksgemeinschaft« fußende Reich habe, so Höhns Begründung des Angriffskriegs des NS-Staats gegen seine Nachbarstaaten, »eine ungeheure Anziehungskraft auf seine Brüder« gehabt, »die außerhalb der Reichsgrenze« lebten und »an dieser Volksgemeinschaft teilnehmen wollten«.[47] »Millionen seiner Brüder und Schwestern« seien auf »dieses Reich der Volksgemeinschaft« zugeströmt und hätten mit den »Brüdern und Schwestern des ›Altreiches‹ das Großdeutsche Reich der Volksgemeinschaft« gebildet.[48]
Aus der Idee zur völkischen Großraumordnung ergaben sich 45nach Auffassung Höhns auch Folgerungen für die nationalsozialistische Kolonialpolitik. Die Kolonien würden von den Nationalsozialisten nicht wie in England oder Frankreich »als Gegenstand der Ausbeutung«, »als Objekt eines skrupellosen wirtschafts- oder rasseverratenden Kulturimperialismus« oder »als Versuchsfeld grenzenloser Ausdehnung und willkürlichen Machtausweitung« angesehen werden, sondern als »Arbeitsfeld aufbauender Leistung und Ausgangspunkt großräumiger Ordnungen«. Für das nationalsozialistische Reich seien »Kolonien wie jedes völkische Leben als ›Äußerung des Selbsterhaltungstriebes der Rassen‹ zu begreifen«.[49]
Aus dieser Position heraus begründete Höhn auch die sich mit dem Zweiten Weltkrieg verschärfende Politik gegen Menschen jüdischen Glaubens in ganz Europa. Das »Dritte Reich« sei »die Startbahn für ein neues Europa« und habe sich einer der zentralen, »Europa bedrängenden Fragen«, der des »Judenproblems«, angenommen. In dieser Frage habe das »Dritte Reiche« »klare Richtlinien« aufgestellt, »die jedermann unmißverständich« seien und die »bereits weitgehend als anerkannt betrachtet werden dürften«.[50]
2.2 Die Volksgemeinschaft im Kleinen – zur Umsetzung der Volksgemeinschaft in Organisationen
Die Idee der Volksgemeinschaft musste nach den Grundgedanken ihrer nationalsozialistischen Verfechter durch eine rassisch begründete Gemeinschaft im Kleinen erlebbar gemacht werden. Das »Gemeinschaftserlebnis« könne, so Höhn, zwar auch in der Masse des deutschen Volkes erfahren werden, konkret spürbar sei es aber erst in kleinen Gemeinschaften.[51] Der NS-Staat lege »mit guten Grün46den« »großen Wert auf die politische Übereinstimmung, auf einen gleichen Gemeinschaftsgeist im staatlichen Leben«. Dazu sei es nötig, den »Gemeinschaftsgeist auf allen Gebieten des Lebens entstehen zu lassen«, den »Menschen also möglichst stark, überall, wo er handelt und wirkt, im Gemeinschaftsgeist zu erfassen«.[52]
In der Sprache der NS-Ideologen drückt sich das in der Vorstellung aus, dass die kleinen »Sturmtruppen des Geistes« als Gemeinschaften für eine rassisch begründete Volksgemeinschaft funktionieren sollten. In »kleinen Gemeinschaften« müsse, so Höhn, das durchgemacht werden, »was das deutsche Volk, ehe es zur Volksgemeinschaft kommt«, noch durchzumachen habe. Konsequent müsse das, was in »kleinen Gemeinschaften an Kämpfen und Widerständen erlebt« werde, für den »Staat, der auf Volksgemeinschaft aufgebaut werden soll«, genutzt werden.[53]
Zur Kristallisation von Gemeinschaft in Organisationen
Das Prinzip der Gemeinschaft konnte nach der Vorstellung der NS-Ideologen in unterschiedlichen sozialen Gebilden festgemacht werden. In der SA, der SS, der Nationalsozialistischen Frauenschaft, der Hitlerjugend oder dem Bund Deutscher Mädel werde, so Höhn, Gemeinschaft durch »die gemeinsamen Strapazen zur Erreichung des Zieles, die Verteidigung gegen die politischen Gegner« entstehen. Der »Gemeinschaftsgeist« trete aber auch in einer »religiösen Gemeinde« auf, die »das religiöse Erlebnis zum Inhalt« habe. Er könne ebenfalls in einer Familie entstehen, die »die gemeinsamen Sorgen und Freuden des Alltags, die Erziehung der Kinder und die tägliche Arbeit« meistert. Aber auch in den Betrieben sei das Gefühl der Gemeinschaft präsent.[54]
Die durch die Nationalsozialisten initiierten »kleinen Gemeinschaften« – »in der SA, im Arbeitslager, in der SS« – würden, so 47Höhn, helfen, die »Stände- und Klassengegensätze im Volk« zu überwinden.[55] Das »Erlebnis des Lagers« festige und stärke die »Gemeinschaft des Bundes«. In einem »Arbeitslager« sei erlebt worden, dass es nicht darauf ankomme, »was für einen Titel und Rang jemand hat, oder was sein Vater ist«, sondern nur darauf, dass »es gilt im Kreis seiner Kameraden als deutscher Mann und Soldat der Arbeit« zu wirken und »Träger des Geistes deutscher Volkgemeinschaft« zu werden.[56] Im gleichen Sinne arbeiteten in der Betriebsgemeinschaft »der Unternehmer als Führer des Betriebs, die Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke« und »zum gemeinen Nutzen von Volk und Staat« zusammen.[57] Das »Gemeinschaftsdenken« trete an die »Stelle des Interessendenkens«.[58]
Die Idealisierung der Arbeit als Basis der Gemeinschaftsbildung
In der Ideologie der Nationalsozialisten war die Ausbildung von Gemeinschaften eng mit der Identifikation mit einer übergeordneten Moralvorstellung verbunden. »Sinnloses Arbeiten« in Be48trieben sei »undeutsch«, so das Postulat von Karl Arnhold, einem der zentralen Verfechter der Anwendung der nationalsozialistischen Gemeinschaftsideologie. »Der deutsche Arbeitsmann« müsse davon überzeugt sein, dass »das, was er tut, einen besonderen Sinn« habe.[59] Im Nationalsozialismus komme es nicht darauf an, Arbeit als eine rein »technische Angelegenheit« oder als ein »Mittel« zum Brotverdienst zu verstehen. Vielmehr entstehe eine tiefe Befriedigung durch die Möglichkeit, »an einem großen Werk« mitschaffen zu dürfen.[60]
Arnhold illustriert die übergeordnete nationalsozialistische Arbeitsideologie mit einer schon in der Weimarer Republik verwendeten, dann aber im NS-Staat expansiv genutzten Parabel einer Gruppe von Steinmetzen. Auf die Frage an den ersten, was er hier eigentlich mache, antwortet dieser entgeistert, dass das doch einfach zu erkennen sei – er müsse »hier Steine behauen, sauber und ordentlich«. Ein zweiter reagiert ärgerlich und verdrossen, man solle ihn in Ruhe lassen, er müsse hier schließlich »Geld verdienen«. Der dritte Steinmetz antwortet, ganz im Sinne der von Arnhold favorisierten Arbeitsmotivation, mit leuchtenden Augen, dass er an einem Dom mitbauen dürfe.[61]
Diesem Beispiel zufolge rückt die Gemeinschaft den Menschen »in den Mittelpunkt«. Wenn man auf Gemeinschaft setze, werde der Mensch zum »beseelten Motor des Betriebsgeschehens«.[62] »Der schaffende Mensch«, so die Auffassung, sei »der Urquell jeder Leistung« – »nicht die Maschine, nicht die Organisation und nicht das Geld«. »Sein Arbeitskönnen, sein Leistungswille und seine Arbeits49gesinnung« seien der Ausgangspunkt für »all die Kräfte«, die durch intelligente Organisationen »einzufädeln« seien.[63]
Betont wird dabei, dass erst durch Adolf Hitler die Arbeit in Organisationen wieder mit einem höheren Sinn ausgestattet worden sei. »Das Letzte und Höchste« könne, so Arnhold, »der Mensch erst dann hergeben, wenn er für ein Ideal kämpft«. »Dieses Ideal« sei aber lange Zeit nicht vorhanden gewesen, weshalb der Mensch »bestenfalls für sich« gearbeitet habe. Es habe erst mit Hitler »der Mann kommen müssen, der das Auge« »vom Ich« auf »ein Höheres« hingelenkt habe, für das es sich lohne, »nicht nur die Stunden zu messen und in die Lohntüte zu gucken«.[64]
Die Bedeutung der informalen Erwartungsbildung im Gemeinschaftskonzept
In der von den Nationalsozialisten propagierten Ideologie herrschte die Vorstellung, dass sich die Erwartungen in gemeinschaftsorientierten Organisationen informal ausbilden.[65] Gemeinschaften, so Höhn, könne man »nicht organisieren«, sie müssten vielmehr »organisch wachsen«. Die Aufgabe der Führer könne nicht darin bestehen, eine Gemeinschaft zu verordnen, sondern darin, »Hindernisse aus dem Weg zu räumen«, »dem Wachstum zu lauschen« und »Formen zu schaffen, in denen sich auf Grund einer gewissen Erfahrung Gemeinschaftsleben bildet«. In der Volksgemeinschaft komme es im Großen wie im Kleinen darauf an, die »Bedingungen für ihr Wachstum« zu bilden – denn auch der Gärtner könne »nicht sagen, er habe die Pflanze geschaffen«; sie sei vielmehr »geworden«. Er habe aber »mit kluger Hand den Boden bereitet und ihr die Bedingungen für ihr Wachstum gegeben«.[66]
Hinter dieser Ideologie steckte eine große Skepsis gegenüber der Anwendung formaler Mechanismen zur Steuerung von Organisa50tionen.[67] Für die Nationalsozialisten war die Vorstellung formaler Planung Ausdruck »jüdischen Denkens«. Dieses »jüdische Denken vom Rechenzettel her« habe sich in der Weimarer Republik, so der Leiter der nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront Robert Ley, »auf das gesamte Volk«, »auf den Staat und auf die Wirtschaft ausgedehnt«. Man sei dazu gekommen, »alles zu organisieren, was irgendwie in Erscheinung trat«. Erst durch die Nationalsozialisten sei dieser Hang zur Formalisierung zurückgedrängt worden.[68]
In seiner programmatischen Schrift Mein Kampf hatte Hitler erklärt, dass er »ein Feind von zu schnellem und zu pedantischem Organisieren« sei, weil dabei »meist nur ein toter Mechanismus« herauskomme und eher »selten eine lebendige Organisation«.[69]