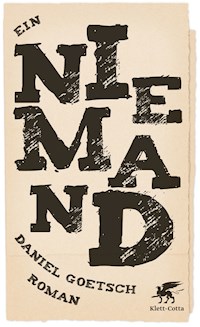12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Höhepunkt seines Ruhms reist der Dramatiker Maxim Diehl auf die Insel Porquerolles, um seine Autobiographie zu schreiben. Die mediterrane Kulisse soll ihm helfen, sich seinen Erinnerungen an die Kindheit, an den hartherzigen Vater und die verträumte Mutter zu stellen. Dabei wirft sich für ihn die existentielle Frage auf, ob man im Vergleich zu den Schicksalen des 20. Jahrhunderts heute überhaupt noch eine Biographie haben kann. Als Diehl auf der beschaulichen Insel vor der französischen Mittelmeerküste nicht die richtigen Worte für seine Autobiographie findet, beginnt er sein ganzes gehetztes Leben in Frage zu stellen. Da begegnet er dem fast doppelt so alten Amerikaner Jack Quintin, der auf einer Hotelterrasse seinen allabendlichen Cognac trinkt und mit sich im Reinen scheint. Man kommt ins Gespräch, erkundet gemeinsam die Insel, bewundert das Wohnhaus von Georges Simenon. Und Quintin fängt an zu erzählen, wie er 1944 im kriegsversehrten Europa gelandet ist, wie er in Deutschland Kriegsgefangene verhört und sich für die Reeducation von Nazis eingesetzt hat. Diehl ist fasziniert von Quintins Lebensgeschichte, die auf unheimliche Weise mit seiner eigenen verknüpft scheint. Er verwirft sein biographisches Projekt und kündigt seinem Verlag einen großartigen Roman an. Doch nach und nach wird klar, dass Jack Quintin nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Als Diehls Exfrau nach einer Stippvisite samt Sohn wieder abreist, muss er feststellen, dass der Amerikaner ebenfalls verschwunden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Daniel Goetsch
Fünfers Schatten
Roman
KLETT-COTTA
Impressum
Fünfers Schatten wurde vom Aargauer Kuratorium unterstützt
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASPKommunikation GmbH, München
unter Verwendung eines Fotos von © Katrien De BlauwerKatrien de Blauwer appears courtesy of Gallery Les Filles du Calvaire and Gallery Fifty One
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN978-3-608-98071-4
E-Book: ISBN 978-3-608-11012-8
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
»Sei es mir also gestattet, mit verstandesmäßiger Kritik das Sagenhafte auszuscheiden und den historischen Kern lauschend zu erfassen; wo aber die Sage allzu selbstherrlich das Glaubhafte überwuchert und die Anwendung der kritischen Methode nicht mehr zulässt, da werde ich freilich mild gesinnte Leser brauchen.«
Plutarch
»Wir sind kaputte Maschinen.«
Bernard-Marie Koltès
1.
Es gibt kein Familienalbum. Nur ein halbes Dutzend abgegriffener Fotos aus seiner Kindheit. Auf einem einzigen ist er zusammen mit seinem Vater zu sehen. Im Hintergrund die zementgraue Fassade eines Wohnblocks. Heinrich Diehl, die Hemdsärmel hochgekrempelt, Kettenschmiere an den Händen, strahlt wie jemand, der in seinem Leben selten Grund fand, stolz zu sein. Neben ihm auf einem froschgrünen Fahrrad der vierjährige Maxim, verrutscht auf dem Sattel, eine Hand am Lenker, die andere umklammert den sehnigen Unterarm seines Vaters, wodurch ein Moment der Zärtlichkeit angedeutet scheint. Aber die Miene passt nicht zu einem Kind, seine Lippen hat er zusammengepresst, als müsste er etwas Zähes hinunterschlucken. Vielleicht ist auch nur der Sattel zu hoch eingestellt. Es ist schwierig, sich kein falsches Bild von Maxim Diehl zu machen. Besonders im Nachhinein, wenn man weiß, was mit ihm geschehen ist.
2.
Als er im Herbst 1999 mit der Fähre auf Porquerolles übersetzte, fühlte er sich frei. Natürlich ging nichts über dieses Gefühl. Er stand an der Reling, hielt das Gesicht in die Brise und versuchte, sich zu entsinnen, was Freiheit eigentlich für ihn bedeutete. Eine Folge von Befreiungsschlägen. Zuletzt jener Zusammenprall mit Jürgen Tembrock, seinem alten Kampfgefährten, dem er eine Reihe von gelungenen Inszenierungen seiner Stücke verdankte. Das war nur eine weitere Etappe in einer verheerenden Entwicklung. Wann hatte es angefangen, fragte er sich, während das Schiff mit metallischem Dröhnen die Wellenkämme durchbrach und auf die Insel zusteuerte, die in flüssigem Quarz zu schweben schien.
Wochenlang hatte Tembrock ihn bedrängt, er solle ein neues Stück liefern. Sie hatten Erfolg, die Aufführungen in der Lagerhalle wurden regelmäßig zu Festivals eingeladen. Sie hätten die tückische Gunst der Stunde nutzen sollen. Allein, es fehlte das nächste Stück. Es war nicht so, dass er, Maxim Diehl, sich ausgepumpt oder schreibblockiert gefühlt hätte. Die Müdigkeit rührte anderswoher. Woher, hätte er nicht sagen können. Morgens kam er kaum aus dem Bett, ging nicht ans Telefon, ließ die Post ungeöffnet auf dem Küchentisch liegen, rettete sich mit einem Kloß im Hals aus der überfüllten Straßenbahn, nahm dabei in Kauf, einen Termin zu versäumen. Er aß nicht, sondern verschlang nur das Nötigste, eine Instantnudelsuppe oder einen Kebab mit Kräutersauce. Zwar mäßigte er sich beim Weintrinken und verbot sich jedes Aufputschmittelchen, dennoch strahlte eine insektenartige Unruhe von seinem Innersten bis in die Zehen und Fingerspitzen aus. Manchmal dachte er, jemand habe ihn vergiftet. Er wusste, wie gefährlich solche Gedanken waren. So hetzte er hin und her, zwischen seiner Zürcher Mansarde, wo er sich vorübergehend eingemietet hatte, und den verschiedenen Berliner Adressen, die ihm Unterschlupf boten.
Tembrock zum Beispiel, sagte er sich, während er gegen die Reling des Schiffs lehnte und dem rhythmischen Brechen der Wellen lauschte. Gewiss hatte der liebe Jürgen es gut gemeint, als er ihm neulich Stefan Heyms Schwarzenberg geschickt hatte, mit der Bitte, eine kongeniale Theaterfassung zu erarbeiten. Diesen Stoff wolle er unbedingt auf die Bühne bringen, diese deutsche Utopie. Doch erstens spürte Diehl, wenn er das Wort Utopie hörte, einen Brechreiz, und zweitens empfand er sich lediglich als ein halber Deutscher, und gerade diese Hälfte war ihm suspekt, wenn nicht gar lästig. Gleichwohl hatte er guten Willen gezeigt und sich durch Heyms Roman gekämpft. Der Plot ging auf ein historisch belegtes Kuriosum zurück: Eine Gegend im Erzgebirge war nach dem Zweiten Weltkrieg unbesetzt geblieben. Weder die Russen noch die Amis waren bis ins sächsische Schwarzenberg vorgedrungen, so dass die Einwohner sich selbst überlassen blieben. Sie konnten schalten und walten, wie sie wollten. Stefan Heym hat diese Ausnahmesituation, die in Wirklichkeit nur einige Monate gedauert hatte, zum Idealtypus eines basisdemokratischen Sozialismus aufgeblasen. Er finde, dieser Roman sei eine einzige papierne Zumutung, hatte er gestanden, als er Tembrock in dessen Kreuzberger Wohnung aufgesucht hatte. Außerdem würde es darin von Nazis wimmeln. Na und? Es gehe doch um einen schicksalhaften Wendepunkt der Geschichte, hatte der andere doziert. Das Buch treffe einen Nerv, lege die Bedingungen der Möglichkeiten frei und so weiter. Quatsch, hatte Diehl entgegnet, der künstlerische Aspekt sei entscheidend, und so gesehen könne man Schwarzenberg in der Pfeife rauchen. Ob er etwa seinen düsteren Existenzialismus für zeitgemäßer halte, hatte Tembrock zurückgeblafft. So was interessiere heute keine Sau mehr. Die Leute verlangten nach lebensnahen Stoffen, echten Anliegen. Ja, genau, eine Utopie.
Während sich das paradiesisch grüne Eiland aus dem morgendlichen Dunst über dem Meer herausschälte, erinnerte sich Maxim Diehl, wie er dem bärenhaften Regisseur in dessen Altbauwohnung gegenübergestanden hatte. Wie sie sich gegenseitig ihre Überzeugungen um die Ohren gehauen, sich mit jedem Wort weniger verstanden hatten. Wie ihn Tembrock in seiner ganzen schnaubenden Massigkeit aus der Küche in den Flur hinausgedrängt hatte, über die Türschwelle ins Treppenhaus. Wie ihn dabei das Gefühl übermannt hatte, aus seiner zweiten Heimat vertrieben zu werden, aus jener urvertrauten Wohnung, wo sie nächtelang gesessen, sich bei Pils und Korn schwindlig geredet hatten, den Kampfgeist entfacht, das wilde Denken entfesselt. Mensch, Jürgen.
Seine Berliner Jahre waren die besten gewesen, dachte Diehl und erschrak keine Sekunde bei dem Gedanken, obwohl in ihm etwas Endgültiges mitschwang und weder das Meer noch der herbstgraue Himmel irgendeinen Halt boten. Tembrocks Wut hatte ihn unvorbereitet getroffen. Zudem war es ihrem Einvernehmen nicht dienlich gewesen, dass sie im Vorfeld eine Flasche Wodka geleert hatten. Und dass die verschlafene Tatjana, nur mit einem Höschen bekleidet, hereingehuscht war. Und dass er ihr zugezwinkert hatte, während Tembrock sich beeilt hatte, seine Edelangetraute ins Schlafzimmer zurückzuscheuchen. Tatjana, die weißrussische Sonntagsdichterin, die der liebe Jürgen seit Jahren durchfütterte, ohne sie je vögeln zu dürfen. Sie war schon immer ein Schwachpunkt gewesen, glaubte Diehl sich zu erinnern. »Du elender Individualist«, hatte Tembrock gekräht. Er solle sich mitsamt seinen geschriebenen, respektive ungeschriebenen Stücken zum Teufel scheren. Worauf er, Diehl, sich die Speichelspritzer von der Wange gewischt und gemeint hatte, er würde sich niemals wegen einer Utopie mit einem alten Mann prügeln. Jürgen Tembrock hatte die Fünfzig überschritten. Bestimmt erwog er bereits, was von ihm einst übrigbleiben würde, bestimmt entwarf er in seinem Hinterkopf letzte kühne Pläne. Daher wohl sein Bedürfnis, eine deutsche Utopie zu stemmen. Im Treppenhaus hatte der Regisseur ihm hinterhergebrüllt: »Du hast dein Leben nicht im Griff.«
Vermutlich sei gar nicht das Theater der Grund gewesen, kam ihm nun auf der Fähre plötzlich in den Sinn. Es musste einen anderen Grund für Tembrocks Jähzorn gegeben haben. Welcher das sein könnte, darüber rätselte er vergeblich, während er beobachtete, wie das Schiff in einem trägen Linksschwenk den Pier ansteuerte, der sich durch den Gischtschleier hindurch abzeichnete.
Neben der Hafenanlage stand ein schlichter Zweckbau, in dem das Office du tourisme und ein Kiosk untergebracht waren. Dahinter thronte auf einem Hügel eine jener militärischen Festungen aus dem vorletzten Jahrhundert, wie sie allenthalben in Frankreich anzutreffen waren. Eine Straße verlief entlang der Bucht zur unbesiedelten Ostspitze der Insel, eine andere führte zur einzigen Ortschaft hinauf. Einige Häuserzeilen, die um einen unasphaltierten Platz herum angeordnet waren, zwei Terrassencafés, das Rathaus mit wehender Trikolore und ein schmuckes Kirchlein, welches das Bild mediterraner Beschaulichkeit abrundete.
Ausgezeichnet, sagte sich Maxim Diehl. Genau das brauchte er, um endlich seine Geschichte niederzuschreiben. Er dachte dabei weniger an eine Autobiographie im herkömmlichen Sinne, kein Stationendrama, das sich die Jahreszahlen entlang von einer Heldentat oder Niederlage zur nächsten hangelte. Was ihm vorschwebte, war eher so etwas wie ein Fazit. Eine schonungslose Abrechnung. Mit diesem Anliegen war er vor einer Woche von Tembrocks Wohnung aus nach Frankfurt geflogen, hatte bei seinem Verlag vorbeigeschaut, die Lektorin mit dem blonden Pony umschmeichelt und sich mit dem Patriarchen, dem griesgrämigen, von Diabetes gezeichneten Karlheinz Würth, gestritten, bis dieser den Plan seines Erfolgsautors mit einem Vorschuss vergolten hatte. Anschließend hatte er seine Mutter in Wettingen besucht, wie üblich ihrem Lobgesang auf ihn gelauscht und vergeblich versucht, sich ins rechte Licht zu rücken: Er sei nun mal nicht der, den sie unter Aufbietung all ihrer Mutterliebe herangezüchtet zu haben glaube. Bevor die Tränen geflossen waren, hatte er den Schauplatz seiner Jugend verlassen.
Von Zürich aus, wo er einen Seesack mit dem Wichtigsten vollgestopft hatte, war er mit dem Talgo bis Avignon und von dort weiter nach Toulon gereist. Ursprünglich hatte er die Absicht gehabt, in Sanary-sur-Mer zu verweilen, um den Geist der unvergessenen Emigranten zu atmen. Aber aus dem verschlafenen Fischerdorf, wie es Klaus Mann so plastisch beschrieben hatte, war mittlerweile eine Rentnersiedlung geworden. Er hatte keine bezahlbare Unterkunft gefunden. So war er per Anhalter die Küste hinuntergefahren. In einer Spelunke in der vergammelten Altstadt von Hyères hatte er einen Straßenmusiker kennengelernt, der sich als Zigeuner ausgegeben und die Jahrtausendwende als apokalyptische Burleske ausgemalt hatte. Weißhäutige Chimären würden über die Menschen herfallen, sie niederringen, vergewaltigen, ihnen das Mark aus den Knochen saugen und so weiter. Inmitten dieses Irrsinns hatte der Mann Porquerolles erwähnt. Eine Insel wie ein ewiger Frühling. Der richtige Ort, um sich produktiv seinem Leiden hinzugeben, hatte er behauptet und nebenbei auf Diehls Rechnung einen Pastis nach dem anderen in sich hineingeschüttet. Am besten steige er in der Pension Les Tamaris ab. Die werde von der Witwe Morientes geführt, die für mittellose Dichter nicht nur ein Zimmer, sondern auch ein Herz habe.
Die Pension befand sich in einer schmalen Gasse, die parallel zum Hauptplatz verlief. Frau Morientes, eine drahtige Frau Mitte sechzig, fand auf Anhieb Gefallen an dem jungen Mann, der einen Seesack geschultert hatte und ein gepflegtes Französisch sprach.
»Hélas, Monsieur. Ende September sind die Touristen bereits verschwunden.«
»Sehr gut«, sagte er.
»Dann müssen Sie ein Romancier sein.«
»Ich gebe mir alle Mühe. Bisher hat es nur fürs Theater gereicht.«
»Keine Sorge, wir werden es schaffen«, meinte die Frau kichernd.
Sie strich ihm mehrmals über den Arm, als sie das angeblich schönste Zimmer der Pension besichtigten. Wenig Tageslicht drang durch das französische Fenster herein. Ein Doppelbett, ein Waschbecken mit Bidet, ein winziges Pult, darauf eine Vase mit einem Strauß Trockenblumen. Es roch nach Putzmitteln und faulen Feigen. Die Stahlfedern quietschten, als er sich aufs Bett warf.
Am selben Abend schrieb er Vivien, der Frau am anderen Ende seines Bewusstseins, einen Brief:
Chère Viv. Ich hätte nie gedacht, dass mich das Schicksal eines Tages in Gestalt eines versoffenen Straßenmusikers heimsuchen würde. Das Leben, as we know it, ist in seiner Fatalität grausam, nicht selten aber auch komisch. Wenn wir uns hinterm Blaubeerbusch unserer Kindheit verkriechen, wenn wir uns auf dem trunkenen Schiff als nüchterne Narren wähnen, wenn die Angst vor dem Schwarzen Mann unsere hellsten Träume durchkreuzt. Eh bien. Ein Spinner hat mir den Weg gewiesen. Nun habe ich meinen Verbannungsort gefunden. Das Endspiel kann beginnen. Ton Voyant.
Die ersten Tage auf der Insel perlten dahin. Im einzigen geöffneten Krämerladen versorgte er sich mit den Unentbehrlichkeiten: Toastbrot, Frischkäse, Weißwein und Zigaretten. Er setzte sich unter die Eukalyptusbäume auf eine Parkbank, blätterte in der Libération und beobachtete, wie Einheimische Pétanque spielten. Oder wie der Mistral die Trikolore über dem Rathausportal aufbauschte. Oder wie zwei Buben einen Hund foppten, indem sie ihm eine Papiertüte über den Schädel zogen.
Für einen Spaziergang fehlte ihm der Atem. Nicht besser erging es ihm mit dem Schreiben. Er konnte unmöglich vor Einbruch der Dämmerung damit beginnen. Das Geschrei der Möwen störte ihn, die Sonnenstrahlen auf der staubigen Fensterscheibe oder der Schattenwurf der Gardinen, dazu die umherflirrende Gewissheit, dass in dieser Sekunde anderswo Myriaden von Mitmenschen folgsam ihrem Tagewerk nachgingen. Woher die ihren Antrieb nahmen? Er beneidete sie ein wenig. Aber er hatte sich geschworen, die Finger von Aufputschmitteln zu lassen. Bis auf seinen Notvorrat besaß er nichts. Es gab zwar hinter dem Rathaus eine kleine Apotheke, aber nein.
Er hatte das Pult freigeräumt, sein schwarzes L1917-Notizbuch mit den linierten Seiten und zwei Kugelschreiber bereitgelegt. Der Seifenhalter diente ihm als Aschenbecher. In einem ersten Entwurf wollte er seine Geschichte chronologisch aufrollen. Wie alles begann. Doch was heißt alles? Er setzte bei seinen Erzeugern an, bei der Begegnung seiner Mutter mit seinem Vater in Deutschland, im kriegsversehrten Mainz. Kurz vor dem Jahreswechsel. Silvester 1945. Bestimmt knallten weder Böller noch Raketen. Kein Jubeln, kein Sekt. Nur verhuschte Gestalten, die in Schutthalden herumstapften. Dazu die epidemische Angst vor Blindgängern.
Nach wenigen Sätzen merkte er, dass er sich vom Eigentlichen entfernte. Auf keinen Fall wollte er auf den Spuren seiner Eltern durch Trümmerlandschaften wandeln. Ihm ging es um seine Zeit. Die Gegenwart, in der er bis zum Hals steckte. Sein zappelndes Ich im Hier und Jetzt. Und wie es dazu gekommen war. Schon nach vier Zigaretten war das höchstens zwölf Quadratmeter große Zimmer vollgequalmt. Und der Weißwein schmeckte grässlich.
Als er einmal gegen Mittag aus der Pension hinausschleichen wollte, hielt ihn Frau Morientes auf. Sie habe eine vorzügliche Tortilla zubereitet. Er war noch nicht richtig wach, fühlte sich aber verpflichtet, die Einladung anzunehmen. Sie setzten sich an einen der drei mit Wachstuch bedeckten Tische im Speisesaal.
»Kommen Sie voran?«
Die Witwe verschlang ihren Gast vor Neugier. Er zuckte mit den Schultern und betrachtete das Stück Eierkartoffelpampe auf seinem Teller.
»Die Zeit eilt ja nicht. Von sich aus.«
»Ach, Monsieur. Sie sollten zwischendurch einen Spaziergang machen. Oder eine Tour mit dem Fahrrad. Porquerolles ist eine Fahrradinsel.«
»Ich habs nicht so mit Rädern.«
Frau Morientes hatte sich über den Tisch gebeugt, als gälte es, ihm ein schreckliches Geheimnis anzuvertrauen.
»Aber hüten Sie sich vor dem Amerikaner.«
Er hob eine Augenbraue.
»Ein bizarres Individuum. Er wohnt im Hotel Sainte-Agathe. Fast jedes Jahr für drei Wochen. Mit unsereins gibt er sich nie ab. Er spaziert jeden Nachmittag zum Leuchtturm. Und jeden Abend trinkt er auf der Terrasse den besten Cognac. Bestimmt führt er was im Schilde.«
Maxim Diehl schnitt eine unentschlossene Grimasse. Ihm gefiel die Vorstellung, dass ein einsamer Amerikaner und er die einzigen Touristen auf der Insel waren. Während er mit der Gabel in der Tortilla herumstocherte, legte seine Gastwirtin in aller Ausführlichkeit dar, warum sie ein Problem mit Amerikanern habe. Sie sei eben eine Kommunistin. Als Kind habe sie mit ihrem Vater aus dem faschistischen Spanien flüchten müssen. Wie zehntausend andere auch. Aber weiter als die Pyrenäen seien sie nicht gekommen. Beim Gedanken an die Pyrenäen musste Diehl grinsen, obwohl der pampige Bissen schwer im Mund lag.
»Sind Sie politisch, Monsieur?«
»Sie meinen, ob ich einer Partei angehöre?«
»Entschuldigen Sie. Als Romancier muss man natürlich nicht politisch sein. Man muss nur leiden und das Leiden in Worte fassen können, n’est-ce pas?«
In ihr heiseres Kichern hinein sagte er:
»Selbst ein Schriftsteller leidet manchmal an ganz simplen Dingen.«
Im Grunde sprach er von der Tortilla, was Frau Morientes unmöglich erraten konnte. Sie fuhr mit ihrer Geschichte fort. Wie sie als Flüchtlingskind in einer Baracke in den Pyrenäen aufwuchs, von ihrem schwermütigen Vater im Stich gelassen, von französischen Gendarmen als kleine Hure beschimpft. Wie sie lernte, sich in der rauen Gebirgswelt zurechtzufinden. Wie ihr ein fünfzehnjähriger Katalane Lesen und Schreiben beibrachte. Derselbe Junge sollte später ihr Gatte werden. Arturo Morientes, Gott habe ihn selig.
»Arturo war ein Mann, der sich nicht mit dem Gegebenen zufriedengab. Nie und nimmer.«
Warum erzählte sie ihm das, fragte sich Diehl und nahm einen Schluck von dem zimmerwarmen Rosé. Ihr lieber Arturo, seufzte die Frau, sei keiner dieser sturen Katalanen gewesen, sondern ein Kommunist von Kopf bis Fuß. Als die deutschen Faschisten zu wüten begannen und Europa mit ihrem Herrenmenschenhass überzogen, suchte er Verbindung zum Widerstand. Er, der Junge, der gerade eben selbst auf der Flucht gewesen war, half den Verfolgten. Natürlich kannte er sämtliche Pfade, die sich durch die Wälder und Felsflanken schlängelten. Die rettenden Wege über die grüne Grenze. Eine merkwürdige Sache, meinte Frau Morientes und leckte sich die Lippen. Erst stellten die Pyrenäen einen Schutzwall für jene dar, die vor den Franquisten in den Norden geflüchtet waren. Danach retteten sich Kommunisten und Juden über dieselben Berge in den Süden. Egal, von welcher Richtung gesehen, alle Fluchtwege führten über die Pyrenäen.
»Die Pyrenäen müssten noch rasch in diesem Jahrhundert heiliggesprochen werden.«
Da glaubte Diehl zu verstehen, worauf sie hinauswollte. Er, der Schriftsteller, sollte ihre Geschichte aufschreiben. Das übliche Missverständnis. Jene Spezies war ausgestorben. Jene selbstlosen Schreiberlinge, die nur aus Augen und Ohren und einem schwammartigen Gedächtnis bestanden, sagte sich Diehl und starrte auf die Pampe in seinem Teller. Einen zweiten Bissen brachte er unmöglich hinunter. Seit Wochen machte ihm das Schlucken zu schaffen. Mit seiner Speiseröhre stimmte etwas nicht. Aber weil seine Gastgeberin weiter über die schlimmen alten Zeiten schwatzte, stopfte er sich eine Gabel voll Tortilla in den Mund.
»Sind Sie schon mal in den Pyrenäen gewesen?«, wollte sie wissen.
Diehl sprang mit einer hingemurmelten Entschuldigung auf, rannte in die Küche und erbrach sich ins Spülbecken. Es war nicht das erste Mal, dass er befürchtete, ernsthaft krank zu sein. Die Anfälle von Schüttelfrost und Schwindel, die verdammte Unruhe.
Bald hatte er ihn entdeckt, den sogenannten Amerikaner. Ein beleibter Herr in seinen Siebzigern, weißer Haarkranz, Hornbrille und Jeanshemd. Am frühen Abend trank er auf der Terrasse des Sainte-Agathe einen Cognac, betrachtete die in der Dämmerung kupferbraun schimmernden Häuser und schmunzelte selig vor sich hin. Wenn dieser Mann nicht im Reinen mit sich war, wusste Diehl nicht, ob überhaupt jemand es sein konnte.
Von der Parkbank aus, wo er mit einer Zeitung hockte, schielte er immerzu zum Amerikaner hinüber. In den folgenden Tagen wiederholte sich die Situation, das verstohlene Beobachten, das Staunen über jene innige Selbstzufriedenheit. Bis er bemerkte, dass der andere es ihm gleichtat. Was stellte der Amerikaner für Vermutungen über ihn an? Ein Mann im besten Alter, der mit sich haderte? Ein abgehalfterter Dichter? Ein kluger Kopf auf Abwegen? Hin und wieder kreuzten sich ihre Blicke. Ein sparsames Lächeln, gegenseitiges Zunicken. Beide hüteten sich davor, dem anderen zu nahe zu treten. Es schien eine Art subliminale Verständigung zu geben, vielleicht auch nur ein Verständnis füreinander. Immerhin teilten sie das Schicksal einsamer Touristen auf einer Insel außerhalb der Saison.
Eines späten Nachmittags, als Diehl wie gewohnt auf der Parkbank saß, dem Klacken der Boules lauschte und sich nicht aufraffen konnte, an sein Pult zurückzukehren, winkte der Amerikaner ihm zu: Er solle sich zu ihm setzen.
»Sind Sie wegen Georges Simenon hier?«, fragte er in einem zerdehnten Französisch.
»Nein. Reiner Zufall.«
Der alte Mann bestellte zwei Cognac und eine Schale Oliven dazu.
»Drüben, in dem hellblauen Haus, wohnt Simenons Nichte. Wenn man hartnäckig ist, kriegt man sie rum. Und sie führt einen durch die Arbeitsräume des Meisters. In einer Vitrine steht seine Olympia.«
»Ich habe noch nie einen Maigret gelesen«, gestand Diehl.
»O, ich schon. Vor Jahrzehnten. Um mein Französisch aufzufrischen. Eine dankbare Lektüre, das können Sie mir glauben. Simenon achtete darauf, nur die geläufigsten Begriffe zu verwenden. Seine Krimis beschränken sich auf ein Vokabular von tausend Wörtern.«
»Tausend Wörter?«
»Jedenfalls prahlte er damit. Keine Fremdwörter, keine fachspezifischen Ausdrücke, keine poetischen Seifenblasen, nichts dergleichen. Er wollte seine Mitmenschen in ihrem Alltag abholen. Aber ich sehe schon. Das scheint Sie nicht zu überzeugen. Sind Sie etwa selbst ein Schriftsteller?«
Der Amerikaner gluckste vergnügt, als kenne er die Antwort bereits.
»Dramatiker, um genau zu sein«, erklärte Diehl und nannte seinen Namen.
»Jack Quintin«, sagte der andere und streckte ihm seine Rechte entgegen. Für Diehl fühlte sich der Handschlag unverbindlicher an, als es die Blicke der letzten Tage hätten erwarten lassen.
»Worüber schreiben Sie, wenn ich fragen darf?«
Diehl lutschte an einer Olive, um das Brennen vom Schnaps abzumildern.
»Ausnahmsweise arbeite ich nicht an einem Theaterstück.«
»Aha. Verstehe. Deshalb der Rückzug auf die Insel. Sie schöpfen Atem für den langen Weg, den epischen Weg. Die Erbarmungslosigkeit des Schicksals, die haarsträubende Banalität des Zufalls, die heimtückischen Winkelzüge der Erinnerung etc.«
Die feinen Kerben in Quintins Augenwinkeln deuteten an, dass er gerne lachte.
»Ich habe immer davon geträumt, einen Roman zu schreiben«, bekannte er. »Aber mir fehlt die Muße. Wahrscheinlich auch das Talent. An Stoffen würde es mir jedenfalls nicht mangeln. Das können Sie mir glauben. Die besten Geschichten schreibt ja bekanntlich das Leben.«
So redselig sich der Amerikaner gab, spürte Diehl doch dessen Widerstreben, etwas von sich preiszugeben. Der Mann redete vor allem, um das Gespräch zu lenken.
»Sie sind kein Franzose, nicht wahr?«, forschte er weiter und schnupperte am letzten Rest Cognac in seinem Glas.
»Ich bin in der Nähe von Zürich aufgewachsen«, sagte Diehl. »Aber das ist nicht der Rede wert.«
»Richtig. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.«
3.
Die deutsche Besatzung habe sie nur am Rande miterlebt, meint Marie-Christine Diehl, die noch immer im siebten Stock eines Mietshauses in Wettingen wohnt. Das Alleinsein scheint ihr nichts auszumachen. Die zitterige Sorgfalt, mit der sie mit Kaffeekännchen und Zuckerdose hantiert, das Aufstrahlen, wenn der Name ihres Sohnes fällt. Nur gelegentlich schwingt eine Wehmut mit, wenn sie von ihrer Kindheit in Paris erzählt, als sie noch Fournier hieß.
Einmal beobachtete sie durchs Fenster der Wohnung im sechsten Arrondissement, wie ihre Mutter auf der Straße mit zwei Männern herumstritt. Sie hatte sie noch nie so aufgebracht gesehen. Anscheinend baten die beiden Résistance-Kämpfer um die Erlaubnis, Maschinenpistolen im Vorgarten des Hauses vergraben zu dürfen. Ihre Mutter widersetzte sich dem Ansinnen. Sie musste sich deswegen üble Beschimpfungen anhören. Aber zur selben Zeit saß ihr Gatte, Charles Fournier, in einem deutschen Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Münster. Mutters einziger Wunsch war es, die Familie wieder vereint zu sehen. So war es nur verständlich, dass sie sich auf nichts einließ, was die Erfüllung dieses Wunschs hätte gefährden können. Am besten man würde den Deutschen Paris überlassen, sagte Mutter immer, dann würden sie endlich Ruhe geben. Charles, Marie-Christines Vater, sprach selten über jene vier Jahre im Lager. Langeweile, meinte er. Das sei das überwiegende Gefühl gewesen. Sie hätten Dame oder Mühle mit Hemdknöpfen gespielt. Als Leutnant hatte er das Glück gehabt, nicht zu Zwangsarbeiten eingezogen zu werden. Ja, damals. Gegenüber französischen Offizieren hatten sich die Nazis noch die Mühe genommen, sich an die Genfer Konvention zu halten.
Die zweifelhafte Ironie der Geschichte wollte, dass Charles Fournier, obwohl er als Jurist die Laufbahn eines Verwaltungsbeamten einschlug, erneut beim Militär landete und im Herbst 1945 in die Besatzungszone nach Mainz geschickt wurde. So verbrachte Marie-Christine einen prägenden Abschnitt ihrer Jugend in Deutschland. Ihre Mutter widersetzte sich dem Umzug nicht, wohl aus Dankbarkeit darüber, dass die Familie wieder vereint war. Aber etwas nagte an ihr. Schon in den ersten Wochen im ehemaligen Feindesland befielen sie Schmerzen im Gesicht. Eine schwere, kaum behandelbare Neuralgie wurde diagnostiziert und führte dazu, dass sie die Jahre in Mainz hauptsächlich in ihrem abgedunkelten Schlafzimmer verbrachte, im Morphiumnebel.
Die kleine Marie-Christine verabscheute das eingezäunte Gelände mit den Mietskasernen, in denen die Angehörigen der Besatzungsmacht untergebracht waren. Sie verabscheute ebenso die feierlichen Anlässe, wo blasse, von Eisenmangel gezeichnete Kinder französische Gedichte aufsagen und sie selbst auf dem Klavier Volkslieder nachklimpern musste. Sie verabscheute die improvisierte Schule, wo den kleinen Franzosen erklärt wurde, dass das Zeitalter der Barbaren ein für alle Mal untergegangen sei und nun wieder der aufklärerische Geist der Französischen Revolution walte, wie es seine ewige Bestimmung sei. Die Nazis waren, so gesehen, nur ein historischer Zwischenfall. Eine germanische Verirrung auf dem Weg ins heilige Reich der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit.
Nach ihrem fünfzehnten Geburtstag erlaubte ihr der Vater, an gewissen Nachmittagen das bewachte Gelände zu verlassen. Zusammen mit ihrer Freundin radelte sie in die nahegelegene Stadt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was sie dort ein Jahr nach Kriegsende vorfinden würde. Mainz, im Frühjahr 1946. Ungefähr so stellten sich zwei wohlerzogene katholische Mädchen die Hölle vor. Sie durchquerten Ruinenlandschaften, Hausfassaden ohne Wohnräume dahinter, geschwärzte Prachtbauten, denen man beim Einstürzen zusehen konnte. Frauen und Kinder stapften mit Eimern über Schutthalden, Alte zogen Bollerwagen mit Gerümpel hinter sich her, Einarmige und Einbeinige boten auf Zeitungspapier Kartoffeln, Möhren oder Zwiebeln feil. Und über allem lag eine nach Verbranntem riechende Schwere. Wie verwöhnt musste sich Marie-Christine vorkommen, wenn sie in ihre Siedlung zurückkehrte. Sie hätte dankbar sein müssen. Sie gehörte zu den Glücklichen. Ja, sie wusste es, aber sie fühlte es nicht.
Eines Nachmittags, als die beiden Mädchen erneut in die Stadt radelten, fuhr Marie-Christine über ein Schlagloch. Das Vorderrad war danach so verbogen, dass sie unmöglich ihre Fahrt fortsetzen konnte. Sie hatte Tränen in den Augen. Zum Glück befand sich in der Nähe eine kleine Werkstatt. Dort stand ein älterer Deutscher mit einbandagierten Händen. Marie-Christine empfand Abscheu vor diesem Versehrten und besaß keinen Sous für eine Reparatur. Ihre hysterische Freundin flehte sie an, kehrtzumachen. Der Deutsche besah sich das Fahrrad und rief nach einem Heiner. Aus dem Schuppen trat ein Halbwüchsiger mit kurz geschorenem Haar, Latzhose und Hände voller Schmiere. Sein Blick aus graublauen Augen nahm sich feindselig aus, was nicht verwunderlich war. Man hasste die Besatzer, hasste die täglichen Demütigungen und vor allem die Tatsache, dass man den Krieg verloren hatte. Aber so ein Fahrrad konnte ja nichts dafür. Der Junge kniete sich nieder, zog und bog so lange an den Speichen herum, bis das Vorderrad wieder perfekt drehte. Er wollte kein Geld dafür. Mit über der Brust verschränkten Armen schüttelte er den Kopf. Aus Verlegenheit machte Marie-Christine eine Art Knicks und schwang sich aufs Rad. Sie hörte, wie der Junge die ersten Töne der Marseillaise pfiff und wie der Ältere ihn deswegen anschnauzte. »Comme ils sont grossiers, ces boches«, meinte ihre Freundin. Und Marie-Christine ahnte, dass sie noch oft an dem Schuppen vorbeiradeln würde.
In den folgenden Tagen trafen sich Marie-Christine Fournier und Heinrich Diehl heimlich hinter der Werkstatt am Fuß eines Trümmerbergs. Sie saßen auf einem umgestürzten Kaminrohr. Heinrich bot ihr von seinem selbstgewonnenen Apfelmost an, sie teilte mit ihm ein Pain au chocolat aus der Schulkantine. Einmal erblickten sie eine Gruppe Männer, die nebeneinander mit Stöcken durch eine Wiese schlenderten. Nazis, bemerkte Heinrich. Die seien zum Minensuchen verdonnert. Sein Lachen war so erfrischend, dass für Marie-Christine ausgeschlossen war, dass dieser Junge etwas mit den Kerlen dort drüben zu tun haben könnte. Bald zogen sich ihre Treffen bis in die Abendstunden, bald gab es nichts Schöneres als diese Treffen, bald ließ Marie-Christine zu, dass Heinrich seinen blonden Schopf auf ihren Schoß legte, und er erlaubte ihr, seinen Unterarm mit einem Grashalm zu streicheln. Worüber sprachen sie? Die Tochter eines französischen Besatzungsoffiziers und der deutsche Kriegswaise verständigten sich, obwohl sie die Sprache des anderen nicht verstanden. Zwischen ihnen ergab sich ein Einvernehmen, das über das jugendliche Verliebtsein hinausging: Beide wollten dieser scheußlichen Zeit nicht angehören.
Im Herbst 1947 wurde der Vater nach Paris zurückbeordert. Die Fourniers bezogen eine standesgemäße Wohnung im fünfzehnten Arrondissement. Marie-Christine bestand ihre Reifeprüfung und fing mit einem Literaturstudium an, obwohl sie lieber das Konservatorium besucht hätte. Doch es hieß, sie sei dafür schon zu alt. Ihre Mutter, wenn sie mal aus ihrem schmerzmittelbedingten Nebel erwachte, bestärkte sie im Musischen, verbesserte ihr Klavierspiel und hörte sich mit ihr Aufnahmen von Debussy, Ravel, Strawinsky oder Hindemith an, dem einzigen guten Deutschen, wie sie meinte. Wider Erwarten pflegten Marie-Christine und Heinrich in dieser Zeit regen Briefkontakt. Sie hatte gerade so viel Deutsch gelernt, dass sie ihm mehr als nur das Wetter in Paris beschreiben konnte. Er wiederum berichtete ihr von seiner Arbeit in der Fahrradwerkstatt und seinem Studium an der technischen Hochschule. Wenngleich ihre Briefe keinerlei Versprechen enthielten oder irgendwas andeuteten, das in die Zukunft gewiesen hätte, war doch aus jeder Zeile herauszuspüren, dass sie einander nicht aufgeben wollten.
Eines verregneten Abends im Jahr 1953 stand Heinrich Diehl mit einem Strauß Ranunkeln vor dem Hauseingang im fünfzehnten Arrondissement. Beinah hätte Marie-Christine den jungen Herrn im Trenchcoat nicht wiedererkannt. Doch seine unverwechselbare Art, auf den Zehen zu wippen, und wie er ihren Namen aussprach. Er hatte eben sein Diplom erworben. Er sagte, er wolle seine Heimat hinter sich lassen. Eine fast animalische Entschlossenheit flackerte in seinen Augen. Er wäre bereit gewesen, mit ihr irgendwohin zu ziehen. Nur in Paris konnten sie nicht bleiben, allein ihres Vaters wegen. Charles Fournier bekam einen Tobsuchtsanfall, als er erfuhr, dass sich seine einzige Tochter mit einem Deutschen verloben wollte. In den Jahren unmittelbar nach dem Krieg war nichts vergessen, auch wenn man eisern darüber schwieg. Er ließ sich auch nicht durch die Tatsache besänftigen, dass der junge Mann ein Ingenieurdiplom in der Tasche und die Strecke von Mainz bis Paris mit dem Rad zurückgelegt hatte. Dennoch nahm es Heinrich, ganz alte Schule, auf sich, dem künftigen Brautvater seine Aufwartung zu machen. Er schaffte es bis ins Treppenhaus. Dort hatte sich der ehemalige Besatzungsoffizier Fournier aufgebaut und brüllte auf Deutsch: »Ihr habt euren Krieg gehabt. Nun lasst uns in Frieden.«
In der ungeheizten Mansarde, die Heinrich in der Nähe des Fischmarkts gemietet hatte, schwiegen sich Marie-Christine und er an. Bleierne Tropfen schienen von der Decke zu fallen. Hin und wieder tauschten sie zwischen Verzweiflung und Sehnsucht schwankende Blicke aus. Er befürchtete, sie zu verlieren, bevor er sie jemals gehabt hatte, während sie hoffte, er sei rücksichtslos genug, sie zu entführen. Aus einer der unteren Wohnungen war der schmachtende Gesang Yves Montands zu vernehmen: »C’est une chanson qui nous ressemble.« Eine Weile lauschten sie dem Rascheln welken Laubs, bis Heinrich sich räusperte: Er habe eine Stelle in der Schweiz in Aussicht. Seine Stimme war schwer, als vermutete er mit diesem Geständnis ihre gemeinsame Zukunft, diese einmalige Möglichkeit, endgültig zu verspielen. Marie-Christine zögerte nicht einen Atemzug lang. Das Leben musste weitergehen. In ihren Augen spiegelte sich längst seine Entschlossenheit. Dieser Mann sollte berufen sein, sie aus dem Nachkriegsmief zu führen, war sie überzeugt. Und die Schweiz war für sie ein weißer Flecken im besten Sinne.
Sie verbrachten die ganze Nacht in dem kalten Zimmer. Durch die Dachluke war der orangefarbene Pariser Himmel zu sehen. Aber ihnen war nicht nach Romantik. Sie blieben Kinder des Kriegs. Ohne dass sie es aussprachen, wussten beide, dass in diesem Augenblick eine kleine Geschichte ihre Fortsetzung fand, die mit einem kaputten Fahrrad in einem zerbombten Mainz ihren Anfang genommen hatte. Und diese Geschichte konnte nur gut ausgehen.
4.
Das Inselleben, vom azurfarbenen Meer umspült, vom gleichgültigen Mistral umweht, war so überschaubar, dass die beiden einzigen Touristen gar nicht anders konnten, als sich täglich über den Weg zu laufen. Jack Quintin kam mit gerötetem Gesicht von seinem Spaziergang zurück und grüßte ihn, den Herrn Romancier, der sich auf der Parkbank hinter der Libération verkroch, darum bemüht, sich seine Zerknirschung nicht anmerken zu lassen. Er drehte sich im Kreis, und der Kreis wurde immer kleiner.
Die vergangenen Nächte hatte er sich vor seinem Notizbuch abgeplagt, ohne auch nur einen brauchbaren Satz zustandezubringen. Er hatte den Gedanken endgültig verworfen, mit der Begegnung seiner Eltern im kriegszerstörten Deutschland anzufangen. Was gingen ihn jene Naziruinen an? Er musste in Wettingen ansetzen, in den klaustrophobischen Verhältnissen einer Kleinfamilie, in der Enge eines Wohnblocks in den Sechzigerjahren. Aber er hatte Mühe, sich die damaligen Umstände zu vergegenwärtigen, die Details, das Dekor, in seiner unverwechselbaren Beklemmung. Die senfgelbe Polstergruppe, die Wohnwand aus Teakholz, Mutters Klavier, Vaters Bastelkammer, der Blick zum Fenster hinaus, auf einen identischen Block, in dem er die identische Trostlosigkeit vermutete. Aber weiter war er nicht gekommen. So hatte er gestern sein drittletztes Nootropil mit Weißwein hinuntergespült und sich gar nicht mehr gezielt erinnert, sondern in seinem Innern, einem schlammigen Teich, herumgewühlt, was jede Menge unscharfer Bilder aufgewirbelt hatte, verblichene, zerfaserte Momente, von denen er nicht mehr wusste, ob er sie tatsächlich erlebt oder bloß ersehnt hatte. Er hatte schlecht geschlafen im schönsten Zimmer der Pension Les Tamaris.
Die tägliche Zeitungslektüre war nicht dazu angetan, ihn aufzuheitern. Allenthalben war vom Millennium die Rede. Die Spalten waren voll von Rückblicken. Das ausgehende Jahrhundert auf Schlüsselereignisse heruntergebrochen: zwei heiße Kriege, ein kalter Krieg, die vielfältige Nutzung der Atomkraft, der erste Mondflug, die Antibabypille, ein Kniefall da, ein Handschlag dort, mehrere Katastrophen, die Erdölkrise, die Vertreibung des kommunistischen Gespenstes, das Internet und so weiter. Jedes Mal, wenn er einen solchen Pauschalartikel las, glaubte er, seine eigene Geschichte habe sich erübrigt.
Zum Glück gab es den Amerikaner. Dankbar nahm Diehl jede Einladung zum Cognac auf der Hotelterrasse an. Anfangs hatten sie sich auf Französisch unterhalten. Irgendwann bestand Jack Quintin darauf, ihr Gespräch auf Deutsch fortzusetzen. In Diehls Schriftsprache, wie er listig hinzufügte. Zwar klangen manche seiner Wendungen angestaubt, aber insgesamt zeigte er sich mit der Sprache bestens vertraut.
»Haben Sie vielleicht einmal in Deutschland gelebt?«, wollte Diehl wissen. Quintin schnitt eine Grimasse, als würde er gleichzeitig gekitzelt und gekniffen.
»Beruflich hatte ich mit Deutschland zu tun. So könnte man es sagen.«
Wie gewohnt vermied er es, mehr von sich preiszugeben, als es der Anstand gebot. Lieber forschte er sein Gegenüber aus.
»Sie schreiben also an einem Roman. Darf man fragen, wovon er handelt?«
An einem regnerischen Nachmittag geriet Diehl erneut in die fürsorglichen Fänge der Witwe. Er hatte es kaum aus dem Bett geschafft, das dunstige Grau hinter dem Fenster hatte ihn abgeschreckt, an Berlin erinnert. Auf dem Weg zum Bad überraschte ihn Frau Morientes: Sie habe eben die Paella vom Vortag aufgewärmt.