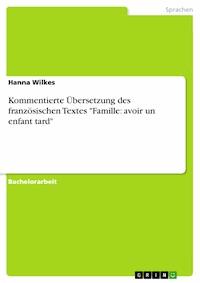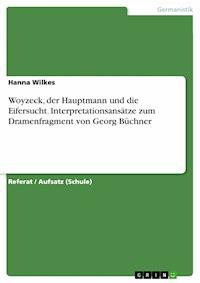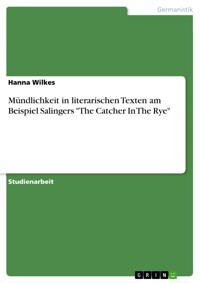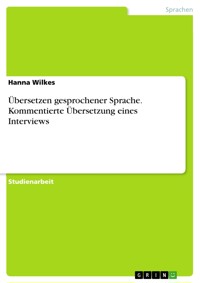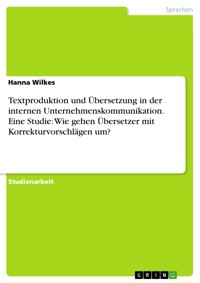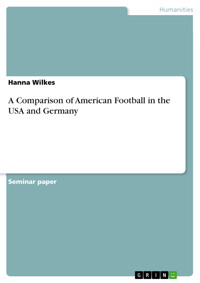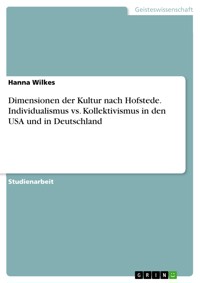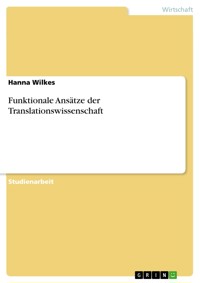
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Informationswissenschaften, Informationsmanagement, Note: 1,7, Universität Hildesheim (Stiftung), Sprache: Deutsch, Abstract: Welche funktionalen Ansätze gibt es in der Translationswissenschaft? Was versteht man unter adäquatem Übersetzen und welche Möglichkeiten bietet die Alternative des äquivalenten Übersetzens? Fragen wie diese führen zusammen mit einigen Beispielen durch die Seminararbeit. Dafür müssen zunächst die Begrifflichkeiten der Adäquatheit und der Äquivalenz erklärt sowie deren größte Unterschiede und Gemeinsamkeiten genannt werden. Darauf folgt der Hauptteil dieser Arbeit, in dem die funktionalen Ansätze der Translationswissenschaft erläutert werden. Darunter fallen hier die Skopostheorie, die Theorie vom Translatorischen Handeln sowie die Scenes-and-frames-Semantik. Anschließend wird die Option des äquivalenten Übersetzens kurz vorgestellt und deren Vorgehensweise und Ziele näher erklärt. Am Schluss steht ein Fazit, in dem die Ergebnisse knapp zusammengefasst und interpretiert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1. Einleitung
2 Was ist adäquates und äquivalentes Übersetzen?
3 Die funktionalen Ansätze der Translationswissenschaft
3.1 Skopostheorie
3.2 Theorie vom Translatorischen Handeln
3.3 Scenes-and-frames-Semantik
4 Eine Alternative: äquivalentes Übersetzen
5 Fazit
6 Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Folgende Situation sei gegeben: Ein Verleger erteilt einer Übersetzerin den Auftrag, einen französischsprachigen Reiseführer über Indochina in die deutsche Sprache zu übertragen. Die Übersetzerin bewertet den Ausgangstext als geeignet und legt dem Auftraggeber schließlich ihr Translat vor. Dieser ist von dem deutschsprachigen Reiseführer jedoch nicht überzeugt und hält ihn unter anderem aufgrund der von der Übersetzerin gewählten Sprachebene für nicht-publizierbar. Er verklagt die Arbeitnehmerin und bekommt vor Gericht tatsächlich Recht. Die uneinsichtige Übersetzerin muss eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen.[1]
Wie lässt sich das erklären? Das Gericht befand, dass die Frau sich unprofessionell verhalten habe, indem sie nicht berücksichtigte, welches Ziel und welche Leserschaft ihre Übersetzung haben sollte. Außerdem hätte sie den Ausgangstext von vornherein als unbrauchbar für den ihr erteilten Translationsauftrag einstufen müssen.[2] Die Übersetzerin hat also die Funktionalität missachtet und den Text nicht adäquat, sondern äquivalent übertragen. Genau um diese Thematik soll es in dieser Hausarbeit gehen. Welche funktionalen Ansätze gibt es überhaupt in der Translationswissenschaft? Was versteht man unter adäquatem Übersetzen und welche Möglichkeiten bietet die Alternative des äquivalenten Übersetzens? Fragen wie diese sollen zusammen mit einigen Beispielen durch die Hausarbeit führen.
Dafür müssen zunächst die Begrifflichkeiten der Adäquatheit und der Äquivalenz erklärt sowie deren größte Unterschiede und Gemeinsamkeiten genannt werden. Darauf folgt der Hauptteil dieser Arbeit, in dem die funktionalen Ansätze der Translationswissenschaft erläutert werden. Darunter fallen hier die Skopostheorie, die Theorie vom Translatorischen Handeln sowie die Scenes-and-frames-Semantik. Anschließend wird die Option des äquivalenten Übersetzens kurz vorgestellt und deren Vorgehensweise und Ziele näher erklärt. Am Schluss steht ein Fazit, in dem die Ergebnisse knapp zusammengefasst und interpretiert werden.
2Was ist adäquates und äquivalentes Übersetzen?
Adäquatheit kommt von dem lateinischen Wort adaequare und bedeutet so viel wie Angemessenheit oder Anpassen.[3] Bezeichnet man die Übersetzung eines Ausgangstextes als adäquat, so ist damit gemeint, dass während des Übersetzungsprozesses der Sinn und Zweck des Translats als vorrangig angesehen wird.[4] Das heißt, dass eine größtmögliche Übereinstimmung von Übersetzung und Kommunikationsziel gefunden werden soll. Der Ausgangstext kann somit verändert und zum Beispiel gekürzt oder ergänzt werden. Dies richtet sich nach dem jeweiligen Übersetzungsauftrag, denn er bestimmt den angestrebten Zweck des Translats.[5] Hierzu ein einfaches Beispiel: Ein Übersetzer bekommt den Auftrag, einen Artikel, der in einer englischsprachigen, medizinischen Fachzeitschrift erschienen ist, für ein deutsches, populäres Magazin zu übersetzen. Er entscheidet sich dafür, die medizinischen Fachbegriffe zu umschreiben oder zu ersetzen, damit die Leserschaft des deutschen Magazins, die sich hauptsächlich aus Laien zusammensetzt, den Artikel nachvollziehen kann.[6] Der Übersetzer hat den Ausgangstext also adäquat übersetzt.
Eine äquivalente Translation setzt dagegen voraus, dass der Ausgangstext sowie die Übersetzung in ihrer jeweiligen Kultur den gleichen Rang beziehungsweise die gleiche Wertigkeit haben.[7] Dafür muss die Übersetzung die kommunikative Funktion des Originals beibehalten.[8] Christiane Nord definiert Äquivalenz, kommend vom lateinischen Wort aequivalentia, was in etwa Gleichwertigkeit bedeutet[9], auch als Treue gegenüber dem Originaltext.[10] Wird eine Übersetzung als äquivalent bezeichnet, so sollte sich in dieser folglich eine größtmögliche Übereinstimmung von Zieltext und Ausgangstext finden lassen und nicht von Zieltext und Kommunikationsziel wie in adäquaten Translaten.[11] Hätte der Übersetzer im obigen Beispiel also die Fachtermini nicht umschrieben oder ersetzt, sondern sie trotz der sich ändernden Leserschaft beibehalten, so hätte er eine äquivalente Übersetzung angefertigt.
3 Die funktionalen Ansätze der Translationswissenschaft
Nachdem die Begrifflichkeiten nun erläutert wurden, widmet sich dieses Kapitel jenen Übersetzungstheorien, die den Fokus auf die Adäquatheit und den kommunikativen Charakter der Übersetzung richten. Vorher sei noch gesagt, dass nicht vergessen werden sollte, dass auch das translatorische Handeln eine Form der Kommunikation ist. Denn es ist nicht nur der Autor, der mithilfe des Geschriebenen der Leserschaft etwas mitteilt, sondern auch der Übersetzer, der durch sein Translat mit dem Publikum des Zieltextes kommuniziert. Daher gelten auch bei einer Übersetzung die Prinzipien des kommunikativen Handelns als Grundlage.[12]
3.1 Skopostheorie
Die Skopostheorie wurde 1984 von den Linguisten Katharina Reiß und Hans Josef Vermeer aufgestellt. Das Wort Skopos meint dabei so viel wie Zweck oder Ziel.[13] Laut dieser Theorie ist die Aufgabe des Übersetzers folgende:
Er [der Translator] soll anhand eines AT [Ausgangstextes] mit anderen (sprachlichen) Mitteln einen neuen Text verfassen, der für andere Rezipienten bestimmt ist und unter anderen kulturellen Gegebenheiten funktionieren soll als der AT.[14]
Das bedeutet also, dass es das Ziel des Übersetzers ist, einen neuen Text in einer anderen Sprache zu erschaffen, der zwar den Originaltext als Quelle hat, aber andere sprachliche Mittel verwendet. Der Gebrauch anderer Mittel ist notwendig, da sich die Übersetzung nicht mehr an die Leserschaft des Ausgangstextes richtet, sondern an einen neuen Rezipienten, der einen anderen kulturellen Hintergrund hat als der Leser des Originals. Reiß und Vermeer betonen dabei, dass das Translat nicht dieselbe Funktion erfüllen muss wie der Ausgangstext, es also keine Funktionskonstanz vorliegen muss. Die Funktion des Ausgangstextes ist für die Translation vorerst sogar unwichtig. Die oberste Priorität ist dagegen, dass die Übermittlung der intendierten Informationen im übersetzten Text funktioniert und der Zieltext somit die Informationen weitergibt, die er laut dem Skopos auch weitergeben soll.[15] Damit dies erfolgreich vonstattengeht, sollten die drei Komponenten Zielorientierung, Adressatorientierung sowie Kulturorientierung beachtet werden, die in den folgenden Absätzen erläutert werden.
Eine der wichtigsten Fragen, die sich der Translator vor seiner Arbeit stellen muss, ist die Frage nach dem Wozu. Wozu soll die Übersetzung angefertigt werden und welchen Sinn und Zweck muss sie laut Übersetzungsauftrag erfüllen? Soll sie eine werbende, eine informierende oder eine narrative Funktion ausüben? In der Skopostheorie gilt dabei nicht die Annahme, dass alle Informationen aus dem Originaltext übernommen werden müssen. Stattdessen sollten nur solche Informationen ausgewählt werden, die für den Skopos tatsächlich relevant sind. Der zu übersetzende Text ist somit lediglich ein Angebot an Informationen und kann je nach Zielorientierung ergänzt oder gekürzt werden. An dieser Stelle zeigt sich sehr deutlich, dass bei dieser Theorie die Adäquatheit und nicht die Äquivalenz im Vordergrund steht.[16]
Dazu ein Beispiel: Ein aus der USA stammender Mann möchte sich um eine Stelle in einer deutschen Firma bewerben, wofür er seine Arbeitszeugnisse übersetzen lassen soll. Dem beauftragten Übersetzer muss nun die Funktion seiner Arbeit bewusst sein, denn an dieser Stelle könnte er einen für den Amerikaner fatalen Fehler begehen. Amerikanische Arbeitszeugnisse enthalten nämlich in der Regel lediglich eine Affirmation über die Beschäftigung, aber keine weiteren Informationen zu der sozialen Leistung oder anderen Fähigkeiten wie es in deutschen Arbeitszeugnissen der Fall ist. Würde das Arbeitszeugnis ohne eine Anmerkung des Translators übersetzt werden, so würde es bei dem möglichen Arbeitsgeber vermutlich zu einem negativen Eindruck des Bewerbers kommen. Folglich muss der Übersetzer eine Erklärung zum Arbeitszeugnis hinzufügen, sofern er das Kommunikationsziel einhalten möchte.[17]
Der nächste Bestandteil der Skopostheorie ist die Frage nach dem Rezipienten des Zieltextes. Für wen soll die Übersetzung angefertigt werden und welchen Personenkreis oder Leser soll sie ansprechen? Für welches Geschlecht oder welche Alters- und Interessengruppe ist sie gedacht? Die Antworten auf diese Fragen sind entscheidend, denn der Übersetzer muss sein Zielpublikum genau kennen, um dessen Wissen einschätzen zu können. Sollten nämlich bei dem Rezipienten während des Lesens aufgrund der Übersetzung Unklarheiten entstehen, so hat der Translator sein Ziel verfehlt. Im Übersetzungsprozess darf die Tatsache nicht in den Hintergrund treten, dass der Originaltext sich an eine Leserschaft mit einem bestimmten Wissensstand richtet, dieser Wissensstand sich aber nicht mit dem der Leserschaft des Translats decken muss. Der Übersetzer sollte also so handeln, dass sein Publikum den Zieltext vollständig verstehen kann.
Als Beispiel lässt sich hier ein Textausschnitt aus einem Artikel der New York Times anführen, in dem es um Schlaflosigkeit während der Schwangerschaft geht. Übersetzt werden soll er für ein deutsches Apothekenmagazin, dessen Leserschaft größtenteils aus Hausfrauen mittleren Alters besteht.
(1a) One of the cruel jokes of motherhood is that the sleeplessness of pregnancy, followed by the sleeplessness generated by an infant (a period in which a staggering – truly – 84 percent of women experience insomnia), is not followed by a makeup period of rest. It is merely the setup for what can become a permanent modus operandi.[18]
(1b) Einer der grausamen Scherze der Mutterschaft ist, dass auf die Schlaflosigkeit in der Schwangerschaft keine Erholungsphase folgt. Es ist eher eine Vorbereitung auf das, was zu einem dauerhaften Zustand werden kann. Denn erschreckende 84% der Frauen leiden unter Schlaflosigkeit, die durch das Neugeborene ausgelöst wird.
Die verschachtelte Satzstruktur aus dem Artikel der New York Times wurde in der Übersetzung aufgelöst und in einfachere, kürzere Sätze umgewandelt. Die Anordnung der Informationen wurde geändert und Fachbegriffe wie modus operandi durch simplere Wörter ersetzt. Der Zieltext wurde also den deutschen Leserinnen, ihrem Wissen und Sprachniveau angepasst, statt den Sprachstil des Ausgangstextes - angepasst an die Rezipienten der New York Times - beizubehalten.
Die letzte Komponente betrifft die Kultur, in der der Ausgangstext stehen soll. Für welche Kultur wird hier übersetzt? In welche Situation wird er platziert? Dieser Faktor sollte nicht unterschätzt werden.[19] Kultur beeinflusst alle Lebensbereiche eines Individuums sowie dessen Wahrnehmung und Handlung[20] und somit hat sie auch Einfluss auf die Gestaltung und das Verständnis eines Textes. Ein Übersetzer sollte bedenken, dass die Textstelle, die er übersetzt, niemals unabhängig von einem ganzen Text steht. Dieser Text wiederum ist Teil einer Situation und die Situation ist in die Kultur eingebettet. Die zu übersetzende Textstelle ist folglich ein Bestandteil eines großen Gefüges und kann nicht losgelöst von der Kultur betrachtet werden. Ignoriert der Übersetzer diesen Zusammenhang, kann dies negative Folgen haben. Im gravierendsten Fall wird das Translat vom Leser nicht verstanden und funktioniert somit nicht.[21]
Beispielhaft für die Kulturorientierung wäre ein englischsprachiger Artikel, der für eine deutsche, jüdische Tageszeitung übersetzt werden soll. Im Original kommt folgender Satz vor:
(2) Apparently, a growing number of Americans are running from organized religion, but by no means running from God.
Im Judentum wird es zum Teil sehr streng genommen mit der Auffassung, dass sich kein Bild von Gott gemacht werden darf. Dazu kann auch gehören, dass das Wort an sich in einem geschriebenen Text unkenntlich gemacht wird, aus Gott also G’tt[22] wird. Würde ein Übersetzer diese sprachliche Besonderheit in der Kultur nicht beachten, wäre es kein allzu großer Fauxpas. Jedoch ist es ein Zeichen des Respekts und der Akzeptanz, wenn er die kulturelle Gegebenheit berücksichtigt.
3.2 Theorie vom Translatorischen Handeln
Die nächste Übersetzungstheorie stammt von der Finnin Justa Holz-Mänttäri aus dem Jahr 1984. Sie kann als eine Erweiterung der Skopostheorie gesehen werden,[23] denn auch hier steht im Vordergrund, welchen Zweck das Translat erfüllen soll. Jedoch ist dies nicht der einzige Aspekt, auf den sich Holz-Mänttäri in ihrer Theorie fokussiert. Vielmehr geht es darum, dass der Übersetzer nicht als alleiniger Akteur handelt, sondern er Teil eines Gefüges ist.[24] Dabei spielen die Schlagwörter Expertenhandlung, Handlungsgefüge sowie Botschaftsträger eine entscheidende Rolle, die nun näher beleuchtet werden.
Das translatorische Handeln beinhaltet, dass der Übersetzer die Verantwortung für seine Arbeit trägt. Das heißt, es ist seine Aufgabe, dass das Translat in der Zielkultur und vom Zielrezipienten verstanden werden kann und er muss die Konsequenzen tragen, falls dem nicht so ist. Für eine erfolgreiche Übersetzung sollte am Anfang eine Analyse der Gesamtsituation stehen. Diese beinhaltet nicht nur eine Ausgangstextanalyse, sondern auch die Beantwortung der Fragen, die bereits in der Skopostheorie aufgeworfen wurden, nämlich wozu, für wen und für welche Situation das Translat gedacht ist. Der Übersetzungsprozess fordert ein hohes Maß an Flexibilität, denn jeder Übersetzungsauftrag unterscheidet sich vom vorherigen und jedes Mal treten individuelle Komplikationen auf.[25] Nach der Gesamtanalyse muss der Translator schließlich entscheiden, ob der vorliegende Ausgangstext als Vorlage für die intendierte Funktion geeignet ist. Wichtig ist dabei, dass die Übersetzung ausschließlich zu der festgelegten Funktion passen und ausschließlich unter Berücksichtigung genau dieser Funktion verstanden werden muss.[26]
Als Beispiel für den Translator als Experte lässt sich die Übersetzerin aus der Einleitung nennen. Sie führte die Gesamtanalyse nicht gewissenhaft genug durch, weshalb ihre Übersetzung schlussendlich nicht funktionierte. Da sie aber als Expertin die Verantwortung für das Resultat trug, konnte sie aufgrund ihres Handelns gerichtlich zur Rechenschaft gezogen werden.
Wie bereits erwähnt, ist der Übersetzer in der Theorie vom Translatorischen Handeln als ein Gruppenmitglied zu betrachten. Seine Aufgabe besteht nicht nur darin, einen Ausgangstext zu übersetzen, sondern auch darin, mit zahlreichen Mitmenschen zu kooperieren, die auf dasselbe Ziel hinarbeiten wie der Übersetzer.[27] Zusammen erstellen sie ein Designprodukt, also eine Art Ware, die eine andere Person für einen konkreten Zweck geordert hat.[28] Wie aber sieht nun solch ein Arbeitsprozess aus? Holz-Mänttäri nennt sechs Personen oder Personengruppen, die wesentlich an dem Prozess beteiligt sind, wobei manche Personen auch mehrere Aufgaben inne haben können.
Am Anfang der Kette muss natürlich derjenige stehen, der das anzufertigende Produkt benötigt. Das ist der sogenannte Bedarfsträger. Zum Beispiel könnte dies ein amerikanisches Unternehmen für Hygieneartikel sein, das künftig auch Shampoo herstellen und in den USA sowie in Deutschland vertreiben möchte. Dafür kontaktiert der Bedarfsträger eine amerikanische Werbeagentur, die nun das Design einer Shampooflasche entwerfen soll. Dafür wird auch eine Person benötigt, die die englischsprachigen Texte auf der Vorder- und Rückseite der Flasche erstellt, welche den Kunden über das Produkt informieren sollen. Diese Aufgabe erhält ein Mitarbeiter der Werbeagentur, der somit der Ausgangstext-Produzent ist. Nachdem Design und Text von dem Bedarfsträger abgenommen wurden, engagiert die Werbeagentur schließlich eine Übersetzungsfirma, womit die Agentur zum Besteller des Translats wird. Bei der Übersetzungsfirma wird nun ein Translator beauftragt, die englischsprachigen Texte auf der Shampooflasche in das Deutsche zu übertragen. Er als Experte muss nach der Gesamtanalyse beurteilen, ob die Ausgangstexte, aber auch eventuelles Bildmaterial, für eine Übersetzung in die deutsche Sprache und Kultur geeignet sind. Möglicherweise muss sich der Translator mit der amerikanischen Werbeagentur in Kontakt setzen, um mithilfe einer Grafikerin an dem Design des deutschen Produkts Änderungen durchführen zu lassen. So könnte beispielsweise eine andere Bildauswahl getroffen werden, falls auf der amerikanischen Shampooflasche Bilder gedruckt sind, die nicht zum deutschen Markt passen. Die übersetzten Texte können nun vom Zieltext-Applikator sowie vom Zieltext-Rezipienten genutzt werden. Der Applikator stellt dabei eine Person oder Personengruppe dar, die mit dem Translat arbeitet. In dem gewählten Beispiel könnte das etwa die Firma sein, die den Zieltext auf die Shampooflaschen druckt. Der Rezipient ist dagegen derjenige, für den das Translat angefertigt werden sollte, in diesem Fall der Kunde, der sich für das Shampoo interessiert.[29]
Es ist also ein komplexes Handlungsgefüge, in dem sich der Übersetzer bewegen und kooperieren muss. Holz-Mänttäris Theorie zeigt, dass das Übersetzen an sich ein Glied in der Kette ist und in der Regel nicht für sich alleine steht.
Der dritte Kernbereich der Theorie beschäftigt sich mit der Übersetzung als Botschaftsträger. Der Translator muss entscheiden, welche Form der Zieltext haben soll, also ob er aus verbalen oder non-verbalen Elementen wie zum Beispiel Skizzen bestehen soll. Um dies zu entscheiden, muss auch hier wieder eine umfassende Analyse des Ausgangstextes und der Zieltext-Rezipienten durchgeführt werden. Nach dieser Prüfung kann es passieren, dass das Medium, welches im Ausgangstext verwendet wurde, für den Zieltext nicht sinnvoll erscheint. So könnte zum Beispiel eine chinesische Bedienungsanleitung für ein elektronisches Gerät aus einer sehr ausführlichen, textlichen Erklärung bestehen. Bei einer Übersetzung in die deutsche Sprache ist diese Fülle an Informationen jedoch nicht nötig, da die Kultur mit diesem speziellen Gerät wesentlich vertrauter ist als die chinesische. Daher wäre es hier sinnvoll, den Botschaftsträger Text in den Botschaftsträger Bild umzuwandeln und dementsprechend in der deutschen Gebrauchsanweisung kleine Skizzen statt Text einzufügen.[30]
3.3 Scenes-and-frames-Semantik
Der letzte hier zu erläuternde funktionale Ansatz in der Translationswissenschaft beschäftigt sich mit der Prototypensemantik, entwickelt von der Psychologin Eleanor Rosch in den Siebziger Jahren, und das darauf aufbauende Konzept der Scenes-and-frames des Linguisten Charles J. Fillmore aus dem Jahr 1977.[31] Grundlage in beiden Theorien ist die Annahme, dass ein Text an sich keine Bedeutung hat. Die Bedeutung entsteht erst, wenn der Leser den Text rezipiert und hängt dann von der Art und Weise ab, wie der Leser den Text versteht. Dieser Verarbeitungsprozess ist wiederum zum Beispiel an soziologische und kulturelle Faktoren gebunden. Daher ist es auch hier, genauso wie in der Skopostheorie, ausschlaggebend, für wen und wozu das Translat angefertigt werden soll.[32]
Roschs Theorie nimmt an, „dass Bedeutung aus Erfahrung aufgebaut wird und zur Bildung von so genannten Prototypen führt“[33]. Damit meint sie, dass ein Mensch und seine Erfahrungen von dem sozialen und kulturellen Umfeld, in dem er aufgewachsen ist oder momentan lebt, geprägt werden. Die Bedeutung, die bestimmten Begriffen zugeschrieben wird, hängt dann von diesen Erfahrungen ab und variiert von Person zu Person, am stärksten jedoch bei solchen, die in verschiedenen Kulturen leben. Durch die im Laufe der Jahre angesammelten Erfahrungen entwickelt der Mensch ein prototypisches Bild für einen Begriff, das zum einen aus dem Kern besteht und zum anderen aus verschwommenen Rändern.[34] Dazu ein Beispiel: Wenn ein Deutscher gebeten wird, ein Obst zu nennen, so wird er vermutlich zuerst an Äpfel, Birnen, Bananen und an weitere in Deutschland verbreitete und beliebte Obstsorten denken. Diese bilden für ihn den Prototypenkern. Früchte wie Papayas, Kumquats oder Kakis gehören dagegen nicht zu seinen ersten Antworten, eventuell sind sie ihm sogar unbekannt. Solche Obstsorten bilden den verschwommenen Rand, da sie weniger stark mit dem Begriff assoziiert werden. In anderen Ländern und Kulturen bilden aber genau solche Früchte wie die Papaya den prototypischen Kern und Äpfel beispielsweise gehören eher zum Rand. Rosch nannte als Beispiel für ihre Theorie die Frage nach einem typischen Vogel. Für die eine Kultur war das vorrangige Merkmal eines Vogels seine Flugfähigkeit und nannte daher Arten wie das Rotkehlchen. In anderen Kulturen spielte dagegen das Eierlegen eine große Rolle und hier waren die häufigsten Antworten Strauße oder Pinguine. Es wird also deutlich, dass die Bedeutungen und Eigenschaften eines Begriffs stark kulturabhängig sind und von Rezipient zu Rezipient variieren.[35]
Welchen Einfluss hat die Prototypensemantik nun auf den Übersetzungsprozess? Dem Translator muss bewusst sein, dass seine Zielleserschaft mit bestimmten Wörtern aus dem Originaltext andere Eigenschaften verbinden könnte als die Leser des Ausgangstextes. Mit solch einem Problem war zum Beispiel der Übersetzer Burkhart Kroeber konfrontiert, der das Werk Der Name der Rose translatierte. Gemeint sind folgender Satz und folgende Übersetzung:
(3a) Era una bella mattina fine di novembre.[36]
(3b) Es war ein klarer spätherbstlicher Morgen gegen Ende November.[37]
Kroeber fügte das Wort spätherbstlich in der Übersetzung hinzu, damit der deutsche Leser mit dem Monat November keine Attribute wie kalt, regnerisch oder ungemütlich verband. In dem Ausgangstext war diese Beschreibung nicht nötig, da die Italiener mit dem November solche Wörter assoziieren, die Deutsche mit dem goldenen Oktober verknüpfen.[38]
Auch das Scenes-and-frames-Konzept fokussiert sich auf Assoziationen, die verschiedene Kulturen mit einem Begriff haben. Fillmore benutzt dafür die Wörter scene und frame, was sich mit Ansicht, Szene und Rahmen, Gerüst übersetzen lässt. Gemeint ist mit einer scene das Bild vor dem inneren Auge eines Rezipienten, das durch eine Kognition ausgelöst wird. Es ist die Vorstellung, die eine Person zu einem bestimmten verbalen oder non-verbalen Reiz hat.[39] Das Beispiel (3b) eignet sich dazu, dies zu verdeutlichen. Bei den Worten klarer spätherbstlicher Morgen gegen Ende November besteht die scene beispielsweise aus einem blauen Himmel, Sonnenschein, leichter Wärme und heruntergefallenem Laub. Wie bereits erwähnt, muss es jedoch keinen verbalen Auslöser geben, denn auch Gerüche, Musik oder Geschmäcke können eine scene hervorrufen.[40] Riecht ein deutsches Kind etwa den Duft von frischgebackenen Plätzchen, so werden in seinem Kopf sofort Bilder wie Weihnachtsbaum, Geschenke und Winter entstehen.
Unter einem frame stellt sich Fillmore den kommunikativen Term vor, der eine scene hervorruft.[41] Dies könnte zum Beispiel das Wort Ostern sein, aber auch wieder non-verbale Reize wie der Geruch von Chlor, das Hören eines Glockenschlags oder das Spüren von Sand unter den Füßen. Folglich kann im Prinzip jeder bemerkbare Reiz ein frame sein.
Auch muss es nicht zwangsläufig zuerst einen frame geben, der eine scene hervorruft, denn es kann auch zuerst eine scene entstehen, die anschließend mit einem bestimmten Rahmen in Verbindung gebracht wird. Wichtig für den Übersetzer ist es nun zu wissen, welche scenes bei der Leserschaft des Translats entstehen sollen und welche Schlüsselwörter er dafür benutzen muss. [42] Denn wie bei der Prototypensemantik die Assoziationen von Kultur zu Kultur variieren, so sind auch die frames kulturspezifisch.[43]
4Eine Alternative: äquivalentes Übersetzen
Wie bereits im zweiten Kapitel dieser Hausarbeit erläutert, unterschieden sich adäquate und äquivalente Übersetzungsmethoden signifikant. Nachdem nun die funktionalen Ansätze ausführlich präsentiert wurden, soll an dieser Stelle auf das äquivalente beziehungsweise auf das einbürgernde und das verfremdende Übersetzen eingegangen werden.
Um die beiden zuletzt genannten Begriffe zu erklären, eignet sich ein Zitat von Friedrich Schleiermacher aus dem 19. Jahrhundert:
Entweder der Uebersezer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen.[44]
Der zweite Teil dieser Erklärung bezieht sich auf das einbürgernde Übersetzen. Dabei soll der Text dem Leser nahe gebracht werden, das heißt, er wird an den Zielrezipienten und dessen Kultur angepasst. Die Übersetzung richtet sich folglich nach den Kenntnissen und Erwartungen, die der Leser des Zieltextes hat, was im Prinzip die Vorangehensweisen der bisher beschriebenen adäquaten Ansätze widerspiegelt. Dominierte diese Auffassung noch im 17. und 18. Jahrhundert, forderten ihre Gegner im 19. Jahrhundert die Berücksichtigung der verfremdenden Translation, beschrieben in dem ersten Teil von Schleiermachers Zitat. Hier soll der Übersetzer sein Translat nicht an die Leserschaft und ihre Kultur anpassen, sondern die kulturellen Eigenheiten und sprachlichen Strukturen des Ausgangstextes beibehalten.[45] Bei beiden Übersetzungsmethoden geht es folglich um den Grad an Ausgangstext-Gebundenheit[46].
Ein Vertreter des verfremdenden Übersetzens war der spanische Philosoph José Ortega y Gasset. In seinem Aufsatz Miseria y Esplendor de la Traducción (Elend und Glanz der Übersetzung) erläutert er in einer fiktiven Gruppendiskussion seine Ansichten bezüglich der Linguistik und Translation. Er bemängelt, dass die einbürgernde Übersetzung eine zu häufige Anwendung findet.[47] Für ihn entsteht eine korrekte Translation nur dann, wenn der Zieltextrezipient nicht mit seinen gewohnten Sprachgewohnheiten, sondern mit denen des Originals konfrontiert wird.[48] Ortega y Gasset wollte die Fremdartigkeit des Originals beibehalten, sie sogar betonen und den persönlichen Schreibstil des Ausgangstext-Autors nicht verschleiern. Dafür kann es durchaus möglich sein, die Grammatikregeln der Zielsprache bis zum Maximum ausdehnen zu müssen, sodass der Zieltext schwer verständlich wird.[49]
Der Philosoph weist große Parallelen zu den Vertretern der Äquivalenztheorien auf, die eine größtmögliche Übereinstimmung von Ausgangstext und Zieltext fordern. Er schneidet aber auch das Problem an, das in der Scenes-and-frames-Semantik erläutert wird. Er erklärt, dass das deutsche Wort Wald zwar im Wörterbuch mit dem spanischen Ausdruck bosque übersetzt wird, die Assoziationen, die beide Kulturen mit dem jeweiligen Begriff haben, sind jedoch vollkommen verschieden. So kommt auch Ortega y Gasset zu der Erkenntnis, dass ein Translat nicht funktioniert, wenn beim Leser des Zieltextes ungewollt ein anderes mentales Bild von einem Ausdruck entsteht als beim Leser des Ausgangstextes.[50]
Zu beachten ist dabei, dass Ortega y Gasset seine Ansichten auf Textstücke der Literatur und Philosophie bezieht. Gerade bei solchen Textsorten kann die Verfremdung anregend für den Leser sein. Bei anderen Texten, wie zum Beispiel Werbe- oder Fachtexte, sollte von einer verfremdenden Translation abgesehen werden. Denn diese haben den hauptsächlichen Zweck, die intendierten Informationen zu übermitteln und nicht, den Rezipienten dem Verfasser näher zu bringen. So ist es etwa bei einer deutschen Gebrauchsanweisung nicht förderlich, wenn dort die sprachlichen Strukturen des spanischen Originals rekonstruiert werden, statt sie dem deutschen Leser anzupassen. Wie lassen sich nun adäquates und äquivalentes beziehungsweise einbürgerndes und verfremdendes Übersetzen miteinander vereinbaren? Die beiden Methoden können durchaus kombiniert werden. Auch wenn der Übersetzer sich für eine Variante entschieden hat, so muss er nicht durchgängig bei ihr bleiben. Bei einzelnen Übersetzungsschwierigkeiten kann beispielsweise ein äquivalentes Übersetzungsverfahren angewendet werden, obwohl der restliche Text adäquat translatiert wird.[51]
5 Fazit
Nachdem nun ausgewählte adäquate sowie äquivalente Übersetzungsansätze erläutert wurden, sollen hier die Ergebnisse kurz zusammengefasst und die Fragen aus der Einführung beantwortet werden.
Die Skopostheorie, die Theorie vom Translatorischen Handeln sowie die Scenes-and-frames-Semantik bieten Anweisungen und Hilfestellungen, wie eine adäquate, funktionale Übersetzung angefertigt werden kann. In allen drei Theorien spielt der Zweck des Translats die entscheidende Rolle, aber auch die Orientierung an Zielrezipient und Zielkultur ist wichtig. Bei den äquivalenten Übersetzungsmethoden ist dagegen die Treue dem Originaltext gegenüber entscheidend. Wie Ortega y Gasset es beschreibt, soll sich der Leser mithilfe des Translats dem Autor nähern und nicht andersherum.
Beide Übersetzungsmethoden zeigen bei strikter Einhaltung ihre Vor- und Nachteile. Die adäquate oder die einbürgernde Variante ist sehr auf den Leser der Übersetzung fixiert und versucht, ihm das Lesen so komfortabel und angenehm wie möglich zu gestalten. Diese Aspekte spielen in der äquivalenten oder verfremdenden Variante eine untergeordnete Rolle, denn sie konzentriert sich auf den Ausgangstext und seine charakteristischen Züge, die so ausgeprägt wie möglich beibehalten werden sollen. Die Äquivalenz bietet dem Leser die Option, in die sprachliche Welt des Autors einzutauchen und eventuell Teile einer anderen Kultur kennenzulernen.
6Quellenverzeichnis
ALBRECHT, Jörn (2005) :
Grundlagen der Übersetzungsforschung. Übersetzung und Linguistik. Tübingen : Gunter Narr Verlag
BLANK, Andreas (2010) :
Einführung in die lexikalische Semantik für Romanisten. Tübingen : Max Niemeyer Verlag
DIZDAR, Dilek (1998) :
Skopostheorie. In : Handbuch Translation, hrsg. von Mary SNELL-HORNBY et al. Tübingen : Stauffenburg Verlag
DUDEN (2012) :
Äquivalenz. (modifiziert : 8. März 2012. Zugriff : 8. März 2012, 14:06 MEZ)
<http://www.duden.de/rechtschreibung/Aequivalenz>
KADRIC, Mira; Klaus KAINDL, Michèle KAISER-COOKE (2010) :
Translatorische Methodik. 4. überarb. Aufl. Wien : Facultas WUV
NEUMANN, Daniel AUF JÜDISCHE ALLGEMEINE (2011) :
Unser Schicksal. (modifiziert : 16. Juni 2011. Zugriff : 13. März 2012, 17:43 MEZ)