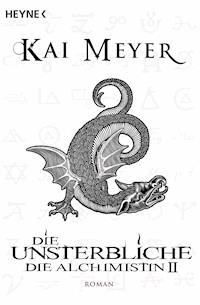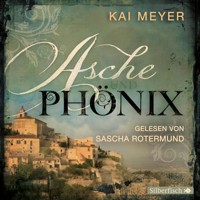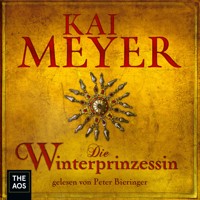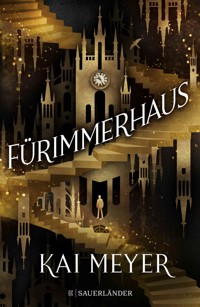
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Fürimmerhaus steht zwischen den Welten, am Ufer eines dunklen Ozeans. Es hat tausende Hallen und Säle, seine Korridore sind endlos. Und noch immer wächst es weiter und verändert sich. Im Fürimmerhaus stranden junge Heldinnen und Helden, die ihre Welten vor dem Untergang bewahrt haben. Die Herrschenden fürchten ihre Macht und schicken sie hierher ins Exil. Doch Carter ist kein Held wie die anderen. Er besitzt keine Erinnerung, ist nur von einem überzeugt: Er hat niemals eine Welt gerettet. Und so begibt er sich auf die abenteuerliche Reise durch das Fürimmerhaus, auf der Suche nach seiner Bestimmung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kai Meyer
Fürimmerhaus
Biografie
Kai Meyer ist einer der wichtigsten deutschen Phantastik-Autoren. Er hat rund sechzig Romane veröffentlicht, Übersetzungen erscheinen in dreißig Sprachen. Seine Geschichten wurden als Film, Hörspiel und Graphic Novel adaptiert und mit Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Zu diesem Buch ist im Argon Verlag ein Hörbuch, gelesen von Simon Jäger, erschienen, das im Buchhandel erhältlich ist.
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Alexander Kopainski unter Verwendung von Motiven von Shutterstock
Innenabbildung: Motiv von Shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0421-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
Als Mitternacht auf Mittag fiel, kam Carter ins Fürimmerhaus.
Er erwachte – und begriff, dass er ertrank. In Panik riss er die Augen auf. Er trieb in lauwarmem Wasser, in absoluter Dunkelheit. Strampelte mit Armen und Beinen, bis sein Gesicht durch die Oberfläche stieß. Schnappte verzweifelt nach Luft, schluckte Wasser, ging unter, kämpfte sich erneut nach oben und atmete begierig ein.
Hoch über ihm in der Finsternis schimmerte jetzt ein grauer Punkt. Der Mond, dachte er, bis ihm klarwurde, dass dieser Mond immer näher kam und größer wurde, so als stürzte er aus einem sternenlosen Himmel auf ihn herab. Das Plätschern des Wassers hallte hohl von unsichtbaren Wänden wider. Da dämmerte Carter, dass er in einem Brunnenschacht trieb, dass das Wasser rasend schnell anstieg und ihn nach oben presste wie eine Kugel durch ein Kanonenrohr. Wieder verschluckte er sich, versuchte zugleich, seine rudernden Arme unter Kontrolle zu bringen, ruhiger zu werden, die Todesangst in den Griff zu bekommen.
Das Wasser drückte ihn mit irrwitzigem Tempo aufwärts, immer weiter aufwärts, und die helle Öffnung über ihm flirrte und funkelte, während Nässe in seine Augen drang und seine Sicht in ein Kaleidoskop aus Reflexionen und Schwärze zersplitterte. Mal setzte sich die Helligkeit dort oben aus Facetten zusammen wie ein geschliffener Diamant, dann wieder war sie scharf umrissen wie ein Auge, das auf ihn herabsah. Irgendwann bekam sie einen unwirklichen Lichtkranz, als rings um ihn das Mauerwerk beschienen wurde. Da wusste Carter, dass er das Ende des Schachts fast erreicht hatte. Nur noch ein paar Sekunden durchhalten.
Er glaubte, goldene Fische zu sehen, die mit offenen Mäulern wie mit Saugnäpfen an seinem Körper hingen, überall an seiner Haut. In einem Augenblick irrwitziger Klarheit fragte er sich, ob sie es waren, die ihm seine Erinnerung raubten, seine Vergangenheit verschlangen wie Algen oder Plankton. Oder waren sie Trugbilder, glitzernde Lichtgebilde und Spiegelungen, nichts als fiebrige Einbildung?
Seine Beine traten Wasser, während er versuchte, sich an der Oberfläche zu halten, um nur ja nicht wieder unterzugehen, nicht zu ertrinken auf den letzten zwanzig, den letzten fünfzehn Metern. Als wollte sich das Schicksal zuletzt noch einen bösen Scherz erlauben, spülte ihm eine Woge übers Gesicht, flutete seinen Mund und schnitt ihm die Luft ab. Er würgte und hustete, verlor die Brunnenöffnung aus den Augen, wurde von dem heftigen Druck aus der Tiefe herumgewirbelt und verlor jedes Gefühl für oben und unten.
Und dann, als er Leben kaum noch von Tod unterscheiden konnte, spie ihn der Schacht in einer Explosion aus Wasser und Schaum in die Oberwelt. Wie auf einer gewaltigen gläsernen Blüte wurde er emporgehoben, wirbelte inmitten der Fontäne um sich selbst, dann brach die Wassersäule auseinander und schleuderte ihn über eine Brüstung auf den steinharten Boden.
Der Aufschlag tat weh, doch Carter stand viel zu sehr unter Schock, als dass er hätte sagen können, mit welchem Körperteil er aufgeprallt war. Einige Herzschläge lang erfüllte ihn der Schmerz von Kopf bis Fuß, ehe er ebenso abrupt abebbte. Wasser prasselte auf ihn herab, die Flut quoll über die Brüstung und den Boden, und er riss rasch den Kopf hoch, um nicht in letzter Ironie außerhalb des Brunnens zu ertrinken.
Erst auf dem Bauch, dann auf allen vieren kroch er ein Stück weit fort, patschte durch die Nässe, weg von dem Brunnenschacht, so als könnte eine riesige Hand aus der Öffnung greifen, ihn von hinten packen und zurück in die Tiefe ziehen.
Tatsächlich aber brach das Fauchen und Schäumen der Flut gleich darauf ab. Als Carter sich umdrehte, stürzte die Wassersäule zurück in den Brunnen und verschwand hinter der Brüstung. Er hörte sie im Inneren des Schachts lautstark tosen und gurgeln, doch der Lärm entfernte sich, fiel zurück in den Abgrund und war bald nur noch ein diffuses Murmeln in der Ferne.
Er versuchte aufzustehen, rutschte mit einem Fuß nach hinten weg, schlug abermals hin und bemerkte mit dem Gesicht am Boden, dass auch hier das Wasser ablief, durch ein Gitterwerk aus Fugen zu einer gemauerten Rinne. Er mühte sich erneut auf die Beine, jetzt viel vorsichtiger, und diesmal kam er schwankend zum Stehen. Keuchend und schnaubend stand er da, leicht gebückt von der Strapaze und zu verwirrt, um einen klaren Gedanken zu fassen. Es dauerte eine ganze Weile, ehe er seine Sinne weit genug beisammen hatte, um zu realisieren, dass er nackt war. Daran konnte er gerade nichts ändern, also blickte er sich erst einmal um.
Er befand sich in einer riesigen Halle, acht Meter hoch, vielleicht auch zehn, und niemand war da außer ihm. Keine Menschen, keine Einrichtung. Nur die runde, hüfthohe Brüstung des Brunnenschachts im Zentrum. Die dunklen, rohen Steinwände waren weit entfernt, in großen Abständen flackerten Gaslaternen. Sie tauchten den Saal in gelben Schein, hell genug, um sich zu orientieren. In einer Mauer entdeckte Carter eine Doppeltür, ein regelrechtes Portal, und er wartete angespannt darauf, dass es sich öffnen und irgendwer eintreten würde.
Niemand trat ein.
Benommen machte er sich auf den Weg zurück zur Einfassung des Schachts, wurde auf den letzten zwei Schritten langsamer und zögerte. Er hatte keine Ahnung, wohin es ihn hier verschlagen hatte, und er besaß keine Erinnerung an alles, was vor seinem Erwachen im Wasser gewesen war. Mit Ausnahme seines Namens. Falls Carter sein Name war. Tausend Fragen kreisten in seinem Kopf, und die Antworten mussten sich an jenem Ort befinden, von dem er gekommen war. Nach dem wenigen, was er wusste, war das der Grund des Brunnenschachts. Dort unten lag das Geheimnis seiner Herkunft und Identität.
Er gab sich einen Ruck und legte zitternd beide Hände auf die Brüstung. Der Schacht war gut zwei Meter breit, und als Carter sich vorbeugte und behutsam über den Rand in die Tiefe spähte, fand er darin nichts als Finsternis. Das trübe Licht in der Halle beschien die nasse Brunnenwand keine zehn Meter tief, darunter lag alles in undurchdringlicher Schwärze. Das Wassergetöse war nicht mehr zu hören, nur ein fernes Rauschen, so schwach, dass Carter die Luft anhalten musste, um es wahrzunehmen. Im Saal gab es nichts, das er hätte hinabwerfen können, um die Tiefe auszuloten. Zudem wollte er dort unten nichts aufwecken, dem er womöglich gerade erst entkommen war. Das mochte aller Vernunft widersprechen, aber er kam nicht dagegen an. Auch den Gedanken, einfach in den Schacht zu rufen und auf Antwort zu hoffen, verwarf er sofort.
Stattdessen horchte er erneut und bemerkte diesmal ein leises Geräusch. Ein leichtes Patschen, mal schnell, dann langsam, jetzt wieder schneller. Vor seinem inneren Auge sah er etwas Bleiches, Gespenstisches, das mit bloßen Händen und Füßen am Mauerwerk emporklomm – patsch-patsch, patsch-patsch – und jeden Moment ans Licht klettern mochte. Dann wurde ihm klar, dass die Laute keineswegs aus dem Inneren des Schachts kamen. Er trat einen Schritt zurück und sah sich um. Noch immer war er allein. Langsam machte er sich daran, die Einfassung zu umrunden. Nach der Hälfte wurde er fündig.
Ein Fisch lag unweit des Brunnens auf dem Boden, golden wie ein Schmuckstück und nicht länger als Carters Zeigefinger. Sein Maul öffnete und schloss sich verzweifelt, während die Schwanzflosse auf die nassen Steinplatten schlug und dabei die klatschenden Laute erzeugte.
Carter hob ihn behutsam auf, betrachtete ihn einen Moment lang und ging dann hinüber zu der Ablaufrinne im Boden. Sie war noch immer halbhoch mit fließendem Wasser gefüllt. Er ließ den kleinen Kerl hineingleiten und beobachtete, wie er nach der unverhofften Rettung einen Augenblick brauchte, um sich zu orientieren. Schließlich verfiel er in muntere Bewegung und trieb mit der Strömung die Rinne hinab durch die Halle. Carter folgte ihm, bis er selbst die Nässe rund um den Brunnen hinter sich gelassen hatte und seine nackten Füße über trockenen Stein liefen.
Es fiel nicht schwer, den Fisch im Blick zu behalten: Das Gaslicht fiel auf seine goldenen Schuppen und brachte ihn zum Schimmern wie eine kostbare Brosche.
Die Rinne endete in einer faustgroßen Öffnung am Fuß einer Wand. Ein wenig wehmütig sah Carter den Fisch darin verschwinden, ließ sich auf die Knie sinken und brachte ein Ohr ganz nah an das Loch. Tief im Mauerwerk hörte er Wasser rauschen, womöglich eine Art Kanalisation. Es war das Beste, was er seinem kleinen Leidensgenossen zu bieten hatte. Mehr konnte er nicht für ihn tun.
Er stand auf, streckte sich, ignorierte seine schmerzenden Muskeln und blauen Flecken, dann machte er sich auf den Weg zum Portal. Es waren etwa dreißig Schritt bis dorthin, und er legte sie zurück wie in Trance. Er hätte Angst haben müssen – nackt, allein und ohne Erinnerung an einem fremden Ort –, aber womöglich hatte die Panik im Schacht bereits all seine Furchtreserven aufgebraucht. Konnte ihn irgendetwas Schlimmeres erwarten als zu ertrinken? Außerdem brauchte er Hilfe, genau wie der Fisch, und wenn die Hilfe nicht zu ihm kam, dann würde er sie finden müssen.
Die Tür war schwer, jedoch nicht verschlossen, und dahinter lag ein zweiter Saal, nicht ganz so groß wie der erste, wenn auch auf seine Weise noch ehrfurchtgebietender. War die Halle mit dem Brunnen schmucklos gewesen, so war diese hier mit einer Vielzahl steinerner Ornamente verziert. Geschwungene Bögen rahmten die Wände, darüber spannten sich Kreuzgewölbe.
In der Mitte des Saals stand ein leerer Tisch ohne Stühle.
Und da war eine zweite Tür, genau gegenüber. Sie stand einen Spaltbreit offen.
Während er darauf zuging, fiel plötzlich ein weißer Lichtschimmer durch die Öffnung. Carter blieb stehen. Das Licht wurde heller, dann schob sich eine zierliche Gestalt durch den Spalt. Ein Mädchen in einem knielangen Kleid.
Alles an ihr war schneeweiß – die Haut, das Haar, das Kleid. Das helle Licht ging von ihr aus.
»Hab keine Angst«, sagte sie. Er schätzte sie auf fünfzehn oder sechzehn, ohne dass er hätte sagen können, wie er darauf kam. Er konnte sich an niemanden erinnern und somit auch an niemandes Alter.
»Bist du ein Geist?«, fragte er.
»Jedenfalls seh ich aus wie einer«, erwiderte sie, was ihm nicht weiterhalf, weil er zwar nackt und verwirrt war, aber nicht blind. Sie lächelte. »Ich hab dir Sachen zum Anziehen mitgebracht. Sie gehören Diabondo, aber sie müssten dir einigermaßen passen.«
Sie zog ein Kleiderbündel hervor, das sie bislang hinter ihrem Rücken versteckt hatte, als wollte sie ihn mit ihrem Geschenk überraschen. Dabei war doch sie selbst die größtmögliche Überraschung, denn als sie jetzt näher kam, gab es keinen Zweifel mehr: Das weiße Licht drang aus ihrem Inneren, brachte sie zum Glühen wie einen menschlichen Lampion.
»Du musst dich beeilen«, sagte sie mit einer Sorgenfalte zwischen den weißen Augenbrauen. »Wir müssen hier weg. Sie werden bald kommen und nach dir suchen.«
»Wer?«
»Ein Archon und seine Diener. Und wenn nicht sie, dann der Haushofmeister oder der Kammerherr.« Sie presste ihm die Kleidung mit Nachdruck vor die Brust. »Zieh das an! Schnell! Wir müssen los.« Das Lächeln war nun gänzlich von ihren Zügen gewichen.
Die Hose und das schlichte Leinenwams waren ein wenig zu groß. Wer immer dieser Diabondo war, er hatte längere Beine und breitere Schultern als Carter, der selbst recht kräftig war, wenn auch nicht allzu hochgewachsen.
»Ich bin Emmeline«, sagte das Geistermädchen. Als sie nach Carters Hand griff, waren ihre Finger kühl und dennoch solide wie seine eigenen.
»Carter«, sagte er.
»Carter«, wiederholte sie leise und legte erneut die Stirn in Falten. »Aber es war noch gar keiner hier, der dir gesagt hat, wie du heißt, oder?«
»Nein.«
»Das ist seltsam.« Sie neigte den Kopf zur Seite und musterte ihn argwöhnisch. »Du solltest dich an gar nichts erinnern können, auch nicht an deinen Namen.«
Hilflos zuckte er mit den Schultern. »Ich glaube jedenfalls, dass ich so heiße. Das ist auch schon das Einzige, was ich weiß.«
Sie blickte ihn einen Moment länger durchdringend an, dann nickte sie. »Am Anfang macht einen das verrückt. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran.« Er wollte nachhaken, doch sie legte einen Finger an ihre Lippen. »Später. Erst mal bring ich dich zu den anderen.«
Damit zog sie ihn mit sich zum Ausgang und den ungewissen Räumen auf der anderen Seite der Tür. Bevor sie den Saal verließen, hielt sie kurz inne und wandte ihm noch einmal ihre schmalen, zarten Züge zu.
»Willkommen«, flüsterte sie. »Willkommen im Fürimmerhaus.«
2
Auf einem Wachturm hoch über den Dächern hielt Ambra ihr Gesicht in den Seewind und schloss die Augen. Eine salzige Böe hob ihr dunkelrotes Haar von den Schultern und kitzelte damit die Haut in ihrem Nacken.
»Wir sollten nicht länger warten«, sagte Diabondo, der neben ihr hinter dem Zinnenkranz stand. Sein linkes Auge war mit einer Augenklappe bedeckt, die er mit ins Haus gebracht hatte. Sie ließ ihn älter erscheinen, und manchmal fragte Ambra sich, ob er das Ding nicht nur aus diesem Grund trug. Er hätte sich auch ein Holzbein umgeschnallt, wenn ihn die anderen dann endlich als ihren Anführer akzeptiert hätten.
»Wirklich«, sagte er, als sie nicht reagierte, »noch länger zu warten wird Calamina nicht retten.«
Dafür hätte sie ihm am liebsten das zweite Auge ausgestochen oder wenigstens die Nase gebrochen, aber sie blieb ruhig, auch weil sie wusste, dass Diabondo zwar eine Reihe elender Eigenschaften hatte, Böswilligkeit aber nicht dazugehörte. Und, zugegeben, Fingerspitzengefühl war auch keines ihrer Talente.
»Ich meine«, setzte er hinzu, als er ihr Schweigen korrekt als Wut deutete, »keinem ist geholfen, wenn wir die Sache hinauszögern. Geh du runter zu Calamina und kümmer dich um sie, dann sorge ich dafür, dass hier oben alles nach Plan läuft.«
Natürlich machte er es noch schlimmer. Wie üblich.
»Ich weiß schon, du hast ihre Schicht auf dem Turm übernommen, weil man es hier zu zweit besser aushält«, fuhr er fort. »Das rechne ich dir hoch an. Aber, ehrlich, mir macht’s nichts aus, wenn ich das hier allein machen –«
»Diabondo«, unterbrach sie ihn so gefährlich leise, dass der Seewind sie fast übertönte, »halt einfach die Klappe.«
»Ich hab’s nur gut gemeint.«
»Du meinst es verdammt nochmal immer gut, und das ist das Problem!« Nach wie vor schaute sie ihn nicht an, hatte aber die Augen wieder geöffnet und blickte hinaus aufs Meer, auf das Riff und das Wrack, das vor Urzeiten daran zerschellt war. Mit all seinen gesplitterten Planken sah es aus wie ein übergroßes Vogelnest, das auf der windumtosten Felsspitze thronte. Und im Grunde war es genau das. Ein Nest. Ein Außenposten der Treibholzmenschen.
Verwundert stellte sie fest, dass Diabondo schwieg, und sie beschloss, die unverhoffte Ruhe auszukosten. Ihr Blick wanderte abwärts zur Innenseite der Zinne, hinter der sie stand. Jemand hatte Verse in den Steinquader geritzt, und über die Jahre hatte sich Salz wie weiße Tinte in den Buchstaben festgesetzt. Das Gedicht mochte aus Zeiten stammen, in denen die Angriffe der Treibholzmenschen viel häufiger vorgekommen waren.
Eins für Horchen, Zwei für Sicht,
Drei für Licht und Widerlicht.
Vier für Angriff, Fünf für Blut,
Sechs für Furcht und Wagemut.
Sieben für die schwarzen Sterne,
Acht und Neun der letzten Ferne.
Doch die Zehn, das merk dir, Kind,
nur für uns und was wir sind.
Sie verstand nicht alles – was zum Kuckuck war ein Widerlicht? –, aber im Grunde war die Sache klar: Ein Wächter wie sie hatte sich beim Warten auf die nächste Attacke die Zeit vertrieben. Ambra verstand nicht das Mindeste vom Dichten, doch im Augenblick hätte sie sich lieber ein paar schiefe Reime abgerungen, als mit Diabondo über die ewig gleichen Themen zu streiten.
Sie nahm an, dass da noch mehr kommen würde, ein paar gutgemeinte Ratschläge und freundlich verpackte Vorwürfe. Gereizt wartete sie darauf, dass er fortfuhr und es hinter sich brachte.
Aber Diabondo blieb stumm, und das war ungewöhnlich. Als sie sich zu ihm umdrehte, bemerkte sie, dass er etwas ansah, das sich hinter ihnen befand.
»Ausgerechnet jetzt«, murmelte er.
Beunruhigt folgte Ambra seinem Blick über das endlose Dächerlabyrinth des Fürimmerhauses. Die niedrige Wolkendecke schien das Licht über den Giebeln und Schindelschrägen zusammenzupressen, bis alle Helligkeit in den ungezählten Innenhöfen und Kaminschächten versickerte. Übrig blieb ein endloser Dämmer, der niemals von Nacht oder Sonnenschein unterbrochen wurde. Hier gab es nichts als ewiges Halblicht, eine monotone Düsternis, die weder Morgen noch Abend war und erst recht nichts dazwischen. Vierundzwanzig Stunden am Tag dasselbe Grau, das sich am Himmel in den Wolken und in der Ferne in Nebelwänden verlor, seltsam körnig und dicht wie Grießbrei.
Die Dächerlandschaft des Hauses erstreckte sich in drei Richtungen, in der vierten lag die aufgewühlte See. Der Wachturm, von dem aus Ambra und Diabondo das Meer beobachteten, stand am einzigen bekannten Rand des Fürimmerhauses, hoch über der Steilküste. Die verschachtelte Masse des Hauses bedeckte jeden Quadratmeter Festland, womöglich einen ganzen Kontinent – so ganz genau wusste das niemand.
Ein gutes Stück weiter landeinwärts erhob sich zwischen Dachfirsten und moosbewachsenen Steinfeldern der Uhrturm, ein wuchtiges, viereckiges Ungetüm, höher als der Wachturm. Von ihrem Standpunkt aus konnte Ambra zwei der vier Uhren sehen, und auf beiden drehten sich die Zeiger so schnell, dass der kleine in kurzer Zeit zwölf Mal über das Ziffernblatt raste.
Diabondo hatte recht. Ausgerechnet jetzt.
Die Zeiger vollendeten ihre Runden auf der Zwölf. Ambra wusste, dass gerade dasselbe auf allen Uhren des Hauses geschah. Innerhalb einer Minute waren zwölf Stunden verstrichen. Mitternacht fiel auf Mittag. Und Mittag auf Mitternacht.
»Halbtag«, sagte Diabondo bitter. »Als hätte jemand geahnt, was wir vorhaben.«
»Das ändert gar nichts.«
Der hochgewachsene Junge schenkte ihr mit seinem einen Auge einen zweifelnden Blick. »Vielleicht ändert es nichts. Vielleicht aber auch eine ganze Menge.«
An Halbtagen kamen Neuzugänge ins Fürimmerhaus. Jede Ankunft kostete das Haus so viel Energie, dass es sich einen Teil davon anderswo beschaffen musste. Dann zapfte es die Zeit selbst an, verschlang einen halben Tag, um sich zu stärken.
»Wenn jemand Neues angekommen ist, wird ihn ein Archon in Empfang nehmen«, sagte Ambra. »Das wird sie ablenken, und wir können den Plan umso leichter durchführen.«
Diabondo sah aus, als wollte er widersprechen, presste dann jedoch die Lippen aufeinander, bis alle Farbe daraus entwichen war. Genau wie Ambra wollte er mit aller Macht daran glauben, dass ihr Vorhaben gelingen konnte. Dass ihr Fluchtplan so erfolgversprechend war, wie sie und die vier anderen es sich seit Wochen gegenseitig einredeten.
Auf beiden Turmuhren rückten die großen Zeiger eine Minute vor und standen wieder still. Alles war wie zuvor. Nur dass aus einem ganzen Tag ein halber geworden war. Und dass es womöglich einen siebten Gefangenen im Haus gab.
»Das ist der Ersatz für Calamina«, sagte Ambra niedergeschlagen. »Die wissen, dass sie bald sterben wird.«
Diabondo deutete auf die schwere Bronzeglocke, die über ihnen unter dem Holzdach des Wachturms hing. »Wir sollten jetzt endlich läuten und loslegen.«
Sobald das Alarmsignal erklang, würden die Famuli – die Diener der Archonten – zur Küstenseite des Hauses eilen, um sich dem vermeintlichen Angriff der Treibholzmenschen entgegenzustellen. Diesen Moment der Aufregung und des Durcheinanders wollten die sechs nutzen, um zu verschwinden – tiefer ins Haus hinein, dorthin, wo sich den Legenden nach der einzige Weg in die Freiheit befand.
Acht und Neun der letzten Ferne.
Hatte der Verfasser damit den Ausgang gemeint? Oder den Tod?
»Warte«, sagte sie, als Diabondo zu dem schweren, salzverkrusteten Hammer ging, der an der Ummauerung lehnte. »Siehst du das da unten?«
Verärgerung flammte über sein Gesicht, aber er ließ den Griff wieder los und trat zurück zu ihr an die Seeseite des Wachturms. »Was soll ich sehen?«
Sie hatte es selbst gerade erst entdeckt und war nicht sicher, ob sie sich getäuscht hatte.
Nein, da waren sie wieder. Menschliche Umrisse in der Brandung, inmitten des Tosens und Schäumens am Fuß der Steilküste. Die Fassade des Fürimmerhauses befand sich gut dreißig Meter über dem Wasser, die Felswand ging geradewegs in das Mauerwerk über. Nur an einer Stelle gab es einen schmalen Sims, oberhalb einer ehemaligen Anlegestelle, die längst vom Meer verschlungen worden war. Vielleicht war das Wrack auf dem Riff einst dorthin unterwegs gewesen – woher auch immer es gekommen sein mochte in einer Welt, in der nichts anderes existierte als das Fürimmerhaus.
»Da sind sie wieder!«, rief Ambra aufgeregt. »Genau unter dem Sims, in der Brandung.«
Diabondo blinzelte angestrengt in die Richtung und schüttelte langsam den Kopf.
Sie konnte durchaus nachvollziehen, dass er an ihr zweifelte. Sie hatten heute einen Überfall der Treibholzmenschen vortäuschen wollen, um das Durcheinander zur Flucht zu nutzen. Stattdessen sollte es nun tatsächlich einen Angriff geben? Es wäre der erste seit über einem Jahr und gerade mal der zweite, den Ambra selbst miterlebte.
Diabondo stieß einen Fluch aus. »Jetzt seh ich sie!«
Dürre Gestalten trieben in den Wogen, wippten in der weißen Gischt auf und ab und trotzten den Elementen. Die ersten zogen sich auf die vorderen Felsen und machten sich daran, die Steilwand zu erklimmen. Obwohl sie annähernd menschlich waren, ähnelten sie von weitem eher bleichen Insekten, die mit bizarren Bewegungen am Fels heraufkrochen.
Ambra zählte zehn, dann fünfzehn, doch Diabondo, der mit seinem einen Auge besser sah als sie mit beiden, sagte: »Das sind mindestens fünfzig. Vielleicht hundert. Die meisten sind noch unter den Wellen.«
Sie holte tief Luft, dann löste sie sich von den Zinnen und eilte zur Falltür. »Umso besser«, sagte sie, während sie die Klappe nach oben zog. Dämmerlicht fiel auf die Stufen darunter. »Dann nutzen wir das für uns. Gib mir drei Minuten, dann schlag die Glocke!«
»Was hast du –« Er brach ab, als ihm klarwurde, was sie plante. »Das ist Irrsinn!«
»Ja«, sagte sie. »Aber es ist die beste Ablenkung, die wir kriegen können.«
»Du kannst sie nicht ins Haus lassen!« Diabondos Stimme überschlug sich fast. »Die werden uns genauso angreifen wie die Famuli!«
»Nicht, wenn wir ihnen aus dem Weg gehen. Wir kennen uns hier aus, die nicht. Und die Famuli werden alle Hände voll damit zu tun haben, sie abzuwehren, während wir uns aus dem Staub machen.«
Sein Auge war weit aufgerissen, das Hellblau fast weiß, und sie sah den Anflug von Panik darin. »Ambra, tu das nicht!«
Aber sie dachte nicht daran, sich von ihm aufhalten zu lassen. Er war neidisch, weil sie als Erste auf diese Idee gekommen war. Und vielleicht auch, weil ihm der Mut dazu fehlte, während sie nur daran denken konnte, dass ihre beste Freundin starb und die Herren des Hauses nicht einmal den Versuch gemacht hatten, sie zu heilen.
»Ich weiß, warum du das machst!«, rief Diabondo, als sie gerade in der offenen Luke abtauchen wollte. »Dir geht’s nicht um die Flucht. Und schon gar nicht um uns andere. Dir geht’s nur um dich selbst, Ambra! Du erträgst die Untätigkeit nicht mehr und die Langeweile. Und du willst Rache.«
Noch einmal kreuzte sie wutentbrannt seinen Blick. Ihr Inneres fühlte sich jetzt sehr kalt an, und sie war so standfest in ihrer Entscheidung wie das uralte Riff da draußen im Nebelmeer. »Ja«, sagte sie, »ich will Rache. Ich will, dass sie alle verrecken, lieber heute als morgen. Und wenn die Treibholzmenschen dafür sorgen, umso besser. Aber wir wissen beide, dass das nicht geschehen wird. Die werden auch diesmal nicht weit kommen. Ob du’s glaubst oder nicht, Diabondo – ich tu das für mich, aber genauso auch für dich und die anderen.«
»Vielleicht für Calamina«, sagte er aufgebracht. »Und ausgerechnet sie würde es am allerwenigsten wollen!«
Ambra starrte ihn einen Moment lang zornig an, dann zog sie den Kopf ins Innere des Turms und stürmte die Treppen hinab, um ihren Feinden die Tür zu öffnen.
3
Emmeline führte Carter durch das Portal auf eine Galerie mit gemauertem Geländer. Von dort zog sich eine breite Treppe hinab in einen Saal, dessen Wände mit dunklem Holz getäfelt waren. Wie in den beiden Räumen zuvor bestanden der Boden und die Treppenstufen aus sandfarbenen Steinfliesen, die Decke wölbte sich zu einem hohen Kreuzgewölbe. Das alles strahlte kühle Erhabenheit aus. Zugleich wirkte es durch die schiere Größe erdrückend.
»Wo sind wir hier?«, fragte er.
»Im Saal vor dem Saal vor der Halle der Ankunft«, erwiderte sie mit einem Schulterzucken. »Er hat keinen Namen, weil es hier keine Fresken mehr gibt.« Sie deutete auf die einzige Wand, die nicht von einer Täfelung bedeckt war. »Da drüben war mal eins, aber angeblich hat ein Erlöser es verschandelt, und da haben die Archonten der Äußeren Sphären es übermalen lassen.« Sie musste ihm ansehen, dass sie damit weniger erklärte als vielmehr neue Fragen aufwarf, denn sie fügte hinzu: »Es gibt Hunderte, vielleicht Tausende solcher Säle im Haus, und wir geben ihnen ihre Namen nach den Gemälden an den Wänden. So fällt es leichter, sie auseinanderzuhalten.«
Erlöser. Archonten. Äußere Sphären. Carter begann zu frieren, und das lag nicht nur daran, dass er die Sachen dieses Diabondo über seinen nassen Körper gestreift hatte. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wovon Emmeline sprach, und je mehr sie redete, desto größer wurde seine Verwirrung.
»Deine Lippen sind fast so weiß wie meine«, sagte sie, als sie ihn ansah. »Aber dir wird warm werden, wenn du läufst. Also komm!«
Damit ließ sie seine Hand los und sprang flink die Treppe hinunter, immer zwei Stufen auf einmal. Erst auf halber Höhe blieb sie stehen und kontrollierte mit einem Blick über die Schulter, ob er ihr folgte.
Carter aber stand noch immer oben auf der Galerie und versuchte, sich in der neuen Situation zurechtzufinden, an diesem Ort und in einem Zustand völliger Ungewissheit.
»Das hier ist kein Traum, oder?«
»Nein«, sagte Emmeline. »Kommst du nun endlich?«
Er rührte sich nicht von der Stelle. »Bin ich tot?«
»Wenn einer von uns tot wäre, wer wäre das dann wohl?« Dass das Geistermädchen dabei mit den Augen rollte, ließ es ziemlich lebendig erscheinen.
Dennoch fragte er: »Bist du tot?«
»Kein bisschen.«
»Ich versteh das alles nicht.«
»So ging’s uns allen«, entgegnete sie. »Mit der Zeit gibt sich das.«
»Aber diese Leute, die mich abholen wollen, würden mir Erklärungen geben?«
»Ja, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Oder du bleibst wirklich für immer im Fürimmerhaus.«
Versuchte sie gerade, ihn mit albernen Wortspielen aufzuheitern? Dann aber sah er wieder die tiefe Sorge auf ihrem kreideweißen Gesicht, und er bekam ein schlechtes Gewissen, weil sie ihm helfen wollte und dafür womöglich selbst ein Risiko einging.
Mit einem Schwindelgefühl, das nur zum Teil von der Höhe der Treppe herrührte, setzte er sich in Bewegung.
»Sehr gut«, sagte sie, als spräche sie mit jemandem, der gerade die ersten Schritte im Leben machte. »Und ich dachte schon, da, wo du herkommst, gäb’s keine Treppen.«
Tatsächlich erinnerte er sich durchaus an Treppen. An Gebäude. An die Wörter für Wände und Geländer und sogar Kreuzgewölbe. Er wusste, was eine Hose war und dass man sich die Nase putzte, wenn sie lief. Was immer ihm seine Vergangenheit geraubt hatte, war nicht gründlich genug gewesen, um ihm auch die Erinnerung an grundlegende Alltagsdinge zu nehmen.
»Jemand hat das absichtlich getan, oder?«, fragte er im Gehen. »Mich alles vergessen lassen, was vorher war.«
»Ja, und normalerweise dürftest du dich auch nicht an deinen Namen erinnern. Keiner von uns konnte das.«
»Aber du heißt Emmeline.«
»Ich weiß nicht, ob das immer mein Name war. Die Archonten haben ihn mir gegeben.«
»Und diese Archonten sind –«
»Sie haben hier das Sagen. Sie beherrschen die Äußeren und die Inneren Sphären.« Ehe er nachfragen konnte, setzte sie hinzu: »Die Sphären sind die Bereiche des Hauses. Hier sind wir in den Äußeren. Die Inneren Sphären darf keiner betreten außer den Archonten selbst.« Sie schenkte ihm ein kurzes Lächeln. »Wir gehen trotzdem hin. Aber ich hab dir schon zu viel verraten. Vielleicht bist du ja ein Spitzel der Archonten.«
»Ich bin kein Spitzel«, sagte er, als sie den Fuß der Treppe erreichten und die weite Halle durchquerten.
»Wär’ auch besser so. Sonst bringt Hengis dich um. Oder Diabondo. Ach, wir alle, schätze ich.«
Verlockende Aussichten, dachte er und spielte noch einmal mit dem Gedanken, einfach hierzubleiben und auf diejenigen zu warten, die ihm sagen würden, wer er war und warum man ihn hergebracht hatte.
»Sie verraten dir nur deinen Namen«, sagte Emmeline, »und was du getan hast. Außerdem erklären sie dir, was alles verboten ist, und versuchen, dir Angst zu machen. Mir haben sie Angst gemacht. Darin sind sie ziemlich gut.«
»Was ich getan habe?« Er stutzte. »Ist das hier so eine Art Gefängnis? Haben wir irgendwelche … Verbrechen begangen?«
»Kommt darauf an, wen du fragst«, sagte sie amüsiert. »Aber, nein, ich glaube, richtige Verbrecher sind wir nicht. Eigentlich eher das Gegenteil.«
Er verstand kein Wort, und es ärgerte ihn, dass sie absichtlich so mysteriös blieb. »Warst du schon immer so … na ja –«
»Leuchtend?«
»Ja.«
»Das ist nichts Besonderes.« Sie grinste spitzbübisch. »Woher willst du wissen, dass du nicht außergewöhnlich bist, weil du nicht leuchtest? Du kannst nicht wissen, wie alle anderen ausgesehen haben, die du mal gekannt hast.«
Obwohl er ziemlich sicher war, dass gewöhnliche Menschen nicht schneeweiß waren und heller glühten als die Lampen an den Wänden, gab er sich geschlagen. »Stimmt«, sagte er. »Nicht mal das weiß ich.«
Abrupt blieb sie stehen.
»Was –«
»Sei still.« Jetzt flüsterte sie wieder. »Wir hätten nicht so laut reden dürfen.«
Er machte es genau wie sie, rührte sich nicht mehr von der Stelle und horchte. Von irgendwoher erklang das Getrappel von Schritten, die sich zügig näherten.
Emmeline legte wieder den Finger an die Lippen und zeigte mit der anderen Hand auf eine Gangmündung an der Stirnseite der Halle. Dann deutete sie mit einer Kopfbewegung nach links. Dort befand sich der Zugang zu einem weiteren Korridor, und Carter wurde klar, dass dies ihr Ziel war.
»Schneller!«, raunte sie ihm zu und lief los.
Er stellte keine Fragen mehr, sondern rannte stumm neben ihr her, noch immer benommen, und als er bemerkte, dass er schneller laufen konnte als sie, nahm er sie bei der Hand und zog sie mit sich. So erreichten sie gemeinsam den Gang, tauchten einige Meter tief hinein und pressten sich auf Emmelines Wink hin in eine Nische, gleich neben die überlebensgroße Steinfigur eines gerüsteten Recken mit Schwert.
Von ihrem Versteck aus konnten sie nur einen schmalen Streifen der Halle sehen. Die Schritte wurden immer lauter, eine ganze Gruppe näherte sich im Laufschritt von links, eilte in einiger Entfernung an der Mündung vorüber und verschwand. Kurz darauf hörte Carter, wie sie die Treppe hinaufstürmten.
»Die haben bis eben nicht gewusst, dass du kommst«, flüsterte Emmeline. »Das ist die einzige Erklärung dafür, dass sie nicht in der Halle der Ankunft auf dich gewartet haben. Bei uns anderen waren sie immer schon dort.«
Carter hörte sie kaum. Er war damit beschäftigt, zu verarbeiten, was er gerade gesehen hatte. Menschen, in gewisser Weise, und doch wieder nicht. Er redete sich ein, dass er sich getäuscht haben musste. Dass sie groteske Helme getragen hatten oder einen bizarren Kopfschmuck. Dass es absolut unmöglich war, dass sie auf ihren Schultern statt eines Schädels eine dritte, riesengroße, zur Faust geballte Hand getragen hatten.
Emmeline blickte ihn verstohlen von der Seite an. »Ich hätte dich warnen sollen.«
»Die hatten keine Köpfe.«
»Denken ist ohnehin nicht ihre Stärke.«
»Das waren … Hände.«
»Ja. Weil sie dumme Handlanger sind. Zu viel mehr taugen sie nicht.«
»Aber wie –«
»Das sind die Famuli. Die Diener der Archonten.«
»Famuli …«
»Famuli, Mehrzahl – Famulus, Einzahl«, sagte sie in belehrendem Tonfall. »Sie sind Soldaten und Wächter und Arbeiter. Wenn eine Mauer zusammenbricht, bauen sie sie wieder auf. Und wenn jemand versucht zu fliehen, fangen sie ihn ein. Wir sollten also schleunigst weiter.«
Und schon waren sie wieder unterwegs, schlichen erst ein Stück, dann liefen sie.
»Ich glaube nicht, dass es da, wo ich herkomme, Menschen mit Händen als Köpfe gibt.«
»Von den Füßen bis zu den Schultern sind sie gewöhnliche Menschen«, sagte Emmeline im Laufen. »Sehr stark und ziemlich schnell, aber eben Menschen. Meistens Männer. Die dritte Hand auf ihrem Hals ist ungefähr so lang wie mein Unterarm und viel beweglicher, als sie aussieht. Manchmal hangeln sie sich damit unter den Decken entlang, wenn sie da oben was reparieren müssen oder die großen Spinnenkokons aus den Ecken holen. Und sie können dich zerquetschen, wenn sie dich zu fassen kriegen.«
»Wo haben sie ihre Augen?«
»Sie brauchen keine. Sie sind wie die Riesenfledermäuse auf den Dachböden. Sie hören besser als wir, und sie können einen wittern.« Sie schüttelte über sich selbst den Kopf. »Wir haben zu viel Zeit verplempert.«
»Das war meine Schuld.«
»Ja«, sagte sie, »das stimmt.«
Eine Weile lang liefen sie schweigend durch verwinkelte Gänge, bogen häufig ab, hasteten Treppen hinauf und andere hinunter, durchquerten spitze Torbögen und kamen an Dutzenden Statuen vorbei, die für Carter schon nach kurzer Zeit alle gleich aussahen. In den meisten Korridoren flackerten Gaslampen, aber manchmal kamen sie durch Regionen, in denen das einzige Licht von Emmeline ausging. Dann war es, als würden die Schatten der Steinfiguren zum Leben erwachen und ihnen aus dem Weg gehen, um sich in ihrem Rücken wieder zusammenzurotten. Carter gewöhnte sich ab, Blicke über die Schulter zu werfen, und vertraute sich notgedrungen seiner geisterhaften Führerin an.
Irgendwann wurde sie langsamer, und da erst bemerkte er, wie schnell sein Atem ging. Bislang hatte er keine Zeit gehabt, daran auch nur einen Gedanken zu verschwenden.
»Da war kein Archon bei ihnen«, sagte Emmeline.
Carter wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. »Archonten, Mehrzahl – Archon, Einzahl?«
Sie lächelte verschmitzt. »Du bist ein ganz Schlauer, was?«
»Im Moment komm ich mir eher dumm vor.«
»Geht mir auch manchmal so. Diabondo ist ziemlich gut darin, einem das Gefühl zu geben, dass man dümmer ist als er.«
Carter verzog das Gesicht. »Du magst ihn nicht besonders.«
»Vor allen Dingen wird er dich nicht mögen, wenn er sieht, dass du seine Sachen anhast. Die ich ihm geklaut hab. Aus seiner Kiste. Uns allen sind unsere Kisten heilig. Da ist alles drin, was wir haben. Sie stehen neben unseren Betten, und alle anderen lassen die Finger davon.«
»Wie viele seid ihr?«
»Sechs. Du bist der siebte. Aber …« Sie brach ab und senkte im Gehen den Blick.
Er wartete einen Moment, dann fragte er: »Aber?«
»Calamina ist krank. Sie wird bald sterben.«
»Tut mir leid.«
»Am schlimmsten ist es für Ambra. Calamina ist ihre beste Freundin.« Sie schluckte. »Wenn ich mir vorstelle, dass Hyazinthe sterben müsste … Ich kann mir das gar nicht vorstellen.«
»Dann ist Hyazinthe deine beste Freundin?«
»So was Ähnliches, ja.«
Aus den Schatten vor ihnen löste sich ein Umriss und trat als Silhouette vor ein Spitzbogenfenster, das auf einen grauen Innenhof wies.
Carter blieb stehen.
Auf den Schultern der Gestalt saß ein Kopf, keine Faust, aber er war nicht sicher, ob das Grund genug zum Aufatmen war. Als sie sich bewegte, erklangen klickende und klackende Geräusche, so als trüge sie eine Rüstung aus Holz, deren Teile an den Gelenken aneinanderstießen. Ihr Umriss war filigran, als wäre sie mit leichten Federstrichen auf das Fenster gezeichnet worden.
»Das ist er also«, sagte eine weibliche Stimme.
Emmeline ging weiter, und ihr Geisterlicht fiel auf etwas, das nur auf den ersten Blick wie ein feingliedriges Mädchen aussah. Auf den zweiten war es eine lebende Holzpuppe. Oder etwas, das auf erstaunliche Weise halb Puppe, halb Mensch war.
»Du hättest ihn nicht mitbringen dürfen«, sagte sie und richtete ihre aufgemalten Augen auf Carter. »Das war ein Fehler.«
4
Als Ambra sich dem Tor näherte, hörte sie auf der anderen Seite das Tosen der See. Brecher krachten dreißig Meter tiefer gegen die Klippen, ein waberndes Donnern, das die Luft in dem breiten Korridor vibrieren ließ.
Jenseits des Portals pfiff der Wind über den Felsensims, rüttelte am Holz und den schweren Beschlägen. Zumindest hoffte Ambra, dass es der Wind war und nicht schon die ersten Treibholzmenschen, die die Steilwand erklommen hatten und versuchten, ins Innere einzudringen. Früher musste ihnen das öfter gelungen sein, aber heute waren alle Fenster zur See hin zugemauert. Dies hier war der letzte verbliebene Zugang, von dem Ambra wusste.
Warum das Tor überhaupt noch existierte, war ein Rätsel, auf das sie bislang keine Antwort gefunden hatte. Fast schien es, als hätten die Archonten oder der Erbauer selbst nicht wahrhaben wollen, dass nie wieder ein Schiff dort draußen den Anker werfen würde. Es gab keine Anlegestelle mehr, keinen Pier – nur das Wrack auf dem Riff als verrottendes Mahnmal. Ambra hatte sich oft gefragt, ob es nicht nur makabre Dekoration war, ein düsteres Detail, das der Erbauer hinzugefügt hatte, um der Welt außerhalb des Fürimmerhauses einen Anschein von Leben zu verleihen.
Calamina hatte einmal vermutet, dass die Treibholzleute ursprünglich nur einem einzigen Zweck gedient hatten: Sie waren eine ominöse Bedrohung, die dann und wann ihren hässlichen Schädel aus den Wellen erhob, um jeden zu entmutigen, der ein Entkommen auf See in Erwägung zog. Irgendwann mussten sie außer Kontrolle geraten sein, hatten ihre Zahl vervielfacht und sich gegen das Haus gewandt. So waren sie von Wächtern des Meeres, die man nur aus der Ferne zu Gesicht bekam, zu einer echten Gefahr geworden.
Ambra war die ganze Strecke vom Turm bis hierher gerannt, und sie hätte gern innegehalten, ein paar Mal tief Luft geholt und kurz darüber nachgedacht, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Doch sie fürchtete, dass der Angriff von den Famuli bemerkt worden und bereits eine ganze Schar von ihnen hierher unterwegs war, um das Tor und den Sims zu sichern. Sie musste ihnen zuvorkommen, auch weil Diabondo jeden Augenblick die Alarmglocke läuten würde. Die drei Minuten, um die sie ihn gebeten hatte, waren schon abgelaufen.
Auf beiden Seiten des Gangs standen Säulen. Ambra passierte die letzten in vollem Lauf und wäre fast gegen das Tor geprallt. Mit bebenden Fingern machte sie sich an den Riegeln zu schaffen – es gab eine ganze Menge davon – und stellte fest, dass einige vom Salz verkrustet waren, das mit der Seeluft durch die Ritzen hereingeweht war. Verzweifelt rüttelte sie daran, lockerte erst einen, dann einen zweiten. Vor allem der dritte machte ihr zu schaffen.
Womöglich war es wirklich eine dumme Idee. Zumindest in einem lag Diabondo ganz richtig: Calamina hätte ihr davon abgeraten. Schlimmer, sie hätte Ambra ins Gesicht gesagt, dass sie den Verstand verloren habe. Doch Calamina würde wohl nie wieder etwas sagen. Seit zwei Tagen drang aus ihrem Mund nichts als ein heiseres Röcheln.
Noch zwei Riegel.
Draußen heulte der Wind. Die Brandung donnerte gegen die Steilwand, als wollte sie das Haus unterspülen und ein für alle Mal in den Ozean reißen. Ambra hätte einiges für ein Schlüsselloch gegeben, um einen Blick hinaus auf den Sims zu werfen, doch es gab keines.
Der vorletzte Riegel erwies sich als besonders widerspenstig. Wäre es um pure Willenskraft gegangen, so wäre das Tor bereits aus den Angeln geflogen. So aber blieb ihr nur, sich mehr schlecht als recht abzustützen und ruckartig an dem verkrusteten Riegel zu zerren, bis er einsehen würde, dass er gegen sie keine Chance hatte.
Mit einem Knirschen gab er nach. Jetzt noch der letzte.
Aus den Tiefen des Hauses erklangen Schritte. Ambras pochender Herzschlag und der Lärm von der Außenseite konnten sie nicht mehr übertönen. Genau wie sie es befürchtet hatte: Ein Famulitrupp kam näher.
»Ambra!« Diabondo tauchte am Ende des Korridors auf, etwa zwanzig Meter entfernt. Die Lampen befanden sich an den Wänden hinter den Säulenreihen und überzogen den Gang mit einem Raster gekreuzter Schatten. Diabondo wechselte immer wieder vom Licht ins Dunkel, vom Dunkel ins Licht, während er sich atemlos näherte. »Sie kommen!«
»Du hast die Glocke nicht geläutet!«, rief sie, als sie den letzten Riegel packte.
»Das war gar nicht nötig! Die Famuli wussten schon Bescheid. Ich hab immer gesagt, dass sie uns nur auf den verdammten Turm schicken, um uns zu beschäftigen. Die haben ihre eigenen Wachtposten entlang der Küste.«
Sie alle hatten das geahnt. Trotzdem hätte ein falscher Alarm – ohne einen wirklichen Angriff – die Famuli eine Weile lang abgelenkt. Jetzt aber, da es in den Äußeren Sphären von ihnen wimmeln musste, war eine Flucht fast unmöglich.
Es sei denn, es gelang ihr, die Feinde hereinzulassen, damit sie die Archonten und ihre Diener ablenkten.
»Das hier … ist unsere letzte Chance«, presste sie hervor, während sie an dem Riegel zog.
Diabondo war noch zehn Schritt entfernt. Sie nahm an, dass er sie aufhalten wollte, und sie würde ihm weh tun, wenn er es versuchte.
Der Riegel ließ sich um die Hälfte verschieben, dann hing er fest. Nicht genug, um das Tor zu öffnen. Selbst der tosende Seewind jaulte auf vor Enttäuschung.
»Irgendwie … muss das doch … gehen«, ächzte sie, während ihr Tränen der Wut kamen. Diabondo war fast bei ihr.
»Lass mich mal!«, rief er.
»Du willst ihn wieder zumachen!«
»Ganz bestimmt nicht!« Ehe sie sich wehren konnte, schob er sie beiseite. Als sie sich gerade auf ihn stürzen und ihn fortreißen wollte, begriff sie, dass er es ernst meinte. Er packte den Riegel mit beiden Händen, stemmte sich mit einem Fuß gegen die Beschläge und zerrte mit aller Kraft.
Die Schritte der Famuli dröhnten in ihren Ohren, als die Schatten am Ende des Gangs zu Gestalten gerannen. Die riesigen Fäuste auf ihren Hälsen öffneten sich und spreizten die Finger, als wollten sie Ambra und Diabondo damit Zeichen geben. Im Halbdunkel sah es aus, als trügen sie groteske Geweihe mit beweglichen Enden.
»Jetzt!«, brüllte Diabondo.
Der Riegel ruckte zur Seite. Von seinem Schwung öffnete sich das Tor eine Handbreit.
Der Wind blies eisig herein, begleitet von einem neuen Geräusch: einem gespenstischen Summen.
»Weg hier!« Ambra packte Diabondo am Arm und zog ihn vom Tor fort.
Stolpernd suchten sie Schutz hinter den Säulen auf der linken Seite des Gangs, während die Famuli heranstürmten. Zwischen den Steinpfeilern und der Wand lag ein Abstand von anderthalb Metern, und bisher verstellte ihnen dort niemand den Fluchtweg.
»Warte noch!«, sagte Diabondo. »Ich will sehen, was passiert.«
Ihr ging es genauso, und so blieben sie hinter der zweiten Säule stehen und blickten um sie herum zum Tor. Die Famuli kamen näher – wie immer stumm, denn sie besaßen keine Münder –, und für einen Augenblick klangen ihre Schritte so dumpf wie unter Wasser, während Ambra ihre ganze Aufmerksamkeit auf den schmalen Spalt zwischen den Torflügeln richtete.
Ein feines Knirschen erklang, ganz kurz nur.
Gleich würden die Famuli am Tor sein, sich dagegenwerfen und die Riegel zurück in ihre Positionen rammen. Einige würden ausschwärmen und Ambra und Diabondo den Weg abschneiden, und was dann mit ihnen geschehen mochte, war ungewiss. Soweit Ambra wusste, hatte es zuvor noch keinen Versuch gegeben, den Feinden des Hauses Zugang zu gewähren, und sie konnte sich nicht vorstellen, dass darauf eine andere Strafe als der Tod stand. Die Entscheidung darüber oblag den Archonten. Vielleicht sogar dem Erbauer selbst.
Draußen auf dem Sims ertönte ein Knistern und Rascheln, als würde sich jemand durch ein Unterholz zwängen. Aber es waren keine Zweige, die da aneinanderrieben.
Der rechte Torflügel flog krachend nach innen.
Ein dürrer Körper, gesichtslos, mit Gliedern wie aus Korb geflochten, sprang herein und stellte sich dem Pulk der Famuli entgegen. Die Diener der Archonten waren mit Säbeln und Äxten bewaffnet, und einige hatten ihre dunklen Lederuniformen gegen Rüstzeug getauscht, wie Ambra es sonst nur von den Statuen kannte: Brustpanzer, Armschienen und Schulterprotektoren. Das machte sie schwerfällig im Vergleich zu ihren flinken Gegnern, schützte sie aber vor deren messerspitzen Gliedmaßen, vor dolchlangen Fingern aus Holz und abstehenden Dornen, die jeden Körper mühelos durchstoßen konnten.