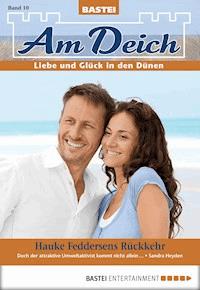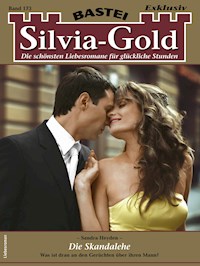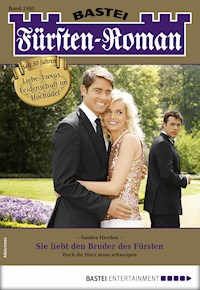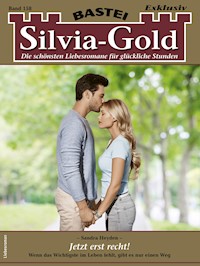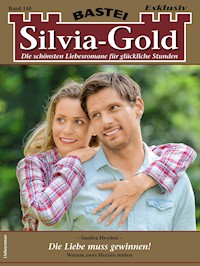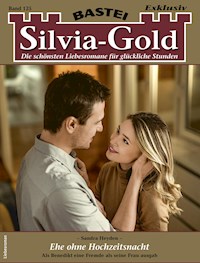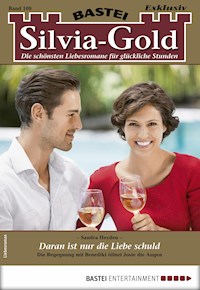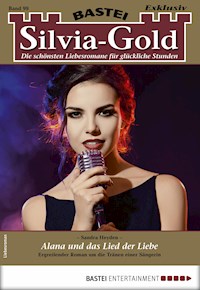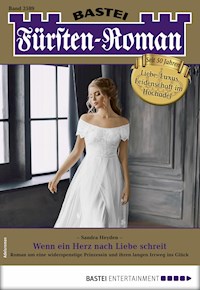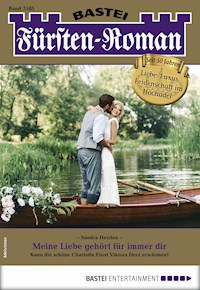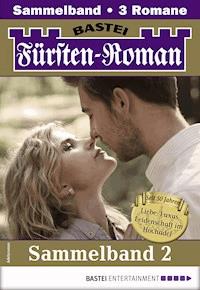1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der plötzliche Tod von Fürst Franz-Otto reißt ein tiefes Loch in Friederikes Leben. In ihrer Trauer zieht sie sich zurück, während ihre Schwiegermutter Dorothea die Kontrolle über das fürstliche Palais und die Kinder übernimmt. Mit harter Hand regiert die alte Frau - für Widerspruch ist kein Platz. Jahre vergehen, bis Friederike den Mut findet, ins Leben zurückzukehren. Doch ihre Kinder sind ihr fremd geworden, und ihre Schwiegermutter duldet keine Einmischung. Erst als Fürstin Friederike dem charismatischen Lehrer Gregor begegnet, wächst in ihr die Hoffnung, sich ihre Rolle als Mutter und Fürstin zurückzuerobern. Doch kann sie sich gegen die mächtige Schwiegermutter behaupten - oder wird sie erneut verlieren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Darf ich nie wieder glücklich sein?
Vorschau
Impressum
Darf ich nie wieder glücklich sein?
Eine Fürstin findet zurück ins Leben
Von Sandra Heyden
Der plötzliche Tod von Fürst Franz-Otto reißt ein tiefes Loch in Friederikes Leben. In ihrer Trauer zieht sie sich zurück, während ihre Schwiegermutter Dorothea die Kontrolle über das fürstliche Palais und die Kinder übernimmt. Mit harter Hand regiert die alte Frau, deren Wort Gesetz ist – für Widerspruch ist kein Platz.
Jahre vergehen, bis Friederike den Mut findet, ins Leben zurückzukehren. Doch ihre Kinder sind ihr fremd geworden, und ihre Schwiegermutter duldet keine Einmischung. Erst als Fürstin Friederike dem charismatischen Lehrer Gregor begegnet, wächst in ihr die Hoffnung, sich ihre Rolle als Mutter und Fürstin zurückzuerobern. Doch kann sie sich gegen die mächtige Schwiegermutter behaupten – oder wird sie erneut verlieren?
Schon seit Wochen arbeitete Friederike zu Williges-Dernau an einer Neu-Übersetzung von Shakespeares »Ein Sommernachtstraum«. Als anerkannte Übersetzerin der altenglischen Sprache war sie die erste Wahl des Verlags gewesen und hatte diesen Auftrag auch gern angenommen.
Auf diese Weise verfügte sie über ein eigenes kleines Einkommen und war nicht mehr auf die knapp bemessene Apanage ihrer Schwiegermutter Dorothea angewiesen, die diese ihr natürlich dennoch gewährte. Friederike stand als Witwe des Fürsten, der Tradition des Hauses Williges-Dernau gemäß, eine monatliche Zuwendung zu.
Dorothea zu Williges-Dernau war sehr in diesen Traditionen verhaftet, und es würde ihr niemals einfallen, ihnen zuwiderzuhandeln. Allenfalls würde sie Wege finden, sie zu unterlaufen, wenn sich diese Traditionen nicht mit ihren Plänen in Einklang bringen ließen.
Heftige Worte drangen durch das Fenster zu Friederike in den ersten Stock des Palais hinauf, in dem sie mit ihrer Familie lebte. Außer ihrer Schwiegermutter Dorothea zählten die inzwischen sechzehnjährigen Zwillinge Maximilian und Amanda dazu. Der kleine Barock-Bau lag idyllisch inmitten üppiger Weinberge in der Nähe von Mainz. Wenn man sich ihm näherte, kam man an dem kleinen vorgelagerten Kavaliershaus vorbei, im gleichen barocken Stil erbaut, wie auch das Palais. Hinter dem Haupthaus erstreckte sich ein kleiner, terrassenförmig angelegter Park, an den sich die Weinberge anschlossen, die zu dem kleinen, aber exquisiten Weingut der Familie gehörten.
Friederike liebte diese Gegend. Sie lebte gern hier, auch wenn es ihr von ihrer Schwiegermutter Dorothea nicht leicht gemacht wurde.
Friederike seufzte, denn sie erkannte die scharfe Stimme ihrer Schwiegermutter, die sich unter ihrem Fenster auf der Terrasse mit dem Hauslehrer ihres Sohnes stritt.
Da Maximilian mit einer Körperbehinderung geboren worden war und im Rollstuhl saß, hatte Dorothea – in einer Zeit, in der es für Friederike unmöglich gewesen war, dies zu verhindern – dafür gesorgt, dass er zu Hause unterrichtet wurde, um ihn nicht den von ihr befürchteten Hänseleien und dem Spott von Mitschülern auszusetzen. Dass Dorothea den Jungen damit aber auch von der Außenwelt und vom wahren Leben isolierte, wollte sie nicht sehen. Wie Dorothea überhaupt wenig sehen wollte, was Maximilian betraf.
Friederikes erneuter Seufzer galt dem Foto, das in einem kostbaren silbernen Rahmen auf ihrem Schreibtisch stand. Es zeigte das Portrait eines sehr gut aussehenden und sehr blonden jungen Mannes. Die Augen strahlten selbstbewusst, und er lächelte die Betrachterin mit leicht süffisant verzogenen Mundwinkeln an. Friederikes Herz wurde schwer.
Warum hast du mich verlassen?, rief ihr Herz, um gleich darauf hinzuzufügen: Und warum hast du nur ein solches Testament hinterlassen?
Ehe Friederike sich selbst die Antwort geben konnte, wurde die Tür ihres Arbeitszimmers aufgerissen und Dorothea stürmte herein. Sie war eine große, kräftige Frau. Das dunkle, zu einem Knoten geschlagene Haar wurde von silbernen Fäden durchzogen. Obschon Mitte sechzig wirkte Dorothea zu Williges-Dernau wesentlich jünger und strotzte nur so vor Tatkraft und Energie.
»Hol bitte Amanda von der Schule ab!«, warf sie Friederike hin. Obwohl in eine Bitte verpackt, waren diese Worte ein Befehl, der weder Widerspruch duldete noch erwartete. »Berthold kommt gleich. Wir haben über geschäftliche Angelegenheiten zu sprechen.«
Friederike nickte.
Berthold Graf von Rothann war nicht nur der beste Freund von Franz-Otto, sondern war auch sein Testamentsvollstrecker gewesen und der Hausjustiziar der Familie. Er stand Dorothea in allen Rechtsfragen zur Seite und gehörte schon fast zur Familie. Friederike wusste, dass Berthold von Rothann an ihr interessiert war. Schon zu Lebzeiten des Fürsten hatte er ihr den Hof gemacht. Ein sehr unsympathischer Zug.
Auch nach Franz-Ottos Tod hatte er sich rührend um sie gekümmert. Friederike hatte es in ihrem unsagbaren Schmerz nur nicht wahrgenommen. Erst in letzter Zeit war ihr aufgefallen, dass Graf Bertholds Bemühungen nicht nachgelassen hatten und diese von Dorothea unterstützt wurden. Dumm nur, dass ihr so gar nichts an diesem Mann lag. Im Gegenteil. In ihren Augen war er ein ausgemachter Opportunist, der gerade dem schmeichelte, der ihm nützlich war. Früher war es Franz-Otto gewesen, nun war es eben Dorothea.
»Warum hast du dich mit Herrn Heberlein gestritten?«, wollte sie dann wissen.
Ein kalter Blick traf Friederike, der ihr wohl klarmachen sollte, dass sie das nichts anging. Schließlich hatte sie sich in den ganzen letzten zehn Jahren kaum um ihre Kinder gekümmert, sich nicht kümmern können! Dorothea führte das oft genug an. Friederike litt entsetzlich unter dieser verpassten Zeit, in der sie kaum wahrgenommen hatte, wie die Kinder sich entwickelt hatten.
»Er ist doch ein guter Lehrer, oder?«, insistierte Friederike. Sie wusste, dass Ernst Heberlein vor allem ein fügsamer Lehrer war, der Dorotheas Herrschaft anerkannte.
Dorothea verzog das Gesicht. »Er ist unfähig, deinem Sohn das Wesen der Wirtschaft und der damit zusammenhängenden Mathematik nahezubringen!«
»Oh«, machte Friederike nur, denn Dorothea hatte den Lehrer ausgewählt, eben weil er auf diesen Gebieten eine pädagogische Kapazität war. »Vielleicht liegt das an Maximilian. Du weißt, dass er für diese Dinge keine ausgesprochene Begabung besitzt.«
Dorotheas scharfer Blick erdolchte Friederike beinahe.
»Es ist gleich, ob er dafür eine Begabung hat oder nicht. Er muss es lernen. In zwei Jahren wird er ein Vermögen verwalten müssen ...«
»... mit deiner Unterstützung«, warf Friederike ein.
»Gott sei Dank. Dafür hat Franz-Otto ja gesorgt!« Jeder Zoll an Dorothea drückte aus, für wie unfähig sie Friederike hielt, diese Aufgabe zu übernehmen und dass ihr verstorbener Sohn das sehr wohl gewusst hatte. »Glaub mir, ich weiß, was gut für Maximilian ist«, schob Dorothea nach und machte ihr so klar, wie viel sie versäumt hatte. Damit schürte Dorothea Friederikes ohnehin schon starkes Schuldgefühl.
Friederike erhob sich. »Ich fahre Amanda abholen.«
Dorothea nickte. »Dazu bist du ja zum Glück in der Lage.«
Friederike parkte den Kombi, der eigentlich Dorothea gehörte und auf dessen Fahrertür das Familien-Wappen prangte, in der Paffengasse, gegenüber dem Maria Ward-Mädchengymnasium am Ballplatz, das ihre Tochter auf Wunsch ihrer Großmutter besuchte.
Auch Dorothea parkte stets in der Pfaffengasse, wenn sie ihre Enkelin abholte und Amanda wusste daher, wo sie hinkommen musste.
Friederike war in Gedanken versunken und erschrak heftig, als es plötzlich an der Seitenscheibe klopfte. Ein freundlich lächelndes Männergesicht blickte herein und bedeutete ihr, das Fenster herunterzukurbeln.
Friederike tat es.
»Ja?«, fragte sie irritiert.
Sie war ein wenig fassungslos, denn das Gesicht vor ihr war auf eine sehr männliche Art unglaublich schön. Ein wenig schmal, aber harmonisch proportioniert. Das dunkelblonde Haar ein wenig lang. Der Mann trug enge, verwaschene Jeans. Ein schlichtes T-Shirt und darüber eine alte, braune Cordjacke mit Aufnähern an den Ellbogen.
Doch das Unbeschreiblichste waren seine Augen. Entwaffnend blaue Augen, umgeben von einem dichten dunklen Wimpernkranz, um den ihn sicher manche Frau beneidete.
»Ich nehme an, Sie sollen Prinzessin Amanda abholen?« Seine Stimme war angenehm, männlich, und sie ging Friederike unter die Haut. Sie spürte, wie ihre Nackenhärchen sich verzückt aufrichteten.
»Ja.« Sie war kaum in der Lage, mehr als dieses eine Wort herauszubekommen, so sehr verwirrte dieser Mann sie.
»Die Prinzessin hat mich gebeten, auszurichten, dass sie sich verspäten wird«, teilte er ihr mit, und Friederike hatte Mühe, seinen Worten zu folgen. »Wie Sie vielleicht wissen, spielt sie in der Theatergruppe und leider musste die Probe verschoben werden. Es wird also noch ein Stündchen dauern ...«
Er musterte sie mit plötzlichem Interesse. Was er sah, schien ihm zu gefallen. Eine schlanke junge Frau von Mitte dreißig. Kupferfarbenes Haar, das in sanften Wellen bis auf die Schulter fiel und ein etwas längliches Gesicht von herber Schönheit umrahmte. Die Nase mochte ein wenig zu lang sein, der volle Mund ein wenig zu breit. Was ihn auf den ersten Blick für sie einnahm, waren ihre Augen. Braune, warme Augen voller Melancholie und Tiefsinnigkeit.
»Verzeihen Sie, ich vergaß mich vorzustellen. Praetorius, mein Name, Leander Praetorius.«
»Oh, Sie sind das!«, entfuhr es Friederike ungewollt, denn dieser Name war ihr aus vielen enthusiastischen Äußerungen ihrer Tochter geläufig.
Studienrat Dr. Leander Praetorius unterrichtete seit einem Jahr Deutsch und Geschichte und war in Windeseile zum Schwarm des Mädchengymnasiums geworden. Nicht nur, weil er einfach umwerfend aussah, sondern weil er offenbar mit den Mädchen umzugehen verstand und seine etwas unkonventionellen Unterrichtsmethoden bei ihnen gut ankamen, wenn auch weniger bei der Schulleitung.
»Sie haben von mir gehört?« Er schien überrascht.
»Amanda und ihre Freundinnen schwärmen geradezu von Ihnen.«
Er lachte. »In diesem Alter sind Mädchen leicht zu beeindrucken.« Er musterte sie wieder. »Ich habe eine Freistunde und wollte am Ballplatz einen Kaffee trinken gehen. Wie ist es? Darf ich Sie einladen? Im Café wartet es sich bedeutend angenehmer.«
Friederike zögerte. Doch der Aussicht, noch ein wenig länger die Gesellschaft dieses faszinierenden Mannes zu genießen, konnte sie nicht widerstehen. Entschlossen zog sie den Zündschlüssel ab und stieg aus.
»Warum nicht.«
Sie versuchte, sich die Wirkung, die er auf hatte, nicht anmerken zu lassen. Doch seine Anziehungskraft war geradezu animalisch, und Friederike musste sich auf jeden Schritt mühsam konzentrieren, um an seiner Seite den Ballplatz zu überqueren.
Wie schmal seine Hüften waren, wie sehnig sein Körper. Seine Hände waren geschmeidig und gepflegt. Wie es wohl war, von ihnen berührt zu werden?
Friederike schalt sich eine Närrin, solchen Gedanken nachzuhängen. Was war nur mit ihr los? Seit unsäglich vielen Jahren hatte sie solche Gefühle für einen Mann nicht mehr erlebt. So unverhofft von ihnen überfallen zu werden, verwirrte sie zutiefst.
Das sonnige Frühjahr hatte die Betreiber des Cafés veranlasst, die Terrasse zu öffnen. Bequeme Korbsessel luden zum Verweilen ein. Leander Praetorius rückte eines der Sesselchen für sie zurecht.
»Von hier aus haben wir die Schule im Blick. Sie werden die Prinzessin nicht verpassen.«
Friederike nickte nur und bestellte einen Cappuccino. Ihr Blick streifte dabei unwillkürlich seine hohe Gestalt. Er schien ein wenig jünger als sie selbst zu sein, doch das war ihr gleich. Er war der faszinierendste Mann, der ihr seit Langem begegnet war. Bei seinem Anblick empfand sie ein erregendes Kribbeln auf ihrer Haut, und ihr Herz schien zu rasen. Zum ersten Mal seit dem Tod ihres Mannes vor zehn Jahren passierte so etwas.
Friederike hatte keinen einzigen Gedanken an einen anderen Mann verschwendet. Sie hatte Franz-Otto geliebt, und ihr war immer klar gewesen, dass man eine solche Liebe nur einmal im Leben erlebte. Sie wollte keinen anderen Mann!
Und jetzt das!
Da saß ihr dieser Leander Praetorius gegenüber, lächelte sie an und brachte, ohne es zu wissen, damit ihr Blut zum Sieden. Friederike sehnte sich plötzlich nach seiner Umarmung, nach der Zärtlichkeit, auf die sie schon so lange verzichten musste und nach der sie sich doch sehnte, wie sie jetzt erkannte.
»Arbeiten Sie schon lange für die Williges-Dernaus?«, erkundigte sich Leander Praetorius nun.
Friederike brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass er sie für ihre eigene Angestellte hielt. Eine Vorstellung, die sie amüsierte.
»Ja, schon eine ganze Weile«, gab sie zu. »Ich kenne die Prinzessin und ihren Bruder schon seit ihrer Geburt.«
»Tatsächlich? Da haben Sie ja noch deren Vater kennengelernt. Wie ich hörte, ist er vor ungefähr zehn Jahren verstorben. Wie war der Fürst denn so?«
»Er war ein fabelhafter Mann«, kam es Friederike unwillkürlich über die Lippen. »Er hat seine Familie sehr geliebt. Anders als seine Mutter, hatte er überhaupt keine Standesdünkel oder dergleichen, sonst hätte er kaum eine Beamtentochter geheiratet. Er war unglaublich warmherzig, und er war ein sehr guter Zuhörer. Mit ihm konnte man über alles reden. Er ...« Ihre Stimme brach, und sie spürte plötzlich eine warme, wissende Hand auf der ihren.
»Verzeihen Sie. Ich wollte keine alten Wunden aufreißen, Durchlaucht.« Er hatte also doch durchschaut, wer sie war.
Friederike lächelte. »Haben Sie nicht. Es tat gut, einmal über meinen Mann sprechen zu können. Meine Schwiegermutter lässt es sonst nicht zu. Ich glaube, der Schmerz wäre für sie zu groß. Franz-Otto war ihr einziges Kind.«
»Wie kommt es, dass ich Sie noch nie in der Schule gesehen habe?«, wunderte sich Leander Praetorius nun.
Die Antwort war Friederike einigermaßen peinlich, weil sie wusste, dass sie auf sein Unverständnis stoßen würde.
»Meine Schwiegermutter kümmert sich um die Ausbildung der Kinder«, gestand sie beschämt.
Die verständnislose Fassungslosigkeit in seinen Augen traf sie tief. Wie sollte er auch verstehen können, dass eine Mutter sich nicht um die Belange ihrer Kinder kümmerte, sondern dies der Schwiegermutter überließ? Wie sollte er verstehen, dass sie nach dem langen, schleichenden und dann doch so überraschenden Tod des geliebten Ehemannes und Vaters ihrer Kinder in ein unendlich tiefes, schwarzes Loch gefallen war?
Der Schmerz und die Trauer über den Verlust hatten sich wie eine schwere Decke über Friederikes Seele gelegt, unmöglich, sie abzuschütteln. Lange Jahre war sie von dieser schmerzvollen Dunkelheit gefangen gewesen. Lange Jahre hatte die Trauer ihr die Luft zum Atmen genommen.
Sie hatte sich kaum um sich selbst kümmern können, geschweige denn arbeiten oder sich gar um die Kinder kümmern. Sie war Dorothea, die doch ebenso unter dem Verlust litt, dankbar für ihre Stärke, dankbar dafür, dass sie die Dinge in ihre resoluten Hände genommen hatte. Doch Dorothea wollte diese Dankbarkeit nicht. Dorothea verachtete Friederike für ihre Schwäche.
Friederike war froh, als sie in diesem Augenblick eine Gruppe Mädchen aus dem Tor zum Schulhof kommen sah. Amandas langes goldblondes Haar leuchtete weithin, und Friederike erhob sich.