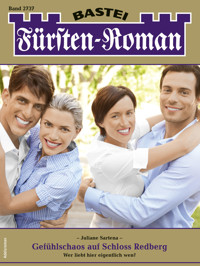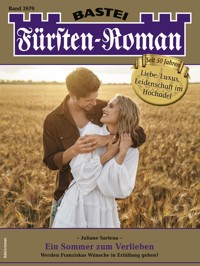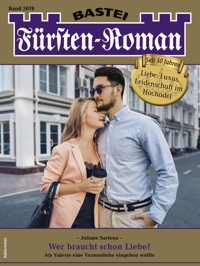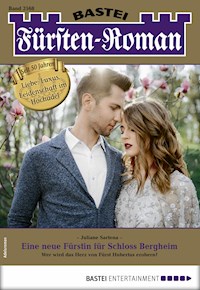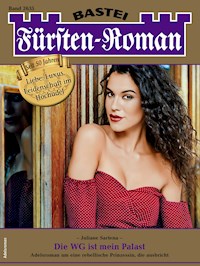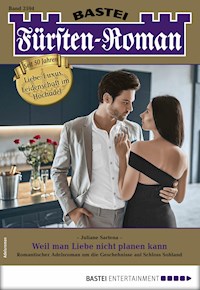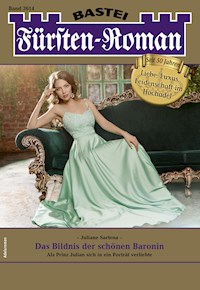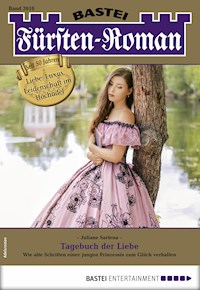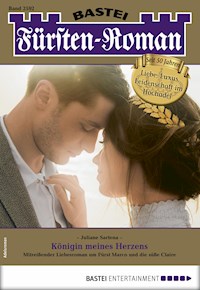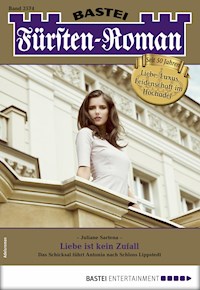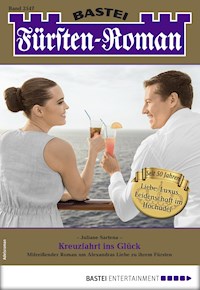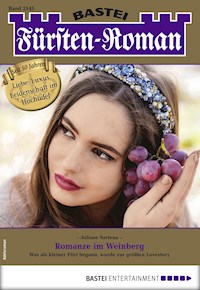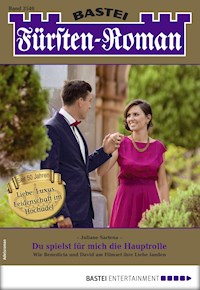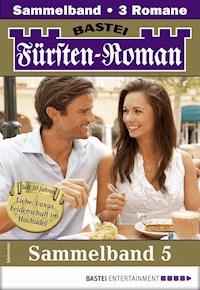
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürsten-Roman Sammelband
- Sprache: Deutsch
Sammelband 5: Drei Mal Liebe, Luxus, Leidenschaft im Hochadel zum Sparpreis
3 Romane lesen, nur 2 bezahlen!
"Fürsten-Romane" entführen in die Welt des Hochadels und lassen die Herzen der Leserinnen und Leser höherschlagen. Die Romanzen der Prinzessinnen und Prinzen spielen auf herrlichen Schlössern, erzählen von Mut und Hoffnung, von Glück und Tränen, Glanz und Einsamkeit - und von der ganz großen Liebe! Welche geheimen Wünsche, Träume und Sehnsüchte bewegen die Reichen und Adeligen?
Seit mehr als 50 Jahren bilden die Fürsten-Romane den Inbegriff für Geschichten aus der Welt des Hochadels. Tauchen Sie ein in eine ebenso aufregende wie glamouröse Welt!
In diesem Sammelband sind Folgen 2442 bis 2444 enthalten:
2442: "Lass mich dein Beschützer sein" von Juliane Sartena
2443: "Ein Traum voller Zärtlichkeit" von Diana Laurent
2444: "... denn die Liebe schmeckt so süß" von Sabine Stephan
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 250 Taschenbuchseiten.
Fürsten-Romane - Luxus zum Lesen
Jetzt herunterladen und sparen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln Titelbild: shutterstock / Monkey Business Images ISBN 978-3-7325-7052-2Juliane Sartena, Diana Laurent, Sabine Stephan
Fürsten-Roman Sammelband 5 - Adelsroman
Inhalt
Inhalt
Cover
Impressum
Lass mich dein Beschützer sein
Vorschau
Lass mich dein Beschützer sein
Bezaubernder Roman um Prinzessin Mara und ihren Leibwächter
Von Juliane Sartena
Nachdem Prinzessin Mara auf einem teuren Privatinternat erfolgreich ihr Abitur bestanden hat, kehrt sie zu ihrer Familie zurück und wünscht sich eigentlich nur eins: ein normales Leben zu führen. Sie hat es satt, immer nur die verwöhnte Prinzessin zu sein. Und so beschließt Mara, sehr zum Missfallen ihrer Eltern, ein Studium an einer staatlichen Universität zu beginnen und in ein gewöhnliches Studentenwohnheim zu ziehen – weit weg vom elterlichen Schloss und all dem Luxus.
Als sie ihr Zimmer im Wohnheim bezieht, glaubt die Prinzessin, endlich frei zu sein, doch schon bald stellt sie fest, dass sich ein geheimnisvoller Fremder stets in ihrer Nähe aufhält …
»Kindchen, wir sind ja so stolz auf dich!«
Charlotte Fürstin von Ambach, rief diese Worte mit dem ihr eigenen Überschwang aus. Mit dem »Kindchen« war ihre immerhin neunzehnjährige Tochter, Prinzessin Mara, gemeint, deren glänzender Schulabschluss heute gefeiert wurde.
Zu diesem Zweck hatte sich nicht nur ein Teil der fürstlichen Verwandtschaft eingefunden, sondern auch Frederik Graf von Bergheim, von dem man sich erhoffte, dass er einmal der Ehemann der Prinzessin werden würde.
Prinzessin Mara lächelte etwas verlegen. Sie fand, dass ihre Mutter immer schrecklich übertrieb, vor allem was ihre eigene Person betraf.
»Ach Mama, es ist doch nichts Besonderes, sein Abitur zu machen«, versuchte Mara, die Euphorie ihrer Mutter zu bremsen.
»Du hattest einen Einserschnitt!«, erinnerte die Fürstin, da sie den Ruhm ihrer Tochter keinesfalls geschmälert sehen wollte, nicht einmal von Mara selbst.
»Wir sind wirklich sehr stolz auf dich«, bestätigte nun auch der Fürst von Ambach mit ruhiger Stimme das Lob seiner Ehefrau.
Mara, die die Erfahrung gemacht hatte, dass mit ihrem Vater meistens viel vernünftiger zu reden war als mit ihrer Mutter, hakte sich bei ihm unter und zog ihn ein wenig beiseite.
Gemeinsam blickten sie auf das im Schlossfoyer aufgebaute Buffet, an dem die Gäste sich bedienten. Die Tafel bog sich unter den von einem Catering Service gelieferten Köstlichkeiten. Der Fürst und die Fürstin von Ambach hatten an nichts gespart. Das taten sie nie, wenn es um ihre einzige Tochter ging.
»Weißt du Papa, so stolz bin ich eigentlich gar nicht auf mich«, versuchte Prinzessin Mara, ihrem Vater zu erklären.
Der Fürst blickte sie erstaunt an.
»Aber warum denn nicht?«, fragte er fast ein wenig erschrocken. »Du hast doch allen Grund dazu.«
»Ach Papa. Du weißt so gut wie ich, dass ich auf einem teuren Privatinternat war, auf dem es möglich ist, die Schüler nach allen Mitteln der Kunst zu fördern.«
»Was ist daran verkehrt? Die Schule, die du besucht hast, genießt einen ausgezeichneten Ruf«, bemerkte der Fürst stirnrunzelnd.
»Es ist nichts verkehrt daran«, gab Mara ihm zu verstehen. »Aber ich finde, es ist auch nichts, worauf ich besonders stolz sein könnte.« Sie suchte kurz nach Worten. »Ich meine damit, ich habe mich nicht selbst durchschlagen müssen. Mir ist sozusagen alles in den Schoß gefallen. Wie bisher immer in meinem Leben.«
Das klang fast wie ein Vorwurf.
Der Fürst musterte sie nachdenklich. Das Licht der Kronleuchter fiel auf Maras blondes Haar, das jetzt golden schimmerte. Sie trug es locker nach oben gesteckt, was ihr besonders gut stand. Der ernsthafte Ausdruck, den ihr hübsches Gesicht nun angenommen hatte, rührte und belustigte ihn zugleich.
»Wir sind froh, dass wir dir eine sorglose Kindheit und Schulzeit ermöglichen konnten«, bemerkte er freundlich. »Und du solltest es eigentlich auch sein.«
»Ich will ja auch nicht undankbar sein«, stellte Mara sofort richtig. »Was ich damit ausdrücken möchte, ist lediglich, dass ich ein behütetes Töchterlein bin.«
»Du bist eine Prinzessin.« Das klang wie ein schlichtes Statement, doch in der Stimme ihres Vaters lag untergründig der Adelsstolz von Generationen.
»Ich weiß.« Prinzessin Mara seufzte unwillkürlich. »Eine Prinzessin wie aus dem Bilderbuch. Eine Prinzessin, die in einem Elfenbeinturm lebt.«
Der Fürst verzichtete auf eine Erwiderung, da sich in diesem Augenblick Maras Fast-Verlobter Frederik Graf von Bergheim zu ihnen gesellte.
»Was ist denn hier los?«, wollte der mit einem kleinen Lächeln wissen. »Eine Verschwörung zwischen Tochter und Vater oder eine Art Geheimkonferenz?«
»Weder noch«, entgegnete der Fürst. »Mara ist lediglich ein wenig unzufrieden mit ihrem Dasein.«
»Aber weshalb denn das?«, rief der junge Graf ungläubig aus.
»Ihr Leben gleicht zu sehr dem einer Bilderbuchprinzessin«, teilte der Fürst ihm mit einer sanften Stimme, die nicht ganz ohne Ironie war, mit.
Mara war ein wenig böse auf ihren Vater, weil er ihr persönliches Gespräch so einfach preisgab. Doch sie wusste, dass er große Stücke auf Frederik hielt und ihn bereits als eine Art Schwiegersohn betrachtete. Deshalb hielt er es auch für unnötig, Geheimnisse vor ihm zu haben.
»Ach Unsinn«, tat sie seine Bemerkung ab, als sie Frederiks fragenden Blick auf sich gerichtet spürte. »Ich weiß, dass es mir gut geht. Ich will nur nicht in einem Elfenbeinturm leben.«
»Das tust du doch gar nicht«, widersprach ihr Vater.
»Ein bisschen schon. Aber das wird sich jetzt ohnehin bald ändern, wenn ich mein Studium aufnehme.«
»So ist es. Wenn du nach Oxford kommst, hast du eine völlig neue Umgebung«, pflichtete der Fürst ihr bei.
Prinzessin Mara drehte das Champagnerglas, das sie in ihren Händen hielt. Dabei überlegte sie kurz, ob jetzt der richtige Zeitpunkt war, ihren Vater von ihren eigenen Plänen zu unterrichten.
Sie entschloss sich dafür. Mit einer entschiedenen Geste stellte sie ihr Glas ab.
»Ich werde nicht nach Oxford gehen«, erklärte sie dabei freundlich, aber bestimmt.
Die Reaktion erfolgte ähnlich, wie sie vermutet hatte.
»Wie bitte?«, erklangen gleichzeitig die Stimmen ihres Vaters und Graf Frederiks.
»Nach acht Jahren auf einem Eliteinternat will ich nicht sofort an eine Eliteuniversität wechseln.« Die Prinzessin nahm unwillkürlich eine Verteidigungshaltung an. »Ich möchte das wirkliche Leben kennenlernen.«
»Das wirklich Leben? Was, um Himmels willen, stellst du dir darunter vor?«, rief Fürstin Charlotte aus, die sich ebenfalls der kleinen Gruppe genähert hatte und der die letzte Bemerkung ihrer Tochter nicht entgangen war.
»Jedenfalls etwas anderes als festliche Empfänge im Schloss, kulinarische Buffets und teure Privatschulen«, entgegnete Mara energisch. »Aus diesem Grund werde ich auch nicht nach Oxford gehen, wo sich wieder erlesene Zirkel und die ganze Upperclass versammeln.« Sie holte kurz Luft. »Ich möchte mich lieber hier in Deutschland ganz normal an einer regulären Universität einschreiben. Als eine von vielen anderen Studentinnen. Ohne Prinzessinnenbonus!«
Mit diesen Worten drehte sie sich auf dem Absatz um und ließ ihre verblüfften Eltern und Graf Frederik stehen.
»Das ist doch nur eine Laune«, wandte Fürstin Charlotte sich sichtbar beunruhigt an ihren Gatten. »Oder was meinst du?«
»Ich will es hoffen«, entgegnete der schulterzuckend.
***
Es war mehr als eine Laune. Es war ein Entschluss. Und Prinzessin Mara blieb dabei: keine Eliteuniversität im Ausland, sondern ein ganz normaler Studiengang in Deutschland. Und keine exklusive Penthousewohnung in der Stadt, sondern ein bescheidenes Studentenwohnheim in Universitätsnähe.
»Das kann sie doch nicht machen!«, meinte Fürstin Charlotte, während sie nervös im Salon von Schloss Ambach auf und ab ging. »Unsere Tochter, eine Prinzessin von Ambach, will sich in einem Studentenwohnheim einquartieren. Das ist einfach un-mög-lich!«
Das Betonen jeder einzelnen Silbe verlieh ihrer Entrüstung noch mehr Ausdruck.
»Ich bin auch nicht damit einverstanden«, gab der Fürst zu verstehen. »Das ist nicht der richtige Platz für unsere Tochter. Sie sollte unter ihresgleichen bleiben.«
»Genau das finde ich auch«, stimmte seine Frau ihm sofort zu. »Aber weißt du, was sie erwidert hat, als ich ihr gestern Abend genau das gesagt habe?«
Er schüttelte den Kopf, blickte die Fürstin dabei aber erwartungsvoll an.
Die holte tief Luft und schnaubte vor Missbilligung.
»Sie meinte: ›Wenn ich mich nur unter unseresgleichen bewegen soll, ist es wohl am besten, ich gehe ab jetzt nur noch in der Familiengruft spazieren.‹ Was sagt man dazu?«, entrüstete sich die Fürstin.
Fürst Ambach musste unwillkürlich grinsen. Er schätzte die Schlagfertigkeit seiner Tochter, auch wenn sie mal nicht seiner Meinung war.
»Nun ja. Vielleicht hat sie damit sogar nicht unrecht«, meinte er.
»Was für ein Unsinn!«, erwiderte Fürstin Charlotte aufgebracht. »Sie ist nun mal eine Prinzessin und unsere einzige Tochter. Somit ist sie auch etwas Besonderes. Wir haben sie immer gut behütet, und das müssen wir auch weiterhin tun. Sie hat doch keine Ahnung vom Leben.«
»Wenn sie wirklich keine Ahnung vom Leben hat, dann liegt das vielleicht daran, dass wir sie bisher tatsächlich zu sehr behütet haben«, gab der Fürst zu verstehen.
Fürstin Charlotte wischte diese durchaus vernünftigen Bedenken ihres Mannes mit einer kurzen, aber bestimmten Handbewegung beiseite.
»Wir müssen uns etwas einfallen lassen.«
»Was willst du denn machen? Sie ist schließlich kein kleines Kind mehr, das man einsperren kann, sondern eine erwachsene Frau.«
»Irgendjemand muss auf sie aufpassen«, fuhr die Fürstin fort, ohne dem Einwand ihres Mannes weitere Beachtung zu schenken. »Und ich glaube, ich habe auch schon eine Idee«, fügte sie nach kurzem Nachdenken hinzu.
***
Prinzessin Mara blickte auf das Profil ihres Verlobten. Graf Frederik lenkte seinen dunkelgrünen Maserati geschickt durch den Stadtverkehr, hatte dabei aber eine ziemlich grimmige Miene aufgesetzt.
Die Prinzessin kannte den leicht verkniffenen Zug um seine Mundwinkel und wusste, dass er damit stumm seine Missbilligung ihrer Pläne zum Ausdruck brachte.
Sobald er den Wagen vor dem angesteuerten Studentenwohnheim geparkt hatte, wandte er sich zu ihr, um sein Missfallen nun auch verbal zum Ausdruck zu bringen.
»Sieh dir nur diese trostlose Architektur an«, machte er sie aufmerksam. »Ein hässlicher Betonbau aus den Endsiebzigern. Und dort willst du einziehen? Ich kann dir bereits jetzt sagen, dass die Zimmer winzig sein werden. Vermutlich musst du dir Küche und Bad mit anderen Studenten teilen, und überall liegen Haare in den Waschbecken.«
Ein deutliches Naserümpfen schwang in seiner Stimme mit.
Bei Prinzessin Mara, die recht eigenwillig sein konnte, bewirkten seine Äußerungen das Gegenteil von dem, was er damit bezweckte. Nun erst recht, dachte sie sich.
»Sind wir hierhergefahren, damit du mir, genauso wie Mama und Papa die ewig gleiche Predigt halten kannst, oder hilfst du mir jetzt, meine Kleiderkoffer und Bücherkisten nach oben zu tragen?«, fragte sie genervt.
»Bitte, wenn du dir in deinem Entschluss sicher bist, dann helfe ich die selbstverständlich, deine Sachen zu tragen«, entgegnete er kühl.
»Ja, ich bin mir sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und ich freue mich bereits auf mein winziges Zimmer und die Haare im Waschbecken«, versicherte sie ihm im freundlichsten Tonfall.
Missmutig stieg der Graf aus dem Wagen.
Mara wusste, dass er gleich auf ihre Seite kommen würde, um ihr wohlerzogen die Wagentür zu öffnen. Um ihm in dieser altmodischen Geste zuvorzukommen, sprang sie rasch auf den Gehweg. Das hätte ihr gerade noch gefehlt, dass er hier den Kavalier der alten Schule spielte.
Sie hatte ohnehin bereits das unangenehme Gefühl, dass man ihre Ankunft mit einigem Erstaunen verfolgte. Vermutlich fuhren die meisten Studierenden, die hier wohnten, nicht unbedingt einen glänzend polierten Maserati.
Frederik von Bergheim öffnete den Kofferraum und hob ein wenig umständlich drei Bücherkisten und zwei Koffer heraus. Das war vorerst alles, was Mara in ihrer neuen Unterkunft dabeihaben wollte. Der Umstand, dass es so wenig war, tröstete ihn ein bisschen. Vermutlich würde sie es doch nur kurze Zeit aushalten.
Ohne auf seinen Protest zu achten, griff Mara selbst nach einem Koffer und ging voran. Sie hatte ihr Zimmer in dem Studentenwohnheim selbst noch nicht gesehen und war jetzt sehr gespannt darauf.
Sie wusste nur, dass die Zimmer, ähnlich wie in einem Hotel, durchnummeriert waren und dass ihr Zimmer die Nummer 217 hatte. Das bedeutete, es lag im zweiten Stock – ohne Lift, wie Graf Frederik sofort abschätzig feststellte – auf der linken Seite des Ganges.
Ein wenig atemlos stellte die Prinzessin den Koffer vor der gesuchten Tür ab. Frederik von Bergheim folgte ihr, sichtbar gebeugt unter der Last von zwei Bücherkisten.
»Hier ist es«, verkündete Mara nicht ohne Stolz.
»Und wo ist der Schlüssel dazu?«
Das war eine gute Frage. Sie wurde von einer jungen, hübschen Frau mit dunklen Locken beantwortet, die in diesem Augenblick aus dem Nachbarzimmer trat.
»Hallo«, begrüßte sie Mara. »Bist du neu hier?«
Die Prinzessin nickte.
»Ich heiße Pilar.«
Ein hübscher, spanischer Name, dachte Mara, und sie reichten sich kurz die Hände.
»Wenn du hier einziehen willst und den Schlüssel brauchst, musst du ihn dir im Verwaltungsgebäude abholen«, teilte Pilar der Prinzessin in einem freundlichen und hilfsbereiten Ton mit.
»Kann das denn niemand anders tun?«, entfuhr es Graf Frederik dennoch gereizt, der befürchtete, die schweren Bücherkisten noch einmal bewegen zu müssen. »Schließlich ist es eine ziemliche Zumutung, dass man hier nicht anständig empfangen wird, zumal ganz sicher nicht jeden Tag eine geborene Prinzessin von Ambach in dieses Heim einzieht.«
Es war vielleicht nicht beabsichtigt, aber sein Auftreten, in dem sich sein Unwille über die gesamte Situation entlud, wirkte sehr arrogant.
Mara, der die Erwähnung ihres Titels gar nicht recht war, warf ihm einen strafenden Blick zu, doch er war zu verärgert, um darauf zu reagieren.
Prinzessin Maras künftige Zimmernachbarin, die anfänglich offen gewirkt hatte, ging sichtbar auf Distanz.
»Entschuldigung. Mir war nicht bewusst, dass ich es hier nicht mit Normalsterblichen zu tun habe. Eure Durchlaucht mögen verzeihen, den Schlüssel müssen Sie sich trotzdem selbst holen. Das Schloss dazu haben Sie ja vielleicht bereits«, fügte sie nicht ohne Ironie hinzu und rauschte davon.
»Das ist vielleicht eine schnippische Person«, bemerkte Graf Frederik, der über diesen temperamentvollen Abgang ein wenig überrascht war.
Prinzessin Mara verdrehte sie Augen.
»Da hast du ja was Schönes angerichtet«, stellte sie dabei fest.
»Warum ich?« Er zeigte sich uneinsichtig.
»Weil du sie so angefahren hast.«
»Habe ich doch gar nicht«, leugnete er.
»Doch hast du. Ich bin sicher, dass sie mich die nächste Zeit hassen wird.«
»Weshalb sollte sie denn?«
»Weil du hier mit meinem Prinzessinnentitel hausieren gehst und sie behandelst, als sei sie deine oder meine zukünftige Dienstbotin«, tadelte sie ihn. »Das macht doch einen schrecklichen Eindruck hier.«
»Auf mich macht umkehrt die ganze Umgebung hier einen schrecklichen Eindruck«, gab der Graf deutlich genervt zu verstehen.
»Du sollst ja auch nicht hier wohnen.«
»Du solltest das auch nicht.«
»Womit wir wieder beim alten Thema wären.« Die Prinzessin seufzte. »Sei so lieb, und bleib einen Augenblick bei den Sachen hier. Ich suche inzwischen das Hauptgebäude, um meinen Schlüssel abzuholen.«
Mit diesen Worten ließ sie ihn stehen, um sich auf den Weg zu machen.
Das Hauptgebäude war ein schlichter Bau in der Mitte der Anlage. Auch er strahlte den Charme der Siebzigerjahre aus, doch die Verwaltungsdame war freundlich, und alle Formalitäten wurden rasch erledigt.
Gut gelaunt kehrte Mara zu Graf Frederik zurück, der mit düsterer Miene ihr Gepäck bewachte.
»Bitte sehr, ich hab ihn.« Sie hielt den Schlüssel hoch. »Jetzt können wir aufschließen.«
Das Zimmer war geräumiger und auch hübscher, als erwartet. Von einem verhältnismäßig großen Fenster aus, an dem ein Schreibtisch stand, bot sich ein Blick auf die durchgrünte Wohnstraße, wo Frederik seinen Maserati geparkt hatte. Zwischen die vielen Fahrräder und verrosteten Kleinwagen passte er so gut wie ein Goldfasan in den Hühnerstall.
Auch ein Bett und ein Schrank waren bereits vorhanden. Ein wenig kam Mara sich vor, als würde sie ein Hotelzimmer beziehen.
»Fünf Sterne hat das hier nicht gerade«, bemerkte Frederik, der eine ähnliche Gedankenverbindung gehabt zu haben schien.
»Na und? Einfach und sauber. Was will man mehr?« Und um weiteren Einwänden seinerseits zuvorzukommen, forderte sie ihn sogleich auf, alles Gepäck auf das Bett zu schaffen. »Auspacken tue ich dann alleine«, versicherte sie freundlich.
Ihr Verlobter reagierte ein wenig pikiert.
»Das hört sich ganz so an, als wolltest du mich schnellstmöglich wieder loswerden«, meinte er.
»Natürlich nicht«, beruhigte die Prinzessin ihn rasch, wobei das nicht ganz stimmte.
Sie freute sich über ihr neues Domizil, das für sie so viel Unabhängigkeit bedeutete, Unabhängigkeit von ihrem bisherigen Luxusleben und – so lächerlich das klingen mochte – einen Hauch von Freiheit.
Dieses neu gewonnene Freiheitsgefühl würde sie jedoch nur genießen können, wenn Graf Frederiks nobler Schlitten nicht länger vor dem Wohnheim parkte und auch er selbst verschwand.
Angesichts der Mühe, die er sich mit ihren schweren Bücherkisten gemacht hatte, fühlte sie sich ein wenig undankbar bei diesem Gedanken. Aber sie konnte es nun mal nicht ändern. Um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, schenkte sie ihm nun ein besonders freundliches Lächeln.
»Soll ich dir einen Tee kochen?«, bot sie an. »Ein paar Teebeutel sind im Gepäck.«
»Wo willst du den Tee denn trinken?«, entgegnete er mürrisch. »Etwa in der gemeinsamen Wohnküche auf dem Flur? Nein, danke.«
»Bitte sehr. Dann eben nicht.«
»Ich möchte nicht wissen, wie es um die Hygiene in dieser Küche bestellt ist, die von mindestens zehn weiteren Personen benutzt wird.«
»Du übertreibst. Es befinden sich hier mehrere Kocheinheiten auf dem Flur« belehrte Mara ihn. »Ich teile die Küche und das Bad nur mit meiner unmittelbaren Zimmernachbarin.«
»War das die unfreundliche Person von vorhin?«
»Sie war nur unfreundlich, weil du sie so angeschnauzt hast.«
»Ich habe nur die Zustände bemängelt. Das war alles.«
»Sie ist für diese ›Zustände‹, die im Übrigen ganz normal sind, aber nicht verantwortlich. Außerdem war es mir sehr peinlich, dass du unbedingt meinen Prinzessinnentitel erwähnen musstest. Genau das will ich hier nicht sein: die Prinzessin.«
»Du bist es aber trotzdem.« Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Niemand kann sich seine Herkunft selbst aussuchen. Und die meisten Menschen werden dich darum beneiden.«
»Ach, Frederik. Ich will einfach nur eine ganz normale Studentin sein. Kannst du das denn nicht verstehen?«
»Ehrlich gesagt, nein.«
Sie seufzten beide, denn die Missstimmung zwischen ihnen war unverkennbar.
Graf Frederik erhob sich von dem Schreibtischstuhl, auf dem er sich kurz niedergelassen hatte.
»Nun ja. Dann möchte ich dich nicht länger aufhalten«, erklärte er dabei. »Versuche dich meinetwegen in deinem Leben als Bettelstudentin. Wenn es dir nicht mehr gefällt, schick mir eine kurze Nachricht. Dann komme ich und hole dich wieder ab.«
»Vielen Dank. Aber ich denke, ich komme hier ganz gut zurecht.«
Er ging ohne Abschiedskuss.
Mara wusste, dass er immer noch schlecht auf sie zu sprechen war, da er ihre Unterkunft für alles andere als standesgemäß hielt und sie selbst für verrückt.
Sie zuckte mit den Schultern, holte einen Teebeutel aus der Tasche und ging damit nach nebenan in die kleine Küche. Dann würde sie sich eben ihren Tee zum Einstand für sich allein kochen.
***
Während Prinzessin Mara noch im Stehen in ihrer Tasse rührte, betrat Pilar die Küche.
»Hallo«, sagte Mara, mit dem schüchternen Versuch, den kleinen Zusammenstoß mit Graf Frederik vergessen zu machen und sich mit ihr anzufreunden.
»Hallo«, wurde ihr kühl erwidert.
Ganz offensichtlich war Pilar immer noch böse.
Mara überlegte, was sie noch sagen könnte, um die Verstimmung ihrer Mitstudentin wieder aufzuheben. Leider fiel ihr nichts Geistreiches ein.
»Ich habe den Wasserkocher gleich gefunden«, erklärte sie daher etwas unbeholfen.
»Eine wahre Meisterleistung für eine Prinzessin, die zu Hause vermutlich alles auf einem silbernen Tablett serviert bekommt«, bekam sie als schnippische Antwort.
Mara war verärgert, da darin die Unterstellung mitschwang, dass sie verwöhnt und zu nichts nutze sei. Sie war schließlich nicht schuld an Frederiks arrogantem Auftreten von eben, also brauchte die hübsche, dunkel gelockte Pilar sich nicht so aufzuregen.
»So wahnsinnig kompliziert scheint mir dieser Wasserkocher nicht zu sein«, gab die Prinzessin daher ein wenig spitz zurück.
»Das kann man nie wissen. Es kommt wohl immer auf die Intelligenz des Benutzers an. Jedenfalls ist es besser, du schüttest immer das ganze Wasser ab, er verkalkt sonst nämlich.«
Sie musterten sich gegenseitig mit wenig freundlichen Mienen.
»Ich werde die Anweisungen bezüglich des Wasserkochers befolgen und mein Besteck in diese Hälfte des Schrankes räumen«, erklärte Prinzessin Mara, indem sie auf die linke Seite deutete, denn dort war noch Platz.
»Ist recht«, entgegnete Pilar. »Ich nehme an, ich werde die silbernen Löffel an dem Krönchen drauf erkennen«, fügte sie dann nicht ohne Sarkasmus hinzu.
»Schon möglich«, entgegnete Prinzessin Mara. »Ich jedenfalls werde meine silbernen Löffelchen alle zählen.«
Man konnte förmlich sehen, wie sich Pilars Locken bei dieser Bemerkung entrüstet in die Höhe stellten.
»Ich habe nicht vor, silberne Löffel zu klauen!«, rief sie empört.
»Es war nur ein Scherz«, beschwichtigte Prinzessin Mara sie, da sie erkannte, dass sie ein wenig zu weit gegangen war.
Pilars Augen flammten immer noch. Es scheint so gut wie ausgeschlossen, dass man sich mit dieser Person anfreunden kann, sagte Mara sich. Pilar schien zu den Menschen zu gehören, die immer gleich hochgehen. Plötzlich hatte die Prinzessin keine Lust mehr auf Tee. Sie schüttete den Rest ihrer Tasse in das Spülbecken.
»Das Spülbecken bitte sauber machen, sonst gibt das Flecken«, bemerkte Pilar, die Mara zugesehen hatte.
Dann rauschte sie aus der Küche.
Mara blickte ihr nach und war geneigt, eine kleine Grimasse zu ziehen. So eine Zicke! Hoffentlich behielt Frederik nicht recht damit, wenn er meinte, dass Mara als Prinzessin hier in diesem Studentenwohnheim fehl am Platz war.
***
Die erste Nacht in ihrem Zimmer schlief Mara schlecht. Das Bett war für sie noch ungewohnt, außerdem störte sie der Schein der Straßenlaterne, der durch ihr Fenster fiel. Unruhig drehte sie sich hin und her, schließlich hielt sie es nicht mehr aus und stand auf.
Es fehlen eben noch die Vorhänge, sagte sie zu sich selbst, während sie an das Fenster trat und in die Nacht hinausblickte. Die Laterne stand ziemlich genau auf der anderen Straßenseite, ungefähr da, wo Frederik tagsüber seinen auffälligen Maserati geparkt hatte.
Sie seufzte bei dem Gedanken daran. Der gute Frederik. Er liebte exklusive Autos und den Luxus. Darauf würde er niemals freiwillig verzichten. Und er würde auch immer auf Stand und Namen pochen.
Was, wenn sie jetzt wirklich nur eine ganz normale Studentin wäre und keine geborene Prinzessin von Ambach, kam ihr in den Sinn. Würde er mich dann auch noch heiraten wollen? Natürlich, versicherte sie sich selbst rasch und schob jeden weiteren Gedanken, der in diese Richtung ging, beiseite.
Besser sie wandte sich den praktischen Fragen des Lebens zu, statt dummen Ideen nachzuhängen. Jeder wusste, dass man in schlaflosen Nächten leicht schwarz zu sehen pflegte. Mal sehen, ob sich eine Außenjalousie an dem Fenster befand.
Während sie nach einer entsprechenden Vorrichtung suchte, fiel ihr Blick erneut auf die nächtliche Straße, und sie hielt unwillkürlich in ihrer Bewegung inne.
Was war das? Ein Schatten? Oder fing sie an, Gespenster zu sehen? Nein, sie irrte sich nicht. Neben der Laterne war ganz deutlich ein Schatten zu erkennen.
Sie rieb sich die Augen, um besser sehen zu können. Es war die Gestalt eines Mannes, der sich vom Dunkel der Nacht abhob. Er schien groß und schlank zu sein, mit einem durchtrainierten Oberkörper und lehnte in einer lässigen Haltung an dem Laternenpfahl.
Obwohl sie das Licht nicht eingeschaltet hatte und man sie in ihrem dunklen Zimmer ganz sicher nicht sehen konnte, trat Mara unwillkürlich einen Schritt zurück. Sie hatte das Gefühl, als würde der männliche Schatten zu ihr nach oben blicken.
Diese Vorstellung empfand sie als nicht besonders angenehm. Ein Unbekannter, der nachts vor ihrem Fenster stand und zu ihr hochstarrte, das war irgendwie unheimlich.
Ich bin müde und überreizt, rief sie sich selbst zur Ordnung, als sie sich wieder zurück in ihr Bett legte. Und morgens werde ich als Erstes möglichst blickdichte Vorhänge kaufen.
***
Der Wasserkocher dampfte bereits, als Mara am nächsten Morgen die kleine Küche betrat. Pilar war dabei, Kaffee zu kochen, verteufelt starken Kaffee, so wie es schien, denn er duftete intensiv und köstlich.
Prinzessin Mara, die nur noch ein paar Teebeutel im Gepäck hatte, warf unwillkürlich einen sehnsüchtigen Blick darauf, der von ihrer Zimmernachbarin jedoch geflissentlich ignoriert wurde. Ganz offensichtlich hegte Pilar immer noch große Vorurteile gegen sie.
Sie begrüßten sich beide mit einem knappen »Hallo«.
Als Mara sich an den Tisch setzte, griff Pilar nach ihrer Kaffeetasse und verschwand damit aus der Küche. Offensichtlich zog sie es vor, ihren Kaffee allein in ihrem Zimmer zu trinken.
»Auch recht«, sprach Mara für sich halblaut in den Raum hinein. »Dann frühstücke ich eben unterwegs in der Stadt. Nur schwarzer Tee, ganz allein hier in der Küche, wäre ohnehin ein bisschen zu wenig.«
Ihr Blick fiel auf den Wasserkocher, und in einer Anwandlung von Bosheit schüttete sie Essig hinein. Das war gut zum Entkalken. Hoffentlich sah Pilar nicht genauer nach, wenn sie sich ihren nächsten Kaffee kochte. Der würde bestimmt gut schmecken.
Ein paar Ecken weiter befand sich eine Bäckerei, die Milchkaffee und Croissants als Frühstück anbot. Die Prinzessin suchte sich einen Platz in einer Fensternische und sog genüsslichen den Geruch von Kaffee ein. Der Kaffee in ihrer Studentenwohnküche hatte zwar noch köstlicher geduftet, aber wenigstens suchte hier niemand Streit mit ihr.
Während sie von ihrem Croissant abbiss, griff sie nach der Zeitung, die auslag. Nichts Weltbewegendes, stellte sie fest, nachdem sie die Schlagzeilen überflogen hatte. Am besten, sie beeilte sich mit dem Frühstück, dann konnte sie die Vorhänge noch vor ihrer ersten Vorlesung kaufen.
Als sie ihr Tablett zurückstellen wollte, stieß sie beinahe mit einem jungen Mann zusammen, der sich gleichzeitig mit ihr von einem anderen Tisch erhoben hatte.
»Entschuldigung«, rief Mara aus, da die Mineralwasserflasche auf seinem Tablett ins Wanken gekommen war und nun zu Boden rollte.
»Das macht nichts«, versicherte er ihr, während er sich rasch bückte, um die Plastikflasche wieder aufzuheben.
Sie hatte Zeit, das Erscheinungsbild des jungen Mannes zu registrieren. Er trug eine helle Hose und eine dunkelblaue Jacke. Sein Profil war gut geschnitten.
Ein Gast hinter Mara drängte sie, weiterzugehen, und auch der junge Mann hatte es offensichtlich ziemlich eilig, die Bäckerei zu verlassen.
Die Prinzessin trat ebenfalls nach draußen. Warum mussten die Leute in der Großstadt nur alle so schrecklich hektisch sein? Fast sehnte sie sich zu ihrer ländlichen Kindheitsidylle auf Schloss Ambach zurück. Auch das Internatsleben hinter Mauern war angenehm und wohlgeordnet gewesen.
Dann schüttelte sie jedoch lächelnd den Kopf und machte sich daran, ein Geschäft zu finden, in dem sie Vorhänge kaufen konnte.
***
»Haben Sie bereits eine genaue Vorstellung?«, erkundigte die Verkäuferin sich bei Mara, die vor einem Tisch mit Stoffballen stand.
Die Prinzessin hielt unschlüssig eine Textilpalette in der Hand und strich über die in Farbnuancen abgestuften Vorhangmuster.
»Das Weiß mit den Streublumen darauf ist ganz hübsch«, meinte sie dann.
»Ein ganz entzückendes Muster«, wurde ihr sofort zugestimmt. »So leicht, frühlingshaft und duftig.«
»Hm«, meinte Mara. »So duftig, dass man auch durchsehen kann?«
»Natürlich. Dieser Stoff ist ein zarter Traum und bietet vollkommene Transparenz. Er nimmt ihnen tagsüber nicht das geringste Licht weg.«
»Dann ist es nicht das Richtige für mich«, entschied Mara. »Ich brauche einen blickdichten Vorhangstoff. Mein Zimmer geht nämlich zur Straße hinaus«, fügte sie fast entschuldigend hinzu.
Den unheimlichen Männerschatten am Laternenpfahl wollte sie lieber nicht erwähnen, zumal sie sich im Laufe des Tages zunehmend sicherer war, dass sie sich das alles nur eingebildet hatte.
»Tja, wenn Sie etwas Blickdichtes suchen, dann wäre vielleicht dieser Stoff hier das Geeignete.«
Die Verkäuferin machte Mara auf einen cremefarbenen Stoff aufmerksam, der seidig glänzte, sich aber ziemlich schwer anfühlte, wenn man ihn in die Hand nahm.
»Er ist auf der Rückseite noch einmal gefüttert, sodass ganz bestimmt niemand durchsehen kann. Vermutlich sieht man von der Straße aus nicht einmal, ob sie Licht in ihrem Zimmer haben. Er ersetzt Ihnen somit eine Jalousie.«
»Das wäre vielleicht das Passende«, meinte Mara.
»Mit diesem hellen Cremeton können Sie eigentlich nichts falsch machen«, versicherte die Verkäuferin ihr. »Er ist neutral, passt zu jeder Einrichtung und wirkt immer hell und freundlich.«
Prinzessin Mara nickte. Der duftige Stoff mit den Streublumen hatte ihr zwar noch besser gefallen, doch es war auf jeden Fall besser, wenn man nachts nicht in ihr Zimmer sehen konnte, auch dann, wenn es keine heimlichen Beobachter gab.
»Ich nehme ihn«, erklärte sie.
»Sehr schön«, freute sich die Verkäuferin, da die Ware nicht ganz billig war. »Bis wann soll der Vorhang denn angefertigt werden?«
»Ich habe die Fenstermaße bei mir«, meinte Prinzessin Mara. »Je eher der Vorhang fertig ist, desto besser.«
»Wenn Sie möchten, kann ich einen Express-Auftrag an unsere Näherei geben. Dann ist der Vorhang übermorgen abholbereit. Das kostet aber einen kleinen Zuschlag.«
»Das macht nichts«, entgegnete Mara. »Ich nehme den Eilservice trotzdem gern in Anspruch.«
»Bitte, gerne. Ich mache einen Vermerk an der Kasse, dann liegen die Vorhänge am Donnerstag für Sie bereit.«
Prinzessin Mara nickte und verließ das Geschäft. Dabei überlegte sie unwillkürlich, ob es wirklich so eilig war mit den Vorhängen. Aber sie war sicher, sie würde sich besser fühlen, wenn sie sich in ihrem Zimmer von der Außenwelt abschotten konnte. Das Bedürfnis, unbeobachtet zu sein, war schließlich ganz normal – oder?
Unmittelbar vor dem Geschäft befand sich eine Ampelanlage. Gedankenverloren machte Mara einen Schritt nach vorne.
Im selben Augenblick fühlte sie eine feste Hand an ihrer Schulter. Sie wusste nicht, wurde sie gezogen oder gestoßen. Reifenquietschen und Hupen wurden laut. Erschrocken fuhr sie zusammen.
Er heranfahrendes Auto hatte scharf gebremst. Der Fahrer ließ das Fenster herunter und äußerte lautstark seinen Unmut.
»Haben Sie denn keine Augen im Kopf?«, fuhr er Mara an. »Die Fußgängerampel ist rot. Beinahe wären Sie mir vor das Auto gelaufen! Hätte der junge Mann Sie eben nicht zurückgezogen, dann wären Sie jetzt vermutlich platt!«
Prinzessin Mara, die blass geworden war, blickte um sich. Neben ihr standen ein paar andere Passanten, aber einen jungen Mann konnte sie darunter nicht erkennen.
»Was für ein Mann?«, fragte sie daher. »Wie sah er aus?«
»Helle Hose, dunkle Jacke. Da vorne läuft er doch.«
Unwillkürlich wandte sie sich in die angegebene Richtung. Die Gestalt, die eben in eine andere Straße abbog, glich aus der Ferne dem jungen Mann aus der Bäckerei.
»Aber es tut ja auch nichts zur Sache, wer Sie rechtzeitig am Kragen gepackt hat«, fuhr der erboste Autofahrer weiter fort. »Sie sollten besser im Straßenverkehr aufpassen, mein Fräulein!«
Das »Fräulein« wurde in einem abschätzigen Ton ausgesprochen, doch Prinzessin Maras Knie zitterten noch zu sehr, als dass sie sich zur Wehr hätte setzen können.
Die Autokolonne rollte weiter, und Mara überquerte mit dem nächsten Fußgängerpulk bei Grün die Ampel.
Sie war heilfroh, als sie endlich das Universitätsgebäude erreichte.
***
Die Vorlesung über englische Literatur, die Mara nach diesem Zwischenfall besuchte, war recht interessant. Der Professor verstand es, hin und wieder einen geistreichen Witz einzustreuen, sodass keine Langeweile aufkam und Mara den unangenehmen Zwischenfall an der Verkehrsampel bald vergaß.
Beschwingt machte sie sich auf den Weg zurück ins Studentenwohnheim. Der fremde junge Mann, der ihr heute zweimal begegnet war, einmal in der Bäckerei und später auf der Straße, war längst wieder aus ihren Gedanken verschwunden – bis sie ihn erneut erblickte. Diesmal stand er in der großen Aula, und sie hätte schwören können, dass er sein Augenmerk auf sie gerichtet hatte.
Eigentlich sah er gut aus: groß, athletisch, dunkelhaarig – doch die Vorstellung, dass er ihr folgte, war ihr unheimlich.
Rasch wandte sie sich ab und schloss sich eilig einer Gruppe von Studenten an, die dieselbe Vorlesung wie sie besucht hatten.
Die meisten kannten sich und lachten und scherzten miteinander.
Sie selbst war ganz allein. Plötzlich fühlte sie sich sehr einsam. Es wäre schön, einfach wieder nach Schloss Ambach zurückzukehren, wo jeder freundlich zu ihr war und man sie den ganzen Tag als Prinzessin verwöhnte.
Sie schob diese verführerische Vorstellung jedoch energisch wieder beiseite. Das hätte ihr gerade noch gefehlt, den unausgesprochenen Triumph ihrer Eltern über die Rückkehr ihrer verlorenen Tochter zu spüren.
***
Als Prinzessin Mara ihr Zimmer betreten wollte, öffnete sich die Tür neben ihr.
Pilar trat auf sie zu, einen großen Blumenstrauß in der Hand.
Mara zog erstaunt die Augenbrauen nach oben. Was war das? Etwa ein Friedensangebot von ihrer Mitbewohnerin?
Pilars Worte belehrten sie rasch eines Besseren.
»Diese Blumen wurden hier für dich abgegeben«, erklärte sie.
»Von wem sind sie?«, fragte die Prinzessin überrascht.
»Vermutlich vom königlichen Hoflieferanten«, entgegnete Pilar ironisch grinsend.
Die Prinzessin war geneigt, sie darauf aufmerksam zu machen, dass ein Witz nicht besser wurde, wenn man ihn in verschiedenen Varianten wiederholte, verzichtete dann aber lieber auf einen solchen Hinweis.
Dafür zog sie die Tür ihres Zimmers hinter sich zu und suchte nach einer Karte in dem Blumenstrauß. Es war aber keine dabei.
Nachdenklich steckte sie die Nase in das schön arrangierte Bukett. Schickte ihr ein Fremder Blumen? Etwa der Unbekannte, von dem sie glaubte, dass er ihr heute gefolgt war? Vielleicht war sogar er es, der nachts vor ihrem Fenster Wache hielt.
Ich beginne, an Verfolgungswahn zu leiden, rief sie sich selbst zur Ordnung.
Der Ton ihres Handys riss sie aus solchen Überlegungen. Es war Graf Frederik.
»Hallo, meine Liebe. Wie geht es dir?«, wollte er wissen.
»Ganz ausgezeichnet«, behauptete Mara, die gar nicht daran dachte, ihn von den seltsamen Vorkommnissen der letzten Stunden zu unterrichten.
»Freut mich zu hören. Hast du übrigens meinen Blumenstrauß bekommen?«
»Die Blumen sind also von dir?« Ein fast erleichtertes Seufzen entrang sich Maras Brust.
»Natürlich. Von wem denn sonst?«
»Ach, ich dachte nur …« Sie brach rasch ab. »Du hast recht, wer sollte mir sonst Blumen schicken?«
»Gefallen Sie dir? Ich habe einen besonders schönen Strauß für dich ausgesucht.« Seine Stimme klang selbstzufrieden.
Typisch Frederik, dachte Mara unwillkürlich, die ihn vor ihrem geistigen Auge in einem exklusiven Blumenladen stehen sah, wie er nonchalant die geschmackvollste und teuerste Variante an Blumen in Auftrag gab.
»Ich hoffe, sie verleihen deinem tristen Domizil einen kleinen Farbakzent.«
»Danke«, sagte sie mit wenig Freude in der Stimme.
Es war vielleicht kindisch von ihr, aber es ärgerte sie, dass er ihre kleine Studentenwohnung derart herabsetzte. Er ist ein richtiger Snob, schoss es ihr dabei durch den Kopf. Er tut so, als würden alle Menschen, die nicht wie wir in Schlössern aufgewachsen sind, nichts zählen. Dabei stellen doch gerade sie das wahre Leben dar.
Sie vermied es jedoch, eine Grundsatzdiskussion am Telefon vom Zaun zu brechen.
»Die Blumen sollen dich außerdem ein wenig darüber hinwegtrösten, dass ich dich dieses Wochenende nicht besuchen kann«, fuhr Graf Frederik weiter fort. »Man hat mich zu einem Pferderennen eingeladen, wo ich unmöglich absagen kann.«
Edle Pferde und schnelle Autos. Mara kannte Frederiks Vorlieben.
»Schon gut«, meinte sie.
»Ich hoffe, du bist mir nicht böse.«
»Natürlich nicht.«
»Dann bis bald.«
»Bis bald.«
Das kurze Gespräch war beendet, und Mara legte ihr Handy beiseite.
Sie würde sich kurz duschen, Zähne putzen, ein entspannendes Buch zur Hand nehmen und versuchen, früh einzuschlafen.
Nachdem sie ihre Nachttischlampe ausgeschaltet hatte, konnte sie nicht umhin, noch einen Blick aus dem Fenster zu werfen.
Alles war still und friedlich. Oder bewegte sich dort an der anderen Hauswand ein Schatten? Ihr Herz setzte einen Schlag aus.
»Reiß dich zusammen«, ermahnte sie sich selbst. Mit einer entschiedenen Geste zog sie die Bettdecke über den Kopf und schlief zu ihrer eigenen Überraschung schnell ein.
***
Es war bereits Mitte Oktober. Dennoch strahlte die Sonne am nächsten Morgen mit einer Wärme und einer Leuchtkraft, die an Sommer denken ließ.
Mara entschloss sich, nur ein leichtes T-Shirt mit einer dickeren Jacke zu ihren Jeans anzuziehen. Vorsichtshalber wickelte sie noch einen Schal um den Hals, dessen blaugrüne Töne gut zu ihren Augen passten.
Sie griff nach ihrer Collegetasche und machte sich auf den Weg.
Doch sobald sie ins Freie trat, zuckte sie zusammen. In ungefähr zwanzig Metern Entfernung war die Gestalt eines jungen Mannes zu sehen. Sofort erkannte sie in ihm ihren unbekannten Verfolger. Unwillkürlich wich sie ein paar Schritte zurück und trat dabei Pilar auf die Zehen, die in diesem Augenblick ebenfalls aus dem Haus kam.
»Autsch!«, rief Pilar vorwurfsvoll aus, der der Fuß schmerzte. »Kannst du nicht aufpassen, wo du hintrittst?«
»Entschuldigung«, murmelte Mara, die blass geworden war.
»Was ist denn los?«, fragte Pilar, als sie den verstörten Gesichtsausdruck der Prinzessin wahrnahm. »Ist irgendwas passiert?«
»Nein, nichts. Das heißt, ich weiß nicht«, erwiderte Mara konfus.
Pilar, die, wenn sie sich angegriffen fühlte, mit einem aufbrausenden Temperament reagieren konnte, hatte im Grunde genommen ein sehr mitfühlendes und menschenfreundliches Gemüt. Das gewann nun die Oberhand, und sie beschloss, alle bisherigen Missverständnisse zwischen ihr und der Prinzessin beiseitezuschieben.
Sie führte die widerstandslose Mara zurück in die Wohnküche und platzierte sie dort auf einen Stuhl. Dann kochte sie, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, eine Tasse ihres teuflisch starken Kaffees und setzte ihn Mara vor die Nase.
»Trink«, forderte sie die Prinzessin dabei auf. »Und danach erzählst du mir, was mit dir los ist. Du siehst ja aus, als hättest du soeben ein Gespenst gesehen.«
Mara lächelte mit immer noch blassen Lippen und nahm dankbar einen Schluck von dem Kaffee, der ihr schier die Haare zu Berge stehen ließ.
»Schön stark, was?«, fragte Pilar.
»Das kann man wohl sagen«, ächzte Mara.
Sie lachten beide. Das Eis schien gebrochen.
»Vielleicht habe ich tatsächlich nur ein Gespenst gesehen«, erklärte die Prinzessin nach einem zweiten vorsichtigen Schluck.
»Was für ein Gespenst denn? Ich habe noch gar nicht gewusst, dass es in unserem Studentenwohnheim spuken soll. Ich dachte eigentlich immer eher, das sei mehr etwas für dein Schloss zu Hause.«
»Ich weiß auch nicht.« Die Prinzessin, in deren Gesicht wieder etwas Farbe zurückgekehrt war, schüttelte lächelnd den Kopf. »Vielleicht bilde ich es mir ja nur ein. Aber ich habe das Gefühl, als würde mich jemand verfolgen.«
Pilar zog überrascht die Augenbrauen hoch.
»Nein wirklich, ich leide nicht unter Verfolgungswahn«, versicherte Mara rasch, die das Gefühl hatte, sie müsse sich rechtfertigen.
Sie wollte schließlich nicht, dass Pilar sie für verrückt hielt.
»Wer verfolgt dich denn?«, erkundigte sich Pilar.
»Ein Mann. Ungefähr in unserem Alter. Groß, sportliche Figur und dunkelhaarig«, versuchte Mara ihn zu beschreiben.
»Kennst du den Typen?«, wollte Pilar wissen, deren Interesse für den Fall erwacht war.
»Nein«, versicherte Prinzessin Mara ihr.
»Du meinst, er ist ein Stalker?«
»Ich habe das Gefühl, dass er mir nachstellt, ja«, bestätigte Mara.
»Hm«, Pilar begann, hin und her zu gehen, wobei ihre dichten, dunklen Locken lebhaft auf und ab wippten. »Du bist doch eine echte Prinzessin, oder?«
Mara nickte.
»Bestimmt sind deine Eltern ziemlich reich«, fuhr Pilar in ihren Überlegungen weiter fort.
»Sie sind nicht gerade arm.«
»Siehst du, da haben wir es. Vielleicht ist dieser Typ hinter dir her, weil er dich entführen will. Um Lösegeld zu verlangen.«
Prinzessin Mara fühlte sich bei dieser Vorstellung nicht besonders wohl, und das war ihr auch anzusehen.
»Vielleicht ist er auch nur auf Blondinen scharf und träumt davon, ihnen den Hals umzudrehen oder so etwas in der Art«, versuchte Pilar daher, einzulenken.
Prinzessin Mara fand diesen Gedanken nicht wirklich beruhigend, und sie gab das auch zu verstehen.
»Ist ja reizend«, bemerkte sie trocken.
»Na ja. Ich dachte ja nur. Könnte doch sein …«, versuchte Pilar, ihre Aussage abzumildern. Dann verschränkte sie energisch die Arme. »Jedenfalls gibt es nur eine Möglichkeit, mit der bestehenden Situation umzugehen.«
»Und die wäre?«, wollte Mara wissen.
»Man muss den Stier bei den Hörnern packen.«
»Deine Vorfahren waren wohl Stierkämpfer«, witzelte Mara.
»Jawohl, das waren sie«, bestätigte Pilar nicht ohne Stolz. »Zumindest väterlicherseits.«
»Dann verrate mir doch bitte mal, wie ich den Stier bei den Hörnern packen soll.«
Pilar machte eine temperamentvolle Drehung. Ihre Augen leuchteten. Es war ihr deutlich anzusehen, dass ihr das Detektivspielen Spaß machte.
»Du musst deinen Stalker stellen.«
»Ich verstehe nicht ganz …«
»Na, das ist doch nicht schwer. Wir beide verfolgen ab jetzt deinen Verfolger, und dann trittst du vor ihn hin und stellst ihn zur Rede.«
Die Prinzessin machte ein zweifelndes Gesicht, was Pilar aber nicht weiter störte.
»Natürlich muss das am hellen Tag geschehen, möglichst in einer belebten Gegend«, erklärte sie weiter. »Und ich werde mich schützend im Hintergrund halten.«
»Du hast recht.« Langsam wurde Mara von Pilars Eifer angesteckt. »Das ist gar keine schlechte Idee, wenn du mir dabei hilfst.«
»Es wird mir ein Vergnügen sein«, versicherte Pilar strahlend. »Ich liebe Abenteuer.«
Die beiden jungen Frauen, die bis vor Kurzem noch den reinsten Zickenkrieg geführt hatten, fühlten sich jetzt plötzlich wie zwei Verschwörerinnen.
***
Alexander Bünger, seines Zeichens Sportstudent, warf sich nach dem Training ein Handtuch über die Schultern und ging zu den Umkleidekabinen.
Sein Freund und Studienkollege Emil folgte ihm.
»Kommst du heute Abend zu der Feier, die Felix gibt?«, erkundigte er sich dabei. »Er hat gerade das Physikum in seinem Medizinstudium bestanden. Da ist ganz bestimmt was los.«
»Tut mir leid, ich kann nicht.« Alexander schüttelte mit leisem Bedauern den Kopf.
»Ach, komm«, versuchte sein Freund, ihn zu motivieren.
»Nein wirklich nicht. Keine Zeit.«
»Was ist eigentlich los mit dir?«, wollte Emil wissen. »Du hast in letzter Zeit fast nie Zeit für irgendetwas. Und erzähl mir bitte nicht, dass es mit dem Studium zusammenhängt. Du bist ohnehin der Beste im Semester und musst dich dafür gar nicht groß anstrengen.«
»Danke für die Lorbeeren.« Alexander grinste. »Ich habe auch nicht gesagt, dass es mit dem Studium zusammenhängt.«
»Dann steckt bestimmt eine Frau dahinter«, mutmaßte Emil, der wusste, wie beliebt der gut aussehende, dunkelhaarige Alexander bei der Damenwelt war.
»Ja und nein«, entgegnete Alexander ausweichend.
»Du hast dich also verliebt, was?«, rief Emil aus, indem er seinem Freund einen herzhaften Schlag auf die Schulter versetzte. »Gratuliere!«
»Unsinn«, entgegnete der ein wenig unwirsch.
»Du hast doch gerade selbst gesagt, dass eine Frau dahintersteckt.«
»Aber ich habe mit keinem Ton angedeutet, dass ich verliebt bin.«
»Ach, ich kenne dich doch. Der Gentleman genießt und schweigt – das ist deine Devise.«
»Genau«, versicherte Alexander ihm freundlich. »Vor allem schweigt er«, fügte er dann hinzu, um seinen neugierigen Freund ein wenig zu ärgern.
Die beiden jungen Männer holten ihre Jacken aus den Umkleidekabinen und traten hinaus ins Freie.
Obwohl es sonnig war, schlug ihnen ein recht frischer Wind entgegen. Von den Bäumen am Straßenrand wirbelten bunte Blätter.
»Hast du dich jetzt eigentlich schon entschieden, ob du Richtung Sportmedizin weitermachen willst?«, erkundigte sich Emil, als sie nebeneinander die Straße entlangschritten.
Alexander nickte. »Ja. Ich habe bereits Medizin belegt.«