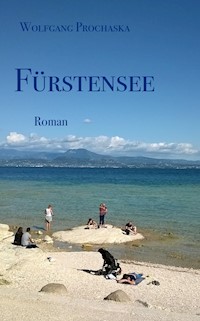
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der heiße Sommer 2003 und eine Einladung zu einem Fest in einer Villa am Starnberger See. Nur ungern kommt der Lokalreporter Andreas Swoboda der Einladung nach. Aber der flamboyante Gastgeber Alexander Roos, ein Finanzinvestor, und das Ambiente sind für ihn dann doch Grund genug, hinzugehen. Das Fest verändert das Leben von Swoboda. Denn dort lernt er die Assistentin von Roos kennen. Die Liebe zwischen den beiden enthüllt ein sorgsam gehütetes Geheimnis. Roos will Swoboda um jeden Preis reich machen, so beginnt ein Spiel um Verführung und Überzeugungen. Fürstensee erzählt eine große Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der ungeheuren Höhenflüge an der Börse zu Beginn des Jahrtausends. Während Swoboda in den Bann von Roos gezogen wird, erkennt er gleichzeitig immer mehr, was er wirklich ist und was nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Prochaska
Fürstensee
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Wie es begann
Die Sonnenfinsternis
Recherchier mal
In den ersten Wochen
Obwohl nichts geschah
Was ist Schuld?
Der Jahreswechsel
Er hatte zuvor Nicole
Ich fühlte mich matt
Obwohl mein Vater
Nicole hatte sich beruhigt
Ich versuchte, nicht an Fehler zu denken
Gegen die Ufersteine
Nach Redaktionsschluss
Das Reich der Glücklichen
Das Wasser, die Weite
Was waren Grundsätze?
Es nieselte an diesem Tag
Dass ich wieder mit einer Frau zusammenlebte
Ich sollte mittags kommen
Nach dem Coup
Etwas hatte sich verschoben
Das neue Jahr
Roos machte weiter
Am Abend des 2. April
Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern
Es wunderte mich
Hinweis
Impressum neobooks
Wie es begann
Seit dem Tod meines Vaters waren für mich Friedhöfe die schönsten Orte der Welt. Ihre geraden Grabreihen mit den geputzten Steinplatten, die verschnörkelten Schriften, die geschmückten Holzkreuze, die geharkten Kieswege, die in sich gekehrten Besucher, die hohen Schatten der Bäume: die Auferstehung war ein ruhiges Fest, und ich genoss, in meiner Trauer, diese Ruhe und Schönheit.
Das Leben war so fern wie der Himmel.
An manchen Tagen konnte ich mich nicht trennen, auch aus Abbitte für die, die nicht mehr lebten und diese Schönheit nicht mehr betrachten konnten. Ich zwang mich zu glauben, dass sie in einer Güte und in einem Frieden aufgehoben waren. Die Menschheit in all ihrer Gesamtheit brauchte Zuneigung und Wärme, auch die Toten, und ich wollte meinen Beitrag leisten.
Ich lebte in München, war noch verheiratet und schrieb an einem Roman, dessen Protagonist darunter litt, sich nicht empfinden zu können. Das Leben war ihm abhandengekommen, die Schönheit, die Liebe und die Hoffnung. Und er sehnte sich nach Unglück oder Schmerz, allein, um sich wieder spüren zu können.
Ich war als Schriftsteller noch nicht wirklich bekannt, hatte aber zuvor bei einem ordentlichen Verlag einen Lyrikband veröffentlicht, mehrere Kritiken in überregionalen Zeitungen erhalten und war zu Lesungen in München und Umgebung eingeladen worden. Ich fühlte mich damals, Ende der 1980er-Jahre, jung wie ich war und gestärkt durch die intensive Lektüre von „Stephen Hero“ und den „Dubliners“, reif für eine Schriftstellerkarriere.
Es war mir, als wartete etwas Großes auf mich.
Dann starb mein Vater.
Er hatte mich immer für ein seltsames Kind gehalten, so still verhielt ich mich nach jenem Vorfall, als ich wegen eines Hundes so erschrak, dass kein verständliches Wort mehr meinen Mund für ein halbes Jahr verlassen wollte. Bücher wurden meine Welt.
Er sagte nichts, er war beim Film, er war seltsame Menschen gewohnt, und er zählte sich insgeheim wohl selber dazu.
Auf einer Lesung in München sprach mich in jener Zeit ein Journalist an und fragte, ob ich mir zusätzliches Geld mit Kulturberichten verdienen möchte, er sei dabei, in Starnberg eine täglich erscheinende Kulturseite aufzubauen. Auch er schreibe Gedichte. Er hieß Siegfried.
Sein Angebot reizte mich, zumal meine Trauer einen Ausweg brauchte und mir meine Arbeit als Paketsortierer auf die Nerven ging. Und selbst die literarischen Aussichten schienen mir zu unsicher. Ich dachte: Am Roman könnte ich ja weiter schreiben.
Ich sagte schließlich nach einer kleinen Bedenkzeit zu, weil ich noch meine Frau in die Pläne einweihen wollte. Unsere Ehe war nicht die beste, aber ohne Julia konnte ich mir mein Leben nicht vorstellen.
Als ich auf dem Weg in die Redaktion war, wurde mir erst bewusst, dass ich weder die Stadt noch den See kannte, dies aber nicht als Mangel empfand. Meine Schriftstellerfreunde hatten nur von der Stadt der reichen Säcke gesprochen.
Es war ein Septembertag, die Sommerferien waren noch nicht zu Ende, aber die Luft fühlte sich schon herbstlich an. Als erstes sah ich das Schloss und die alte Kirche, danach erst den See oder vielmehr die Bucht, über der eine dicke Nebeldecke lag, grau und schwer. Das war mir angenehm. Ich vertrug schöne Tage nicht mehr und flüchtete mich stets in die Wohnung. Es war einer der Punkte, der meine Ehe belastete.
Ich sagte laut den Namen der Stadt, als würde mir jemand zuhören, während mein alter VW Bus den kleinen Berg hinunterrollte, um vor einer Ampel zum Stehen zu kommen. „Halte dich nach der dritten Ampel links, dann findest du uns schon”, hatte mir Siegfried eingeschärft.
Die Redaktion war in einem weißgelben Stadthaus untergebracht, hatte Gartenzugang und lag in einer Geschäftsstraße der Innenstadt. Daneben floss ein breiter Bach, eingefasst mit einer hohen, dicken Steinmauer. Es war mir egal. Ich brauchte kein Grün, keinen Garten, keine Obstbäume oder Bachläufe. Ich wollte schreiben und vergessen. Viel schreiben. Wörter pflanzen, wie ich es nannte.
Als Schriftsteller war es für mich ein stetes Wunder, dass abstrakte Zeichen, die in bestimmter Reihenfolge auf Papier standen, ganze Welten aus Geist und Gefühl erschaffen konnten: einen Wald aus Bedeutungen! Aber nun ging es um die direkte Vermittlung von Welt und Wirklichkeit.
82 Pfennig bekam ich pro Zeile. So war es mit dem Redaktionsleiter, einem schon älteren Herrn mit Haarkranz, ausgemacht. Das war mehr, als ich erwartet hatte. Es störte mich deshalb nicht, dass die Zimmer klein waren, dass Klo dünnwandig, der Zigarettenrauch dicht, die Schreibmaschinen laut und der Biergeruch intensiv. Ich nahm auch die klaren Anweisungen hin, den festen Abgabetermin und die vorgegebene Länge der Artikel. Ich nahm es hin wie einen glücklichen Schmerz.
„Am besten, Sie machen sich erst einmal mit der Stadt vertraut. Schauen Sie sich um, und schreiben eine kleine Reportage. Ich bin gespannt.“
Der Redaktionsleiter, den alle nur respektvoll mit seinem Nachnamen ansprachen und der hinter einem großen Schreibtisch mit abgeschabter Holzplatte und aufgeschichteten Mappen saß, sah mich freundlich an. Dass er mich sofort hinausschicken wollte in jene Welt, die mir fremd beziehungsweise fremd geworden war, hielt ich auch für einen Tauglichkeitstest.
Das hätte meinem Vater gefallen, der bei mir doch gewisse Alltagserfahrungen vermisst hatte, trotz meines großen literarischen Ehrgeizes. Immerhin hatte er das Wenige, das ich bis zu seinem Tod veröffentlicht hatte, mit Aufmerksamkeit gelesen. Mag sein, dass es auch daran lag, dass ich in meinen Prosatexten den schwedischen Mystiker und Seher namens Emanuel Swedenborg hin und wieder erwähnt hatte.
Mein Vater, der relativ erfolgreich im Filmgeschäft gearbeitet hatte, war ein Anhänger seiner Vorstellungen. Besonders stolz machte ihn, dass auch Ingmar Bergman zu dieser Religionsgemeinschaft gehörte und Goethe seinen „Faust II” mit einem Swedenborg-Zitat enden ließ: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis...”
Ich hatte Schönheit befürchtet: hübsche Villen, gepflegte Gärten, große Parks und war erleichtert, dass nur der See, der sich wie ein schlanker Fjord nach Süden streckte, und die Aussicht auf die Alpen, meiner Befürchtung entsprachen.
Die vorherrschend billige Architektur, die nur von wenigen Häusern aus der Jahrhundertwende unterbrochen wurde, würde mich nicht herausfordern. Selbst der alte Bahnhof direkt am See wirkte ungepflegt.
Ich wunderte mich über diese große Lieblosigkeit, aber ich war auch neu.
Wie diese Stadt, in der es angeblich von reichen und glücklichen Menschen nur so wimmeln sollte, funktionierte, merkte ich, als mich eine neue Erkundungstour in ein großes Blumengeschäft führte, in dem ich etwas für meine Frau kaufen wollte. Sie liebte Überraschungsgeschenke. Ein Mann mittleren Alters (er stieg später in einen Porsche) feilschte gerade um den Preis eines Blumenstraußes, der 35 Mark kosten sollte. Ich bewunderte die Floristin, eine junge Frau in grüner Schürze und hochgebundenen, braunen Haaren, um ihre Hartnäckigkeit, den Preis zu verteidigen. Es war ein großer Strauß, ein buntes, heiteres Etwas.
Es ging hin und her. Am Ende einigte man sich auf 35 Mark, dafür sollte der Strauß noch zwei Rosen hinzubekommen und besonders repräsentativ eingewickelt werden. Aber ohne Aufpreis. Die Floristin sah mich danach an, nicht empört, geradezu emotionslos, und sagte jenen Satz, der hier ein Naturgesetz zu sein schien und mich weiter begleiten sollte: „Von den Reichen das Sparen lernen.”
Ich dachte zuerst, wegen der Feilscherei, ich sei zu empfindlich, zu dünnhäutig, weil ich auch gewisse Aggressionen in mir gespürt hatte, ich war so etwas nicht gewohnt. Aber als ich einige Wochen später in einer Parfümerie ein Geburtstagsgeschenk für Julia auswählte, wurde ich auf andere Weise aufgeklärt: Man deckte mich mit Probepackungen von Aftershaves und Eau de Cologne regelrecht ein, nur weil ich zwei Fläschchen von Givenchy und Clarins gekauft hatte.
Die Verkäuferin, eine sorgfältig geschminkte Frau um die 40, schmal und zierlich, aber mit großen grauen Augen, öffnete die Schubladen in der Ladentheke, und befüllte die Plastiktüte. Als ich aus dem Geschäft trat, fühlte ich mich auf angenehme Art belohnt und auf eine bis dahin unbekannte Weise zufrieden, als könnte es meine Trauer aufwiegen.
Ich blickte noch einmal in die Tüte, in der die Probepäckchen lagen, nur um mich zu vergewissern und merkte, wie ich ihren Wert zu meinen Ausgaben aufrechnete. Was war mit mir in diesem Moment passiert?
In dieser Zeit, in der ich versuchte zu vergessen, nahm ich auch gesellschaftliche Einladungen und Empfänge wahr, zu denen unser Chef keine Lust hatte. „Sie müssen unter die Leut‘, das ist das Beste”, hatte er zu mir gesagt. „Ein ordentliches Jackett haben Sie ja.“
Mein Vater hatte mich immer ermahnt, mich ordentlich anzuziehen, und es war einer der wenigen Ratschläge, die ich von ihm angenommen hatte. Der zweite lautete, und es klang wie eine Mahnung: Verrate nie, woran du glaubst!
Ich lernte tatsächlich Menschen kennen, die reich waren, sei es durch Erbschaft, Erfindung oder Ehrgeiz, und die mir dennoch nicht glücklich schienen.
Immer, wenn ich von solchen Empfängen zurückkehrte, fühlte ich mich angenehm betäubt und leicht, als würde er noch leben. Ich legte mich dann still zu meiner Frau, die tief und fest schlief, und spürte die alte Wärme wieder.
In diesen Anfangsjahren entwickelte ich mich zum Kenner von Dingen, deren Wissen der normale Mensch meist für überflüssig hält: Ich erkannte mit schnellem Blick Accessoires von Luxusmarken wie Prada oder Vuitton, Kostüme der Pariser Modemacher Lagerfeld oder Yves, wie Yves Saint-Laurent damals von den Damen der Stadt genannt wurde, und ich bewunderte an solchen Abenden zusammen mit ihren Männern deren teure Autos oder „Karren”, wie sie in einer seltsamen Verachtung ihre „Lieblinge” bezeichneten.
Ich genoss diese Distanz, die mich von ihren Leben trennte, genoss meine Fremdheit, die immer eine Fremdheit bleiben würde, und meinte, eine gewisse Heilung zu verspüren.
Ich war aber verunsichert, denn das alte Gefühl, jener Hoffnungsglaube, den ich seit meiner Kindheit tief in mir trotz allem bewahrt hatte, wollte sich nicht mehr einstellen. Ich versuchte gesellig zu sein und war nach jedem Fest, nach jeder Feier froh, in meine Stille zurückkehren zu können.
Nicht, dass ich in dieser Zeit nur unglücklich war: Die Redaktion mochte meine Worte und ich konnte viel und ausgiebig schreiben. Ich erfuhr in diesen Jahren unter dem alten Redaktionsleiter wirklich Anerkennung und Respekt. Auch von meiner Frau, obwohl sie einen Schriftsteller geheiratet hatte.
An guten Abenden hatte ich auch die Kraft, an meinem Roman weiter zu arbeiten. Und sie sah es gern, wenn ich daran schrieb.
Sie glaubte an mich, an mein Talent, an meinen Erfolg, ich liebte sie dafür, bis sie eines Tages ihre Sachen packte, enttäuscht und ernüchtert, und wieder zu ihren Eltern zog.
Ich war zu betäubt, um mich verlassen zu fühlen.
Etwas war auch erkaltet in mir, etwas, das ich nicht bestimmen konnte.
Die Sonnenfinsternis
Die Sonnenfinsternis im August 1999 erlebte ich als Reporter auf einem Dampfer auf dem großen See. Ich vergaß aber in dem Moment meine Aufgabe und Arbeit, als sich der Mond vor die Sonne schob und es urplötzlich, mitten am Tag, dunkel wurde, so dunkel, dass im nächsten Moment auch die Vögel, die auf dem See schwammen, schwiegen, ja, dass alles, das große, eben noch helle Sommerleben erstarb.
Eine große Stille breitete sich über dem Wasser aus – und wir schwiegen ebenso auf dem Schiff, beeindruckt und benommen von der plötzlichen Finsternis und der aufkommenden Kühle.
Als ich sah, wie an der Seepromenade die Lichter angingen, matt und energielos, fühlte ich mich in einen Traum versetzt. Aber es war kein Traum, es war Wirklichkeit, reine Wirklichkeit…
An dieses Erlebnis und an dieses Gefühl musste ich vier Jahre später wieder denken. Es war noch Spätwinter, kalt und neblig, und alter, grauer Schnee lag in der Stadt, der alles noch unwirtlicher und unheimlicher machte.
Ich hatte mit Julia gestritten, wir lebten inzwischen in Scheidung, sie hatte mich einen Versager genannt, wollte Geld, mehr als ich dachte, meine Stimmung fühlte sich deshalb so grau an wie der schmutzige Schnee. Noch vor ein paar Jahren, in jener Zeit der Trauer, hätte ich diese Stimmung ignoriert und über ihre Worte und ihre Forderung gelächelt, dankbar einen neuen Schmerz gefunden zu haben.
Vielleicht war ich verletzlicher geworden.
Ich war kein wirklich junger Mann mehr, das Leben hatte in mir weitere, andere Spuren hinterlassen. Es hatte im Verlag auch Kündigungen gegeben, wir wurden weniger, überall, was würde noch kommen?
Das Büro, in dem das Pressegespräch stattfand, befand sich in einem neuen, mehrere Stockwerke hohen Haus im Gewerbegebiet, die Hinterlassenschaft eines Internet-Unternehmens, das zu schnell groß geworden war, viel Geld verbrannt hatte und pleite gegangen war.
Es war damals die größte Pleite dieser Stadt.
Der mit Alu-Applikationen verzierte Bau bestand aus unzähligen Büros, deren größter Teil leer stand. Die Stille ließ jedem, der es betrat, schon im Treppenhaus seine Schritte wie die Störung einer höheren Ruhe empfinden. Mag das Gebäude noch vor zwei, drei Jahren der Ort der kühnsten Träume, der größten Möglichkeiten und der besten Geschäftsideen gewesen sein, jetzt lastete die Leere so schwer, als wäre sie das beginnende Reich der Untoten. Ich verhielt mich so leise wie möglich.
Der Raum, in dem mein Kollege Ingo Reiz von der anderen Zeitung und ich empfangen wurden, war mittelgroß, aber karg eingerichtet. Ein solider, fast grob gearbeiteter Schreibtisch gehörte dazu. An der Wand hing ein von drei Landschaftsfotos und dem Porträt eines jungen Mannes umrahmter großer, in alter Schrift gestalteter Spruch, auf dem zu lesen stand: „In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, wir sind die stärkste der Partei’n, die Müßiggänger schiebt beiseite! Diese Welt muss unser sein.“
Das war nicht Swedenborg und auch kein kesser Spruch eines atavistisch-gesinnten Spekulanten oder übermotivierten Karrieristen, ich musste ein wenig nachdenken, ich hörte den Klang des Liedes auf einmal, ein Echo meiner Studentenzeit, und dann wusste ich, dass es Teil der zweiten Strophe der „Internationalen” war, jenem Kampflied der Arbeiterbewegung.
Es begrüßte uns ein etwa 40-jähriger, elegant gekleideter Mann, der sich als Alexander Roos vorstellte („Bitte mit zwei O“) und Gründer der Firma war. Er trug einen dunkelblauen, sehr flott geschnittenen Anzug, wobei Krawatte und Einstecktuch farblich nahezu übereinstimmten. Es sah alles teuer, aber auch konservativ aus, von der Arbeiterbewegung dürfte er sich entfernt haben.
Mir waren Managertypen eigentlich suspekt, zu viele hatte ich in den vergangenen Jahren kennen gelernt, und ihre immer gleichen Sprüche über Erfolg, Leistung und Effizienz anhören müssen, nun spürte ich aber eine gewisse Neugier.
Bislang hatte ich von Alexander Roos nur gehört, dass er eine Villa aus der Jahrhundertwende gekauft hatte, die am Ostufer des Sees in einem kleinen Ortsteil der Stadt lag und von den vorherigen Besitzern sehr vernachlässigt und wohl auch wegen des Privatstrands als Spekulationsobjekt betrachtet wurde.
Es gab viele solcher Immobiliengeschäfte, meist endeten sie mit dem Abriss des alten Hauses oder der alten Villa. Roos ließ aber das Haus nicht abreißen; er ließ das gesamte Ensemble restaurieren, auch den großen Park, zu dem ein Pavillon, barocke Brunnen und Blumenbeete gehörten. Dass die Villa den Namen „Schattenschön” trug, war mir neu. Er gefiel mir.
„Was wollen die Herren trinken: Kaffee, Cappuccino, Espresso, Tee – oder Champagner?”
Wir einigten uns auf Mineralwasser.
Eine Sekretärin, die sich später als Pressesprecherin und Assistentin von Roos herausstellte, brachte uns das Wasser und zeigte ihrem Chef auf ihrem Blackberry eine E-Mail. Er machte ein kurzes Zeichen, indem er Daumen und kleinen Finger zu einem Halbmond formte, was wohl so viel hieß, dass er später zurückrufen werde.
Ich bemerkte erst jetzt, dass Roos ein auffällig rundes Gesicht mit hoher Stirn und lichtem Haar hatte, das nicht zu seinem festen Blick und zu seiner Stimme passen wollte, die melodisch, ja fast rheinisch klang, aber dennoch in harten Endungen mündete.
Es dauerte nicht lange, und er erläuterte kurz seine Vita (Betriebswirt), die Pläne seiner Firma, sprach von der Börse und dass man demnächst eine Aktiengesellschaft sei. Den leeren Börsenmantel habe man sich schon von einer anderen, insolventen Firma besorgt, das spare Zeit und Kosten, ich sah ein freudiges Grinsen.
Er sprach in diesem lockeren Ton weiter, lehnte sich dabei entspannt in den Sessel zurück, und erzählte ganz nebenbei, was sein Mitarbeiterteam künftig für Firmenübernahmen plane: „Fünf bis zehn sollten es in diesem Jahr schon noch sein.“ Viele Mittelständler seien ja schlecht geführt und hätten kaum Rücklagen, und die Krise tue ihr Übriges. „Die Zeit spielt für uns und wir stehen bereit.” Schon in der kommenden Woche hätten wir wieder Stoff für eine neue Geschichte, kündigte er an.
Wer andere Firmenchefs kannte, wusste, dass hier einer nicht nur schönes Geld verdienen, sondern auch seinen Spaß haben wollte. Dieser Unternehmer begann mich zu interessieren.
Man spürte auch gewisse Sympathien, die er dem Journalismus entgegenbrachte. Er verkörpert eine andere Liga, dachte ich.
„Und Sie bleiben wirklich beim Wasser, kein Champagner?“, fragte er nach. Wir blieben beim Wasser.
Dann redete er über künftige Umsatzzahlen, über weitere Gewinnmöglichkeiten und dass die Aktie etwa einen Euro kosten sollte. Er sprach dieses Wirtschaftsdeutsch, gespickt mit den üblichen, sinnentleerten Euphemismen, bei ihm klang aber alles, wegen des Singsangs, charmanter, ja lieblicher. Am Ende seiner Ausführungen blickte er in die kleine Runde, selbstsicher, amüsiert, und nickte mir aufmunternd zu: „Sie haben jetzt die Chance, Herr Swoboda, steigen Sie bei uns ein, es wird im nächsten Jahr schon eine ordentliche Dividende geben, Sie werden es nicht bereuen, Sie werden reich werden.”
„Reich…? Sie meinen reich an Erfahrung“, antwortete ich.
Ingo Reiz lachte.
„Denken Sie in Ruhe darüber nach”, bat er.
Er stand dann auf, verabschiedete sich bei jedem Einzelnen und schnappte sich ein Handy, um zu telefonieren.
Beim Hinausgehen meinte seine Pressesprecherin: „Unser Alex war schon immer so. Direkte Kontakte zu Journalisten sind ihm wichtig. Das Angebot mit dem Champagner nehmen Sie ihm aber nicht übel. Er mag gutes Leben genauso wie bequeme alte Autos. Er hat da recht eigene Vorstellungen.” Sie war genauso elegant wie er angezogen und hatte ihre rotbraunen Haare zum Nest aufgesteckt.
Mein Kollege und ich gingen zusammen noch ein paar Schritte über den Parkplatz und redeten über unsere Termine. Plötzlich blieb er stehen. „Dem Erich seine Staatskarosse, ich glaub‘s nich”, rief er in breitem Sächsisch und deutete auf einen schwarzen Wagen.
Es war ein großer, alter Citroen, die Langversion „Prestige“, gut 20 Jahre alt. Der Wagen war mir schon vorher wegen seines gepflegten Zustands aufgefallen, und nun war mir klar, wem er gehörte und was sie gemeint hatte.
Er hätte auch meiner Frau gefallen.
Draußen war es immer noch kalt und neblig und das Gewerbegebiet hässlich. Überhaupt erschien mir alles jetzt noch hässlicher, einschließlich Alexander Roos, der zwar Geschmack hatte, beste Anzüge trug, aber Unternehmen kaufen und ausschlachten wollte und sich ziemlich sicher war, damit Erfolg zu haben.
War nicht seine Aufforderung an mich, Aktien zu kaufen, eine Frechheit? Stand auf meiner Stirn geschrieben: Ich bin käuflich!
Ich wunderte mich über meine Empfindlichkeit.
Ich hatte auch keine Lust, direkt in die Redaktion zu gehen, denn auch dort würde mich nichts Erfreuliches erwarten und wahrscheinlich ein weiterer Anruf meiner Frau. Zudem hatten wir nach der Jahrtausendwende einen neuen Redaktionsleiter erhalten, diesmal eine junge Frau, sie hieß Nicole Groß.
Sie hatte bei einer anderen Zeitung gearbeitet und ihre eigenen Vorstellungen von Journalismus mitgebracht. Seitdem stand es auch um meine Wertschätzung nicht mehr zum Besten.
Es begann leicht zu schneien, ein Schnee aus dem Hochnebel, mit feinen, schmutzigen Flocken, gefüllt mit den Abgasen der teuren Luxuskarren.
Ich rechnete. Rechnete aus. Mit jedem Schritt begann mein Kopf noch mehr zu rechnen: 5000 Aktien für 5000 Euro. Oder noch besser: 10 000 Aktien für 10 000 Euro. Sollte die Aktie nur ein bisschen steigen, auf 1,50 Euro oder gar drei Euro, so rechnete ich weiter, mein Gewinn würde bei…
Vor mir standen Zahlen, deren Summe ich nicht wissen wollte.
Ich umrundete noch einmal das Gewerbegebiet, kickte auf dem Weg zum Büro noch unzählige Eisplatten weg, aber es half nicht, alles half nicht, meine Stimmung blieb im Keller.
„Auch schon da”, sagte Nicole zu mir, als ich mir einen Kaffee holen wollte. „Wir müssen reden.”
Sie deutete mit dem Arm nach hinten.
Sie war mittelgroß, hatte lange, brünette Haare, ein fein geschnittenes Gesicht und war mit ihren 33 Jahren die jüngste Redaktionsleiterin im Verlag.
Wir setzten uns in ein kleines Zimmer, genannt der Sozialraum.
Er war vollkommen kahl, keine Bilder, keine Poster, nichts. Nur ein Tisch und Stühle. Wie ein Verhörzimmer. Eine Idee von ihr. Die Kargheit der Ausstattung sollte unsere Kreativität fördern.
Sie hatte auch die meisten Wände der Büros im Sinne besserer Kommunikation entfernen lassen.
Sie kam gleich zur Sache: „Es ist nicht so, dass ich erfahrene Kollegen nicht schätzen würde, das weißt du inzwischen, aber deine Ironie in Berichten aus dem Gemeinderat kannst du dir künftig sparen. Tut mir leid, dass ich es dir so deutlich sagen muss, aber es hat mich von Anfang an genervt.“
Wir blickten uns kurz an.
„Gut. War es das?”, fragte ich.
„Ja”, sagte sie ein wenig verwundert, als hätte sie eine große Verteidigungsrede meinerseits erwartet.
Ich brauchte keinen weiteren Streit.
Beim Hinausgehen fragte sie mich: „Sonst alles klar? Was macht deine Scheidung?”
„Meine Frau hält mich für einen Versager.”
„Oh!“ Sie hustete kurz auf, als hätte sie etwas verschluckt.
„Bei der Scheidung meiner Eltern war mein Vater für meine Mutter nur noch der Scheißkerl, der mich gezeugt hat. Ich mag keine Scheidungen, ich will davon auch nichts mehr hören. Bitte, verschone mich, ja?”
„Aber Nicole, du hast mich…”
„Bitte, kein Wort mehr. Danke.”
Ich löschte den Artikel.
Es war nicht mein Tag.
Nach Redaktionsschluss, am frühen Abend, wie aus einem alten Zwang, zog es mich noch zum Waldfriedhof. Er lag etwas abseits und oberhalb der Stadt, eine Viertelstunde zu Fuß. Der Eingang, der von einer matten Straßenlampe erhellt wurde, war schon verschlossen, wie immer im Winter, aber verschlossene Friedhofseingänge hatten seit dem Tod meines Vaters kein Hindernis für mich gebildet.
Es hatte aufgehört zu schneien, eine dünne Schneedecke lag auf den Gräbern und den Wegen, schmale Pfade, die sich in Serpentinen nach oben schlängelten. Die Luft roch frisch. Ich ging in einer Dunkelheit, die ich wie einen erholsamen Frieden empfand, schaltete hin und wieder meine Taschenlampe ein, um mich zu orientieren und stapfte danach weiter.
Es zogen an mir Gräber wie lange Schatten vorüber, manche so schmal, als hätte man sparen wollen, dann wieder so groß, wie eine andere Welt. Ich blieb an einem alten Grab mit einem riesigen Kreuz stehen. Ein steinernes Etwas aus Glaube und Hoffnung.
Ich leuchtete darauf, aber der Name des Toten und seine Lebensdaten waren schon verwittert. Nur ein ovales, eingerahmtes Foto, auf dem ein Mann in Uniform ernst in die Kamera blickte, ließ ahnen, dass hier ein vergangenes Leben ruhte, ein Leben, das gemessen an der Größe der Grabesstätte, sicherlich erfolgreich und groß gewesen war, aber nun war es schon lange Geschichte und das Vergessen und die Kälte hatten sich seiner bemächtigt.
Ich wusste, dass ich irgendwann eine Geschichte über alte Friedhöfe und ihre Ruhestätten schreiben würde, allein um dieses Vergessen zu dokumentieren.
Das Grab meines Vaters lag in einer anderen Gegend.
Der Friedhof war ebenso ruhig, aber er wollte dort niemals begraben werden.
„Also, es geht doch”, sagte Nicole zu mir, der man in Papierform jeden Artikel vorlegen musste. Mit einem Rotstift strich sie Stellen an, die ihr nicht gefielen oder die sie angeblich nicht verstand.
Sie gab den Artikel dann zurück oder warf ihn unwirsch auf den Schreibtisch. Zuerst dachten wir, es sei eine vorübergehende Marotte, man konnte auch am Computer redigieren und korrigieren, aber sie meinte es ernst, so wie den Sozialraum.
In der Stadt hatte sich die Firmengründung schnell herumgesprochen. Roos hatte nicht zuletzt wegen des Kaufs der alten Villa und der Zeitungsberichte einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Erste Gerüchte kamen auf und machten ebenso schnell die Runde.
Einmal hieß es, dass es bei seinen kaufmännischen Tätigkeiten in der Vergangenheit nicht ganz sauber zugegangen sein soll, dann war wiederum von dubiosen Geschäften die Rede.
Ich dachte, dass ich mich häufiger in Segelclubs herumtreiben müsste, um mehr zu erfahren, aber nicht jeder hatte Zugang. Möglicherweise könnten meine Kontakte helfen.
Was ich unter der Hand erfuhr und was mich überraschte: Er war adelig, eigentlich Alexander Freiherr von Roos und Gerau, die alte, jedoch verarmte Linie.
Er hatte Volks- und Betriebswirtschaft studiert, auch im Ausland, eine Deutsch-Chilenin geheiratet und eine Familie gegründet. Bei einer kleinen Unternehmensberatung begann seine Laufbahn. Nach einigen gut dotierten Aufträgen, so meine Informanten, verließ er das Büro, um sich mit einer eigenen Beratungsfirma selbstständig zu machen. Damit soll er ordentlich verdient haben, bis er keine Lust mehr hatte und sie verkaufte.
Er sei etwas unstet, aber äußerst ehrgeizig, hieß es.
Warum er seinen Adelstitel abgelegt hatte? Das wusste keiner. Es gab nur Vermutungen. Ein Segler meinte: Vielleicht sei es eine politische Koketterie oder selbstbewusstes Understatement. Solch bürgerliche Bestrebungen habe es ja bei nicht wenigen Adeligen in der Vergangenheit gegeben.
Was mich aufhorchen und an die Liedzeile an der Bürowand erinnerte: Er sei sehr politisch, angeblich weil ein Onkel zweiten Grades aktiv gegen den Nationalsozialismus als überzeugter Gewerkschafter und Kommunist gekämpft habe. Er wurde von den Nazis verhaftet und habe nur durch Zufall überlebt.
Es hieß deshalb, dass der ferne Neffe linke Organisationen unterstütze, auch im Ausland, insbesondere in Südamerika (da waren die Angaben widersprüchlich).
Mag sein, dass er idealistisch gesinnt war, dass er von einem gewissen Sinn für Gerechtigkeit geleitet wurde; Tatsache war, dass der ferne Neffe, der den Adelstitel abgelegt hatte, nur noch Millionen machen wollte, viele Millionen, wofür und für wen auch immer. Fragen dazu hatte er am Telefon überhört. Auch auf der im Aufbau befindlichen Homepage seiner Firma: nichts. Alles perfekt und sauber.
Wer war dieser Alexander Roos wirklich?
Es blieb nicht bei dieser einzigen Einladung. Zwei Wochen später rief seine Sprecherin an, es würde interessante neue Nachrichten geben, die auch unsere Leser interessieren könnten.
Diesmal erlebte ich ihn nicht wie einen lockeren Unternehmer mit Spaß am Geschäft, sondern wie einen Prediger, der seinen Sektenjüngern, als wollte er ein anderer Gordon Gekko sein, etwas mitteilen wollte.
Seine blauen Augen waren hart, sein Blick fest und in eine Ferne gerichtet, die ich nicht sah. Selbst wenn ich sie wahrgenommen hätte, sie hätte anders ausgeschaut als die seine.
„Wir sind Beratungs-Experten und wir werden vielen Firmen und Unternehmen, die keine Chance haben, beim Überleben helfen – und damit den Menschen, die dort arbeiten. Wir sind wie Ärzte, wir wissen, wo wir ansetzen müssen!”
Er betonte die Worte so bedeutungsschwer und pathetisch, wie von einer imaginären Kanzel herab oder wie Gewerkschafter am Tag der Arbeit am 1.Mai auf dem Marienplatz in München.
So hatten auch tief gläubige Swedenborgianer geredet, wenn sie zu Besuch bei meinen Eltern waren, und immer ging es um neue Wege der Erkenntnis, um Hoffnungen, man müsse nur vertrauen, alles sei beseelt, das All und seine Sterne, jedes Daseinskorn, es gebe nichts Materielles, das nicht auch Geist und Gott sei, unser Leben die erste Form und am Ende die absolute Wahrheit in Form von göttlich absoluter Liebe.
Wahrscheinlich war ich zu vorbelastet, um beeindruckt zu sein.
Ich merkte: Er war ein Gläubiger, ein Gläubiger wie mein Vater, nur um viele Jahre jünger, und ein Anhänger einer anderen Glaubensgemeinschaft.
Er redete immer noch, schaute zu meinem Kollegen Ingo Reiz, schaute zu mir, und breitete dann seine Vorstellungen aus. 40 Millionen Euro Umsatz in diesem Jahr, doppelt so viel dann im nächsten. „Es gibt zu viele phantasielose und bequeme Geschäftsführer im Markt, die nur in ihre eigene Tasche wirtschaften.”
Wieder blickte er mich an.
Er fixierte mich dabei, als ob ich ihn an jemandem erinnern würde.
Ich wusste mit dieser Aufmerksamkeit wenig anzufangen. Als Medium für seine Visionen konnte ich, sollte er es geglaubt haben, nicht dienen. Ich war bloß Lokaljournalist, zwar inzwischen verantwortlich für unsere kleine Wirtschaftsseite, aber ich bestritt diese seit den Kündigungen meist als Einzelkämpfer.
Ich fragte deshalb, ein wenig genervt und im Sinne meines Vaters: „Glauben Sie wirklich an das, was Sie gerade skizziert haben?”
Ich erwartete ein empörtes oder beleidigtes Gesicht, gar eine pastorale Verstimmung, aber er sagte nur: „Sie haben recht, ich sollte konkreter über die Pläne unserer Firma reden. Vielen Dank für den Hinweis.”
Er räumte danach ein, dass die Analysten, mit denen er in Frankfurt schon gesprochen hatte, um das Unternehmen bekannter zu machen, ebenfalls Zweifel angemeldet hätten.
Daraufhin mischte sich sein jüngerer Kompagnon Bernd Walter ein, der sich zu unserer Runde gesellt hatte: „Aber wir kommen von unten, wir haben klein angefangen, wir wissen, was harte Arbeit bedeutet.”
Ich beobachtete Roos, seine Haltung, seine Gesten, seine Mimik, als könnte ich aus diesen Äußerlichkeiten auf etwas Tieferes schließen und hörte erst wieder zu, als er mich direkt ansprach mit der Aufforderung: „Herr Swoboda, steigen Sie bei uns ein, der Kurs ist günstig, die Aussichten groß, ich werde Sie reich machen, auch zur Freude ihrer Frau.”
Auf mir ruhte ein Blick, dessen Ziel einer Erlösung gleichkam, und er kam von einem Mann, der anscheinend etwas über mich in Erfahrung gebracht hatte. Was wusste er noch? Dass ich wenig Geld auf dem Konto hatte und einen Autokredit abstottern musste? Dass mein Redakteursgehalt nicht das höchste war? Oder war es nur ein blöder Scherz?
Es war mir egal. Auf eine Weise war ich schmerzlos geworden. Aber ich würde es mir merken.
Als wir uns verabschiedeten und hinausbegleitet wurden, meinte seine Sprecherin: „Sie haben sicher gemerkt: Unser Alex kann auch richtig emotional werden. Da kann ihn keiner bremsen.” Ich bemerkte ein verhaltenes Lächeln.
„Sollte man aber”, antwortete ich und ging in Richtung Ausgang.
Ich wollte weg.
„Männer mit ehrlichen Emotionen sind selten, da ist er eine Ausnahme. Vielleicht kenn’ ich auch zu wenige.“
„Vielleicht”, rief ich. „In ihrer Branche ist das leicht möglich.”
Meine Worte hallten im Gebäude.





























